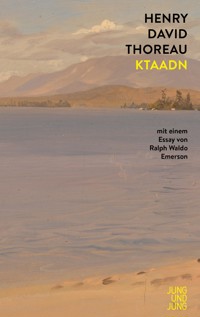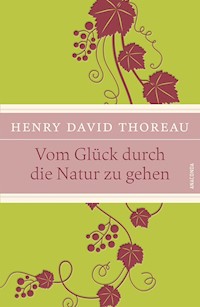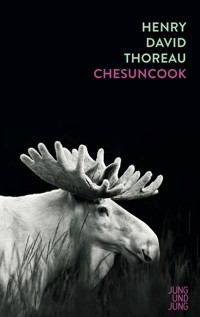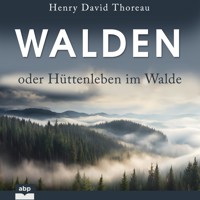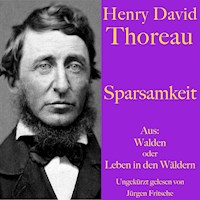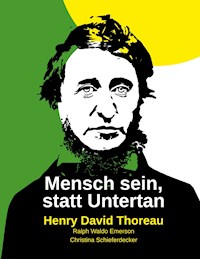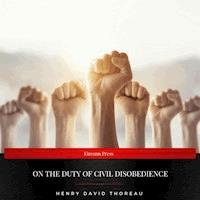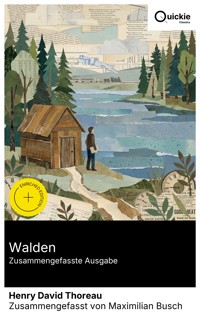Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jung u. Jung
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Rechtzeitig zum 150. Todestag dieses Verfechters des einfachen Lebens (Walden) erscheint hier erstmals auf Deutsch seine hinreißende Erzählung einer abenteuerlichen Fahrt durch die nordamerikanische Wildnis an der Seite eines Indianers.Als Henry David Thoreau sich 1857 entschließt, gemeinsam mit einem Freund die Urwälder von Maine zu durchqueren, heuert er einen kundigen Indianer an, ohne den eine so abenteuerliche Reise nicht zu bestehen war. Joseph Polis heißt der Mann, er hat ein Kanu, und er ist genau der Richtige für den nicht ungefährlichen Weg durch die Wälder, Sümpfe und Seen. Versehen mit dem nötigen Proviant und der richtigen Kleidung, machen sie sich auf ihren Weg durch das unentdeckte Land. Es ist ein Weg, auf dem Thoreau vieles lernt, nicht zuletzt durch den Indianer an seiner Seite, der uraltes Wissen und die Vorteile der Zivilisation durchaus zu verbinden weiß. Er erkennt, was ihm die Sprache der Natur vermitteln kann, wenn er ihre Zeichen zu deuten und ihren vielen Stimmen zu lauschen versteht. Es ist eine überaus farbige, oft auch heitere Schilderung aus der Zeit der wahren Entdeckung Amerikas und aus der Feder eines großen Vordenkers des gelingenden Lebens.Mit einer Notiz von Nathaniel Hawthorne. Aus dem Amerikanischen übersetzt und mit einem Nachwort von Alexander Pechmann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Wildnis von Maine
Originaltitel:Canoeing in the Wilderness – The Allegash and East Branch© 2012 Jung und Jung, Salzburg und WienAlle Rechte vorbehaltenDruck: CPI Moravia Books, PohoreliceISBN 978-3-902497-98-7
HENRY DAVID THOREAU
Die Wildnis von Maine
Eine Sommerreise
Mit einer Vorbemerkung vonNathaniel Hawthorne
Aus dem Amerikanischen übersetzt undherausgegeben von Alexander Pechmann
Nathaniel Hawthorne:Thoreau und sein Kanu
Donnerstag, 1. September 1842. Mr. Thoreau war gestern bei uns zu Gast. Er ist ein einzigartiger Mensch – ein junger Mann, der immer noch viel wilde ursprüngliche Natur in sich trägt, und soweit er kultiviert ist, ist er es auf seine ganz eigene Art und Weise. Er ist hässlich wie die Sünde, hat eine lange Nase, einen schiefen Mund und besitzt ungehobelte und ein wenig ländliche, aber dennoch höfliche Manieren, die sehr gut zu solch einem Erscheinungsbild passen. Doch ist seine Hässlichkeit von der ehrlichen und liebenswürdigen Sorte und steht ihm viel besser als Schönheit. Ich glaube, er hat in Cambridge studiert und früher in dieser Stadt unterrichtet, doch seit zwei oder drei Jahren hat er alle gewöhnlichen Mittel, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, zurückgewiesen und scheint dazu geneigt, eine Art Indianerleben unter zivilisierten Menschen zu führen – unter Indianerleben verstehe ich das Vermeiden jeglicher systematischer Anstrengung, ein Auskommen zu finden. Seit einiger Zeit wohnt er bei Mr. Emersons Familie und vergilt die Gastfreundschaft mit Gartenarbeit und anderen Gefälligkeiten, die ihm gerade zusagen – er wird von Mr. Emerson allein aufgrund seiner wahren Menschlichkeit beherbergt. Mr. Thoreau ist ein leidenschaftlicher und feinfühliger Beobachter der Natur – einen so ernsthaften Beobachter trifft man, wie ich befürchte, ebenso selten wie einen originellen Poeten –, die Natur scheint ihn aus Dankbarkeit für seine Liebe als ihr bevorzugtes Kind adoptiert zu haben und zeigt ihm Geheimnisse, die nur wenigen anderen offenbart werden. Er ist vertraut mit Säugetier, Fisch, Vogel und Reptil und kann seltsame Geschichten von seinen Abenteuern und freundschaftlichen Begegnungen mit diesen untergeordneten Brüdern der Sterblichkeit erzählen. Gleichermaßen sind Pflanze und Blume, wo immer sie sprießen, ob im Garten oder in der Wildnis, seine engen Freunde. Auch pflegt er gute Beziehungen zu den Wolken und kann die Vorzeichen eines Sturms erkennen. Es ist typisch für ihn, dass er großen Respekt vor dem Vermächtnis der Indianerstämme hat, deren wildes Leben ihm so gut gefallen hätte, und merkwürdigerweise geht er selten über ein gepflügtes Feld, ohne eine Pfeil- oder Speerspitze oder ein anderes Relikt des roten Mannes aufzulesen. Als ob ihre Geister ihn als Erben ihres schlichten Reichtums auserkoren hätten.
Darüber hinaus hat er mehr als nur einen Anstrich literarischer Bildung – einen tiefen und echten Sinn für Poesie, besonders für die klassischen Dichter, auch wenn er wie alle anderen Transzendentalisten, soweit ich mit ihnen bekannt bin, anspruchsvoller ist als wünschenswert wäre. Er ist ein guter Autor – zumindest hat er einen guten Artikel geschrieben, eine weitschweifige Abhandlung über Naturgeschichte in der letzten Ausgabe des Dial, die, wie er sagt, hauptsächlich aus Aufzeichnungen seiner eigenen Beobachtungen zusammengestellt wurde. Ich glaube, dieser Artikel vermittelt ein sehr gutes Bild seines Denkens und Wesens. So wahr, genau und nüchtern in der Beobachtung, doch ebenso die Seele wie das Äußere dessen vermittelnd, was er sieht, wie ein See seine bewaldeten Ufer widerspiegelt, jedes einzelne Blatt zeigt, aber auch die wilde Schönheit der ganzen Szene abbildet. Außerdem gibt es in dem Artikel Passagen vager und verträumter Metaphysik, teils gekünstelt und teils dem natürlichen Atem seines Intellekts entsprungen – und auch Stellen, wo seine Gedanken das Maß und den Klang spontaner Verse anzunehmen scheinen, was nur folgerichtig wäre, da er echte Poesie in sich trägt. Durch den ganzen Text ziehen sich zudem gesunder Menschenverstand und moralische Wahrheit, was ebenfalls seinen Charakter widerspiegelt, denn seine Art zu denken und zu fühlen ist nicht töricht, auch wenn seine Handlungsweisen keineswegs perfekt sind. Alles in allem halte ich ihn für einen Mann, dessen Bekanntschaft gewinnbringend und bekömmlich ist.
Nach dem Essen (zu dem wir die erste Wassermelone und Muskatmelone ernteten, die in unserem Garten gereift sind), spazierten Mr. Thoreau und ich zum Flussufer hinauf, und an einer bestimmten Stelle rief er nach seinem Boot. Sogleich paddelte ein junger Mann damit über den Fluss, und Mr. Thoreau und ich reisten darin weiter stromaufwärts, wo der Fluss bald schöner wurde als auf jedem Gemälde, mit seiner dunklen und ruhigen Wasserfläche, halb im Schatten liegend, halb in Sonnenlicht getaucht, zwischen hohen und bewaldeten Uferböschungen. Die jüngsten Regenfälle haben den Fluss derart anschwellen lassen, dass viele Bäume sozusagen bis zu den Knien im Wasser standen, und Zweige, die vor Kurzem noch hoch in der Luft schwangen, tauchen und hängen nun tief in die vorbeistreichende Welle. Was die armen Lobelien angeht, die bis vor einigen Tagen am Ufer glühten, konnte ich nur ein paar ihrer scharlachroten Mützen aus dem Wasser hervorlugen sehen. Mr. Thoreau beherrschte das Boot so vollkommen, ob mit zwei Paddeln oder mit einem, dass es mit seinem eigenen Willen zu verschmelzen schien und dass es anscheinend keiner körperlichen Anstrengung bedurfte, um es zu steuern. Er erzählte, wie er, als einige Indianer vor ein paar Jahren Concord besuchten, feststellte, dass er ganz ohne Lehrer exakt ihre Methode angenommen hatte, ein Kanu anzutreiben und zu lenken. Da der arme Kerl jedoch Geld brauchte, wollte er das Boot verkaufen, das er so geschickt steuerte und mit seinen eigenen Händen gebaut hatte. Also kam ich mit ihm überein, seinen Preis zu zahlen (nur sieben Dollar), und wurde entsprechend zum Eigentümer der Musketaquid. Ich wünschte, ich könnte das aquatische Geschick seines ursprünglichen Besitzers zu einem ebenso vernünftigen Preis erhalten.
IMontag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 20. – 23. Juli 1857
Am Montag, dem 20. Juli 1857, brach ich mit einem Begleiter zu meiner dritten Reise in die Wälder von Maine auf und erreichte am nächsten Tag um die Mittagszeit Bangor. Ein Verwandter von mir, der die Penobscot-Indianer gut kennt, nahm mich am folgenden Morgen in seiner Kutsche mit nach Oldtown, um mir zu helfen, einen Indianer für diese Expedition anzuheuern. Wir setzten in einem Flussboot zur Indianerinsel über. Der Junge des Fährmanns hatte den Schlüssel für die angekettete Fähre, doch der Vater, ein Schmied, durchtrennte nach kurzem Zögern die Kette am Felsen mit einem Kaltmeißel. Er erzählte mir, die Indianer seien fast alle an die Küste und nach Massachusetts gezogen – zum Teil deswegen, weil die Pocken, vor denen sie große Angst haben, in Oldtown ausgebrochen seien. Der alte Häuptling Neptune sei jedoch noch dageblieben.
Der erste Mann, dem wir auf der Insel begegneten, war ein Indianer namens Joseph Polis, den mein Verwandter seit seiner Kindheit kannte und vertraulich mit „Joe“ ansprach. Er bearbeitete gerade ein Rehleder auf seinem Hof. Das Leder war über einen schrägen Baumstamm gebreitet, und er schabte es mit einem Stock ab, den er mit beiden Händen festhielt. Er war stämmig, vielleicht ein bisschen größer als der Durchschnitt, hatte ein breites Gesicht und, wie andere meinten, Gestalt und Züge eines perfekten Indianers. Sein Haus war zweistöckig mit Fensterläden, das schönste, das ich auf der Insel sah, und so gut wie ein gewöhnliches Häuschen an einer Dorfstraße in New England. Es war von einem Garten und Obstbäumen umgeben, zwischen den Bohnen ragten einzelne Maispflanzen dünn empor. Wir fragten ihn, ob er einen guten Indianer kenne, der uns in die Wälder begleiten wolle, genauer gesagt, über Moosehead Lake bis zu den Allegash Lakes und zurück über den East Branch, den östlichen Nebenfluss des Penobscot.
Daraufhin antwortete er aus jener seltsamen Ferne, die den Indianer stets vom Weißen trennt: „Ich will selbst gehen, ich will Elch jagen.“ Dabei fuhr er fort, das Leder zu schaben.
Der Fährmann erzählte uns, dass von den besten Indianern alle außer Polis, der dem Adel angehöre, fortgegangen seien. Er sei sicherlich der beste Mann, den wir bekommen könnten, aber wenn er wirklich mitkäme, würde er einen hohen Preis verlangen. Polis forderte zunächst zwei Dollar pro Tag, war aber schließlich mit eineinhalb täglich und fünfzig Cent pro Woche für das Kanu zufrieden. Er werde am selben Abend mitsamt seinem Kanu mit dem Sieben-Uhr-Zug in Bangor eintreffen – wir könnten uns auf ihn verlassen. Wir waren glücklich, uns die Dienste dieses Mannes gesichert zu haben, der als besonders zuverlässig und vertrauenswürdig galt.
Ich verbrachte den Nachmittag mit meinem Reisegefährten, der in Bangor geblieben war, um Proviant, Zwieback, Schweinefleisch, Kaffee, Zucker etc., sowie Kautschukkleidung für unsere Expedition zu besorgen.
Der Indianer traf abends mit dem Zug ein, und ich ging ihm eine dreiviertel Meile bis zum Haus meines Freundes voran, während er mir mit dem Kanu auf seinem Kopf folgte. Ich kannte den genauen Weg nicht, sondern orientierte mich an den Landmarken, so wie ich es in Boston tue. Ich versuchte ein Gespräch zu beginnen, doch Polis keuchte unter dem Gewicht seines Kanus, zu dem er die übliche Tragevorrichtung nicht dabei hatte, und da er außerdem noch Indianer war, hätte ich währenddessen ebenso gut auf den Boden seines Birkenholzbootes klopfen können. Als Antwort auf meine verschiedenen Bemerkungen grunzte er nur ein- oder zweimal unbestimmt unter seinem Kanu hervor, damit ich wusste, dass er da war.
Früh am nächsten Morgen rief uns die Kutsche. Mein Gefährte und ich besaßen jeder einen großen Rucksack, der bis zum Rand vollgestopft war, und wir hatten zwei große Gummitaschen, die unseren Proviant und Geschirr enthielten. Das ganze Gepäck des Indianers, neben seiner Axt und seinem Gewehr, bestand aus einer Decke, die er lose in der Hand hielt. Er hatte sich jedoch einen Vorrat an Tabak und eine neue Pfeife für den Ausflug zugelegt. Das Kanu war quer über das Kutschendach festgebunden, mit Teppichstücken, die unter die Kanten gestopft worden waren, damit sie nicht scheuerten. Der Kutscher schien ebenso daran gewöhnt, Kanus auf diese Art zu transportieren wie Hutschachteln.
Am Bangor House stiegen vier Männer zu, die einen Jagdausflug unternahmen. Einer von ihnen war der Koch. Sie hatten einen Hund, einen mittelgroßen, gescheckten Köter, der neben der Kutsche herlief, während sein Herr ab und an den Kopf aus dem Fenster steckte und pfiff. Doch nachdem wir etwa drei Meilen zurückgelegt hatten, war der Hund plötzlich verschwunden, und zwei der Jäger gingen zurück, ihn zu suchen, während die vollbesetzte Kutsche warten musste. Schließlich kam ein Mann zurück, während der andere weitersuchte. Diese ganze Jagdgesellschaft erklärte sich bereit, auszusteigen, bis der Hund gefunden war, doch der überaus gefällige Kutscher war gern bereit, noch ein Weilchen zu warten. Offensichtlich wollte er nicht so viele Passagiere verlieren, die ein privates Transportmittel genutzt oder vielleicht die andere Postkutschenlinie am nächsten Tag genommen hätten. So kamen wir voran, auf einer Strecke von über sechzig Meilen, die wir an jenem Tag zurücklegen sollten, und es begann gerade heftig zu regnen. Während wir dort warteten, diskutierten wir bis zum Überdruss das Thema Hunde und ihre Instinkte, und der Anblick der Vororte von Bangor war mir immer noch deutlich in Erinnerung.
Nach einer geschlagenen halben Stunde kehrte der Mann zurück, den Hund an einer Leine führend. Er hatte ihn eingeholt, als er gerade Bangor House betreten wollte. Nun wurde er am Kutschendach festgebunden, doch da er nass war und fror, sprang er während der Fahrt mehrmals herunter, und ich sah ihn an der Leine baumeln. Dieser Hund galt als verlässlich darin, Bären zu stellen. Er hatte schon einmal einen von ihnen irgendwo in New Hampshire aufgehalten, und ich kann auch bezeugen, dass er in Maine eine Kutsche aufhielt. Diese vier Jäger bezahlten wahrscheinlich nichts für die Fahrt des Hundes und auch nicht für seine Flucht, während wir drei für das leichte Kanu, das immer noch auf dem Dach festgezurrt war, zwei Dollar hinlegten und letztlich sogar vier in Rechnung gestellt bekamen.
Die Kutsche war auf der ganzen Strecke überfüllt. Wenn Sie hineingeschaut hätten, dann hätten Sie vielleicht gedacht, wir seien gerüstet, bei einer Räuberbande Spießruten zu laufen, denn auf dem Vordersitz befanden sich vier oder fünf Gewehre und auf dem Rücksitz ein oder zwei, wobei jeder Mann sein liebstes in den Armen hielt. Es stellte sich heraus, dass die Jagdgesellschaft denselben Weg hatte wie wir, aber viel weiter reisen würde. Ihr Anführer war ein gutaussehender Mann von ungefähr dreißig Jahren, ziemlich groß, aber nicht besonders kräftig, mit den Manieren eines Gentleman und tadelloser Kleidung. Sein Teint war so blass, als hätte er immer im Schatten gelebt, und sein Gesicht wirkte vergeistigt, so dass er mitsamt seiner ruhigen Art als Theologiestudent hätte durchgehen können, der einiges von der Welt gesehen hat. Überrascht musste ich feststellen, dass er der wohl wichtigste weiße Jäger von Maine war, der überall entlang der Straße erkannt wurde. Später hörte ich, wie man ihm nachsagte, er könne extreme Kälte und Erschöpfung ertragen, ohne sich etwas anmerken zu lassen, und könne nicht nur mit Gewehren umgehen, sondern sie auch selbst herstellen, da er ein Büchsenmacher sei. Im Frühling hatte er auf dieser Strecke im Seitenarm des Piscataquis einen Kutscher und zwei Passagiere vor dem Ertrinken gerettet, indem er durchs eiskalte Wasser ans Ufer schwamm, ein Floß baute und sie damit an Land brachte, obwohl er selbst in Lebensgefahr schwebte und die Pferde ertranken. Gleichzeitig flüchtete sich der einzige andere Mensch, der schwimmen konnte, in das nächstgelegene Haus, um nicht zu erfrieren. Er kannte unseren Mann und meinte, wir hätten da einen guten Indianer, einen guten Jäger, und er fügte hinzu, dass er angeblich sechstausend Dollar habe. Der Indianer kannte ihn ebenfalls und sagte zu mir: „Der große Jäger.“
Der Indianer saß mit gleichmütigem Gesichtsausdruck auf dem Vordersitz, als ob er kaum wahrnahm, was um ihn herum geschah. Außerdem war ich von der eigenartigen Unbestimmtheit seiner Erwiderungen überrascht, wenn er in der Kutsche oder in den Gasthäusern angesprochen wurde. Tatsächlich sprach er zu solchen Anlässen kein Wort. Er wurde lediglich wie ein wildes Tier aufgeschreckt und murmelte teilnahmslos ein paar unbedeutende Silben. In solchen Fällen war seine Antwort so vage wie eine Rauchschwade, schien vollkommen unverbindlich, und wenn man darüber nachdachte, merkte man, dass er eigentlich nichts gesagt hatte. Dies stand im Gegensatz zum konventionellen Geschwätz und der Gewandtheit des weißen Mannes, brachte aber denselben Gewinn. Den Meisten gelingt es nicht, mehr aus einem Indianer herauszuholen, weswegen sie ihn als gleichmütig bezeichnen. Ich staunte über die dumme und unverschämte Art, in der ihn ein Mann aus Maine, ein Passagier, ansprach, als ob er ein Kind wäre, woraufhin er lediglich seine Augen ein wenig schimmern ließ. In einem Gasthaus fragte ihn ein beschwipster Kanadier mit schleppender Stimme, ob er rauche, worauf er mit einem unbestimmten „Ja“ antwortete.
„Kannst du mir mal kurz deine Pfeife leihen?“, fragte sein Gegenüber.
Er blickte mit einem einzigartigen Gesichtsausdruck, dem jedes gesellige Interesse fehlte, gerade am Kopf des Mannes vorbei und sagte: „Ich keine Pfeife haben.“ Allerdings hatte ich an jenem Morgen gesehen, wie er eine neue mit einem Vorrat an Tabak in seine Tasche steckte.
Unser kleines Kanu, das sauber und gut in Schuss war, wurde von all den Schlaumeiern unter den Wirtshausgästen entlang der Straße mit wohlwollenden Urteilen bedacht. Am Straßenrand, nahe den Kutschenrädern, bemerkte ich ein prächtiges großes Knabenkraut mit purpurnem Blütensaum, wegen dem ich gern die Kutsche angehalten hätte, um es zu pflücken, doch da es nicht dafür bekannt war, Bären zu stellen wie der Köter auf dem Dach, hätte der Kutscher das wahrscheinlich für Zeitverschwendung gehalten.
Als wir den See um ungefähr halb neun am Abend erreichten, regnete es immer noch gleichmäßig, und in dieser frischen, kühlen Luft piepsten Laubfrösche und die Kröten lärmten an den Ufern. Es war, als hätte sich die Jahreszeit zwei oder drei Monate zurückentwickelt, oder als wäre ich in der Heimstatt des ewigen Frühlings gelandet.
Wir hatten geplant, sofort auf den See hinauszufahren, zwei oder drei Meilen zu paddeln und dann auf einer seiner Inseln unser Lager aufzuschlagen, doch wegen des Regens beschlossen wir, in einem der Gasthäuser zu übernachten.
IIFreitag, 24. Juli
Obwohl es ziemlich bewölkt war, begleitete uns der Wirt am nächsten Morgen um ungefähr vier Uhr in der Dämmerung ans Ufer des Moosehead Lake, wo wir unser Kanu von einem Felsen zu Wasser ließen. Unser Kanu war recht klein für drei Personen, drei Meter lang, in der Mitte achtzig Zentimeter breit und innen dreißig Zentimeter tief. Ich schätze sein Gewicht auf beinah achtzig Pfund. Der Indianer hatte es erst kürzlich selbst gebaut, und sein kleines Format wurde teils dadurch wettgemacht, dass es neu und wegen seiner sehr dicken Rinde und den Rippen zuverlässig und solide war. Unser Gepäck wog rund hundertsechsundsechzig Pfund. Der Großteil des Gepäcks wurde wie üblich in der Mitte, an der breitesten Stelle untergebracht, während wir uns davor und dahinter in die frei gebliebenen Ritzen und Spalten zwängten, wo es keinen Platz gab, um die Beine auszustrecken, da die losen Gegenstände in Bug und Heck gestopft worden waren. Das Kanu war also ebenso vollgepackt wie ein Einkaufskorb. Der Indianer saß auf einem Querholz im Heck, wir aber hockten am Boden, mit einer Schiene oder Platte im Rücken, die uns vor dem Querholz schützte, und jeweils einer von uns paddelte zusammen mit Joseph Polis.
Während wir in der Stille des Morgens am Ostufer des Sees entlangfuhren, sahen wir bald ein paar Brandenten, die von den Indianern Shecorways genannt werden, und einige scheckige Flussuferläufer am felsigen Strand. Außerdem sahen und hörten wir Seetaucher. Das Geräusch des regelmäßigen Eintauchens der Ruder, als ob es sich um unsere eigenen Finnen oder Flossen handelte, und die Feststellung, dass wir endlich wirklich aufgebrochen waren, weckten unsere Lebensgeister.
Nachdem wir die kleinen felsigen Inseln passiert hatten, die sich vom unteren Ende des Sees bis über zwei bis drei Meilen erstrecken, berieten wir uns rasch über unseren Kurs und wandten uns dann dem Westufer zu, da dieses windgeschützt war. Ansonsten wäre es bei aufkommendem Sturm unmöglich gewesen, Mount Kineo zu erreichen, der ungefähr in der Mitte des Sees am östlichen Ufer liegt, allerdings an seiner schmalsten Stelle, wo wir die Seite würden wechseln können, wenn wir uns westlich hielten. Der Wind ist das hauptsächliche Hindernis beim Überqueren eines Sees, besonders in einem so kleinen Kanu. Der Indianer meinte immer wieder, es gefiele ihm nicht, Seen „in kleinum Kanu“ zu überqueren, aber dennoch, „wenn wir es so wollten, machte es ihm nichts aus“.
Moosehead Lake ist an seiner weitesten Stelle zwölf Meilen breit und erstreckt sich dreißig Meilen in gerader Linie, ist aber tatsächlich noch länger. Während wir in Ufernähe paddelten, hörten wir oft das pe-pe des Fliegenschnäppers mit der olivgrünen Flanke und auch den Waldbaumläufer und den Eisvogel. Als der Indianer uns daran erinnerte, dass er ohne Essen nicht arbeiten könne, landeten wir am Hauptufer südwestlich von Deer Island, um zu frühstücken. Wir holten unsere Taschen hervor, und der Indianer machte unter einem sehr großen ausgebleichten Stamm ein Feuer, wobei er weiße Kiefernrinde von einem Baumstumpf benutzte, obwohl er sagte, dass Hemlocktanne und Kanubirkenrinde als Anzündholz besser geeignet seien. Unser Tisch bestand aus einem großen Stück frisch abgeschälter Birkenrinde, das verkehrt herum hingelegt wurde, und zum Frühstück hatten wir Hartbrot, gegrilltes Schweinefleisch und starken, gut gezuckerten Kaffee, bei dem wir die Milch nicht vermissten.
Während wir frühstückten, schwamm eine Brut von zwölf Jungvögeln, schwarzen Enten, fünfzehn bis zwanzig Meter entfernt an uns vorbei, die überhaupt nicht scheu waren. Sie waren sehr niedlich, trieben sich um uns herum, solange wir dort verweilten, drängten sich bald eng zusammen, um sich dann wieder in einer langen Reihe fortzumachen.
Wenn man von dieser Stelle nordwärts blickte, schien es, als ob wir in eine große Bucht hineinkämen, und wir wussten nicht, ob wir gezwungen sein würden, von unserem Kurs abzukehren und einer von uns aus sichtbaren Landspitze auszuweichen, oder ob wir eine Passage zwischen ihr und dem Festland finden könnten. Es herrschte nebliges Hundstagswetter, und wir waren bereits in eine kleinere Bucht derselben Art eingedrungen und dennoch weitergekommen, obwohl wir eine Sandbank zwischen einer Insel und dem Ufer überwinden mussten, wo das Wasser gerade breit und tief genug war, damit das Kanu schwimmen konnte. Der Indianer hatte angemerkt, wie leicht es sei, „hier Brücke zu machum“, nun aber schien es, als wären wir wirklich in eine Sackgasse geraten. Bald lichtete sich jedoch der Nebel ein wenig und enthüllte eine Lücke im nördlichen Ufer. Der Indianer meinte sogleich: „Ich glaube, ihr und ich sollten dorthin.“
Dies war sein üblicher Ausdruck für „wir“. Er sprach uns nie mit unseren Namen an, obwohl er sich neugierig danach erkundigte, wie man sie buchstabiere und was sie bedeuteten. Wir nannten ihn Polis. Er hatte bereits sehr genau unser Alter erraten und sagte, er sei achtundvierzig.
Nach dem Frühstück leerte ich das übrig gebliebene Schweinefett ins Wasser, schuf das, was Matrosen eine „glatte See“ nennen, und beobachtete, wie sie sich verbreitete und die aufgewühlte Oberfläche ebnete. Der Indianer sah es sich einen Augenblick lang an und sagte: „Das macht Paddlum schwer, hält Kanu fest. So sagen die Alten.“
Wir packten rasch unsere Sachen ins Kanu, legten das Geschirr in Bug und Heck, sodass es griffbereit war, wenn wir es brauchten, und brachen wieder auf. Das Westufer, an dem wir entlangpaddelten, erhob sich allmählich bis auf eine beträchtliche Höhe und war überall dicht bewaldet, wobei ein großer Anteil an Laubbäumen die Fichten und Tannen auflockerte und belebte.
Der Indianer sagte, die Flechten, die wir von den Bäumen hängen sahen, würden chorchorque genannt. Wir fragten ihn nach den Namen verschiedener Vögel, die wir an diesem Morgen gehört hatten. Die weit verbreitete Drossel, deren Zwitschern er nachahmte, werde Adelungquamooktum genannt, meinte er, aber manchmal konnte er den Namen eines kleinen Vogels, den ich hörte und kannte, nicht nennen. Dann sagte er: „Ich kennen alle Vögel hier, kenne nicht kleinum Stimme, aber wenn ich sehen, kann ich erkennen.“