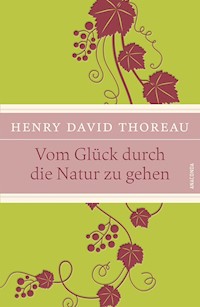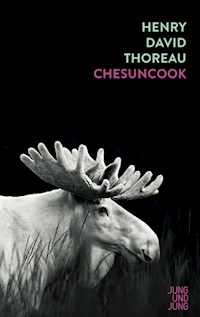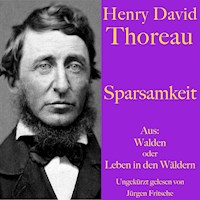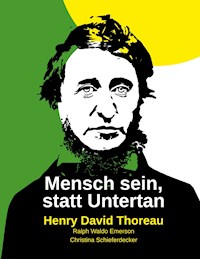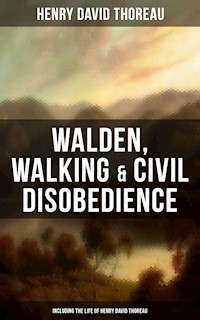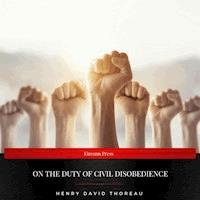Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erstmals auf Deutsch: Thoreaus meisterliche Reiseerzählung Zahlreiche Reisen führten H. D. Thoreau ab 1849 auf die Halbinsel Kap Cod in Massachusetts.Seine Aufzeichnungen zu Land und Leuten, Tieren und Pflanzen, zur Landschaft und ihrer herben Schönheit bilden die Grundlage für das posthum erschienene Buch "Kap Cod". Es legt Zeugnis ab von der immensen wirtschaftlichen Bedeutung des Walfangs, von der Abholzung der Wälder, der Gewalt des Ozeans, der Kargheit des Landes und der Ausdauer seiner Bewohner. Erstmals erscheint eine der großartigsten Reiseerzählungen des 19. Jahrhunderts auf Deutsch. Ilija Trojanow, der das heutige Kap für dieses Buch bereiste, bereichert dieses literarische Juwel um seine persönliche Perspektive.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Henry David Thoreau
Kap Cod
Aus dem Amerikanischen übersetzt und herausgegeben von Klaus Bonn
Mit einem Essay von Ilija Trojanow
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeDaten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
www.residenzverlag.at
© 2014 Residenz Verlagim Niederösterreichischen PressehausDruck- und Verlagsgesellschaft mbHSt. Pölten – Salzburg – Wien
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.Keine unerlaubte Vervielfältigung!
ISBN ePub:978-3-7017-4458-9
ISBN Printausgabe:978-3-7017-1615-9
CAPE COD – NACHGEREIST
Essay von Ilija Trojanow
Als ich eines Abends spät über die lang gezogene Landzunge von Cape Cod fuhr, vor mir einen fast vollen Mond und im Ohr einen Crooner aus längst vergangener Zeit, wurde ich von einem gleißenden Blaulicht mit Sirene gestoppt. Nachdem ich Führerschein und Fahrzeugpapiere überreicht hatte, fragte mich der Polizist, was ich auf Cape Cod vorhabe. Die Halbinsel erkunden, antwortete ich, in den Fußstapfen von Henry David Thoreau, der ist vor mehr als 150 Jahren von Sandwich nach Provincetown gewandert. Die ganze Strecke zu Fuß? Ich nickte. Was haben Sie’s dann so eilig, meinte der Polizist. Langsamer fuhr ich weiter.
Im Autoradio wurde die Nachricht des Tages verkündet: Ein junger Mann sei mit zwei Kilogramm Marihuana erwischt worden. Später im Hotel, deutete der Manager auf den Safe, nicht ohne zu kommentieren, es gebe hier keine Kriminalität, nur wollten das die Gäste – aus einer anderen, bösen Welt kommend – nicht wahrhaben. Wie ich später herausfand, hatte der Mann nur eine Ausnahme unterschlagen, den endemischen Fahrradklau. Vielleicht weil das Jahr in den November gerutscht und niemand auf einem Zweirad unterwegs war.
Der Unterschied zwischen Sommer und Winter ist auf Cape Cod noch ausgeprägter als anderswo. Zwischen Ende Juni und Anfang September sind die Parkplätze des Paradieses schon um zehn Uhr in der Früh belegt, die Strände gemäß einer prägnanten soziokulturellen Ordnung besetzt, manche den Männern vorbehalten, andere den Frauen. Es gelte die Regel, schreibt Michael Cunningham, dass die Schwulen nur in Badehose und mit einem Handtuch zum Strand gingen, die Lesben hingegen so viel Hausrat hinschleppten, wie sie nur könnten. Natürlich gibt es auch Strandabschnitte für Familien, für Sandburgenbauer und Grillmeister, für jene, die keinem Körperkult huldigen, und für jene, die sich eher nach Sonne als nach Sex sehnen.
Freunde in New York hatten mich gewarnt: »Watch your arse!« Sie sprachen von angeblich 90 Prozent Homosexuellen in Provincetown. In der Fantasie manch eines braven Heteros sind die Dünen um das Städtchen herum Sodom und Gomorra en miniature, weil manche Einheimischen, aber auch Touristen zwischen Wasser und Gras wilden Sex treiben.
An einem glasklaren Novembermorgen erwartete mich ein einziges Fahrzeug auf dem asphaltierten Areal hinter dem Herring Cove Beach. Ich parkte meinen Wagen ungefähr hundert Meter davon entfernt und machte mich auf, allein bis auf die Spuren eines Fuchses (es gibt auch Waschbären, Beutelratten und Kojoten – »Nicht füttern!« –, nachts ziehen Stinktiere durch die Straßen), die meinen Weg kreuzten, sobald mein Blick vom Pfad abschweifte. Denn an den Stadtgrenzen von Provincetown, Truro, Wellfleet und Eastham beginnt der Cape Cod National Seashore, ein unter der Ägide von John F. Kennedy eingerichtetes Reservat. Den Präsidenten verband eine intensive Beziehung zu Cape Cod, in Hyannis gibt es ein Museum zu seinen Ehren und auf der Halbinsel wurde des fünfzigsten Todestages seiner Ermordung besonders intensiv gedacht (und bei der Beerdigung von Jacqueline Kennedy Onassis wurde Edna St. Vincent Millays Gedicht »Memory of Cape Cod« vorgetragen).
Der Tag, der am Hafen mit einer roten Explosion begonnen hatte, setzte sich in mondartiger Dünenlandschaft mit einer Reduktion der Farben fort. Vom unvergänglichen Grün der vereinzelten Nadelbäume abgesehen war alles karg, keine Blätter im Buschwerk, kein Boden außer dem dunklen Grau des asphaltierten Pfades und dem hellen Grau des Sands. Über all dem der klarste Himmel, der jemals über einen einsamen Wanderer gespannt wurde. Einst wuchsen größere Bäume, aber frühe Siedler haben sie gefällt und Kiefern gepflanzt, die in dieser Umgebung offensichtlich nur sehr zögerlich wachsen. Manchenorts gibt es Sand und nichts als Sand. Ich komme mir in meinem neongelben Jogginganzug laut vor und sehne mich nach Mimikry.
Der Pfad, auch für Fahrradfahrer gedacht, ist nicht nur asphaltiert, sondern auch mit einem durchgängigen gelben Strich in der Mitte versehen. Unvermittelt stößt der Wanderer auf ein großes Warnschild, das die Verengung des Pfades verkündet, und dann auf eine riesige Ampel, die durch Sonnenkraft zum Leuchten gebracht wird – ein Übermaß an zivilisatorischem Reglement, das Thoreau mit Ingrimm verspottet hätte. Der Pfad führt am Flughafen vorbei (zu viel Freiraum darf man der Natur nicht lassen), der einzigen Möglichkeit, den sommerlichen Staus auf der Hauptstraße durch Cape Cod zu entgehen, und weiter zum Race Point Beach.
Dort erschließt sich der merkwürdige Beginn dieser Reisebeschreibung von Henry David Thoreau. Am hölzernen Life Saver House, umringt von hohen Dünen, wird dokumentiert, wie viele Schiffe vor Cape Cod zerschellt und versunken sind. Havarien gehörten zum Alltag. Die Bergung der Passagiere und Matrosen war eine gefährliche Aufgabe, denn die kleinen Rettungsboote mussten durch die gewaltige Brandung ins Meer hinausgeschoben werden. Manch ein Rettungsversuch scheiterte daran, dass die Boote immer wieder an den Strand geworfen wurden.
Der letzte Teil des ordentlichen Pfads führt durch den Beech Forest – eine baumdichte Überraschung nach der bisherigen, kargen Landschaft. Die Buchen formen natürliche Alleen und Promenaden, an manchen Stellen sind Lichtungen entstanden, auf denen im Sommer geheiratet wird, umgeben von Bäumen, die vom Menschen markiert wurden, intime Brandmarkungen, Bob liebt Sue, Jack und Jill waren hier, und hinter jedem Stamm scheint sich ein Kind zu verstecken.
Übernachtet hatte ich in Provincetown. P-Town (jeder, der dort war, darf das Städtchen so nennen, wurde mir versichert) ist auf Sand gebaut, wortwörtlich. Die Häuser – meist grau, weitaus seltener in Weißblau, mit Holzschindeln und einer lang gezogenen Veranda – haben kein Fundament, es würde einen nicht wundern, wenn sie hierher zur Sommerfrische von einem jener gewaltigen amerikanischen Trucks über das Land transportiert werden würden, wie ein Boot, das zu einer neuen Marina geschleppt wird. Die Erde selbst ist ein Einwanderer, hergebracht als Ballast in den Laderäumen von Schiffen, die schwer beladen mit Salz wieder gen Europa aufbrachen, sodass in manch einem alteingesessenen Garten die winterharten Rhododendren auf europäischer Scholle wachsen. Immer wieder haben sich die Einheimischen gefragt, ob es nicht ein Fehler war, sich hier anzusiedeln, und sind doch geblieben.
Mitten im Städtchen erhebt sich ein Turm, einer jener Bauten, die so fehl am Platz sind, dass man hofft, sie würden sich im nächsten Augenblick voller Einsicht in diesen Sachverhalt aus dem Staub machen. Der Torre del Mangia aus Siena wurde in grauer Einfalt nachgebaut, erstaunlicherweise um die Pilgrim Fathers zu ehren. Denn P-Town ist Konkurrent in einem erinnerungskulturellen Kampf: so sehr allgemein bekannt ist, dass die Pilgerväter 1620 auf der Mayflower über den Atlantik segelten und Plymouth in Massachusetts gründeten, so wenig ist die Kunde verbreitet, dass sie zuerst in Cape Cod anlandeten, auch wenn Thoreau es ausgiebig beschreibt. Das ärgert die Lokalpatrioten schon seit Längerem, aber trotz des toskanischen Turms und einer aufwendigen Gedenktafel inmitten des Kreisverkehrrondells am äußersten Ende des Städtchens hat sich die korrekte historische Darstellung nicht durchsetzen können.
Thoreau besaß einen siebten Sinn für Absurditäten. Wäre er einige Jahre später durch Cape Cod gewandert, hätte er gewiss diese Anekdote über die Wehrhaftigkeit von Provincetown erzählt: Als der Sezessionskrieg ausbrach, fürchteten die Bürger des Städtchens einen Angriff der Konföderiertenarmee, weswegen sie auf jenem Zeigefinger gegenüber dem Hafen namens Long Point zwei sandige Festungen errichteten, eine jede ausgestattet mit einer Kanone. Tag und Nacht wachten die Männer der Stadt, hielten Ausschau nach einem Feind, der nie auftauchte, weswegen die Festungen im Volksmund Fort Useless und Fort Ridiculous getauft wurden.
Es gibt allerdings weder eine Erklärung noch eine Entschuldigung dafür, dass Thoreau den Friedhof in P-Town keines Wortes für würdig erachtet, obwohl es sich um einen der schönsten Friedhöfe der Welt handelt, die kleinen schmalen Grabsteine, die meist nur den Namen und die Lebensdaten mitteilen, über einige kleine Hügel verstreut. Kein Firlefanz, keine Eitelkeit. Zur sonnigen Mittagszeit wirkt es, als hätten sich die Toten zu einem Picknick eingefunden und sich mal in Grüppchen, mal in Pärchen, mal einzelgängerisch über den Rasen verteilt, den Namen nach überwiegend WASPs – Goodwin, Hopkins, Summer, Cooper, O’Neill, Whitney, Deyer, Butler, Cobb. P-Town ist weiterhin ein durch und durch weißes Städtchen. Ich habe durch die Schwingtür in der Küche meines Hotels einen einzigen Schwarzen erspäht und ihn später jamaikanisch fluchen gehört, aber ansonsten nur wettergegerbte Bleichgesichter erblickt; von der ethnischen Vielfalt der Großstädte Boston und New York keine Spur.
Cape Cod schaut aus wie der gekrümmte Arm bei einer Tai-Chi-Übung, das Landende bei Provincetown die Fingernägel einer gebeugten Hand, der National Seashore der gestreckte Unterarm und der Rest ein muskulöser Oberarm. Östlich von P-Town wird die Landzunge sehr schmal, rechts eine Häuserreihe, dahinter die Bucht, links Sanddünen, dahinter das offene Meer. Der Sand ist seit den Tagen von Thoreau domestiziert worden. Noch im 18. Jahrhundert haben Stürme diese Verbindung zur Außenwelt immer wieder weggeschwemmt, das Ende von Cape Cod wurde zu einer Insel, erreichbar nur mit Boot. Gesichert wirkt seine Existenz auch heute nicht. Ein Hurrikan, der hier zuschlägt, könnte dieses sandige Provisorium wegfegen, wie ein wütender Arm über einen reichlich gedeckten Picknicktisch. Es ist junges Land, geformt vor kaum mehr als 10 000 Jahren, hier haben, wie Norman Mailer meint, »die eigenen Geister keine Wurzeln geschlagen«.
Hinter dem Pilgrim Lake (man gibt sich nicht geschlagen!) führt ein Pfad zum ersten Brunnen, der, wie eine Tafel verkündet, die Pilgerväter mit frischem Wasser versorgte, genau an der Grenze zwischen bewachsenen Dünen und einem dichten Nadelwald, einem erstaunlich dichten Baldachin, das leuchtende Grün ein Kontrast zu den ansonsten eher ausgewaschenen Farben. Wenn die Sonne den Wald durchkämmt, tänzeln die Schatten um die Stämme herum, der Hintergrund offeriert gelegentlich einen Tupfer Meerblau. Am Wegrand benennen Schilder eine Flora, die zu dieser Jahreszeit – blüten- und blätterlos – schwer zu erkennen ist.
Truro – verschlafener als Wellfleet, weniger mondän als Provincetown – strahlt eine große Ruhe aus. Nirgendwo auf Cape Cod fühlte ich mich der Welt von Thoreau näher (denken wir uns Autos und Strommasten weg), im Zentrum der Kleinstadt liegen die Häuser im Schatten von Bäumen, in der Umgebung über die sanften Hügel versprengt. Wer bei dem Schild Highland Light abbiegt, wird kurz darauf das Motiv eines der berühmtesten Bilder von Edward Hopper von der Rückseite sehen. Immer wieder hat Hopper diesen Leuchtturm in Aquarell- und Ölfarben abgebildet. Wenn man ihn zum ersten Mal erblickt, erschrickt man fast über die Vertrautheit. Es hat den Eindruck, als hätte Edward Hopper, der sich 1930 mit seiner Frau Jo ein einfaches Haus mit großen Fenstern in South Truro nach eigenen Plänen erbauen ließ, ganz Cape Cod gemalt: die Dünen entlang der Küste, die Bäume bei Eastham, die Hügel in Truro, die Methodist Church in P-Town, Segler vor Wellfleet, einen verheißungsvollen »Cape Cod Morning« sowie einen bedrohlichen »Cape Cod Evening«. Im Gegensatz zu seinen trostlosen Großstadtszenen strahlen diese Bilder von Straßen, Häusern und Landschaften auf der Halbinsel etwas Versöhnliches aus, eine Versöhnung zwischen den Elementen und den Bauten, so als wären die Häuser der Natur nicht mehr fremd. Sie hätten Thoreau gefallen, so wie umgekehrt Thoreau zu Hoppers Lieblingsautoren gehörte.
Der Leuchtturm auf der Anhöhe, heute um mehrere hundert Meter landeinwärts versetzt, weil die Küste abbricht (von den einstigen zehn Hektar Land sind nur noch vier übrig geblieben), wurde 1779 von George Washington in Auftrag gegeben, doch erst Mitte des 19. Jahrhunderts in Stein gebaut. »Nature grows by inches, but dies by feet.« Eine Tafel fordert den Besucher auf, die Dünen am Steilabbruch nicht zu betreten. Eine ironisch anmutende Mahnung, denn wenn man sich umdreht, sieht man rechts vom Leuchtturm einen Golfplatz mit Spielbahnen, auf denen die Natur »by yards« gestorben ist.
Hopper war nicht der einzige kreative Eremit – Cape Cod zieht seit Längerem Aussteiger, Exzentriker und Künstler an. In Truro hat John Dos Passos einen Teil seiner U.S.A.-Trilogie geschrieben, deren erster Band The 42nd Parallel betitelt ist, der Breitengrad, der durch Cape Cod Bay und Truro verläuft. Eugene O’Neill hat auf der Halbinsel als unbekannter Alkoholiker mühsam sein erstes Stück zu Papier gebracht, Tennessee Williams als weltberühmter Alkoholiker mühsam sein letztes Stück nicht fertiggestellt. Robert Motherwell und Mark Rothko haben sich hierher zurückgezogen, ebenso wie Edmund Wilson und Norman Mailer.
Auch Wissenschaftler: Weiter südlich – die Sanddünen erstrecken sich kilometerweit entlang des Atlantiks – befindet sich die Stelle, wo Guglielmo Marconi den ersten Telegrafen erprobte, die erste immaterielle Nachricht über den Ozean sendete. Das Gebäude ist inzwischen ins Meer gestürzt, doch ein Aussichtspunkt samt Gedenktafel erinnert an den vergeistigten Tüftler, der sicher war, dass seine Erfindung eines Tages auch die Kommunikation zwischen Lebenden und Toten ermöglichen würde.
Das jährliche Oyster Festival in Wellfleet hatte ich leider knapp verpasst, aber wie stolz das Städtchen auf diese Tradition ist, las ich von T-Shirts und Aufklebern ab. Wellfleet nimmt seine Meeresfrüchte weiterhin ernst, es hat sogar einen shellfish constable (Krustentierschutzmann) bestellt. Heute werden die Austern meist gezüchtet, im Hafen des Städtchens, im dortigen Watt, auf 80 zertifizierten Bänken. Wer Appetit und Abenteuerlust verspürt, kann aber weiterhin in Gummistiefeln im seichten Buchtwasser nach wilden Austern suchen. Westlich des Hafens liegt eine sich nach Süden zuspitzende kleinere Landzunge, Great Island genannt. Ein Pfad führt direkt an der Bucht entlang, entlang der grüngelb überwachsenen Dünen, die zu betreten verboten ist, erosion control area, please keep off, denn trotz Naturschutzgebiet ist das Ökosystem labil, es muss sich erholen vom Zugriff der Vertreter der abendländischen Zivilisation (die Pononakanits-Indianer, Teil der Wampanoag-Föderation, hatten jahrhundertelang dort gelebt, ohne die Ressourcen zu erschöpfen), die mit der üblichen Hingabe und Konzentration innerhalb weniger Jahre alle Wale harpunierten und alle Bäume fällten. Seitdem sind die Dünenköpfe kahl, der Wind onduliert den Sand, der Kampf gegen die Erosion ist ein mühsames Geschäft. Und es ist schwer, stundenlang im Sand zu laufen, die Füße sinken ein, der Wind bläst einem die Körner ins Gesicht, Thoreau, der ja – im Gegensatz zu mir – meist über Sand ging, muss eine hervorragende Kondition und einen starken Willen gehabt haben.
Niemand würde behaupten, dass Cape Cod überwältigend schön ist –wie etwa die Wüstenlandschaften im Südwesten der USA. Aber genau das macht seinen Reiz aus. Es ist Natur, die einen nicht überwältigt, die man zu Fuß gut bewältigen kann, jünger als das Menschengeschlecht, im Winter stürmisch, im Sommer sonnig, spürbar in Veränderung begriffen.
Als Henry David Thoreau Cape Cod durchwanderte, war er unbekannt, als sein Reisebericht erschien, war er tot, als das 20. Jahrhundert anbrach, war er so gut wie vergessen. Heute gilt er als ein Gigant der US-amerikanischen Literatur, ein Stilist vom Range Ralph Waldo Emersons, ein politischer Denker, der den zivilen Ungehorsam von Mahatma Gandhi, Martin Luther King und anderen inspirierte, ein Visionär, der die Umweltbewegung vorwegnahm (und auch unsere Zeit mit ihrer Vertreibung der Natur aus der Realität in die Welt der Begriffe: »Es gibt viele Herring-Flüsse auf dem Kap; bald werden es vielleicht mehr sein als die Heringe selbst.«) Aber auch als etablierter Klassiker macht Thoreau es dem Leser nicht leicht. Eigenwilligkeit ist unter Autoren eine häufig anzutreffende Eigenschaft, vom Leser mal als Tugend, mal als Laster empfunden. Thoreau, dieser spöttische Dickkopf, setzt dem Üblichen noch eins drauf – manchmal liest sich »Cape Cod« so, als würde der Autor uns nur sehr unwillig Einblick in seine Notizen gewähren.
Thoreau war von jungen Jahren an widerborstig. Er gab seine erste Arbeitsstelle als Lehrer – damals, in Zeiten einer Depression, ein seltener Segen – in seiner Heimatstadt Concord auf, weil er sich weigerte, die Schüler mit Prügelstrafen zu maßregeln. Er benannte sich um, aus David Henry wurde Henry David, und beharrte darauf, auch wenn die Nachbarn und Bekannten ihn bis zu seinem Lebensende David Henry nannten. Er reagierte allergisch auf Autorität und Dummheit. Thoreau war ein freier Geist, und da solche dünn gesät sind, erschrecken wir, wenn wir einem begegnen, und stolpern bei der Lektüre über seine Eigenwilligkeiten. Thoreau irritiert und provoziert weiterhin. Doch in seinen Werken sind wertvolle Gedanken enthalten, wie Edelsteine in einer Druse, Einsichten, oft aus dem Augenblick geboren, leicht dahingeworfen und doch von beachtlicher Relevanz. Manch ein Einheimischer warnt, schreibt Thoreau in einer Szene dieses Buches, vor Haifischen. »Andere lachten über diese Geschichten, aber vielleicht konnten sie sich das leisten, weil sie nie irgendwo badeten.« Für grundsätzliche Bademuffel ist »Cape Cod« als Lektüre wenig geeignet; alle anderen werden ihren Gefallen daran finden.
Kap Cod
Die mit * versehenen Anmerkungen stammen von H. D. Thoreau. Die durchnummerierten Kapitelendnoten hat der Herausgeber Klaus Bonn verfasst.
I
Das Schiffswrack
Da ich mir einen besseren Eindruck als bisher vom Ozean verschaffen wollte, der, wie uns gesagt wird, mehr als zwei Drittel des Globus bedeckt, von dem aber ein Mensch, der ein paar Meilen entfernt im Landesinneren lebt, vielleicht nie auch nur eine Spur wahrnimmt, nicht mehr als von einer anderen Welt, besuchte ich Kap Cod im Oktober 1849, ein weiteres Mal im darauffolgenden Juni und Truro noch einmal im Juli 1855; das erste und das letzte Mal mit einem einzigen Gefährten,1 das zweite Mal allein. Ich habe, alles in allem, etwa drei Wochen auf dem Kap verbracht; bin zweimal von Eastham nach Provincetown auf der atlantischen Seite gegangen,2 einmal auch auf der Seite der Bucht, ließ vier oder fünf Meilen aus und ging auf meinem Weg ein halbes Dutzend Mal quer über das Kap; da ich aber so frisch zum Meer gekommen bin, wurde ich nur wenig gesalzen. Meine Leser dürfen daher nur so viel an Salzigkeit erwarten, wie sie die Landbrise vom Wehen über einem Meeresarm mitnimmt oder wie sie auf den Fensterscheiben und Baumrinden zwanzig Meilen landeinwärts nach Stürmen im September geschmeckt wird. Ich war es gewohnt, Ausflüge zu den Weihern im Umkreis von zehn Meilen von Concord zu machen, doch neuerdings habe ich meine Ausflüge zum Meeresstrand hin ausgedehnt.
Ich habe nicht eingesehen, warum ich nicht genauso gut ein Buch über Kap Cod schreiben sollte wie mein Nachbar eines über »Menschliche Kultur«3. Es ist nur ein anderer Name für dieselbe Sache und wohl kaum ein sandigerer Teil davon. Was meinen Titel angeht, so nehme ich an, dass das Wort Kap vom französischen cap kommt; was vom lateinischen caput, Kopf, herrührt; was vielleicht vom Verb capere, nehmen, fassen, kommt – das ist also der Teil, mit dem wir eine Sache zu fassen bekommen: – Pack die Gelegenheit beim Schopfe. Es ist auch die sicherste Stelle, an der man eine Schlange packt. Und was Cod angeht, so wurde das direkt von »dem großen Vorrat an Kabeljau« abgeleitet, den Kapitän Bartholomew Gosnold4 dort 1602 gefangen hatte; jener Fisch wiederum scheint seinen Namen dem angelsächsischen Wort codde zu verdanken, »eine Kiste, in der Samen aufbewahrt werden«, sei es wegen der Form des Fisches oder der Menge an Laich, die er enthält; woher vielleicht auch codling (pomum coctile?) kommt und ›coddle‹ – Grünzeug wie Erbsen zu kochen.
Kap Cod ist der entblößte und gebeugte Arm von Massachusetts: die Schulter befindet sich an der Buzzard’s Bay; der Ellbogen oder Musikantenknochen am Kap Mallebarre; das Handgelenk in Truro; und die sandige Faust in Provincetown – dahinter hält der Staat Wache, seinen Rücken den Green Mountains zugewandt und seinen Fuß auf den Meeresgrund gesetzt, wie ein Athlet, der seine Bucht schützt – im Boxkampf gegen nordöstliche Stürme und seinen atlantischen Gegner immer wieder aus dem Schoß der Erde hochfahrend –, stets bereit, mit der anderen Faust zuzuschlagen, die noch eine Weile seine Brust bei Kap Ann schützt.
Beim Studieren der Karte sah ich, dass es dort einen ununterbrochenen Strandabschnitt im Osten oder an der Außenseite des Unterarms des Kaps geben musste, mehr als dreißig Meilen von der allgemeinen Küstenlinie entfernt, der einen guten Blick aufs Meer gewähren würde, dass ich aber, aufgrund einer Öffnung im Strand, welche den Zugang zum Hafen von Nauset in Orleans bildete, erst in Eastham auf ihn treffen würde, wenn ich mich ihm über Land näherte, und dass ich wahrscheinlich von dort aus geradewegs nach Race Point gehen könnte, etwa achtundzwanzig Meilen ohne Hindernis.
Wir brachen am Dienstag, dem 9. Oktober 1849, in Concord, Massachusetts, auf. Als wir Boston erreichten, ergab es sich, dass das Dampfschiff von Provincetown, das am Vortag hätte eintreffen sollen, wegen eines heftigen Sturms noch nicht angekommen war; und als uns in den Straßen ein Flugblatt auffiel mit dem Titel »Tod! Einhundertvierzig Menschen in Cohasset ums Leben gekommen«, entschieden wir uns, den Weg nach Cohasset einzuschlagen. In den Eisenbahnwaggons trafen wir auf viele Iren, die unterwegs waren, um Leichen zu identifizieren, den Überlebenden ihr Mitgefühl auszudrücken und auch der Bestattung beizuwohnen, die am Nachmittag stattfinden sollte; – und als wir in Cohasset ankamen, schien es, als seien fast alle Passagiere zum Strand unterwegs, der etwa eine Meile entfernt war, und viele andere Personen schwärmten aus den benachbarten Gebieten herbei. Einige Hundert von ihnen strömten über Cohasset gemeinsam in jene Richtung, manche zu Fuß und andere in Fuhrwerken – unter ihnen waren einige Jäger in ihren schweren Jacken mit ihren Gewehren, Jagdtaschen und Hunden. Als wir am Friedhof vorbeikamen, sahen wir ein großes Loch, wie ein Keller, der frisch ausgehoben war, und gerade bevor wir über eine angenehm sich windende, felsige Straße das Meeresufer erreichten, begegneten wir etlichen Heuwägen und Bauernfuhrwerken, die zum Gemeindehaus fuhren, ein jeder beladen mit drei großen, groben Kisten. Wir mussten nicht fragen, was sich darin befand. Die Besitzer der Wägen waren zu Leichenbestattern gemacht worden. Viele Pferde mit ihren Fuhrwerken waren an den Zäunen in der Nähe des Meeresufers festgebunden, und eine Meile oder mehr in beide Richtungen war der Strand von Leuten bevölkert, die nach Leichen Ausschau hielten und die Bruchstücke des Wracks untersuchten. Unweit des Ufers gab es eine kleine Insel namens Brook Island, mit einer Hütte darauf. Man sagt, dies sei das felsenreichste Ufer in Massachusetts, von Nantasket bis nach Scituate – hartes orthophyrisches Gestein, das die Wellen bloßgelegt haben, aber nicht zu zerbröseln vermochten. Es ist der Schauplatz gar vieler Schiffbrüche gewesen.
Die Brigg St. John aus Galway, Irland, befrachtet mit Emigranten, erlitt am Sonntagmorgen Schiffbruch;5 jetzt war es Dienstagmorgen, und die Wellen brachen sich noch immer mit Macht an den Felsen. Achtzehn oder zwanzig von jenen großen Kisten, die ich erwähnt habe, lagen an einem grünen Abhang, ein paar Ruten6 vom Wasser entfernt, und sie waren von einer Menschenmenge umgeben. Die Leichen, die man geborgen hatte, sieben- oder achtundzwanzig insgesamt, waren dort zusammengetragen worden. Manche Leute nagelten rasch die Deckel zu, andere karrten die Kisten weg, und wieder andere hoben die Deckel an, die noch lose waren, und lugten unter die Tücher, denn jede Leiche war, mitsamt den Fetzen, die ihr noch anhingen, lose mit einem weißen Betttuch bedeckt worden. Ich sah keinerlei Anzeichen von Betrübnis, vielmehr war die Erledigung des Geschäfts so nüchtern, dass es berührend wirken konnte. Ein Mann suchte eine bestimmte Leiche zu identifizieren, und ein Leichenbestatter oder Zimmermann rief einem anderen etwas zu, um zu erfahren, in welche Kiste ein bestimmtes Kind hineingelegt worden war. Ich sah viele marmorkalte Füße und verfilzte Köpfe, als die Tücher hochgehoben wurden, und den fahlen, aufgedunsenen und verstümmelten Körper eines ertrunkenen Mädchens – das vermutlich die Absicht gehabt hatte, in den Dienst irgendeiner amerikanischen Familie zu treten –, an dem noch ein paar Fetzen Kleidung und eine vom Fleisch halb verdeckte Kette um den geschwollenen Hals hingen; das verkrümmte Wrack eines menschlichen Rumpfs, mit tiefen Wunden von den Felsen oder den Fischen, sodass Knochen und Muskeln entblößt waren, doch recht blutleer – nur rot und weiß – mit weit geöffneten, starrenden Augen, jedoch glanzlos, Toten-Lichter; oder wie die Bullaugen eines gestrandeten Schiffs, mit Sand gefüllt. Zuweilen waren da zwei oder mehr Kinder, oder ein Elternteil und ein Kind in derselben Kiste, und auf dem Deckel stand vielleicht mit roter Kreide geschrieben: »Bridget So-und-so und Kind der Schwester«. Der Grasteppich rundherum war bedeckt mit Segel- und Kleidungsstücken. Ich habe danach von jemandem, der in der Nähe dieses Strandes lebt, gehört, dass eine Frau, die früher schon herübergekommen war, ihr kleines Kind aber bei ihrer Schwester zurückgelassen hatte, damit sie es bringe, hierherging, in diese Kisten schaute und in einer – vermutlich derjenigen, deren Aufschrift ich zitiert habe – ihr Kind in den Armen der Schwester sah, als ob die Schwester so vorgefunden hätte werden wollen; und binnen drei Tagen starb die Mutter an den Nachwirkungen jenes Anblicks.
Wir wandten uns ab und gingen die steinige Küste entlang. In der ersten Bucht waren dem Anschein nach die Bruchstücke eines Schiffes verstreut, in kleinen Teilen, vermischt mit Sand und Seetang wie auch mit großen Mengen an Federn; doch sah dies so alt und rostig aus, dass ich es zuerst für irgendein altes Wrack hielt, das dort viele Jahre lang gelegen hatte. Ich dachte sogar an Kapitän Kidd7 und daran, dass die Federn von Seevögeln dort verloren worden waren; und vielleicht könnte es eine Überlieferung dazu in der Nachbarschaft geben. Ich fragte einen Seemann, ob das die St. John wäre. Er bestätigte es. Ich fragte ihn, wo sie auf Grund gelaufen sei. Er wies auf einen vor uns befindlichen Felsen, eine Meile vom Meeresufer entfernt, Grampus- Felsen geheißen, und fügte hinzu:
»Sie können einen Teil von ihr jetzt herausragen sehen; er sieht aus wie ein kleines Boot.«
Ich erblickte es. Man nahm an, dass es von den Ankerketten und Ankern gehalten wurde. Ich fragte, ob die Körper, die ich sah, alle gewesen seien, die ertrunken waren.
»Nicht ein Viertel von ihnen«, sagte er.
»Wo ist der Rest?«
»Die meisten genau unterhalb jenes Stücks, das Sie sehen.«
Es schien uns, dass allein in dieser Bucht genug Schutt lag, um das Wrack eines großen Schiffes auszumachen, und dass es viele Tage dauern würde, alles fortzukarren. Das Gerümpel lag etliche Fuß hoch, und hier und da war eine Mütze oder Jacke obenauf. Mitten in der Menge, die um das Wrack stand, gab es Männer mit Karren, die geschäftig jenen Seetang sammelten, den der Sturm aufgeworfen hatte, und ihn fortschafften, jenseits der Flutlinie, wenngleich sie oftmals Kleidungsfetzen herauslösen mussten und jeden Moment eine Leiche darunter hätten finden können. Ertrinke wer da wolle, sie vergaßen nicht, dass dieser Tang ein wertvoller Dünger war. Dieser Schiffbruch hatte keine sichtbare Erschütterung im Gefüge der Gesellschaft hervorgerufen.
Etwa eine Meile südlich konnten wir die Masten der britischen Brigg über die Felsen ragen sehen, der die St. John zu folgen bestrebt gewesen war. Sie hatte ihre Ankertaue heruntergelassen und war, mit viel Glück, in die Hafenmündung von Cohasset eingelaufen. Ein wenig weiter die Küste entlang sahen wir die Kleidung eines Mannes auf einem Felsen; und weiter weg einen Frauenschal, ein Damenkleid, eine Strohmütze, die Kombüse der Brigg und einen ihrer hohen und langen Masten in einzelne Teile zerlegt. In einer anderen steinigen Bucht, einige Ruten entfernt vom Wasser und hinter zwanzig Fuß hohen Felsen, lag ein noch immer zusammenhängendes Stück einer Schiffsseite. Es hatte vielleicht eine Länge von vierzig und eine Breite von vierzehn Fuß. Ich staunte noch mehr über die Macht der Wogen, die an diesem zertrümmerten Fragment zur Schau gestellt wurde, als beim Anblick der kleineren Teile zuvor. Die größten Balken und eisernen Brassen hatte eine überschießende Kraft zerborsten, und ich verstand, dass kein Material der Macht der Wogen zu widerstehen vermochte; dass Eisen in solch einem Fall in Stücke gehen musste und ein eisernes Schiff an den Felsen aufbrechen würde wie eine Eierschale. Einige dieser Balken waren jedoch so morsch, dass ich fast meinen Schirm durch sie hindurchstoßen konnte. Man erzählte uns, dass einige Leute sich auf diesem Stück retten konnten, und zeigte uns auch, wo das Meer es in diese jetzt trockene Bucht hineingehoben hatte. Als ich sah, wo es hereingekommen war und in welcher Verfassung, wunderte ich mich, dass überhaupt jemand darauf gerettet worden war. Etwas weiter entfernt war eine Menschenmenge um den Offizier der St. John versammelt, der dabei war, seine Geschichte zu erzählen. Er war ein schmächtig aussehender junger Mann, der vom Kapitän als dem Meister sprach, und er schien ein wenig aufgeregt. Er sagte, dass das Boot, als sie hineinsprangen, vollgelaufen sei, und da das Schiff schlingerte, das Gewicht des Wassers im Boot die Fangleine zum Reißen gebracht habe und sie derart getrennt worden seien. Woraufhin ein Mann fortging und sagte:
»Nun, ich finde, seine Geschichte klingt rechtschaffen. Sie verstehen, das Gewicht des Wassers im Boot hat die Fangleine zum Reißen gebracht. Ein Boot voller Wasser ist sehr schwer« – und so weiter, in einem lauten und unverschämt ernsthaften Ton, als ob er eine Wette am Laufen hätte, die davon abhing, aber keinerlei menschliches Interesse an der Sache.
Ein anderer, großer Mann stand unweit auf einem Felsen, schaute aufs Meer hinaus und kaute große Stücke Kautabaks, als wäre dies seine hartnäckigste Gewohnheit.
»Komm«, sagte ein anderer zu seinem Gefährten, »lass uns gehen. Wir haben alles gesehen. Es lohnt nicht, bis zum Begräbnis zu bleiben.«
Weiter entfernt sahen wir einen auf einem Felsen stehen, einen, wie man uns sagte, von denen, die gerettet wurden. Der Mann machte einen schlichten Eindruck, gekleidet in eine Jacke und ein graues Beinkleid, die Hände in den Taschen. Ich stellte ihm einige Fragen, die er beantwortete; doch schien er nicht geneigt, über die Sache zu sprechen, und ging bald fort. An seiner Seite stand einer der Männer vom Rettungsboot in einer Wachstuchjacke; er erzählte uns, wie sie sich zur Unterstützung der britischen Brigg aufgemacht und gedacht hatten, dass das Boot der St. John, das sie auf dem Weg passierten, ihre ganze Besatzung enthielt –, denn die Wellen verstellten ihnen die Sicht auf jene, die sich auf dem Schiff befanden, wenngleich sie manche hätten retten können, wenn sie nur gewusst hätten, dass dort noch Leute waren. Etwas weiter entfernt war die Flagge der St. John auf einem Felsen zum Trocknen ausgebreitet und an den Ecken mit Steinen beschwert. Dieser schwächliche, aber wesentliche und bedeutende Teil des Schiffes, der so lange dem Spiel der Winde ausgeliefert gewesen war, erreichte selbstverständlich die Küste. Ein oder zwei Häuser waren von diesen Felsen aus zu sehen, in denen einige der Überlebenden sich von dem Schock erholten, den ihre Körper und Seelen erlitten hatten. Keiner hatte damit gerechnet zu überleben.
Wir gingen weiter die Küste entlang bis zu einem Whitehead genannten Felssporn, damit wir mehr von den Cohasset-Felsen sehen könnten. In einer kleinen, knapp eine halbe Meile entfernt gelegenen Bucht waren ein alter Mann und sein Sohn mit einigen anderen dabei, den Seetang einzusammeln, welchen der fatale Sturm aufgeworfen hatte; sie gingen ihrem Geschäft so ruhig nach, als ob es niemals auf der Welt ein Wrack gegeben hätte, obwohl sie sich in Sichtweite des Grampus-Felsen befanden, an dem die St. John zerschellt war. Der alte Mann hatte gehört, dass es einen Schiffbruch gegeben habe, und er kannte die meisten Einzelheiten, aber er sagte, er sei nicht da oben gewesen, seit es passiert war. Der angeschwemmte Tang war es, der ihn am meisten beschäftigte, Felstang, Riementang und Seetang, wie er ihn nannte, den er zum Hof seiner Scheune karrte; und jene Leichen waren für ihn bloß andere Sorten Tang, welche die Flut aufgeworfen hatte, die aber für ihn keinen Nutzen hatten. Danach gelangten wir zu dem Rettungsboot im Hafen, das auf einen weiteren Notruf wartete – und am Nachmittag sahen wir in einiger Ferne den Trauerzug, an dessen Spitze der Kapitän mit den anderen Überlebenden ging.
Insgesamt war die Szene nicht so beeindruckend, wie ich es erwartet hätte. Wenn ich eine einzelne, an den Strand geschwemmte Leiche an einem einsamen Ort gefunden hätte, würde mich das stärker bewegt haben. Ich fühlte mehr mit den Winden und Wogen, als ob das Hin- und Herschleudern und Verstümmeln dieser armen menschlichen Körper an der Tagesordnung wäre. Wenn dies das Gesetz der Natur war, warum sollte man dann die Zeit mit Ehrfurcht und Mitleid verschwenden? Wenn der letzte Tag gekommen wäre, sollten wir nicht so sehr über die Trennung von Freunden oder die zunichte gemachten Erwartungen des Einzelnen nachdenken. Ich sah, dass Kadaver vervielfacht werden können wie auf einem Schlachtfeld, bis sie uns in keiner Weise mehr als Ausnahmen des allgemeinen Schicksals der Menschheit berühren. Nehmt alle Friedhöfe zusammen, sie bilden stets die Mehrheit. Es ist das Einzelne und das Persönliche, das nach unserem Mitgefühl verlangt. Ein Mensch vermag lediglich einer Bestattung beizuwohnen im Laufe seines Lebens, er kann lediglich einen Kadaver betrachten. Und doch sah ich, dass die Bewohner der Küste nicht wenig betroffen waren von diesem Ereignis. Sie würden hier viele Tage und Nächte darauf warten, dass das Meer seine Toten hergeben würde, und ihre Vorstellungen und ihr Mitgefühl würden an die Stelle der weit entfernten Trauernden treten, die bisher noch nichts von dem Wrack wussten. Viele Tage darauf wurde von jemandem, der am Strand entlangschlenderte, etwas Weißes gesichtet, das auf dem Wasser trieb. Man näherte sich in einem Boot, und es stellte sich als die Leiche einer Frau heraus, die in aufrechter Haltung hochgestiegen war und deren weiße Mütze vom Wind zurückgeweht wurde. Ich sah, dass selbst die Schönheit der Küste für manch einsamen Wanderer zerstört war, solange, bis er endlich begriff, dass ihre Schönheit durch Wracks wie dieses erhöht wurde und ihr dies sogar eine seltenere und erhabenere Schönheit verlieh.
Wozu sich um diese toten Körper scheren? Sie haben wahrlich keine Freunde außer den Würmern und Fischen. Ihre Besitzer waren zur Neuen Welt gekommen wie Kolumbus und die Pilger – sie waren eine Meile von der Küste entfernt; doch bevor sie sie erreichen konnten, wanderten sie in eine Welt, die noch neuer war als jene, von der Kolumbus geträumt hatte, allerdings eine, für deren Existenz wir glauben, dass es weit universellere und überzeugendere Beweise gibt – wenn sie von der Wissenschaft auch noch nicht entdeckt worden sind – als die, die Kolumbus für jene hatte; nicht bloß Seemannsgeschichten und ein wenig dürftiges Treibholz und Seetang, uns treibt ein beständiger Instinkt an diese unsere Küsten. Ich sah die leeren Rümpfe, die an Land kamen; aber sie selbst hatte es in der Zwischenzeit an eine Küste viel weiter im Westen geworfen, an die es uns alle zieht und die wir letzten Endes erreichen werden, sei es auch durch Sturm und Finsternis wie jene. Kein Zweifel, wir haben allen Grund, Gott zu danken, dass sie der »Schiffbruch nicht wieder zurück ins Leben trieb«. Der Seemann, der im sichersten Hafen im Himmel anlegt, mag nach Ansicht seiner Freunde auf Erden Schiffbruch erlitten haben, da sie den Hafen von Boston als den besseren Ort erachten; wenn auch vielleicht für sie unsichtbar, begegnet ihm ein geschickter Lotse, und die schönsten und mildesten Winde blasen von jener Küste her, es geht sein braves Schiff an Land in glücklichen Tagen, und er küsst verzückt das Meeresufer dort, während sein alter Rumpf in der Brandung hier emporgeworfen wird. Es ist schwer, sich von seinem Körper zu trennen, aber zweifelsohne ist es leicht genug, ohne ihn zurechtzukommen, wenn er einmal fort ist. All ihre Pläne und Hoffnungen zerplatzen wie eine Blase! Kinder wurden in Massen durch den erzürnten Atlantischen Ozean an den Felsen zerschmettert! Nein, nein! Wenn die St. John nicht hier anlegen konnte, dann wurde ihr von dort telegrafiert. Der stärkste Wind vermag einen Geist nicht ins Wanken zu bringen; es ist der Hauch eines Geistes. Die Bestimmung eines gerechten Mannes kann an keinem Grampus- oder anderen steinernen Felsen zerschellen, vielmehr wird sie selbst Felsen spalten, bis sie ihr Ziel erreicht.
Die an den im Sterben liegenden Kolumbus gerichteten Verse mögen, mit geringfügigen Änderungen, auf die Passagiere der St. John angewendet werden: –
»Alsbald wird alles aus sein mit ihnen,
Alsbald wird die Reise anheben,
Auf der sie entdecken werden
Ein weit entferntes, unbekanntes Land.
Land, das jeder nur allein aufsuchen kann,
Das keine Kunde gibt den Menschen;
Denn kein Seefahrer, der einst aufgebrochen,
Ist je zurückgekehrt.
Kein geschnitztes Holz und kein geknickter Zweig
Treibt je aus dieser fernen Wildnis her;
Wer sich auf jenes Meer begibt,
Begegnet nicht dem Leichnam eines Engelskinds.
Unverzagt, ihr edlen Seeleut’,
Breitet, breitet alsdann euer Segel aus;
Geister! Selig durch den blauen Äther
Sollt ihr bald gleiten dahin!
Wo kein Lot die Tiefe ausmisst,
Fürchtet nicht verborgene Brandungswellen,
Und der fächelnde Engelsflügel
Soll eure Barke grad’ nach vorne treiben.
Lasst nun, mutig und getröstet,
Die rauen Küsten hier, die der Erde sind;
Da, wo die rosigen Wolken sich öffnen,
Tauchen schon die Inseln der Glückseligen auf.«8
Zu einem späteren Zeitpunkt ging ich an einem Sommertag zu Fuß von Boston aus auf diesem Weg entlang der Küste. Es war so warm, dass manche Pferde wegen der Brise ganz nach oben auf die Schutzwälle der alten Festung von Hull geklettert waren, wo es kaum Platz gab, sich umzudrehen. Die Datura stramonium, der Gemeine Stechapfel, stand in voller Blüte entlang des Strandes; und beim Anblick dieses Kosmopoliten – dieses Kapitän Cook9 unter den Pflanzen –, der als Ballast über die ganze Welt verbreitet wurde, hatte ich das Gefühl, als ob ich mich auf der Landstraße der Nationen befände. Sagen wir lieber, dieser Wikinger, König der Buchten, denn es ist keine unschädliche Pflanze; sie verweist nicht nur auf den Handel, sondern auf die dazugehörenden Laster, als ob seine Fasern der Stoff wären, aus dem Piraten ihr Seemannsgarn spinnen. Ich hörte die Stimmen von Männern, die an Bord eines Schiffes herumschrien, eine halbe Meile von der Küste entfernt; sie klangen, als wären sie in einer Scheune auf dem Land, befanden sie sich doch zwischen den Segeln. Es war ein rein ländlicher Klang. Als ich über das Wasser blickte, sah ich die Inseln rasch dahinschwinden, sah, wie das Meer unersättlich am Kontinent nagte, wie der vorspringende Bogen eines Hügels plötzlich unterbrochen wurde, ähnlich der Landspitze von Alderton10 – was Botaniker wie abgebissen nennen mögen –, und die Kurve, die er gegen den Himmel zeichnete, zeigte, wie viel Raum er eingenommen haben musste, dort, wo jetzt nur noch Wasser war. Andererseits waren diese Insel-Wracks fantasiereich zu neuen Küsten angeordnet worden, wie bei der Insel Hog mitten in Hull, wo alles sanft in die Zukunft zu entgleiten schien. Diese Insel hatte genau die Form einer kleinen Welle – und ich dachte, dass die Bewohner als Wappen auf ihren Schildern eine kleine Welle tragen sollten, eine Woge, die sie überkommt, und eine auf dem Wellenkamm sprießende Datura, von der es heißt, sie rufe eine Geisteskrankheit von langer Dauer hervor, ohne die körperliche Gesundheit zu beeinträchtigen.* Das Interessanteste, wovon ich in dieser Gemeinde von Hull hörte, war eine unversiegbare Quelle, auf deren Ursprung am Hang eines entfernten Hügels ich hingewiesen wurde, als ich die Küste entlangkeuchte, wenngleich ich ihn nicht aufsuchte. Sollte ich einmal durch Rom gehen, so wäre es vielleicht eine Quelle auf dem Hügel des Kapitols, an die ich mich am längsten erinnern würde. Es ist auch wahr, dass ich recht interessiert war an dem Brunnen an der alten französischen Festung, von dem es hieß, er sei neunzig Fuß tief, mit einer Kanone auf seinem Grund. Am Strand von Nantasket zählte ich ein Dutzend Einspänner, die zum Gasthaus gehörten. Von Zeit zu Zeit wendeten die Kutscher ihre Pferde zum Meer hin, wo sie der Kühlung wegen im Wasser standen – und ich sah, welchen Wert Strände für Städte wegen der Meeresbrise und dem Bad hatten.
In der Ortschaft Jerusalem waren die Bewohner vor dem Herannahen eines Gewitterregens eifrig damit beschäftigt, das Irische Moos aufzusammeln, das sie zum Trocknen ausgebreitet hatten. Der Schauer zog auf einer Seite vorüber, und ich bekam nur ein paar Tropfen ab, die die Luft nicht abkühlten. Ich fühlte lediglich einen leichten Windstoß an meiner Wange, und doch kenterte in Sichtweite ein Schiff im Hafen, und einige andere zerrten an ihren Ankern und waren knapp davor, an die Küste gespült zu werden. Das Baden im Meer an den Felsen von Cohasset war vorzüglich. Das Wasser war reiner und durchsichtiger als jedes andere, das ich bislang gesehen hatte. Es gab keinerlei Teilchen von Matsch oder Schlamm. Da der Grund sandig war, konnte ich den Amerikanischen Flussbarsch herumschwimmen sehen. Die glatten, wunderbar ausgewaschenen Felsen und die vollkommen sauberen und wie geflochtenen Felsgräser, die über meinem Kopf auf einen herabfielen und so fest am Fels hafteten, dass man sich an ihnen hochziehen konnte, erhöhten das Wohlgefühl des Bades ungemein. Der Streifen von Seepocken11, die genau oberhalb der Gräser lagen, erinnerte mich an eine Art pflanzlichen Bewuchs – an Knospen und Blütenblätter und Samenkapseln von Blumen. Sie lagen entlang der Gesteinsspalten der Felsen wie Knöpfe auf einer Weste. Es war einer der heißesten Tage des Jahres, und doch empfand ich das Wasser als so eisig kalt, dass ich nur einen oder zwei Schwimmstöße machen konnte, und ich dachte, dass bei einem Schiffbruch die Gefahr, durch Kälte zu Tode zu kommen, größer wäre als die des Ertrinkens. Ein Tauchbad reichte aus, um die Hundstage voll und ganz vergessen zu machen. Auch wenn man vorher verschmachtete, bedurfte es jetzt einer halben Stunde, um sich daran zu erinnern, dass es jemals warm gewesen war. Da waren die gelbbraunen Felsen, gleich schlafenden Löwen, die dem Ozean trotzten, dessen Wogen unablässig gegen sie schlugen und sie mit gehörigen Mengen Kies abschabten. Das in ihren kleinen Höhlungen beim Zurückweichen der Flut aufgefangene Wasser war so kristallklar, dass ich es nicht für salzig halten konnte, aber danach verlangte, es zu trinken; und weiter oben gab es Bodensenken mit frischem Wasser, das der Regen hinterlassen hatte – welche allesamt, auch bei unterschiedlicher Tiefe und Temperatur, zu verschiedenen Arten von Bädern einluden. Überdies formten die größeren Höhlungen in den geglätteten Felsen die angenehmsten Sitzplätze und Umkleideräume. In dieser Hinsicht war es das vollkommenste Meeresufer, das ich je gesehen hatte.
In Cohasset sah ich, lediglich durch einen schmalen Strand vom Meer getrennt, einen schönen, aber flachen See von etwa vierhundert Morgen. Wie mir gesagt wurde, hatte das Meer ihn bei einem heftigen Sturm im Frühling über den Strand geschleudert, und nachdem die Großaugenheringe hineingeschwommen waren, hatte sich seine Abflussöffnung verstopft, und jetzt starben die Großaugenheringe zu Tausenden, und die Bewohner befürchteten eine Seuche, da das Wasser langsam verdunstete. Es befanden sich fünf Felsinselchen darin.
Diese steinige Küste heißt auf manchen Karten »Pleasant Cove«; auf der Karte von Cohasset scheint der Name auf jene Felsenbucht beschränkt, wo ich das Wrack der St. John sah. Der Ozean sah jetzt nicht so aus, als ob jemals einer Schiffbruch darin erlitten hätte; er war nicht mächtig und erhaben, sondern wunderschön wie ein See. Kein Überbleibsel eines Wracks war sichtbar, auch konnte ich nicht glauben, dass die Knochen zahlreicher Schiffbrüchiger in diesem reinen Sand begraben waren. Nun aber weiter zu unserer ersten Exkursion.
Anmerkungen
1Thoreaus Gefährte war sein Freund Ellery Channing, der, zusammen mit Thoreaus Schwester Sophia, dieses Buch zur Veröffentlichung nach Thoreaus Tod edierte.
2Der ununterbrochene Strandabschnitt vom Norden der Biegung bis zum Ende des Kaps ist heute der Nationalpark »Cape Cod National Seashore« und etwa 40 km lang.
3Eine Anspielung auf Ralph Waldo Emersons Vorlesungsreihe über »Menschliche Kultur« aus dem Jahr 1838.
4Bartholomew Gosnold (1572–1607), englischer Forscher, segelte 1602 mit der Concord nach Neuengland. Er gab Kap Cod und Martha’s Vineyard (nach seiner Tochter) ihre Namen.
5Die St. John verließ Irland am 7. September 1849. Am 7. November trieb ein heftiger Sturm sie auf die felsige Küste südöstlich von Boston zu. Die genaue Zahl der Opfer ist unbekannt, es dürften aber etwa hundert gewesen sein.
6Eine Rute sind etwa 5 Meter.
7William Kidd (vermutlich 1645–1701), schottischer Freibeuter
8Der Text stammt von dem dänischen Dichter Adam Gottlob Oehlenschläger (1779–1850) und lag Thoreau in einer Übersetzung von W. H. Furness vor, die 1845 in The Gift publiziert wurde.
9Kapitän James Cook (1728–1779), britischer Seefahrer und Forscher, umsegelte zweimal die Welt.
10Die Spitze am Eingang zum Hafen von Boston.
11Seepocken gehören zur Ordnung der Rankenfußkrebse. Es handelt sich um sesshafte Tiere, im ausgewachsenen Zustand können sie ihren Aufenthaltsort nicht mehr wechseln. Äußerlich sichtbar sind lediglich kleine weißliche Kegel, ihre Arme, Beine und Scheren sind zu Rankenfüßen umgebildet.
II
Beobachtungen aus der Postkutsche
Nachdem wir die Nacht in Bridgewater verbracht und dort am Morgen noch ein paar Pfeilspitzen eingesammelt hatten, nahmen wir den Zug nach Sandwich, wo wir vor Mittag ankamen. Dies war die Endstation der Eisenbahnstrecke,1 obgleich es erst der Anfang des Kaps ist. Da es heftig regnete, mit dahinziehenden Nebelfeldern, und keinerlei Anzeichen gab, dass es aufhören würde, nahmen wir hier jenes nahezu veraltete Beförderungsmittel, die Postkutsche, nach »soweit sie an diesem Tage fährt«, wie wir dem Kutscher mitteilten. Wir hatten vergessen, wie weit eine Postkutsche an einem Tag fahren konnte, aber man sagte uns, dass die Straßen des Kaps sehr »schwierig« seien, fügte jedoch hinzu, dass sie aus Sand bestünden und bei Regen besser würden. Diese Kutsche war äußerst eng, aber weil das Rund eines Sitzes fast für zwei Personen bemessen war, wartete der Kutscher, bis neun Fahrgäste eingestiegen waren, ohne bei irgendeinem Maß genommen zu haben, und schloss dann die Tür nach zwei- oder dreimaligem vergeblichem Zuknallen, als ob einzig die Angeln oder der Riegel schuld wären – während wir mit unseren Ein- und Ausatmungen die Zeit maßen, um ihn zu unterstützen.
Wir waren nun ganz und gar auf dem Kap, das von Sandwich aus fünfunddreißig Meilen nach Osten hin misst und von dort dreißig weitere nach Norden und Nord-Westen, alles in allem fünfundsechzig Meilen, und eine durchschnittliche Breite von fünf Meilen hat. Im Landesinneren steigt es bis zu einer Höhe von zweihundert, manchmal vielleicht dreihundert Fuß über dem Meeresspiegel an. Laut Hitchcock,2 dem Geologen des Staates, besteht es fast ausschließlich aus Sand, mancherorts sogar bis zu einer Tiefe von dreihundert Fuß, wenngleich es da wahrscheinlich knapp unter der Oberfläche einen felsigen Kern gibt; und es ist diluvialen Ursprungs,3 mit Ausnahme eines kleinen Teils an der Spitze und an anderen Uferstellen, welcher alluvial4 ist. Auf der ersten Hälfte des Kaps mischen sich hier und da große Steinblöcke mit dem Sand, auf den letzten dreißig Meilen aber trifft man kaum mehr auf Felsbrocken oder selbst Kies. Hitchcock mutmaßt, dass der Ozean im Lauf der Zeiten den Hafen von Boston und andere Buchten aus dem Festland herausgefressen hat und die kleinen Bruchstücke von der Strömung in einiger Entfernung von der Küste abgelagert wurden und diese Sandbank bildeten. Wenn die Oberfläche landwirtschaftlichen Überprüfungen unterzogen wird, findet sich über dem Sand eine dünne Schicht Erde, die von Barnstable bis nach Truro langsam abnimmt und hier schließlich aufhört; doch gibt es viele Löcher und Risse in diesem wettergegerbten Gewand, die gewiss nicht so bald gestopft werden; sie zeigen das nackte Fleisch des Kaps, und seine Spitze ist völlig nackt.
Ich zog sofort mein Buch hervor, den achten Band der Sammlungen der Historischen Gesellschaft von Massachusetts5 aus dem Jahr 1802, welcher einige kurze Bemerkungen zu den Städten des Kaps enthält, und begann, lesend die Strecke bis zu unserem jetzigen Aufenthaltsort nachzuholen, denn in den Eisenbahnwaggons hatte ich nicht so schnell lesen können, wie ich reiste. Denjenigen, die von der Seite von Plymouth herkamen, sagte das Buch: »Nach einem Ritt durch ein mit nur wenigen Häusern durchsetztes Waldstück von etwa zwölf Meilen taucht, ein weit angenehmerer Anblick, vor dem Auge des Reisenden die Siedlung von Sandwich auf.« Ein anderer Autor spricht von ihr als einem wunderschönen Dorf. Ich denke aber, dass unsere Dörfer nur miteinander verglichen werden können, und nicht mit der Natur. Ich hege keinen großen Respekt für den Geschmack des Autors, der leichthin von wunderschönen Dörfern redet, die womöglich mit einer »Walkmühle«, »einer stattlichen Akademie« oder einem Gemeindehaus und »einer Anzahl von Geschäften für verschiedene handwerkliche Künste« geschmückt werden; wo die grünen und weißen Häuser der wohlhabenden Bürger in Reihen aufgestellt zu einer Straße hin zeigen, von der man schwerlich sagen könnte, ob sie eher einer Wüste oder einem Stallhof gleicht. Solche Orte können nur wunderschön sein für den ermüdeten Reisenden oder den zurückkehrenden Einheimischen – oder vielleicht für den reuigen Menschenfeind; nicht aber für den, der mit unvoreingenommenen Sinnen soeben aus den Wäldern getreten ist und sich einem von ihnen über eine kahle Straße nähert, durch eine Abfolge von verstreut liegenden Häusern, von denen er nicht sagen kann, welches denn das Armenhaus sei. Was allerdings Sandwich betrifft, so kann ich nichts Besonderes sagen. Das unsere war höchstens ein halbes Sandwich, und das war wohl irgendwann auf die gebutterte Seite gefallen. Ich sah nur, dass es für eine Kleinstadt dicht bebaut war, mit Glaswerken, um seinen Sand zu verbessern, und mit engen Straßen, auf denen wir solange im Kreis fuhren, bis wir nicht mehr sagen konnten, in welche Richtung wir unterwegs waren; der Regen drang zuerst auf dieser, dann auf jener Seite ein, und ich sah, dass die in den Häusern es bequemer hatten als wir in der Kutsche. Mein Buch sagte auch über diese Stadt: »Die Einwohner leben im allgemeinen ein solides Leben« – das heißt, nehme ich an, dass sie nicht wie Philosophen leben: Doch da die Kutsche nicht lange genug haltmachte, um essen zu gehen, hatten wir keine Gelegenheit, die Richtigkeit dieser Behauptung zu überprüfen. Sie mag sich allerdings auf die Menge »an Öl, das sie aus Algen gewannen«, bezogen haben. Im Buch hieß es weiter: »Die Einwohner von Sandwich legen zumeist eine liebevolle und ausdauernde Nachahmung des Verhaltens, der Tätigkeiten und Lebensweisen ihrer Väter an den Tag«, was mich auf den Gedanken brachte, dass sie, letzten Endes, dem ganzen Rest der Welt ziemlich ähnlich waren – und es wurde hinzugefügt, dass diese »Ähnlichkeit ihnen bis auf den heutigen Tag keine Anklage, weder bezüglich ihrer Tugend noch ihres Geschmacks, eingebracht hat«: eine Bemerkung, die für mich als Beweis dafür gelten kann, dass der Autor mit ihnen unter einer Decke steckte. Kein Volk hat je gelebt, indem es seine Väter verfluchte, und mögen seine Väter auch der größte Fluch gewesen sein. Man muss aber einräumen, dass unser Autor eine alte Autorität war, und sie wahrscheinlich heute alles geändert haben.