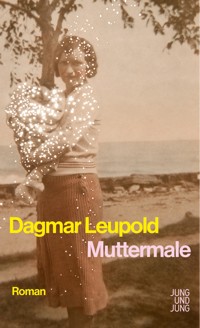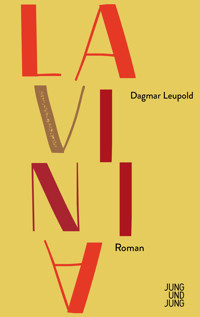Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jung u. Jung
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Witwe ist keine der vier Frauen, von denen hier erzählt wird. Dazu wären sie vielleicht auch noch zu jung. Aber zu Witwen fehlen ihnen vor allem die Männer. Nur die eine, Penny, war verheiratet. Ist verheiratet? Der Mann ist verschwunden, und so lebt sie mit Sohn und Schwiegereltern abgelegen am Moselstrand zwischen Weinbergen. Nicht allein, ihre drei Freundinnen (Beatrice, Dodo und Laura) sind ihr von Berlin in die Provinz gefolgt. Die vier haben sich gut eingerichtet, jede für sich, im Leben, im Warten. Aber worauf? Also beschließen sie eines Tages, große Fahrt zu machen, aufzubrechen. Sie mieten sich einen Wagen und suchen per Anzeige jemanden, der sie fährt. Wohin? An die Quelle, an den Ursprung, zurück. Dass sie unterwegs dahin eine Panne haben, wird zu unserem Glück. Und zum Glück ihres Chauffeurs, der auch etwas vermisst, nur nicht das, was er zurückgelassen hat: Zierfische mit den Namen von Philosophen. Die vier beginnen zu erzählen, ihm, den anderen, sich selbst, und sie erzählen wie im Rausch: herzzerreißend, vergnüglich und vergnügt, doch ungeschminkt ehrlich und schonungslos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Witwen
Die Autorin dankt dem Deutschen Literaturfonds e.V. für die Förderung dieses Romans
© 2016 Jung und Jung, Salzburg und Wien Umschlagbild: © Aleksey Kondakov »Train« Alle Rechte vorbehalten ISBN 978-3-99027-088-2 eISBN 978-3-99027-151-3
DAGMAR LEUPOLD
Die Witwen
Ein Abenteuerroman
dem Stein, dem Wasser
ABWESENHEIT
O wie sehn’ ich mich so bang hinaus wieder in das dumpfe Flutgebraus! möchte immer auf den wilden Meeren einsam nur mit deinem Bild verkehren! Nikolaus Lenau, Wandel der Sehnsucht
Steinbronn ruht, innig umschlossen, zwischen zwei Moselarmen, die sich um den Ort herum zur Schleife runden. Die Weinberge stürzen hier ab wie eine stürmische Zusage. Das Wort »lieblich« liegt dennoch prompt auf den Zungen all derer zum Ausruf bereit, die sich Steinbronn erholungsentschlossen nähern. Der Himmel wirft das lebenssatte Grün des Weinlaubs zurück – keine andere Gegend kann das bieten: einen Himmel, der grünt. In einem solchen buchstäblich von allen Seiten umfassten Ort einsam zu sein, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit – und doch gelang es vier Frauen, nicht mehr jung, aber längst nicht alt. Nur ratlos. Und irgendwie übrig.
Eine echte Witwe war nicht einmal Penny, aber sie war immerhin die einzige Verheiratete unter den vieren und damit rechtmäßige Anwärterin auf zukünftige Witwenschaft. Ihr Mann war von einer Dienstreise nach Fernost nicht zurückgekehrt. Mittlerweile – nach acht Jahren – waren die Fragen, warum sie nichts unternehme, ihn zu finden, spärlicher geworden. Penny hatte sich geweigert, ihn für tot erklären zu lassen. »Er lebt«, sagte sie und richtete ihren Blick auf einen Punkt in der Ferne, als empfange sie von dort den sicheren Hinweis. Seinen Namen nannte sie nie. Sie hatte in den vergangenen acht Jahren die Wäsche im Doppelbett einmal im Monat gewechselt, auf beiden Seiten. Sie lag auf der linken, weit entfernt vom Brandfleck im Holzrahmen, den eine ausglühende Zigarette hinterlassen hatte, kreisrund wie ein Fingerabdruck. Die Zeit, die ihr durch die Abwesenheit ihres Mannes zuwuchs, nutzte sie halbherzig für einige Kurse an der Volkshochschule: Polnisch, Webtechniken, Stepptanz (eine einzige Havarie) und, wegen der günstigen Kurstage, Kohlenhydratarm Kochen und trotzdem satt werden. Die anderen drei Frauen, Dodo, Beatrice und Laura, fühlten sich nur wie Witwen. Nicht Männer waren ihnen abhandengekommen, sondern die Zuversicht oder die Verwegenheit oder die Fantasie.
Sie kannten einander seit ihrer Einschulung; ein Foto, das alle vier in Ehren hielten, zeigte sie mit spitzen Schultüten, Zahnlücken und Faltenröcken. Volksschule 44, Berlin Tiergarten. Dodo, schon damals die Rundeste von ihnen, stemmte die Beine derart störrisch in den Boden, dass der Betrachter nicht umhinkam zu begreifen, wie entschlossen sie war, sich dem Schuldienst zu verweigern. Die damals sehr zarte Beatrice hatte aus demselben Grund ein verheultes Gesicht, und Laura lächelte bezaubernd, weil sie es liebte, fotografiert oder, überhaupt, angeschaut zu werden. Dem jeweiligen Blick folgten seit jeher und prompt Komplimente zum blonden Haar, dem feinen Profil – ein Liebhaber in späteren Jahren hatte sie einmal »Grace Kelly reloaded« genannt, und sie war, trotz ihrer Angst, idiotische Bemerkungen nicht umgehend als solche zu erkennen und zurückzuweisen, dem Vergleich geschmeichelt erlegen. Schließlich Penny, die ernst, aber gefasst die Kamera fixierte und ihre Schultüte wie ein Schild vor den Brustkorb hielt.
Fünfundzwanzig Jahre nach Entstehung dieses Fotos war als Erste Penny nach Steinbronn, Sitz des Weinguts ihres Mannes, gezogen; »vor Liebe«, wie sie Dodo anvertraute, »halb besinnungslos«. Es sei ihr vorgekommen, als hätten auch ihre Muskeln jeden Tonus verloren, eine Gliederpuppe sei in Steinbronn gelandet, eine Gliederpuppe mit vor Erwartung geblähtem Herzen. Ihr Mann Otto war Winzer in der fünften Generation. Oder mehr. Penny fürchtete sich vor Dynastien und dachte doch manchmal mit wehmütiger Befriedigung, dass der Steinbronner Bock, ein Riesling, mittlerweile in neuer Erde, vermutlich Japan, gedieh und dort bei seinen Verkostern diesen besonderen Rausch erzeugte, der am Anfang ihrer Ehe stand. Otto verfügte über ein zuversichtliches Lächeln und einen hellbraunen Haarschopf, der zwischen den Rebstöcken leuchtete, zuverlässig wie ein Kompass, ein Kompass, dessen Nadel hartnäckig den Süden anzeigte. Penny, eigentlich Lehrerin für Deutsch und Geschichte, saß im neuen Steinbronner Heim in der großen Wohnküche des Hinterhauses – nach vorne lag das Wirtshaus Zum Rebstock –, die Hände im Schoß, die Schritte der Schwiegermutter über ihr. Irgendwann würden das junge und das alte Paar die Stockwerke tauschen, der Treppen wegen. Und wartete. Vielleicht auf Kinder, aber eigentlich empfand sie das Warten als in sich ruhende, auf sich selbst gerichtete Tätigkeit. Es ging ihr damit gar nicht schlecht. Und das Kind kam ja auch. Zwar nicht nach neun oder zwölf oder vierundzwanzig Monaten, sondern erst nach vierzig, aber das Warten hatte schließlich nichts mit Zählen zu tun, sondern war eine Verfassung. Wie jeder Sohn dieser ausgreifenden Winzerfamilie wurde auch Berthold mit einem Tropfen Steinbronner Bock begrüßt. Den Penny ihm von den Lippen küsste, als sie sah, wie sich sein ohnehin runzliges Gesichtchen vor saurem Schreck noch mehr verzog.
Als Zweite zog Dodo nach Steinbronn und übernahm dort eine Gärtnerei für einen Spottpreis, den Preis nämlich, den sie als Ablöse für ihren Berliner Schrebergarten zäh erhandelt hatte. Schließlich folgten Beatrice und zuletzt Laura, Yogalehrerin und Feldenkraistherapeutin die eine, Maskenbildnerin die andere. In Steinbronn gab es niemanden, der professionell geschminkt oder auf eine Rolle vorbereitet werden wollte oder musste, also ließ sich Laura zur Logopädin umschulen und überraschte die stolzen Mütter von Steinbronn mit unbarmherzigen Instantdiagnosen, deren Kinder betreffend: Lispeln, Redeflussstörungen, inkorrekte Lautverwendung, gering ausgebildete Mundfunktionen. Stammeln und Stottern war ihr Spezialgebiet. Eigentlich hielt sie auch den Dialekt dieser reizenden Gegend, die mit nichts geizte, das Weichlich-Nachgiebige der Zischlaute, die verschliffenen R, für behandlungswürdig und physiologisch folgenreich, konnte sich mit ihrer Auffassung aber nicht durchsetzen. Ihr Haar wurde in den Steinbronner Jahren immer blonder; »Moselwein«, sagte sie und bestritt nachdrücklich, Aufheller zu benutzen.
In den ersten Jahren wurden sie von eingefleischten Steinbronnern immer wieder ungläubig befragt: »Aus Berlin nach Steinbronn?« Und das auch noch in den aufregendsten, den Wendejahren! Dodo antwortete trocken: »Eben, ich vertrage keine Aufregung. Und schon gar keine künstliche. So wenig wie meine Pflanzen Kunstdünger.« Beatrice brauchte Ruhe. Und gab unumwunden zu, dass die Erreichbarkeit der drei Freundinnen für sie wichtiger war als eine prominente Adresse. »Welche Innenräume wir uns schaffen, gibt den Ausschlag«, sagte sie und schaute lächelnd in die ratlosen Gesichter der Fragenden. Laura musste nichts begründen, weil allgemein und zu Unrecht angenommen wurde, sie wäre einem Mann gefolgt, wie Penny. Sie war froh, schweigen zu dürfen, denn sie hätte es nicht erklären können. Tiergarten war zum Rummelplatz verkommen, das ja. Und besonders anstrengend fand sie, ihr eher unspektakuläres Leben inmitten einer Stadt zu gestalten, die unisono zum spektakulärsten Schauplatz des ausgehenden Jahrhunderts ausgerufen wurde. Weder war sie Künstlerin – auch nicht Lebenskünstlerin –, noch wollte sie es sein. Penny schrieb begeisterte Briefe aus Steinbronn, der Fluss, das Licht, die Sonne – alles knapp bemessen in Berlin (auf Wasser bezogen stimmte das weniger, aber so genau wollten die Freundinnen es nicht nehmen) und hier, in Steinbronn, im Überfluss ausgeschüttet.
Ohneeinander konnten die vier nicht. Miteinander durchaus, aber nicht ohne kleinere oder größere Gefechte.
»Wir kennen uns schon so lang«, sagte Laura eines hochsommerlichen Frühlingstages, an dem die Luft stockte und der Fluss brütete. »Das halbe Leben haben wir nun schon an diesem Ort der schönen Verheißungen verbracht, aber wir haben kaum etwas erlebt, einfach immer nur gelebt. Lasst uns etwas erleben!«
Und Beatrice widersprach, nein, ums Erleben gehe es nicht. Erlebnisse ließen sich kaufen, vielleicht nicht in Steinbronn, aber bestellen könne man sie frei Haus und überall. Ob Laura das wolle?
»Meine Güte, Beatrice«, rief Dodo, »du machst aus allem eine halbe Vorlesung!«
Beatrice sprach sehr sanft, gestikulierte sparsam, von all ihren Feldenkraisschülern zählte sie selbst zu den begabtesten. Sie hatte an ihrer sensomotorischen Differenziertheit hart gearbeitet, gewissermaßen den schwarzen Gürtel in reifem Verhalten errungen. Das hatte sie mit dem von ihr glühend verehrten Moshé Feldenkrais gemeinsam – auch wenn es sich bei seinem schwarzen Gürtel um den eines Judoka handelte. Bewehrt, vielmehr zur Bewehrung aufgerufen fühlte sich Beatrice auch ohne Kampfsport. Oder genauer gesagt: Sie empfand das Leben als einen Kampfsport, für den man unausgesetzt trainierte. Und die meisten taten dies eben falsch; erst die richtigen Bewegungen schafften die Voraussetzung für diese Einsicht. Und die richtigen Bewegungen, in ihrem kräftigen, schlanken Körper längst zu Hause, wollte sie weitergeben wie eine Erzählung.
Ihre Kurse waren voll. Und wenn Beatrice in der Mitte des luftigen Therapieraums stand, die Matten um sie herum sternenförmig ausgebreitet, darauf die ausgestreckten Körper, atmend, beschwert von Lebensgeschichten, die nicht selbst geschrieben oder ungeschrieben geblieben waren, dann fühlte sie sich inmitten einer Gemeinde, die durch ihr, Beatrices abschließendes, wenn auch unausgesprochenes Amen erlöst werden konnte: Macht euch fest in mir, dann werdet ihr auch in euch gefestigt sein. Sie hatte nachgeschlagen und beglückt zur Kenntnis genommen, dass »Amen« von derselben Wurzel im Hebräischen kam – denn aus dem Hebräischen kam es –, von der auch die Worte für Zuversicht, Verlässlichkeit, Übung und Künstler sich ableiteten. Ihre eigene, Feldenkrais zu verdankende Lebenseinstellung kam darin also zum Ausdruck. Leitete sie nicht durch Verlässlichkeit und Übung zur Zuversicht an? Und war das nicht eine Kunst?
Von den drei Freundinnen hatte keine je auf einer der leuchtend blauen Matratzen gelegen und sich von Beatrice, worin auch immer, festigen lassen. Penny war im Wirtshaus unabkömmlich (und belegte unter Umständen einige Kurse an der Volkshochschule, auch um Beatrice gegenüber triftige Gründe für ihre Nichtteilnahme anführen zu können). Laura sah sich selbst mehr als Wohltäterin denn als Wohltatenempfängerin. Und Dodo sagte resolut, ihr ginge es dann gut, wenn ihre Hände in feuchter schwarzer Erde verschwänden, das sei an unbezweifelbarem Kontakt zur Welt genug. »Und Männer«, fügte sie an, »Männer lassen sich bei dir ja ohnehin nicht blicken.«
Das stimmte. Fast. Vor Jahren war einmal ein Ehepaar gekommen, hatte sich die Matratzen, die voneinander am weitesten entfernt lagen, ausgesucht und keinen Termin versäumt. Aber der Mann ließ sich von Beatrice nicht segnen, also festigen, wie sie es verstand, sondern blieb geduckt und zu Blickwechseln unfähig. Im Liegen hielt er die Augen geschlossen, bei der Ankunft dagegen richtete er den Blick auf irgendeine Zukunft, die jenseits des Raums und jenseits von Beatrices ausgestreckter Hand und dem dazugehörigen Gesichtsausdruck, entschlossenes Erbarmen, lag. Ihn durfte sie nicht zu den Geretteten zählen.
Aber Bendix.
Er kam seit einigen Wochen und hatte nüchtern die Gründe aufgezählt, die ihn zu ihr führten: ein schwerer Unfall, bei dem beide Beine mehrfach gebrochen waren, monatelange Immobilisierung in Krankenhäusern, eintretende Steife. Er hinke den ganzen Vormittag, so lange, bis sich sein Blut endlich bequemte, auch die Außenbezirke zu versorgen. Das alles hatte er stotternd hervorgebracht; seit dem Unfall stockten nicht nur die Bewegungsabläufe, sondern auch der Sprachfluss. Zu seinem auffälligen Namen befragt, hatte er knapp erwidert: »Kurzform von Benedikt, der Gebenedeite, gesegnet bin ich also schon.« Zunächst hatte Beatrice ihm dies als Feindseligkeit ausgelegt, sehr bald aber verstanden, dass er der Einzige war, der genau erfasst hatte, was sie tat: nämlich Gemeindepflegerin des Zusammenhalts, Stimmgabel für den richtigen inneren Ton zu sein. Und, in den seltensten Momenten, ein Lamm Gottes, eine Priesterin, die auf sich nahm, was die Gebeugten zu ihren Füßen mitbrachten und auf den leuchtend blauen Matratzen zurückließen. Beatrice ahnte, wie anmaßend und verrückt eine solche Selbstwahrnehmung war, und behielt sie strikt für sich. Aber so empfand sie. Bendix war groß und setzte seine nicht minder großen Füße mit Bedacht und leichter Innenstellung auf den unsicheren Boden (als den sie beide das Steinbronner und jedes andere Pflaster betrachteten). Er trug sein lockiges Haar unmodern lang und verdeckte seine Oberlippe zu Beatrices Bedauern mit einem Seehundschnäuzer. Beim Sprechen glättete er ihn links und rechts des Mundes in Bahnen; möglicherweise, dachte sie, bereitete er so den Worten einen Ausweg. Wie alle anderen auch verstaute er seine Sachen in einem der kleinen Spinde, die Beatrice für ihre Klienten angeschafft hatte. Die Brille mit den großen tropfenförmigen Gläsern, den Schal mit klassischem Burberry-Karo, die glänzend gewichsten dunkelbraunen Halbschuhe, die Uhr mit dem mürben Lederarmband, innen dunkel verfärbt vom Schweiß, von aufgesogener Zeit, wie Beatrice, der keine dieser Einzelheiten entging, für ihre Verhältnisse ungewöhnlich poetisch befand. All dies tat er mit einer Sorgfalt, die sie wegen des hilflosen, blinden Ausdrucks in seinem brillenlosen Gesicht so anrührte, dass sie sich manchmal abwenden musste. Und ohne dass sie Dodo auf ihre spitze Bemerkung hin – über diese Schwelle treten sicher nur Frauen – je verriet, dass sich sehr wohl ein Mann bei ihr hatte blicken lassen.
Dodo bekämpfte ihre Kreuzschmerzen – unausweichlich bei einer Arbeit, die zum größeren Teil in gebückter Haltung vonstattenging, umgraben, setzen, zupfen, rupfen, schneiden und stutzen – mit Mitteln, die Beatrice nicht gutgeheißen hätte, aber ausgesprochen nahelagen. Mit dem Saft der Trauben nämlich, die sich auf den Steilhängen ausgiebig gesonnt hatten und wie kleine hochexplosive Granaten auf der Zunge lagen, wenn man sie auf einem frühherbstlichen Spaziergang von einem der unteren Rebstöcke pflückte. Schöner Mundraub, dachte Dodo und fühlte sich geküsst. Jeden Morgen drehte sie mit ihrem Hund Zwiebel – »er ist so vielschichtig«, war ihre Erklärung für die Namensgebung – eine Runde durch ihr Grundstück, begrüßte die Rabatten, die Setzlinge, zählte Triebe und Knospen, klemmte die drahtigen, dicken Haare mit entschlossener Geste hinter die Ohren, damit sie ihr beim Bücken und Inspizieren nicht im Weg waren. Dodo amüsierte die Freundinnen mit ihrem kindlichen Stolz auf ihr schmales Becken – wie bei einem jungen Mann –, das sie trotz ihres stämmigen Körperbaus hatte und der Grund für ihre Kinderlosigkeit war: »Zu schmal zum Gebären, dafür gedeiht alles andere bei mir«, ausholende Armbewegung, die noch den Horizont einschloss. Die abendliche Inspektion dagegen fand im Sitzen statt, auf der Westseite des Hauses, mit einem Glas Wein, das sie auf die Kreatur erhob, die ihr gerade am nächsten war: eine der Freundinnen, Zwiebel oder ein Regenwurm, der ihr half den schweren Boden zu belüften, in dem sich Wurzeln zu einem Wachstum in einer Pracht rüsteten, die sie nicht aufhören konnte zu bestaunen. Sie färbte ihr Haar mit Henna, »Rembrandt-Rot« nannte sie das Ergebnis, und in der Tat leuchtete es im Abendlicht wie ein Helm aus Kupfer. Wenn Dodos Blick von der Kuppe des Weinbergs der Familie Rohme – der Schwiegerfamilie Pennys – über das unter ihr liegende Steinbronn schweifte, dachte sie keineswegs, dass es von zärtlichen Moselarmen umschlossen werde, sondern vielmehr darin erschlafft sei. Stranguliert und abgemurkst. Ein Ort ohne Zugluft und ohne Bahnhof! Ihr Herz war groß genug, dem Widerspruch zwischen großstädtischer Verachtung für die Provinz – Berliner Luft! – und hingebungsvoller Widmung an noch das unscheinbarste Pflänzchen Steinbronns, seine Bewohner eingerechnet, ausreichend Platz zu bieten. Zwiebel war außerdem ein gebürtiger Steinbronner, und der Besitzer seiner Mutter, Lehrer an der Grundschule, hatte einige Jahre lang den Sitzplatz in der Abendsonne mit ihr geteilt. Dem Glas Wein, das sie gemeinsam tranken, waren kurze, hektische (»stürmische«, wie sich Dodo diese schönredete) Umarmungen vorausgegangen: in ihrem Bett, das die Ausmaße eines Frachtkahns hatte. Dodo schwor auf Beischlaf am Nachmittag; Akkus aufladen, wenn es noch nicht zu spät war, um von dem Energieschub etwas zu haben. Ihre Haut roch nach Erde und Sonnencreme, ihr fester Griff um die schmalen und im Gelenk ein wenig nachgiebigen Lehrerhüften hatte etwas erregend Dringliches; im erlösenden letzten Moment brach sie in ein Lachen aus, das er, sein Ohr an ihre Rippen gepresst, innen orgeln hören konnte. Das war ihm – solchen wie ihm – neu.
Nicht lange nachdem die Hündin geworfen hatte, verschwand Zwiebels Schwiegervater wieder aus Dodos Leben. Manchmal vermisste sie ihn und stellte ihr Glas dort ab, wo er, anfangs befangen und wie zum Absprung bereit, gesessen hatte. Sie behielt ihren Appetit und stillte ihn mal so, mal so. Dafür brauchte sie keine Theorie und keine Weltanschauung, nur Praxis. Und natürlich saßen an vielen Tagen auch die Freundinnen oder wenigstens eine von ihnen auf Dodos Bank, die Beine ausgestreckt, den Rücken an der warmen Hauswand. Talent zum Feierabend hatte Dodo, und sie spielte ihre Begabung gern aus: ein Schälchen mit speckumwickelten Pflaumen (für Laura, die das Mittagessen ausfallen ließ), ein geheiztes Kirschsteinnackenkissen (gegen Pennys Schulterschmerzen), ein Schuss Holundersirup (für Beatrice, damit der Steinbronner Bock sich nicht zu wild gebärdete).
Vor Jahren hatten die vier eine Initiative zur Umbenennung der Hauptstraße gegründet, die zu Kirche und Marktplatz führte und Adolfstraße hieß. Adolfstraße! Sie vermuteten gar nicht, dass es mit demjenigen zu tun habe, der den Namen für alle Zeiten geschändet hatte, aber es rief ihn auf. Wer zum Bäcker ging, in die Stadtbücherei oder zum Drogeriemarkt, kam um Adolf nicht herum. Im Steinbronner Anzeiger wurde ein Foto der vier Freundinnen veröffentlicht, Unterschrift »Amazonenstammtisch«. Von Pennys sagenhaft langem Haar war die Rede (das seit Ottos Aufbruch gewachsen war und erst bei seiner Rückkehr auf Kinnlänge, also Normalnull, gekürzt werden würde), von Lauras Ähnlichkeit mit der jungen Grace Kelly und von Dodos männlich tiefer Stimme, typisch Berliner Schnauze. Kaum ein Wort zum Anlass der Ereiferung. Ein paar, gar nicht wenige, Steinbronner schlossen sich an, verhängten nachts die Straßenschilder und überpinselten sie mit Mainstreet. Alles in allem blieb die Initiative aber erfolglos – und folgenlos. Adolfstraßen, hieß es, gebe es auch in den umliegenden Orten, verdienstvolle Bürgermeister oder Landesfürsten aus Zeiten der Zersplitterung hätten so geheißen. Und nicht einmal Goethe habe auf seiner Reise in der Gegend im Sommer 1774 Anstoß genommen; das war ein hübsches Argument.
Eine kleine Eiszeit brach aus, während der die Liebe der Freundinnen zu Steinbronn litt und ein wenig verwitterte. Am Stammtisch wurde auch die Möglichkeit der Scheidung diskutiert und letztlich verworfen. »Meine Erde ist schwarz, nicht braun«: Dodos Credo. Und Penny sagte sehr bestimmt, ihr Ort sei hier, Berts wegen, aber nicht nur. Wie sollte man einander finden, wenn beide suchten? Ein Aufbruch reicht, dachte sie und sagte es nicht. »Eine Flinte, die man nicht hatte, kann man auch nicht ins Korn werfen«, das sagte sie laut. Für Beatrice und Laura hatte durch diese Aktion und ihre Aufnahme bei den meisten Steinbronnern und der lokalen Presse jedenfalls die Zahl der Behandlungsbedürftigen und Verirrten erkennbar zugenommen, auch wenn die beiden wussten, dass weder mit den richtigen Bewegungen noch der richtigen Aussprache allein eine Bekehrung stattfinden würde. Aber Missionare denken zunächst an die Mission, nicht an den Erfolg. Auf Idioten musste man im Übrigen überall gefasst sein, sagte sich Laura, die ihre Wohnung mit Blick auf den Fluss liebte und nicht aufgeben wollte.
Im Untergeschoss befand sich ihre Praxis für Logopädie. Sehr praktisch. Und die Miete provinziell niedrig. Trotz des kurzen Weges ging Laura niemals ungerüstet aus der Wohnung, auch wenn sie im Treppenhaus gar keinem begegnen konnte; sie war geschminkt, frisiert, mit Schirm, Mantel und Schal auf jedes Wetter vorbereitet. Sie wohnte im zweiten Stock, so hoch über Steinbronn wie maximal möglich. Zum Schlafzimmer führte eine Wendeltreppe, sein Fenster öffnete sich zum Fluss hin, das Zimmerchen hatte etwas Kajütenhaftes. Alles in allem empfand Laura ihre Behausung gar nicht als eine gemauerte Wohnung, eher als ein Hausboot. Irgendwohin würde es steuern, mit ihr an Bord, irgendwann. Möglicherweise mit einem Unteroffizier an ihrer Seite. Oder Ko-Pilot, verbesserte sie sich. Es ging ja nicht um Ränge. Worum sonst? – Sie würde es herausfinden.
Allen vieren, auch Beatrice, war entgangen, dass unter den Steinbronnern, die sich solidarisierten und am donnerstäglichen Stammtisch teilnahmen, einmal auch Bendix gewesen war, der seinen Schnurrbart glättete, rauchte und den Schwaden so aufmerksam mit dem Blick folgte, als läse er Botschaften darin. Gesprochen hatte er nicht; nach drei kleinen Hellen war er aufgestanden, hatte freundlich mit den Fingerknöcheln auf die Tischplatte geklopft und Tschö gesagt. Also eine Prise Köln im Rebstock zurückgelassen. Leicht hinkend war er verschwunden. Da Penny ihn gar nicht wahrgenommen hatte, konnte sie auch später nicht denken: unser Mundschenk.
Und Bendix hatte sich zu Hause ein viertes Helles eingeschenkt, am Schreibtisch den Platz mit Blick auf das Aquarium eingenommen und in seiner schwarzen Kladde, Sudelheft genannt und PLANKTON betitelt, festgehalten:
Donnerstag, 22. Mai
Vier Frauen. Berlinerinnen. Vier Farben: blond, braun, rot und grau. Die Blonde kenne ich vom Sehen, wohnt um die Ecke. Sehr schöne Hände, Gang staksig, geschminkt, als müsse sie auf alles gefasst sein. Was sonst? Mal sehen. Mir war nicht nach langen Sätzen, und es wurde hingenommen. A-Straße aussichtslos, das Aussichtslose betreiben: mein Ding. Bloch geht es schlecht, Leibniz dagegen gedeiht. Spricht für den Barsch. Und ich roste, Knochen um Knochen.
Bendix schlug die Kladde zu, schaltete das Licht aus, sodass nur das bläuliche Flackern als Beleuchtung zurückblieb. Er hatte kein besonderes Interesse an Fischen; das Aquarium diente der Kontemplation. Statisch, der gläserne Kasten, und doch Behältnis für so viel Bewegung. Bendix unterschied die Fische nach ihren Namen, allesamt Philosophen, die ihm als Student den Weg gewiesen hatten. Die Fische wendeten rasant wie von Stromschlägen getroffen. Die Sauerstoffbläschen quirlten in die Höhe, Bendix dagegen saß wie versteinert, massierte die Druckstelle der Brille auf dem Nasenrücken und rauchte eine Zigarette nach der anderen, bis der Ananasschwertträger (Nietzsche), der Schmetterlingsfisch (Kierkegaard), der Hochlandkärpfling (Benjamin) und all die anderen, die es schafften, die Dunkelheit des Meeres mit ihren prächtigen Farben in großer Tiefe zu narren, im Sepiadunst seines Rauchs verblassten.
Den Stammtisch gab es schon lange, Jahre vor der Initiative zur Straßenreinigung. Donnerstags saßen die vier Freundinnen zusammen; solange Bert klein war, ab neun, damit Penny ihn in Ruhe zu Bett bringen konnte. Eine längere Angelegenheit mit Vorlesen und Vorsingen, später mit Geschichten von der Notwendigkeit des Verschwindens: »Jeder muss einmal im Leben verschwinden«, erklärte Penny dem Zehnjährigen (und das war nun auch schon acht Jahre her). »Warum?« hatte, Bert gefragt. »Weil man sich von sich selbst manchmal entfernen muss. Weil« – Penny brach ab, sah die Verwirrung im Gesicht ihres Sohnes –, »wie bei Mensch ärgere dich nicht, wenn man zurück muss auf Los.« Bert hatte sehr skeptisch geschaut.
Die Freundinnen empfanden sich als Berts Tanten. Seine Vorliebe galt Dodo, auch wegen Zwiebel, aber nicht nur. Beatrice und Laura flößten ihm ein wenig Ehrfurcht ein, die eine wegen ihres durchdringenden Blicks, unter dem er sich fühlte wie ein aufgeschlagenes Buch, die andere wegen ihrer Schönheit. Bert verglich Lauras Augen mit den gletscherfarbenen Hustenbonbons, an denen er sich die Zunge aufschnitt vor lauter Gier, ins weiche Innere vorzudringen. Also schlug er vor beiden Freundinnen seiner Mutter den Blick nieder, was sie zu Kommentaren und Nachfragen veranlasste, die er hasste: »Bist du müde? Weißt du nicht, dass man sein Gegenüber anschaut, wenn man mit ihm spricht?« Nach und nach schaffte er es, der einen in die braunen, der anderen in die Eisaugen zu schauen, ohne mit der Wimper zu zucken. Und Laura, die Logopädin, las göttlich vor. Ihre Zunge und ihre Lippen schienen jedes Wort mit der Sorgfalt zu formen, die Bert vom Bäcker kannte, dem er einmal, es war ein Schulausflug, beim Kneten eines Brotlaibs zugeschaut hatte. Nicht allein Sorgfalt, sondern Zärtlichkeit lag in den Bewegungen; dem Fingerdruck, dem Abklopfen der Flanken mit der flachen Hand, selbst in den kurzen Schlägen mit der Handkante für die Kerben in der späteren Kruste. Und auch in dem abschließenden Hinbetten auf ein bemehltes Blech, einer, so schien es Bert, dem Abschiedswinken sehr ähnlichen Geste. So viel Fürsorge. Was er nicht wusste, war, dass die Vorführung in der Backstube gewissermaßen museal war, denn eigentlich wurden alle Backwaren morgens um vier vom Großhändler als Rohlinge geliefert.
Bert galt als fröhliches Kind, »kleiner Mann« wurde er bereits bei der Einschulung genannt, obwohl er da noch einen leibhaftig anwesenden Vater hatte. Dodo hatte einmal angemerkt, dass Bert die klassischen Eigenschaften eines Witwensohns schon hatte, als seine Mutter noch gar keine war: zu brav, zu anhänglich, zu ritterlich. Wenn er bei ihr in der Gärtnerei war, ließ sie ihn mit bloßen Händen im frischen Kompost buddeln. »Du brauchst Dreck, Junge«, sagte sie, und er sah sein ratloses Gesicht sich in ihren Augen spiegeln. »Dein Vater, der Herr Wohlfahrt«, sagte sie auch, obwohl Otto ja eigentlich Rohme mit Nachnamen hieß und er, Bert, auch. Aber dass er selten verstand, was Dodo meinte, fand er andererseits nicht besonders störend.
Bert vermisste seinen Vater und behielt dies angesichts der besorgniserregend und vergeblich wachsenden Haare seiner Mutter so gut er konnte für sich. Erst als sie so lang waren, dass Penny sie nicht mehr offen trug, sondern hochsteckte, konnte er wieder den Arm um ihren Nacken schlingen, wenn sie, müde von irgendeinem längeren Ausflug oder Fest, Arm in Arm vom Auto bis zur Haustür gingen. Sie waren gleich groß. Aber eigentlich war es ihm schon vor Ottos Aufbruch – Verschwinden nannte es keiner außer Penny selbst – unangenehm, seine Mutter wie eine Freundin ins Haus zu führen. In den ersten Jahren nach Ottos Weggang trödelte Bert oft nach Schulschluss durch die Unterführung zum Fluss hinunter und füllte seine Lungen mit dem faulig-brackigen Geruch des an das Ufer schwappenden Wassers. Und mit dem nach Pisse, der stechend im Gewölbe hing. Dodo hätte sofort verstanden, dass er sich so von allem erholte.
Wenn Weinlese war, füllten sich das Wirtshaus und die anhängende Pension, die von Pennys Schwiegermutter betrieben wurde: schlichte Zimmer mit Bad und Toilette im Gang. Frau Rohme, geborene Braubach, inspizierte wie eine Marschallin abends und morgens die zwei langen Flure, zu denen hin sich die Zimmertüren öffneten. Den Gehstock setzte sie weniger als Stütze ein denn als Metronom. Ihre Nasenflügel weiteten sich in der von Duschgels und Testosteron verdickten Luft. Polnisch, Rumänisch, Musikfetzen: Sie liebte es. Ein paar Brocken in den gängigsten Sprachen der Saisonarbeiter hatte sie sich beigebracht, und sie rührte diese unter die reichlich strengen Ermahnungen, kein Wasser zu verschwenden, keine tropfnasse Wäsche aufzuhängen und ab 23 Uhr die Nachtruhe zu wahren. Penny erschien ihre Schwiegermutter wie ein riesiger Baum, mit einer Krone, die alles Umliegende schützte, diesem aber zugleich die Sonne zum Gedeihen nahm. Was sich an ihrem Mann, Pennys Schwiegervater, am besten studieren ließ. Der war so schmächtig, dass der Gürtel die Hose im Bund regelrecht raffte und seinen Träger nur dadurch zusammenzuhalten schien. Ottos Vater saß tagaus, tagein in einer Art Kontor und machte die Buchführung. Am Telefon dagegen wirkte er wie ein Schwergewicht, tiefe Stimme, feste Ansagen, durch keinen Gesprächspartner einzuschüchtern. Erst dachte Penny, Maulheld, aber über die Jahre lernte sie, dass ihn das Fehlen von äußerer Autorität keineswegs beschäftigte und er seine Unscheinbarkeit hinnahm wie eine Gegebenheit und nicht als Mangel. Vielleicht, dachte Penny, war Otto wegen dieser großen Unterschiede zwischen seinen Eltern so ausgeglichen. Und hatte sich abgesetzt auf der Suche nach Absetzung? Immer dazuzugehören, konnte möglicherweise genauso zu Verzweiflung führen wie das Gegenteil: nie zu etwas zu gehören.
Von der alten Köchin, die eigentlich nichts mehr zu tun hatte, weil die meisten Gerichte halb fertig angeliefert wurden, hatte sie erfahren, dass Otto als Kind seine Zeit am liebsten bei ihr in der Küche verbracht hatte. Wie ein Kater sei er ihr um die Beine gestrichen und hätte jeden ihrer Handgriffe so aufmerksam beobachtet, als müsste er alles für kommende Zeiten archivieren. Die Gegenwart der Köchin tröstete Penny, in ihrem Blick war noch immer eine Spur des Kindes Otto bewahrt, auch wenn in den alten Augen die Farbe der Iris längst ausgeschwemmt war.
Solche Gedanken trieben Penny nach draußen, sie lief durch die Steinbronner Straßen, die nach Geschäftsschluss hinter verhangenen Schaufensterlidern blicklos wurden. Je nach Wind- und Wetterlage roch man den Fluss, im Schillerpark sammelten sich die Obdachlosen und klirrten mit den Bierflaschen, ein paar Vierzehnjährige wussten nicht wohin mit sich, Familienväter standen vor der Pizzeria Schlange und telefonierten mit ihren Freundinnen. Am Ortsende größere Grundstücke, Trampoline, Rutschen, Sandkästen in den Gärten, kleine Festungen gegen die Feinde ringsum. Von den Müttern hingebungsvoll dekoriert. Welcome stand auf den Matten für den Schmutz unter den Schuhen, und die amerikanischen Briefkästen, die aussahen wie Hundehütten, verbargen gemütlich die Mahnungen und Zahlungsaufforderungen, die ihnen ins Maul gestopft wurden. Dabei erinnerte sich Penny gut daran, welche Sehnsucht Ottos Erzählungen über seine moselselige Heimat in ihr ausgelöst hatten.
Sie hatten einander auf einer Italienreise kennengelernt, Otto war einer ihrer Mitfahrer, zwei weitere saßen hinten und spielten keine Rolle. Jeder Stau wurde willkommen geheißen, jede Schlange vor den Pässen und den Mautstellen insgeheim bejubelt. Gib uns Zeit! Am Ende der Reise, in Piombino (Penny wollte zu einer Freundin auf Elba), hatten sie einander ihre Leben einigermaßen schonungslos erzählt und waren mit dem Gefühl künftiger Unzertrennlichkeit in ihren jeweiligen Ferienorten gelandet. Den Namen »Steinbronn« nahm Penny mit wie ein Pfand auf demnächst sich erfüllende Versprechen. Damit lag sie am Strand; es wurde auf jeder Buchseite, die sie umblätterte, bejaht. Ihm, dem Versprechen, galt der letzte Gedanke vor dem Einschlafen und der erste beim Aufwachen. Stein-Bronn, das Feste, Beständige einerseits und das Flüssige, Sprudelnde, Lebensverheißende andererseits. Alles in einem, alles in Otto. Der von vorne und hinten gelesen derselbe blieb. Otto war ihr Jawort zum Leben. Und dann hatte er, vor acht Jahren, Nein gesagt. Aber nein wozu?
Penny war bei Dodo angekommen. Die Beete und Rabatten lagen im Dunkeln wie schlafende Tierleiber, die Luft gezuckert vom falschen Jasmin, der Akazienblüte, dem Kirschlorbeer. Penny stand still am Zaun, gab ihren Augen Zeit, sich an die dämmrigen Umrisse zu gewöhnen und mit der zunehmenden Sehschärfe auch die Beklemmung zu entlassen, die sie bei ihrem Gang durch Steinbronn befallen hatte. Zwiebel schlug an, kurz darauf Dodos Stimme: »Komm rein!« Der Kies unter ihren Füßen knirschte, als sie die wenigen Meter zum Eingang zurücklegte; wer mochte, konnte darin ein gutes Zureden vernehmen, an sie, die Umsichtige, umsichtig zu bleiben. Also die Gegenwart nicht aus den Augen zu verlieren und die Zukunft nicht zu fürchten. Dodos Umarmung war so kräftig, dass Penny lachen musste und einen Schritt zurücktrat, um Luft zu holen.
»Du nimmst anscheinend Maß an Bäumen«, sagte sie und rieb sich die Rippen.
Bei Dodo stand das Foto von der Einschulung auf der Anrichte in der Küche, das Glas war gesprungen und angelaufen und der Rahmen etwas angekokelt. Vermutlich hatte er unter der Nähe zu Dodos aus- ufernden Kochexerzitien gelitten. Der Firnis aus Dampf und Fettspritzern rückte das fotografierte Geschehen in noch größere Fernen als die, die tatsächlich zurückgelegt worden waren. »Als läge unser erster Schultag noch vor der Jahrhundertwende«, hatte Laura einmal angemerkt, »in der Verkleidung der noch einzutreten habenden Zukunft.«
Dodo heftete ihre Augen auf Penny und verkündete prompt ihre Diagnose: »Du siehst aus, als wärst du beraubt worden.«
Und du hast keine Augen, sondern Saugnäpfe, die sich auf einen setzen wie Blutegel, dachte Penny, halb dankbar, halb verdrossen, und verkroch sich ins spitze Eck der Küchenbank, den Herrgottswinkel. Dodo hatte vor Jahren ein wurmstichiges Kruzifix aufgetrieben, zwischen den Füßen des knochigen, verhärmten Christus ein verwittertes Buchssträußlein, das sie als Aufforderung auffasste. Sie kaufte das Kruzifix für ein paar Euro, entfernte die verdorrten Äste und steckte frische Zweige hinter den Nagel, der die Füße durchbohrte. »Auch Marias Sohn braucht Hoffnung«, sagte sie, und Hoffnung hatte für Dodo, ganz klassisch, mit der Farbe Grün zu tun.