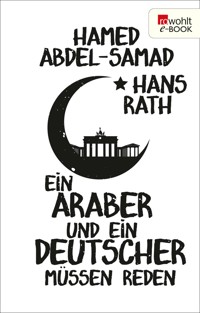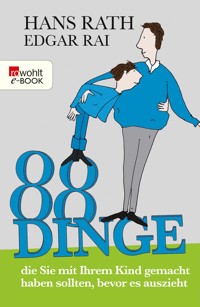16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei ungleiche Gefährten auf einer Reise, die alles verändert In Ligurien will Soziologiestudentin Paula endlich ihre Doktorarbeit über Wunder beenden. Doch so einfach lässt sich das Phänomen wissenschaftlich nicht fassen. Da naht Hilfe in Gestalt von Benedikt, Pater in einem Marien-Wallfahrtsort in Bayern. Wunder sind sozusagen sein täglich Brot – aber glaubt er wirklich noch daran? Gemeinsam sichten sie Paulas Wundersammlung und begeben sich auf eine Reise. Denn vielleicht können ihnen ein Wunderkurator in Avignon, eine Mathematikprofessorin in Bern, eine Einsiedlerin in den Schweizer Bergen, eine Psychologin und ein Astronomenpaar dabei helfen, dem Phänomen Wunder doch noch auf die Spur zu kommen. Ein kluges und inspirierendes Buch über die kleinen und großen Wunder im Leben Die beiden Wunderreisenden: Zum Glück gibt es Franca, ihre Sommerfreundin, sonst würde Wundersammlerin Paula, 28, über den Wundern verzweifeln. Noch dazu hofft sie seit Langem auf ihr persönliches Wunder: endlich ihre leiblichen Eltern kennenzulernen. Oder ist es bereits ein Wunder, dass sie am gleichen Tag Geburtstag hat wie ihr Reisegefährte Benedikt? Benedikt, 55, liebt gutes Essen und seinen betagten Volvo. Als Pater in einem Wallfahrtsort hat er tagtäglich mit Wundern zu tun. Doch gibt es sie wirklich, die Wunder? Schon lange wünscht sich Benedikt von seiner Familie ein Zeichen der Versöhnung. Es käme einem Wunder gleich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
In Ligurien will Soziologiestudentin Paula endlich ihre Doktorarbeit über Wunder beenden. Doch so einfach lässt sich das Phänomen wissenschaftlich nicht fassen. Da naht Hilfe in Gestalt von Benedikt, Pater in einem Marien-Wallfahrtsort in Bayern. Wunder sind sozusagen sein täglich Brot – aber glaubt er wirklich noch daran? Gemeinsam sichten sie Paulas Wundersammlung und begeben sich auf eine Reise. Denn vielleicht können ihnen ein Wunderkurator in Avignon, eine Mathematikprofessorin in Bern, eine Einsiedlerin in den Schweizer Bergen, eine Psychologin und ein Astronomenpaar dabei helfen, dem Phänomen Wunder doch noch auf die Spur zu kommen.
Hans Rath / Michaela Wiebusch
Die Wundersammler
Roman
Für alle, die sich auf die Reise machen
»Nur das Herz vollbringt Wunder.«
George Sand
1
Die Morgensonne lässt das weiße Kuvert leuchten.
Paula hat sehnsüchtig auf diesen Brief gewartet. Kein Wunder, denn er könnte ihr Leben verändern. Möglich, dass er ihr endlich Antworten auf all die Fragen gibt, die ihr viele schlaflose Nächte beschert haben. Falls nicht, dann ist nun auch der letzte Versuch, das Geheimnis zu lüften, fehlgeschlagen. Sie wird diese Antworten dann nie bekommen.
Es klingt schlimmer, als es ist. Im Grunde hat sie nichts zu verlieren. Wenn dieser Brief ihr keine Antworten gibt, dann bleibt ihr Leben einfach so, wie es ist. Nichts wird sich ändern.
Es wäre kein Beinbruch, denn sie hat ihren Frieden damit gemacht, dass manche Fragen unbeantwortet und manche Dinge im Leben rätselhaft bleiben.
Sie nippt an ihrem Kaffee und fragt sich, ob sie überhaupt noch wissen will, was in dem Brief steht. Möchte sie im Grunde ihres Herzens vielleicht doch lieber, dass alles so bleibt, wie es ist? Seltsam, man könnte meinen, sie hätte Angst vor der Wahrheit.
Wie jeden Tag sitzt sie auf der Gartenbank im Schatten des alten Olivenbaumes und genießt die Morgensonne, die durch das Blätterdach fällt. Dem kleinen Natursteinhaus, das noch bis zum Ende des Sommers ihre Heimat sein wird, hat sie den Rücken zugewandt. Das Haus steht im höher gelegenen Teil des sanft abfallenden Grundstücks, und wenn man es von hier unten betrachtet, dann wirkt es größer, als es in Wirklichkeit ist. Es scheint sich zu recken, um über den alten Baum hinweg das Meer sehen zu können.
Auch Paula liebt das Meer. Es ist in weiter Ferne als glitzerndes Blau zwischen zwei ligurischen Hügeln zu erkennen. Sie hatte gehofft, ein Haus in Küstennähe zu finden, aber im Sommer sind die Strände gespickt mit Touristen, was die Preise in schwindelerregende Höhen treibt. Alle wünschen sich Meerblick und kurze Wege zu den Badestränden.
Die Mietpreise haben Paula immer weiter ins Hinterland gedrängt. Beinahe wäre es ein Häuschen ohne Meerblick geworden. Aber dann hat sie dieses Städtchen entdeckt: Molitoni. Eigentlich ist es mehr ein Dorf, aber die Bewohner legen Wert darauf, dass sie in einer Stadt wohnen. In einer Kleinstadt zwar, aber eben in einer Stadt.
Paulas Haus steht am Rand von Molitoni, auf einem der Hügel. Von hier aus betrachtet, sieht es aus, als hätte man das Städtchen mitsamt der Kirche und dem alles andere überragenden Torre di Molitoni, dem alten Wehrturm, fürsorglich in ockerfarbenes Packpapier eingehüllt, um die greisen Gemäuer auf ihrer Reise durch die Jahrhunderte zu schützen.
Abends, wenn die Sonne das Städtchen und die Umgebung in ein zartes Rot taucht, scheinen die tönernen Dachziegel mit den Hügeln zu verschmelzen. Paula mag diese Abendstimmung ebenso wie die Ruhe, die sie hier gefunden hat. Überhaupt ist sie inzwischen froh, dass sie das Meer zwar sehen, aber nicht problemlos erreichen kann. Der Bus braucht bis zum nächsten Badeort eine geschlagene Stunde. Wer Strandurlaub machen möchte, der verirrt sich nicht so weit ins Hinterland. Die wenigen Touristen, die in dem kleinen Hotel am Marktplatz absteigen, sind hier, um zu wandern oder sich die mittelalterlichen Gebäude anzusehen, besonders die Kirche, die Santa Maria di Molitoni.
Das Schmuckstück ist vor vielen Jahren in einem Reiseführer erwähnt worden. Sie sei anlässlich einer Marienerscheinung gebaut worden, heißt es dort. Obwohl das ein Irrtum ist, hat niemand den Fehler beanstandet, schon gar nicht die Einwohner von Molitoni. Sie können das Geld, das die Touristen bringen, gut gebrauchen. Außerdem ist die Sache mit der Marienerscheinung nicht völlig aus der Luft gegriffen. Wenn man auf dem Weg, der an Paulas Haus vorbeiführt, ein halbes Stündchen weiter den Hügel hinaufgeht, dann gelangt man zu einer kleinen Kapelle. Die Leute hier nennen sie die Santuario della Madonna. Sie soll vor fast zweihundert Jahren von einer Bauernfamilie errichtet worden sein. Zum Dank dafür, dass die Eltern ihr jüngstes Kind, das sich im Wald verlaufen hatte, nach zwei bangen Tagen der Suche unbeschadet wiederfanden. Zuvor soll die Muttergottes der Bäuerin im Traum erschienen sein und ihr gesagt haben, wo das Kind zu finden sei.
Paula hat den Brief gegen das achteckige Kännchen gestellt, das die Italiener caffettiera nennen. Unten im Dorf könnte sie einen weitaus besseren Morgenkaffee bekommen. Den besten gibt es bei Faustino, dessen Bar am Marktplatz, schräg gegenüber vom Hotel Primo liegt. Den klingenden Namen trägt das Hotel nicht, weil es das Erste und Beste in der Gegend ist, sondern weil sein Besitzer Primo heißt, wie schon sein Vater. Das Fauchen und Brodeln der Siebträgermaschine in Faustinos Bar ist die Begleitmusik für den morgendlichen Caffè.
Paula schätzt ihre Ruhe mehr als eine perfekte Crema oder eine hübsche Milchschaumkrone. Außerdem liebt sie es, wenn ein sanfter Wind durch die Olivenbäume streicht, während sich unten im Dorf die Straßen und Plätze langsam mit Leben füllen. Faustinos Bar ist nur einen kurzen Spaziergang entfernt. Manchmal geht sie nachmittags, wenn sich der Tag zu voller Größe aufgerichtet hat und man eine Ahnung davon bekommt, dass die Hitze bald nachlässt, den Hügel hinab, um auf dem Marktplatz einen Cappuccino zu trinken. Wie wohl alle italienischen Barista macht Faustino einen Weltklasse-Caffè. Paula findet es tröstlich, dass sie ein solches Meisterwerk auch dann nicht so gut hinbekäme, wenn sie eine dieser imposanten Siebträgermaschinen besäße, wie sie in jeder noch so kleinen italienischen Bar zu finden ist. Ein chromblitzendes Schmuckstück, groß wie ein Schrank und meistens teurer als der Rest der Einrichtung.
Auch der Postbote ist nachmittags bei Faustino anzutreffen. Nach getaner Arbeit gönnt er sich einen Espresso und ein paar Gläser der hausgemachten Zitronenlimonade. Wenn er Paula sieht, lächelt er und nickt freundlich oder hebt kurz die Hand zum Gruß. Sie bekommt nicht oft Post, deswegen haben die beiden sich den Sommer über häufiger auf dem Marktplatz gesehen als an Paulas Haus.
Er ist etwa in ihrem Alter, vielleicht ein paar Jahre älter. Anfang dreißig, höchstens. Sie ahnt, dass er ihr gern häufiger die Post über die Gartenmauer reichen würde, um bei einer dieser Gelegenheiten mit ihr ins Plaudern zu geraten. Vielleicht würde er später sogar einen Flirt riskieren oder sie auf eine Nachmittagslimonade einladen.
In einem Dorf, wo jeder jeden kennt, bleibt eine junge Frau, die den Sommer allein hier verbringt, keinem der jungen Männer verborgen. Dabei findet Paula, dass sie so gar nicht mit den Frauen aus der Gegend konkurrieren kann. Sie ist das komplette Gegenteil der dunkelhaarigen, kurvigen, selbstbewussten und attraktiven Italienerinnen, die unten im Dorf zu finden sind. Frauen, die ihre provinzielle Herkunft damit vergessen machen, dass sie sich im Stil von Mailand und Florenz kleiden und ebenso mondän geben.
Paula ist eher schmächtig als kurvig. Sie hat keinen großen Po und keinen großen Busen. Das Größte an ihr sind ihre Augen. Die allerdings sind so groß, dass sie meistens erstaunt, manchmal sogar erschrocken aussieht. Die bequeme Kleidung, die sie trägt, vorzugsweise weite Hosen, dazu Blusen oder T-Shirts, sieht an ihrem schlanken Körper aus, als wäre sie ihr eine Nummer zu groß. Und ihre Haare sind nicht schwarz, sondern dunkelblond. Zudem sehen sie am frühen Morgen aus, als wäre etwas in ihnen explodiert. Noch ein Grund, warum Paula den Morgen lieber allein verbringt.
Den Postboten scheint all das nicht abzuschrecken. Gestern, als er ihr den Brief gebracht hat, schien es, als wäre er beinahe glücklich gewesen, ihretwegen den Hügel hinaufzustrampeln.
Der Brief. Paulas Blick fällt auf die geschwungenen Buchstaben, mit denen die Adresse auf das Kuvert gemalt wurde. Sie kennt die Handschrift.
»Guten Morgen!«, ruft eine helle Stimme. Dann erscheinen zwei Hände auf der Gartenmauer, und gleich danach schiebt sich ein von braunen Haaren umrahmtes Gesicht dahinter hervor.
2
Behutsam nimmt Benedikt das schlichte Holzkreuz von der Wand. Vor ihm auf dem Bett liegt der gepackte Koffer. Er ist alt, aus dunkelbraunem Leder gefertigt und nicht sehr groß. Es ist der einzige Koffer, den er besitzt. Beinahe hat sein ganzes Hab und Gut darin Platz.
Bevor er das Holzkreuz oben auf die ordentlich gefaltete Wäsche legt, betrachtet er es einen Moment. Es ist schmuck- und schnörkellos und aus hellem Eichenholz gefertigt. Die beiden Stücke, aus denen es besteht, sind so perfekt ineinandergefügt, dass auch dort, wo sie sich kreuzen, keine Unebenheit zu spüren ist. Wie um sich davon zu überzeugen, streicht er mit dem Zeigefinger über das glatte Holz.
Hinter ihm, an der gegenüberliegenden Wand, hängt ein Kruzifix. Anders als das Kreuz in seinen Händen ist es eine bildhafte Darstellung der Leiden Jesu. Ein drastisches Bild. Schon oft hat Benedikt diesen Gekreuzigten betrachtet. Die winzigen Nägel und die Blutströpfchen an Händen und Füßen. Die kleine Wunde an der Flanke, die dem Gottessohn von der Lanzenspitze eines römischen Soldaten zugefügt wurde. Benedikt muss an einen Satz aus dem Johannesevangelium denken: Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben.
Er dreht sich um und blickt nun ebenfalls auf den Durchbohrten. Die Dornenkrone ist kaum größer als ein Fingernagel, auch sie ist mit Blutstropfen besprenkelt. Darunter die traurigen Augen und die von Schmerzen verzerrten Gesichtszüge. Der Mund des Messias ist leicht geöffnet. Benedikt hat sich schon oft gefragt, ob Jesus gerade Atem schöpft oder vor Schmerzen aufstöhnt. Vielleicht will er auch etwas sagen. Bittet er um Wasser? Tröstet er die Seinen? Spricht er Freunden, Verwandten und nicht zuletzt sich selbst Mut zu?
Seine streng katholische Großmutter – Gott hab sie selig – hat ihm dieses Kruzifix vor beinahe fünfzig Jahren zur Erstkommunion geschenkt. Als Kind fand er den Anblick des gekreuzigten Heilands unangenehm, ja sogar angsteinflößend. Später hat er sich nicht nur mit dem Anblick angefreundet, sondern am Ende sogar mit dem Gekreuzigten selbst.
Das Kreuz in seinen Händen ist nur halb so alt wie das Kruzifix der Großmutter. Er hat es zur Priesterweihe geschenkt bekommen. Der Spiritual, zuständig für die geistliche Ausbildung der Priesteranwärter, hat es ihm zum Dank für einen wichtigen Rat überreicht.
Als dessen Schüler wäre es eigentlich an Benedikt gewesen, Ratschläge vom Spiritual zu bekommen, aber der Priester, damals etwa so alt wie Benedikt heute, haderte zu dieser Zeit selbst mit seinem Glauben und seinem Schicksal. Benedikt hatte das bemerkt und ihn gefragt, ob er ihm irgendwie helfen könne. Der Priester hatte ihm daraufhin erzählt, dass er Gott schon lange darum bitten würde, als Missionar tätig werden zu dürfen. Doch Gott scheine sich nicht für diesen Plan erwärmen zu können, denn die Jahre seien vergangen, und immer noch arbeite er als Spiritual in München, statt Gottes Botschaft in alle Welt zu tragen. Nicht mehr lange, dann sei er vielleicht zu alt und zu müde, um noch aufzubrechen. Warum nur erhöre der Herr ihn nicht?
»Gott möchte, dass wir das Richtige tun«, hatte Benedikt geantwortet. »Er zeigt uns den Weg und gibt uns Kraft und Hoffnung für die Reise. Aber er drängt uns zu nichts. Vielleicht sollten wir deshalb auch ihn zu nichts drängen.«
Benedikt erinnert sich, dass der Spiritual den Ratschlag mit einem langen, ernsten Kopfnicken bedacht hatte, um dann zu erwidern, dass er beim Abendgebet darüber nachdenken wolle. Danach haben sie nie wieder über das Thema gesprochen, nicht einmal an jenem Tag, als der Lehrer ihm das Kreuz geschenkt hat. Vielleicht hatte er bereits seinen Frieden damit gemacht, den Allmächtigen zu nichts drängen zu können. Jedenfalls ist der Mann bis zum Ende seines langen Lebens Spiritual in München geblieben. Der Wunsch, missionarisch tätig zu werden, wurde ihm nie erfüllt. Vielleicht hat Gott ihm immerhin die Einsicht geschenkt, dass ein Priester den Weg des Herrn gehen muss, auch wenn dieser noch so unergründlich ist.
Gedankenverloren schaut Benedikt zum Fenster, wo die Morgensonne funkelt, als wollte sie damit angeben, dass heute ein besonders heißer Tag würde. Noch vor zwei Stunden, als er aufgestanden ist, war das Licht ein dünnes, zartes Rot. Jetzt ist es ein breites und sattes Gelb. Der prächtige Pfarrgarten hat sich längst mit Leben gefüllt. Vögel und Insekten berauschen sich an der Fülle des Sommers und schütteln schwere Düfte aus den Blumen und Bäumen.
Der greise Pater Johannes geht am Fenster vorbei, einen Korb Rosen in der einen, die knallrote Gartenschere in der anderen Hand. Der große Sonnenhut, den er weit ins Genick geschoben hat, ist ein Geschenk von Frau Hackenberg. Die engagierte Vorsitzende des Pfarrgemeinderates hat den alten Pater ohne Kopfbedeckung im Garten werkeln sehen und war sofort von der Sorge erfüllt, dass er sich ohne Hut bei der stundenlangen Gartenarbeit einen Sonnenstich holen würde. Johannes ist siebenundachtzig Jahre alt. Vermutlich hat er die Sommer schon hutlos durchgearbeitet, als die fürsorgliche Frau Hackenberg, die etwa in Benedikts Alter sein müsste, noch gar nicht geboren war.
Johannes trägt ihren Hut trotzdem. Vielleicht, weil er Frau Hackenberg nicht enttäuschen will. Vielleicht liegt es aber auch an seinem Naturell. Er ist ein Mensch, so sanft und friedlich wie sein Garten.
Benedikt findet es beruhigend, Johannes bei seinen Blumen und Bäumen zu wissen. Sollte der ehrgeizige Vikar mit seiner forschen Art dem alten Pater zu sehr auf die Nerven gehen, dann könnte der sich jederzeit in sein Reich zurückziehen. Benedikt beneidet Johannes manchmal darum, dass der Pfarrgarten ihn so wunschlos glücklich macht. Die Blumen, Bäume und Sträucher zu hegen und zu pflegen und sich an ihrem Anblick zu erfreuen, ist alles, was der Priester noch vom Leben erwartet. Und wenn Gott ihm einen Gefallen tun will, dann lässt er ihn eines Tages in seinem Garten sterben.
Benedikt legt das Kreuz in den Koffer, schließt den Deckel und fragt sich, ob es auch ihm je vergönnt sein wird, Frieden zu finden. Er hat nicht geahnt, dass der Ratschlag, den er damals seinem Spiritual gegeben hat, eines Tages auch ihm selbst gelten könnte. Heute ist er es, der abwechselnd mit Gott und mit sich selbst hadert. Und er hat ebenfalls erfahren müssen, dass der Herr im Himmel sich nach wie vor zu nichts drängen lässt.
Als die Kofferschlösser zuschnappen, klopft es an der Tür.
»Ja, bitte?«
Der Kopf des Pfarrvikars erscheint. »Der Küster hat Ihren Wagen vorgefahren. Sind Sie bereit?«
»Wollen Sie mich etwa loswerden?«, fragt Benedikt freundlich.
Der Pfarrvikar sieht, dass Benedikt noch beim Packen ist, und betritt das Zimmer. Er ist Anfang dreißig, trägt Brille und wirkt auf den ersten Blick wie ein gemütlicher Typ, dem Ruhe und gutes Essen wichtiger sind als seine Laufbahn. Aber der Eindruck täuscht. Ignaz ist nicht nur ehrgeizig, sondern auch clever genug, seinen Ehrgeiz nicht an die große Glocke zu hängen. Eine Kombination, mit der er in der Kirche bestimmt Karriere machen wird, findet Benedikt.
»Aber sicher. Ich kann kaum erwarten, dass Sie weg sind«, erwidert der Vikar scherzhaft. »Dann habe ich hier endlich allein das Sagen.«
Benedikt lächelt milde. Ignaz lässt die Sätze zwar wie einen Scherz klingen, aber es ist die Wahrheit.
»Soll ich Ihren Koffer nehmen?«, fragt er.
»Geht schon«, sagt Benedikt und nimmt ihn selbst.
»Frau Hackenberg ist auch gekommen«, fügt Ignaz hinzu. »Sie hat Ihnen Brote gemacht. Für die Fahrt.«
»Das ist nett von ihr«, sagt er und freut sich. Frau Hackenberg backt nicht nur leidenschaftlich gern Kuchen, sondern auch ihr eigenes Brot. Vor zwei Jahren ist sie Witwe geworden, nachdem sie sich lange und sehr rührend um ihren todkranken Mann gekümmert hat. Benedikt kommt es manchmal vor, als hätte sie inzwischen ihn zum neuen Ziel ihrer Fürsorge auserkoren.
Er bemerkt, dass Ignaz ihn mustert. »Was ist? Stimmt was nicht?«
»Sie tragen keine Soutane«, stellt der Vikar fest. Es schwingt ein leiser Vorwurf in dem Satz mit.
Benedikt hat eines seiner schwarzen Kollarhemden mit weißem Priesterkragen angezogen, den sommerlichen Temperaturen entsprechend ein kurzärmeliges. Dazu trägt er eine dunkle Stoffhose und leichte Halbschuhe. Für einen Priester ist er vielleicht leger gekleidet, für jemanden, der in den Urlaub fährt, wirkt er hingegen ziemlich zugeknöpft.
»Das haben Sie gut beobachtet«, sagt er.
»Pater Johannes trägt seine Soutane selbst bei der Gartenarbeit«, fügt Ignaz hinzu.
Hat sich das gerade wie ein Tadel angehört? Pater Johannes muss auch nicht stundenlang im Auto sitzen, denkt Benedikt. Da er jedoch nicht die geringste Lust hat, über seine Kleidung zu diskutieren, sagt er: »Ich weiß. Gehen wir.«
»Sofort«, sagt der Vikar. »Ich wollte Ihnen nur noch etwas unter vier Augen sagen.«
Benedikt steht da, den Koffer in der Hand, unschlüssig, ob er ihn abstellen und sich setzen soll.
»Dauert es länger?«, fragt er.
Ignaz schüttelt den Kopf. »Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich für Sie bete. Ich hoffe inständig, Sie finden auf Ihrer Reise, wonach Sie suchen. Möge Gottes Segen mit Ihnen sein.«
»Danke«, sagt Benedikt. »Und danke auch, dass Sie sich in der Zwischenzeit um unsere Gemeinde und die Wallfahrer kümmern. Ich weiß, dass ich beruhigt auf Reisen gehen kann, weil die Arbeit hier bei Ihnen und Pater Johannes in den allerbesten Händen ist.«
Das ist keine Lobhudelei, sondern die reine Wahrheit. Niemand wäre für seine Vertretung besser geeignet als der ehrgeizige Ignaz. Er scheint nur darauf gewartet zu haben, sich und der Welt endlich zu beweisen, dass ihm längst die Leitung einer eigenen Pfarrgemeinde zustünde.
Der Pfarrvikar lächelt zufrieden. »Soll ich Ihnen noch die Beichte abnehmen?«, fragt er. »Dann können Sie Ihre Reise mit reinem Gewissen antreten.«
Benedikt überlegt, ob er seinem Stellvertreter sagen soll, dass Pater Johannes ihm bereits die Beichte abgenommen hat. Das stimmt zwar nicht, aber es würde ihn vor unangenehmen Fragen bewahren. Die Wahrheit ist, dass es ihm widerstrebt, dem Pfarrvikar seine Sünden zu beichten. Denn Benedikt hat das merkwürdige Gefühl, dass seine Sünden bei Ignaz nicht gut aufgehoben sind. Es gibt Menschen, denen man problemlos viel Geld oder sein Haustier oder sogar die eigenen Kinder anvertrauen würde, aber kein Geheimnis. Nicht, weil sie es nicht bewahren würden, sondern weil sie zu schwer daran zu tragen hätten. Ignaz ist so ein Mensch. Einer, der gern organisiert, strukturiert und gestaltet. Ein Macher, der den Sinn seines Lebens in unermüdlicher Arbeit sieht und den schon allein deshalb nie Zweifel plagen, weil er schlicht keine Zeit dafür hat.
Vielleicht ist das so ähnlich wie mit manchen Leuten, denen man ein Buch leiht, denkt Benedikt. Man hat die Befürchtung, dass sie es nicht so wertschätzen und pfleglich behandeln, wie man selbst es tut. Und obwohl man es dann in einwandfreiem Zustand zurückbekommt, glaubt man, dass das Buch sich in der Fremde nicht wohlgefühlt hat. Benedikt findet den Vergleich ganz passend. Der springende Punkt ist wohl, dass er befürchtet, seine Sünden könnten sich bei Ignaz nicht wohlfühlen.
»Ein andermal«, sagt er. »Ich würde meine Sünden gerne mit auf diese Reise nehmen.«
Ignaz scheint die Antwort zu irritieren, denn er runzelt die Stirn, sagt aber nichts.
Kurz darauf startet Benedikt den Wagen.
Der Küster hat ihm zuvor erklärt, dass sein alter Kombi, den er partout nicht gegen einen neueren Pkw eintauschen will, zwar halbwegs fahrtüchtig ist, dass der Motor aber jederzeit den Geist aufgeben könnte. Benedikt hat die Brote und die guten Wünsche von Frau Hackenberg entgegengenommen, ebenso den Segen von Pater Johannes und die warmen Abschiedsworte von Ignaz.
Jetzt rollt sein dunkelblauer Volvo die Einfahrt hinab. Im Rückspiegel ist zu sehen, wie die Vier ihm hinterherwinken. Er kurbelt die Scheibe herunter, streckt den linken Arm ins Freie und winkt zurück.
Als er die Straße erreicht, ist er außer Sichtweite.
Er hält an und schaut erneut in den Rückspiegel, diesmal um seine Augen zu betrachten. Er hat dunkelbraune Augen, die Brauen sind buschig und angegraut wie sein Bart. Viele kleine Falten verraten, dass er zwar noch kein alter Mann ist, aber die Fünfzig längst überschritten hat. Seine Augen wirken traurig. Er hat das Gesicht eines unglücklichen Mannes.
Seufzend setzt er den Blinker und fährt los.
3
Paula freut sich jedes Mal, wenn sie dieses Lachen sieht. Es kommt ihr vor, als würde es mit der Sonne um die Wette strahlen. »Guten Morgen, Franca.«
Bevor sie ihre Besucherin durch das Gartentor hereinlassen kann, hat diese bereits die kleine Mauer erklommen, um von dort in den Garten zu springen, leichtfüßig und flink, wie es nur eine Zwölfjährige kann. »Und ob das ein guter Morgen ist!«, ruft sie übermütig.
Franca ist die Tochter von Letizia und Primo Martinelli, jenem Primo, dessen Großvater dem Hotel am Markt seinen Namen gegeben hat. Die Martinellis haben vier Kinder. Franca ist die Jüngste. Ihren drei älteren Brüdern ist es vermutlich zu verdanken, dass sie nicht nur so schnell laufen und so gut klettern kann wie ein Junge, sondern auch ein enormes Durchsetzungsvermögen besitzt. Paula mag die Energie der Kleinen. Wobei es nicht mehr ganz passend ist, Franca als klein zu bezeichnen. Zum einen ist sie schon jetzt fast so groß wie Paula, zum anderen kann Franca sehr erwachsen wirken. In solchen Momenten glaubt Paula, die junge Frau zu erkennen, die schon bald aus ihr werden wird.
»Hast du Kakao gekauft?«, fragt die frühe Besucherin.
Hat Paula natürlich. Trotzdem tut sie so, als müsste sie überlegen. »Sollte ich das?«, fragt sie scheinheilig.
Francas Schultern sacken herab. »Du hast es vergessen.«
Paula muss lachen. »Auf dem Küchentisch. Und im Kühlschrank ist frische Milch.«
Franca freut sich. »Gibt’s auch Eiswürfel?«
»Klar.«
»Super. Bin gleich wieder da«, sagt sie und läuft zum Haus.
Sie haben sich kurz vor den Sommerferien auf dem Marktplatz kennengelernt. Paula wohnte erst seit ein paar Tagen in Molitoni, hatte aber schon voller Elan damit begonnen, ihre Dissertation zu beenden. Sie wollte diesen Hügel mit einem halb fertigen Manuskript erklimmen, um ihn mit einer erstklassigen Doktorarbeit wieder herabzusteigen.
»Bist du neu hier?«, hat Franca gefragt.
Paula, mit ihrem dritten Cappuccino in einen Stapel Bücher vertieft, hat hochgeschaut und einen eisverschmierten Mund mit einem extrabreiten Lachen gesehen. Sie hat in diesem Moment gedacht, dass Francas Zahnzwischenräume bestimmt nur deshalb entstanden sind, weil die Zähne es partout nicht geschafft haben, dieses unglaublich breite Lachen auszufüllen.
Auch Paula hat in diesem Moment lächeln müssen.
Dann haben die beiden sich erzählt, wer sie sind, womit sie ihre Zeit verbringen und welche Eissorten sie besonders gern mögen. Und so sind sie Freundinnen geworden. Freundinnen für einen Sommer. Das zumindest hat Franca eines Tages so beschlossen, denn seit dem Treffen auf dem Marktplatz schaut sie regelmäßig bei Paula vorbei, um Eisschokolade zu trinken und mit ihr zu quatschen. Dunkle Schokolade ist übrigens auch ihre Lieblingseissorte bei Faustino.
Die Sommerferien heißen in Italien nicht nur so, sie umfassen tatsächlich beinahe den ganzen Sommer. Je nach Region beginnen sie Anfang oder Mitte Juni und enden im September. Dass für Franca bald wieder die Schule beginnt, erinnert auch Paula an das bevorstehende Ende ihres italienischen Sommers. In wenigen Wochen werden ihre finanziellen Mittel erschöpft sein. Dann muss sie zurück nach München, ob sie nun will oder nicht.
Leider kommt ihr das Manuskript noch so unfertig vor wie am ersten Tag. Sie hat zwar ständig daran gearbeitet, hat am Text gefeilt, Passagen verändert oder gleich ganz neu geschrieben. Trotzdem ist sie mit dem Ergebnis unzufrieden. Immer noch hat sie keine Antworten auf eine entscheidende Frage gefunden: Was sind Wunder? Sind sie Zeichen einer göttlichen Gnade oder doch nur glückliche Zufälle? Sind sie pure Einbildung oder handfeste Realität? Sind sie von dieser Welt oder aus einer anderen Dimension? Sind sie allgegenwärtig oder so selten wie ein Besuch des Halleyschen Kometen?
Wie um Paula an all diese Fragen zu erinnern, kommt Franca zurück in den Garten und hat nicht nur ihre Eisschokolade dabei, sondern auch Paulas Manuskript. Sie legt es auf den Tisch und setzt sich zu ihrer Freundin auf die Bank. »Du hast dein Doktorbuch vergessen«, sagt sie und nippt an ihrem Getränk. Erwartungsvoll fügt sie hinzu: »Oder bist du etwa fertig?«
Paula möchte nicht an ihre Probleme erinnert werden, und sie möchte schon gar nicht darüber reden, also schüttelt sie lediglich den Kopf.
»Und wann bist du fertig?«, hakt Franca nach, die mit Paula schon vor Wochen abgemacht hat, dass die beiden bei Faustino feiern werden, wenn Paulas Werk vollendet ist. Franca will sich diese Party auf gar keinen Fall entgehen lassen.
Paula hebt die Schultern. »Weiß nicht. Ich befürchte, ich schaffe es nicht, zumindest nicht in diesem Sommer.«
»Was? Warum nicht?«, fragt Franca, empört darüber, dass die Buchpremiere bei Faustino ins Wasser fallen könnte.
Paulas Schultern sinken herab. »Mir fehlt einfach noch der gesamte Schlussteil.«
»Dann schreib ihn doch einfach auf.«
»Leider weiß ich nicht, was ich schreiben soll.«
»Aber du schreibst doch jeden Tag«, gibt Franca zu bedenken.
»Na und?«
»Dann müsste das Buch doch auch irgendwann mal fertig werden, oder nicht?«
Paula muss über Francas Logik lächeln. »So einfach ist das nicht, Franca. Man bekommt den Doktortitel nur, wenn man ein paar neue und interessante Dinge herausfindet.«
»Und die sind dir nicht eingefallen?«
»Bislang nicht«, erwidert Paula. »Ich habe zwar eine Menge Informationen gesammelt, aber es kommt mir vor, als wären es zu viele. Wenn ich glaube, eine gute Idee zu haben, flutscht sie mir im nächsten Moment schon wieder weg.«
»Das kenne ich«, sagt Franca.
»Deshalb überarbeite ich ständig das, was ich schon geschrieben habe«, fährt Paula fort. »In der Hoffnung, dass mich das irgendwie weiterbringt. Gestern habe ich zum Beispiel den Anfang umgeschrieben. Wieder mal.«
»Und? Hat es dir geholfen?«, fragt Franca.
»Ich glaube, nicht«, antwortet Paula.
Franca schiebt ihr das Manuskript zu. »Willst du mir mal die erste Seite vorlesen? Ich kenne mich damit aus. Ich gehe oft in die Bibliothek und lese erste Seiten, um zu entscheiden, welche Bücher ich mitnehmen will. Das ist, wie wenn man jemanden zum ersten Mal trifft und er dich begrüßt und du dann denkst: Hey, der ist nett. Oder: Schade, der ist aber langweilig. Oder: Wow, ist der spannend! Auf der ersten Seite sagt einem ein Buch hallo. Danach kann ich ziemlich genau sagen, ob ich es weiterlesen will.«
»Das ist was anderes«, sagt Paula. »Ich erzähle ja keine Geschichte. Es ist eher so etwas wie eine Hausarbeit.«
»Umso besser«, erwidert ihre Freundin für einen Sommer mit einem überbreiten Lächeln. »Mit Hausarbeiten kenne ich mich noch besser aus.«
Paula nimmt das Manuskript vom Tisch und lässt die Gedanken und ihren Blick in die Ferne schweifen. Ein Boot mit schneeweißen Segeln gleitet zwischen den ligurischen Hügeln durch das tiefblaue Wasser und den wolkenlosen Morgen. Es lässt die Gischt mit den Sonnenstrahlen um die Wette funkeln.
Paula hat an Momente wie diesen gedacht, als sie das Haus gemietet hat, um Inspiration für ihre Arbeit zu finden. Inzwischen muss sie jedoch befürchten, dass dieser Plan nicht aufgegangen ist.
»Komm. Trau dich«, sagt Franca. »Ich sage dir auch ehrlich, was ich davon halte, okay?«
Sie gibt sich einen Ruck, öffnet die Mappe und nimmt das erste Blatt in die Hand. »Okay. Erste Seite. Bereit?«
Franca nickt und nimmt zur Stärkung noch rasch einen Schluck Eiskakao.
»Wenn wir Kinder sind, dann ist jeder Tag voller Wunder. Selbst Sonne, Wind oder Regen lassen uns staunen und ehrfürchtig innehalten. Der erste Schnee ist ein Wunder. Ein Schmetterling. Eine Blume. Wir sehen, schmecken, fühlen und riechen die Welt um uns herum, als wäre sie allein da, um uns zum Staunen zu bringen.
Nicht viele Menschen können sich dieses Gefühl bewahren. Die meisten finden sich im Laufe der Jahre damit ab, dass die wundersamen Momente im Leben seltener werden und irgendwann ganz verschwinden. Was uns als Kinder zum Strahlen brachte, ringt uns später nur noch ein müdes Lächeln ab. Was uns als Kinder staunen ließ, lässt uns als Erwachsene mit den Schultern zucken.«
Paula hält inne. Sie fragt sich, ob sie selbst diesen neuen Einstieg gelungen findet.
»Es ist schon mal sehr schön geschrieben«, stellt Franca fest.
»Danke. Aber?«
Franca wiegt unschlüssig den Kopf hin und her.
»Du wolltest mir die Wahrheit sagen. Gib ruhig zu, wenn du es nicht gut findest«, fordert Paula.
»Es ist vielleicht ein bisschen kitschig, oder?«, überlegt Franca laut. »Und denkst du wirklich, dass Kinder so doof sind, dass sie alles, was sie sich nicht erklären können, gleich für ein Wunder halten?«
Paula muss lachen. So hat sie ihre Einleitung bislang noch nie gelesen. »Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann war das bei mir als Kind so«, sagt sie. »Die Geschenke unter dem Christbaum waren für mich ein echtes Wunder.«
»Wirklich? Oder hast du nur so getan, als wären sie ein Wunder, damit du auch im nächsten Jahr wieder Geschenke bekommst?«, fragt Franca.
»Nein! Ganz sicher nicht«, widerspricht Paula energisch, muss dann aber stutzen. »Oder doch?«
»Gib es zu. Als du herausgefunden hast, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt, bist du nicht gleich zu deinen Eltern gelaufen, um es ihnen zu erzählen, sondern hast das schön für dich behalten.«
Paula muss grinsen. »Vielleicht später, als ich älter war.«
»Siehst du«, sagt Franca. »Kinder sind längst nicht so doof, wie Erwachsene immer denken.«
Paula legt die Manuskriptseite zurück auf den Stapel, schließt die Mappe und schiebt sie ein Stück weg. »Egal«, sagt sie. »Vielleicht sollte ich den Rest des Sommers genießen und mich einfach damit abfinden, dass ich keine fertige Arbeit mit nach Hause bringe.«
»Kommt gar nicht in die Tüte«, widerspricht Franca. »Wenn das Buch nicht fertig wird, dann können wir kein Fest bei Faustino feiern. Dabei freue ich mich schon den ganzen Sommer darauf, mit dir Eis zu essen, bis ich platze.«
Paula nickt amüsiert. »Das ist natürlich ein guter Grund, die Flinte noch nicht ins Korn zu werfen.«
»Genau. Du hast gesagt, du willst an diesem Tag alle Eissorten probieren, die du noch nicht kennst.«
»Stimmt. Wäre wirklich schade, wenn ich mir das entgehen lassen würde«, gibt Paula zu.
»Das ist die richtige Einstellung«, lobt Franca und stellt mit entschlossener Miene ihren Eiskakao auf den Tisch. Dabei fällt ihr Blick auf den Brief. »Oh. Du hast Post bekommen.«
»Mhm.«
»Und?«, fragt sie neugierig. »Was steht drin?«
»Weiß nicht. Ich habe ihn noch nicht aufgemacht.«
»Warum nicht?«
»Mach ich später.«
»Bist du nicht neugierig?«
»Doch.«
»Dann mach ihn halt auf.«
»Ich bin einerseits sogar sehr neugierig, aber andererseits befürchte ich, dass ich enttäuscht sein könnte, wenn ich ihn lese.«
»Das wirst du nur erfahren, wenn du ihn liest«, gibt Franca zu bedenken.
»Ich weiß«, erwidert Paula. »Ich werde ihn auch ganz bestimmt öffnen, aber …«
»Dann los, mach ihn auf«, unterbricht Franca. »Jetzt hast du mich auch neugierig gemacht.«
»Ich werde ihn später aufmachen«, sagt Paula.
»Gut.« Franca nickt. »Dann warte ich eben.«
»Viel später«, fügt Paula hinzu.
»Und wann ist ›viel später‹?«
»Vielleicht am Nachmittag.«
»Das dauert ja noch ewig«, beschwert sich Franca.
»Vielleicht mache ich ihn auch früher auf, mal sehen.«
»Soll ich ihn für dich aufmachen?«, schlägt Franca vor. »Ich kann ihn dir auch vorlesen.«
Paula schüttelt den Kopf. »Nicht nötig. Ich mache das schon selbst.« Kunstpause. »Später.«
Franca lässt die Schultern sinken. »Schade.«
»Ich mache dir einen Vorschlag. Wenn du mich morgen wieder besuchst, dann werde ich ihn geöffnet haben«, sagt Paula. »Und dann verrate ich dir auch, was drinsteht, okay?«
»Ich bin zwar eigentlich genau jetzt neugierig«, erwidert Franca. »Aber morgen ist immerhin besser als nichts.«
4
Es wird eine lange Fahrt. Um beizeiten loszukommen, hat Benedikt auf das Frühstück verzichtet. Doch kaum ist er zwei Stunden unterwegs, merkt er, dass er Hunger hat. Meist isst er morgens nicht viel, oft reicht ihm ein Kaffee. Aber heute ist das anders. Sein Aufbruch ins Ungewisse scheint ihn hungrig zu machen.
Er hat sich eigentlich vorgenommen, Frau Hackenbergs Brote mit einem echten italienischen Cappuccino zu genießen, aber Google Earth behauptet, dass er den Brennerpass frühestens in zwei Stunden erreichen wird. So lange kann er nicht warten.
Während er die linke Hand am Steuer und den Verkehr im Blick behält, tastet er mit der Rechten auf dem Rücksitz nach dem Lunchpaket. Er wird fündig, legt es auf den Beifahrersitz und wickelt es vorsichtig aus, was mit einer Hand nicht ganz einfach ist.
Ohne hinzusehen, fischt er eines der belegten Brote aus dem Papier, und weil er volles Vertrauen in die kulinarischen Fähigkeiten von Frau Hackenberg hat, lässt er sich überraschen und beißt einfach hinein.
Er hat ein Käsebrot erwischt. Ein ebenso schlichtes wie ausgezeichnetes Käsebrot. Es besteht aus einer Scheibe altem Gouda, die von zwei Scheiben dunklem Brot freundschaftlich umarmt wird. Der Teig ist traumhaft frisch, nicht zu fest und nicht zu locker. Frau Hackenberg hat die Scheiben nur mit gesalzener Butter bestrichen und auf jede weitere Zutat verzichtet. Kein Salatblatt, kein Dill, keine Gurkenscheibe trüben den puren Genuss dieses Brotes.
Schade, ein solches Meisterwerk hätte er wirklich gern mit einem Kaffee genossen, der diesem Brot ebenbürtig wäre.
Er tastet nach dem Lunchpaket, den Blick weiter auf die Straße gerichtet. Sie hat ihm ein weiteres Brot gemacht, hoffentlich ebenfalls eins mit Käse. Wenigstens dieses könnte Bekanntschaft mit einem italienischen Kaffee machen, denkt er und beschließt, es aufzusparen, bis er in Italien ist.
So gut es mit einer Hand geht, packt er es wieder ein und legt es zurück nach hinten, damit es ihn nicht vom Nebensitz aus in Versuchung führt.
Er muss an die Pausenbrote seiner Mutter denken. Schon zu Schulzeiten hat er sich nicht viel aus Wurstsemmeln gemacht. Ganz anders als sein jüngerer Bruder, der nie genug davon bekommen konnte. Theo labte sich an Schweinshaxen, Rippchen, Würsten und Braten, während Benedikt auch mit einer Gemüsesuppe oder einem Salat zufrieden war.
Der Gedanke an seinen Bruder stimmt ihn melancholisch. Nicht nur beim Essen sind die beiden immer grundverschieden gewesen. Dabei mag auch Benedikt Fleisch, nur eben nicht in so rauen Mengen, wie es in seiner fränkischen Heimat gegessen wird.
Vielleicht war es absehbar, dass er sich in einer Gegend, wo man schon für einen Asketen gehalten wird, wenn man keine Schlachtplatten mag, irgendwann fremd fühlen würde. Wobei er zugeben muss, dass er noch andere Eigenarten hatte, die den Leuten seltsam vorkamen. Nicht nur seine Beziehung zur heimischen Küche, sondern auch seine Beziehung zu Gott war den Dorfbewohnern nicht geheuer. Er verbrachte viele Stunden in der Kirche, versunken in Meditation und Gebet, und gab damit den Leuten Rätsel auf. Wieso sitzt ein junger Mann, der eigentlich ganz andere Dinge im Kopf haben müsste als Gottes unergründliche Wege, ganze Nachmittage lang in einem Gotteshaus?
Hätten sie ihn gefragt, wäre seine Antwort so simpel wie einleuchtend gewesen. Seitdem er denken konnte, interessierte er sich brennend für die Wege Gottes. Deshalb verbrachte er viel Zeit damit, sie abzuschreiten und über die Entscheidungen des Allmächtigen nachzudenken. Manchmal sprach er auch mit dem Gekreuzigten, was irgendwann herauskam und dazu beitrug, Benedikts Ruf als merkwürdiger Kauz zu festigen. Während andere junge Männer sich auf Volksfesten oder in Kneipen und Diskotheken amüsierten, widmete er seine Zeit lieber dem Herrn. All das missfiel seinem Vater, der schon früh befürchtete, seinen Ältesten an die Kirche zu verlieren. Xaver hatte andere Pläne mit Theo und Benedikt. Er wollte seinen Söhnen die Schreinerei vermachen. Einst hatte der alte Steinbach den Betrieb selbst von seinem Vater übernommen. Eines Tages sollten Benedikt und Theo in seine Fußstapfen treten.