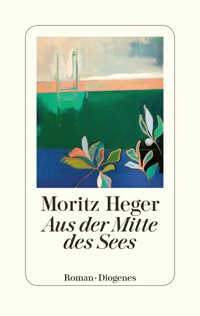20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Für Alex beginnt der Ruhestand. Doch statt Ruhe plant sie den Aufbruch ins Ungewisse: Mit einem Tinyhouse auf Rädern will sie alles Gewohnte hinter sich lassen. Johann, Mitte fünfzig, sucht den Ausbruch aus einem fragwürdig gewordenen Beruf und einer erkalteten Ehe. Ein ererbtes Steinhaus in Ligurien scheint ein guter Ort dafür zu sein. Alex folgt Johanns Einladung: Zwei nicht mehr junge und sehr verschiedene Menschen wollen an diesem Sehnsuchtsort die nächste Lebensetappe angehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Moritz Heger
Die Zeit der Zikaden
Roman
Diogenes
ERSTER TEILLichten
Was können wir tun, außer fortzufahren.
(Armin Senser: Novelle)
1
Alex wird wieder Alex sein. Nicht mehr, was sie sechsunddreißig Jahre lang war, Frau Mattmann. »Fraumaaaattmann!!!« Die hellen Stimmen der Fünftklässler ziehen die erste Silbe des Namens in die Höhe und Länge, dass die eigentlich höfliche Anrede ein einziges Drängen ist. Nestlinge sind es, die um die Wette sperren. Das hat in den letzten Jahren zugenommen. Die sich hinziehende Krise hat es noch verstärkt, wie sie ja vieles verstärkt hat. Man meint, mit den neuen digitalen Tools früh die Selbstständigkeit der Kinder zu trainieren, doch dahinter bricht sich eine umso größere Bedürftigkeit Bahn.
Grundschullehrerin zu sein hätte sie sich nie vorstellen können. Sie ist keine Ersatzmama. Sie betüddelt sie nicht, ist auch mal ironisch. Vielleicht gerade dafür mochten die Kleinen sie ihr ganzes Pädagoginnenleben lang. Aber im Grunde war sie immer eine für die Großen. Wenn man mit denen wirklich etwas anfangen konnte, gingen sie, Jahrgang für Jahrgang. Sie hat ihnen nie nachgetrauert. Fast nie. Sie wusste, das ist Lehrerlos, zurückbleiben, von vorne anfangen, über all dem schleichend altern. Aber nun ist sie es, die geht.
Und draußen wird sie wieder Alex sein und jung, ohne ihre Jahre zu verleugnen, ohne sich zuzukleistern oder gar mit Botox nachzuhelfen. Natürlich und drahtig: ein Anteil erfahrene Füchsin, ein Anteil zupackender Kerl, ein Anteil jugendliche Ausreißerin. Eine gute Mischung für eine Frau jenseits der sechzig. Sie wird sich begehrenswert fühlen, wenn sie an einem dieser schönen Plätze, die ja nun immer mehr entstehen, weil es ein Bedürfnis danach gibt, morgens hinaus ins glitzernde Gras treten, die köstliche, herbfrische Luft tief einziehen und im Hohlkreuz die Arme in verschiedene Himmelsrichtungen recken wird. Sie freut sich auf diese Gemeinschaften auf Zeit, auf spannende Nachbarnomaden. Auf erzählte Lebensreisen, Lebendigkeit, leuchtende Augen im Feuerschein. Auf die große Einfachheit in dieser kleinen, genialen Box, in der alles multifunktional ist, jede Treppenstufe noch Stauraum bietet. Den Kaufvertrag hat sie heute unterschrieben, beim Innenausbau wird sie im Sommer einiges selber machen, nicht nur, um Kosten zu sparen. Ihr Tinyhouse, nicht breiter als eine Fahrspur, wird sie nicht beengen, davon ist sie überzeugt. Vielmehr ihren Raum ins nahezu Grenzenlose öffnen. Ein Standbein wird sie so schnell nicht mehr brauchen. Kann man das haben, zwei Spielbeine?
Sie lächelt: In ihrer alten Schule, wo sie noch eine wichtige Rolle im Kollegium einnahm, hatte sie sich ein Kellertheater ertrotzt und über den Treppenabgang den Schriftzug Spielraum gehängt, geschrieben mit einer Lichterkette, die sie vor Aufführungen verheißungsvoll blinken ließ. Ihr, die ihr hier eintretet, habt Lust auf krasse Erfahrungen. Damals riss sie sich etwas vom Herzen, als sie ihren geliebten, mottenlöchrigen roten Vorhang im kalten Arbeitslicht aus der Schiene zog und zu ihrem Auto trug, mit dem sie niemals aus anderen als aus Theatergründen in den Pausenhof gefahren war. Es regnete, das passte. Sie war allein und musste zweimal gehen. Aber diesen Vorhang hatte sie aus Italien mitgebracht, den nahm sie wieder mit. Auf einer Reise in die Toscana hatte sie ihn einst einem Männlein mit akkurat getrimmtem Schnurrbart im gegerbten Gesicht abgeschwatzt. Durch Zufall und den Spalt einer schweren Tür hatte sie in einem Bergdorf in ein halb verfallenes Theater gelinst, als er plötzlich, gut und männlich nach Rasierwasser riechend, in seinem hellen Anzug mit Hut hinter ihr gestanden hatte: »Non recitiamo più, Signora. Mi dispiace.« Radebrechen, Gestikulieren, Lachen. Ein Flirt wie im Schwarz-Weiß-Film, und am nächsten Tag verließ sie das Dorf mit einem Ballen Samt auf dem Rücksitz, bei dem einem war, als würde er aus seiner Tiefe heraus von selber leuchten. Irgendwo im Keller liegt er noch. Jetzt ist beherztes Sichtrennen angesagt, der Sperrmüll bestellt. Die Bücher fährt sie kistenweise in ein Antiquariat, sie kriegt nichts und muss nichts zahlen, das ist die Abmachung.
Wird sie ihre Altbaumansarde mit den einander so treu zugeneigten Schrägen vermissen? Mehr als einunddreißig Jahre hat sie hier gelebt. Eingezogen ist sie einst mit dem festen Vorsatz: nie mehr Immobilieneigentümerin. Nie mehr Haus & Grund. Ein mit Verlust abgestoßenes Reihenhaus reicht. In der Anfangszeit zwang sie sich, hier alles so einzurichten, wie sie und niemand anders es wollte, inklusive der fitzeligen Kücheneinbauten aus Massivholz mit den Scharnieren, die man niemals perfekt eingestellt kriegt. Wenn sie durch wäre, hat sie wohl geglaubt, wäre sie auch durch mit ihrem Ex. Ein Irrtum. Das heißt, fertig war sie mit ihm schnell, im Grunde noch am selben Abend, als er ihr das mit der anderen sagte. Wie lange das schon ging, dass ihr schlechtes Gefühl berechtigt gewesen war in jeder einzelnen Situation. »Du vertraust mir nicht!« Er hatte recht gehabt. Sie hatte recht gehabt. Es gab nicht zu wenig Recht auf der Welt, sondern zu viel. Den Vertrauensverlust hinterließ er in ihr. Das war ihr ungeborenes Kind, und wenn seither etwas in Fluss kommen wollte, konnte sie sicher sein, dass sie es verkantet in sich spürte wie einen Baumstamm im Hochwasser.
Nicht dass sie keine Männer mehr gehabt hätte. Einmal auch eine Frau. Elisabeth hat sie in einem Workshop für Theater-AG-Leiter kennengelernt, in dieser aufgekratzten Atmosphäre, wo alle gleichzeitig besonders tolle Lehrer und keine Lehrer sein wollen, vielmehr Künstler, aus denen noch bei der banalsten Übung Spielfreude hervorsprudelt. Viel Lachen im Raum und dann eine, die einen nur intensiv anschaut, und wenn man hinterher auf einen Wein mitgeht, weiß man, das Gespräch wird sich nicht um die Kinder drehen. Alex hat es gefallen, sich abschleppen zu lassen. Etwas mit sich machen zu lassen, bei dem sie vorab Nein angekreuzt hätte. Es hat sich jung angefühlt. Und es war dann auch schön. Zärtlich, liebevoller als mit den Männern. Vielleicht zum ersten Mal wirklich liebevoll. Aber ein wenig war es auch wie Langlauf, wenn man Abfahrt gewöhnt ist.
Alex wandert durch die Zimmer. Der unterschriebene Kaufvertrag, der auf dem Küchentisch liegt, rückt die Möbel, obwohl alles noch an Ort und Stelle ist, etwas ab. Eigentlich ist das ein seltsamer Tausch, denkt sie: Man räumt den Möbeln Platz ein in der Hoffnung, dass sie einem einen Platz in der Welt schaffen. Um den Gründerzeitsekretär, den sie von ihrer Mutter geerbt hat und der eine der wenigen geraden Wände besetzt, wird es schade sein.
Sie kommt ins Bad. »Wer baut so was?«, hat sie Gerd lachend gefragt, als sie es das erste Mal sah. Gerd war ihr Vermieter und ist jetzt auch schon seit fast drei Jahren tot, nachdem alle Beatmung nichts genutzt hat. Bei der Besichtigung damals war er quicklebendig, ein T-Shirt-Typ, der immer einen Schnitz Rücken oder Bauch zeigte und manchmal bei der Arbeit den Ansatz der Pofalte. Einer, der in all seiner prallen Beweglichkeit Heimat ausstrahlte, dessen Schweiß nicht abstieß. Der kuriose Schnitt war wohl ein Grund dafür, dass sie die Wohnung bekommen hat, hier kann eigentlich nur ein Single wohnen. Oder ein sehr symbiotisches Paar. Man muss durch alle Räume durch, wenn man wo hinwill. Und durchs Bad aufs Dach. Durch dieses Riesenbad mit der leeren Mitte. Dabei war sie nie eine, die ewig Toilette macht. »Wer baut so was?«, hat sie ihn auch wieder gefragt, als das Klo mit dem überlang den Kniestock suchenden Abflussrohr verstopft und er spontan mit hochgekommen war. Warum das Vermieterpaar im Erdgeschoss wohnte, hat sie nie verstanden, im ersten oder zweiten Stock hätte man den schöneren Blick und wäre mehr für sich. Aber Gerd und seine Frau waren keine, die residierten. Helga hält jetzt noch die Stellung als ihre eigene Concierge, sie sind locker befreundet. Alex erklärt ihr Sachen am Computer. Gerd musste man damals nur anfassen, als er danach die Hände wusch, nicht berühren, anfassen, mit beiden Händen, und alles Weitere ergab sich. Sie mochte das klatschende Geräusch.
Sebastian hat sie geliebt. Er war ihr Schulleiter an ihrem alten Gymnasium, mit dem sie sich identifizierte. Ja, auch mit dem Gebäude – und damit meint sie nicht nur ihr Theaterchen, zu dem es im Hof runterging, sie meint auch und gerade die Fassade mit den riesigen Rustikasteinen und Säulen, der Freitreppe und den Graffiti. Die stolze Schule war im späten neunzehnten Jahrhundert auf dem Streifen Land errichtet worden, das dem Rhein beim Begradigen abgerungen worden war. Alex hatte eine besondere Beziehung zu dem klassizistischen Kasten, wenn er leer war und man allein durch Gehen das Licht anspringen ließ. Das Altehrwürdige hatte die Jugend ausgeatmet und hielt einen langen Moment inne, bevor es sie wieder einsaugen würde. Als Theatermacherin war sie damals oft die Letzte, die ging, sie war die, die sich mit den migrantischen Putzkräften duzte. Genau genommen war sie natürlich die Vorletzte. Sebastian hauste ja nahezu in seinem schmalen Büro. In diesem Flur musste man auf den Lichtschalter drücken, was sie niemals tat, denn sie kannte den Weg und mochte den Lichtstrich unter der Tür.
An dem einen verhängnisvollen Donnerstag im April 2011 ist sie nicht zu ihm hinaufgegangen, obwohl er sich für die letzte Aufführung angekündigt hatte und obwohl Dr. Egyptien nicht der Typ war, der einen Platz, auf den er einen Zettel mit seinem Namen hatte kleben lassen, leer ließ. Repräsentation nahm er ernst. Alex hat gedacht, er käme nicht, weil sie sich gestritten hatten. Sie hat ihn noch für kindisch gehalten, dass er nun einfach ihrem Theater fernblieb und die Schüler mitbestrafte. Sie war die Kindische, so zu denken. Vielleicht hätte sie ihn retten können. Es hieß zwar, er sei sofort tot gewesen, dennoch wird sie sich das nie ganz verzeihen können.
In ihrer neuen Schule, auch nach zwölf Jahren und bis zum Ende wird es ihre neue sein, ist sie froh um ihre Nische, lässt es laufen und auslaufen. Theater hat sie hier nie mehr gemacht. Im Sommer wird an ihrem Platz im Lehrerzimmer nur eine Schlangenhaut zurückbleiben, die die Jungen, wenn der Herbst kommt, nicht mehr als solche erkennen und zwischen den Fingern zerreiben werden, Alex lächelt.
Zwei Männer hat sie wirklich geliebt in ihrem bisherigen Leben. Sie weiß nicht, ob das eine magere oder eine normale Ausbeute und sie nur ehrlich ist. Die beiden waren gegensätzlich. Den Studienfreund, den Gleichaltrigen, hat sie einst geheiratet. Liebe war ein Projekt. Das klingt prosaisch, aber das war es nicht. Die Zukunft war, als sie knapp halb so alt war, ein lehmiger Baugrund, an dem sie sich trafen, von den verschiedenen Schulen kommend, an die sie nach dem Referendariat geschickt worden waren. Die Erde lag offen, und sie legten ihre Fantasien übereinander, sodass das Haus in 3-D vor ihnen stand. Sie sahen ihre Kinder, zwei, schon im Gras tollen, in einem satten, aus dem Paradies herüberleuchtenden Grün, scherzhaft stritten sie über die Namen. »Fürchtegott«, sagte sie, weil ihr kein Name einfiel, an dem man mehr angeeckt wäre. »Ich wollte schon immer einen kleinen Gotti als Stammhalter«, grinste er. »Oder Fürchti, das darfst du dir aussuchen.« Sie küssten sich, und dann schwang sie sich aufs Rad und gewann das Wettrennen zu ihrer Wohnung gegen ihn im Auto. Es war Liebe, von ihrer Seite bis zum Schluss, sie stürzte wie diese Brücke in Genua ein. Nie wird sie wissen, ob nicht von Anfang an der Riss der Lüge durch ihn ging.
Dr. Sebastian Egyptien maß fast zwei Meter und faltete sich bei Gesprächen immer in denselben Sessel aus weichem cognacfarbenen Leder, das an den beanspruchten Stellen längst gelb gerieben war. Alex kann sich nicht vorstellen, dass jemals jemand anders darin saß. Wo der Sessel wohl hingekommen ist? Er wird vermutlich den Weg allen Fleisches gegangen sein. Oder er ist in irgendeinem abgeranzten Schülerkeller gelandet, wo einem der Geruch von Kiffen entgegenschlägt. In ihrer neuen Schule gibt es keine ungenutzten Räume, gibt es überhaupt keinen Keller und auf der digitalen Lernplattform natürlich schon gar nicht, den die Jungs und Mädels erobern könnten, in einer konzertierten Aktion befreien von altem Krempel und eh man sich’s versieht vollkrempeln mit neuem altem Zeug. Heute gibt es auch keine Kontinente mehr zu entdecken. Nach dem Abi fliegen sie zwar in die hintersten Winkel Afrikas, aber nicht ohne vorher die ausufernden Blogs und Vlogs ihrer Vorgänger angeschaut und Bewertungen und Rankings studiert zu haben. Von allem haben sie ein Bild, bevor sie es kennenlernen. Sebastians alter Sessel, seine verlorene Form. Wenn sie ihn morgen an der Straße stehen sehen würde, bereitgestellt zum Sperrmüll, vollgeregnet, sie würde ihn mitnehmen, mitnehmen in ihr Tinyhouse, wo er natürlich im Weg und fast schon ein Schandfleck wäre. Doch würde sie abends darin sitzen, ein hochgezogenes Knie umschlungen oder einen Fuß unters Gesäß gesteckt wie er, ihr Weberknecht. Sie würde durch das Panoramafenster, deshalb hat sie sich für dieses Modell entschieden, hinausblicken, bis der Wald vom Dunkel verschluckt und sie allein mit ihrem Spiegelbild und ihren Erinnerungen wäre, einsam auf eine umhüllende Art. All God’s children need travelling shoes … Look my eyes are just holograms … From my hands you know you’ll never be / More than twist in my sobriety.
Genau einen gemeinsamen Urlaub haben sie gemacht. Fünf Tage Ammersee, fünf Tage knallblauer Himmel. Während er zu Hause darauf bedacht war, nicht mit ihr in einer irgendwie zweideutigen Situation gesehen zu werden, küsste er sie hier, vierhundert und nicht etwa viertausend Kilometer entfernt, mitten auf der belebten Promenade. Wollte Sebastian damals einen Schubs vom Schicksal? Fünf Tage waren sie ein eingespieltes Team, im hellen Sonnenschein hatten sie das Unnormale dieser Normalität fast vergessen, wenn es Abend wurde, bekam es etwas Fiebriges. Sie gingen baden und edel essen, machten Wanderungen, schleckten in einem mittelalterlichen Städtchen Eis und hatten nachts bei sperrangelweit offenen Balkontürflügeln den heftigsten Sex ihres Lebens. Sie hatten die Suite genommen, das Teuerste, was es gab – er zahlte –, natürlich mit Seeblick, den sie viel zu wenig würdigten, doch nachts gebaren ihre verschwitzten Leiber einen Ghul oder Dschinn, der das für sie tat und in wilder Körperlosigkeit über der mondbeschienenen Wasserfläche Loopings schoss, während sie sich drinnen in ihn verbeißen musste, um nicht zu laut zu sein – so fest, dass er es war, der schrie. Bis heute kann sie nicht sagen, warum Sebastian keine offizielle Beziehung wollte. Gut, Chef und Mitarbeiterin, das schafft gewisse Spannungen. Andererseits ist es der Klassiker. Sie wären nicht die Ersten gewesen. Sie waren nicht die Ersten. Klar gab es auch die Geschichte mit seiner Ex-Frau, doch die war damals seit etlichen Jahren eben das, Geschichte. Sebastian hatte wirklich alles für sie getan, was er konnte. Irgendwann kannst du nicht mehr tun. Irgendwann musst du dich befreien. Über diese Schiene waren sie anfangs überhaupt einander nähergekommen, sie hatte ihm ein offenes, weibliches, unhysterisches Ohr geboten. Ein Personalentwicklungsgespräch am Spätnachmittag, er hatte sich schon aus seinem Sessel hochgestemmt, um noch das dusselige Protokoll zu holen und auszufüllen, doch dann ging es in die Verlängerung, mit Rollenumkehr und ohne Formular. Der Moment, in dem sie begriff, wie einsam Könige sind. Denn das war er, ein weiser, prophetischer, aus heutiger Sicht sicherlich veralteter König. Ein Ohr ohne Hintergedanken hat sie ihm geboten. Das ist die reine Wahrheit. Es brauchte dann ja auch Jahre. Wuchs im Stillen, und als sie sich endlich über Begrüßung und Abschied hinaus berührten, war es aufregend neu und zugleich so, als würden ihre Hände in den Hafen des jeweils anderen einlaufen.
Das Bild passte auch später, nur dass, was daran schön gewesen war, nun nerven konnte. Behutsam wie ein Hafenlotse manövrierte sie das Gespräch dann und wann, weiß Gott nicht ständig, in die Richtung einer gemeinsamen Zukunft. Er wurde entweder kurz angebunden oder aber weitschweifig, allgemein und philosophisch. Er flüchtete sich in Melancholie, nebelte sich in seiner Gesamtverantwortung ein wie ein Oktopus. Sie hasste das. Sie hasste es, wenn er spitzfindig wurde und sich darauf zurückzog, er habe ihr nie falsche Versprechungen gemacht, so als wäre das zwischen ihnen ein zu erfüllender Vertrag und sie füreinander Waren mit zugesicherten Eigenschaften. Das machte alles so klein! In solchen Momenten hätte sie ihn schlagen wollen, nur um ihn zu treffen. Ein Schlag ist ein Punkt, eine Definition. Manchmal sehnt sie sich in diesem zivilisierten, lauen Dahingleiten danach. Schuldbewusst bemerkt sie das allzu Konkrete des Gedankens: Er ist ja an einem Schlag gestorben oder zumindest an etwas sehr Ähnlichem, einem geplatzten Aneurysma.
An Heirat hat sie gar nicht gedacht, das wäre für sie wenn überhaupt der dritte oder vierte Schritt gewesen. Alex ist eigentlich sicher, dass es keine andere gab. Nach dem Tod kommt so etwas doch raus. Aber es gab keine böse Überraschung an der Engstelle des Grabs, wo man sich in eine Reihenfolge des Nahestehens einfädeln muss, es gab keine Fee zu viel. Nur den Moment, in dem du allein an der Kante der Welt stehst, in dem es ein Leichtes wäre, vornüberzukippen, auf die hohl tönende Kiste aufzuschlagen und vor aller Augen bei ihm zu liegen.
Das ist auch schon wieder, Moment, fast zwölf Jahre her. Die Beerdigung fand Ende April statt. Man hatte sie so weit nach hinten geschoben, wie es ging, damit alle aus den Osterferien zurück waren. Er hatte immer im Scherz gesagt, er sei mit seiner Schule verheiratet – ein Spruch, zu unoriginell, um nur ein Scherz zu sein –, und nun waren über tausend Trauergäste zusammengekommen. Die Sonne strahlte die Welt an, das Grün schien in diesem Jahr jünger und frischer als sonst, es passte wie die Faust aufs Auge. Aber weil man an so einem Tag in Watte wandelt, passte es auch wieder gerade. Dass die Natur sich nicht um einen scherte, dass das Leben weiterging, war ein Gruß vom anderen Flussufer herüber, ein angemessen schwacher Trost. Sie hatte sich gewundert, wie viele Kollegen und vor allem Kolleginnen ihr so tief in die Augen schauten und sie so fest in die Arme schlossen, dass klar war, sie wussten alles – oder das, was man wissen konnte, sie hatte ja selbst das Gefühl, mit einem Geheimnis zusammen gewesen zu sein. Spontan hatte sie beschlossen, sich am Grab umzudrehen und das Gedicht zu sprechen. Laut vor aller Welt. Ihr Gedicht. Zum Kaffeetrinken ging sie nicht mit. Man sagt ja immer, und es stimmt ja auch, dass da gelacht wird, wenn eine Anekdote über den Verstorbenen die nächste hervortreibt, dass das allen guttut. Aber ihre Geschichten, ihre Geschichte mit ihm, damit musste sie an den Fluss und rennen, und hinterher saß sie die halbe Nacht hier auf ihrem Dach, so lange, bis sie und der Schornstein Brüder waren.
Mehrfach in ihrem Leben hat Alex sich gefragt, ob sie einen Vaterkomplex hat. Das war schon bei ihrem Linguistikprofessor so. Obwohl da nie wirklich etwas lief. Er hatte nur einen Arm und einen aufgeschraubten Knauf auf dem Lenkrad, und wenn er sie nach dem Oberseminar noch zum Italiener kutschierte, hatte sein Fuhrwerken etwas Kühnes. Wie ein Adler schoss er in die engste Parklücke, nur einmal flog mit einem Knall der Außenspiegel ab, der eigene oder fremde, das weiß sie nicht mehr. Auf den Professor war ihr späterer Mann, damaliger Kommilitone und Freund, sehr eifersüchtig. Sie hat nur gelacht. »Auf einen Krüppel …!« Das Wort sagte man damals. Bei Sebastian warfen die Freundinnen die Frage erneut auf. Wenn sie heute daran denkt, ärgert sie das. Ist man in einer asymmetrischen Beziehung, wird einem um die Ohren gehauen, was alle doch auch in den sogenannten normalen Beziehungen suchen, die Befriedigung ureigenster Bedürfnisse. Und eben weil es die ureigensten sind, sind sie einem nicht erklärlich, nicht vollständig, und schon gar nicht einfach veränderbar. Aber bei einer solchen Beziehung heißt es nicht, wie schön, dass du einen gefunden hast, der dir gibt, was dir offenbar kein anderer geben kann. Nein, da heißt es Komplex, das wird abgetan. Da wird man gleich als unselbstständig hingestellt. Manchmal denkt sie, darin drückt sich tiefer Neid aus. Wie soll denn Liebe, echte Liebe, gehen, ohne sich abhängig zu fühlen? Das ist doch das Intensivste daran. Das Wehste und Schönste. Ist das nicht auch ein Komplex, vielleicht ein viel verhärteterer, sich auf nichts wirklich einzulassen?
Gedankenlos öffnet sie einen Umschlag, den sie beim Hereinkommen auf die lederbespannte Platte des Sekretärs geworfen hat. Sie hätte sogar noch einen Brieföffner. Auch ein Erbstück. Aber er ist nie zur Hand, immer hat es der Finger schon erledigt und das Kuvert zerfetzt. Bei Nebensächlichkeiten ist sie nachlässig, bei Kunstwerken wird sie zur Perfektionistin. An dem Reihenhaus samt dem Handtuch von Garten war damals vieles ihr Kunstwerk. Das einfach aufgeben zu müssen, verlassen zu müssen als etwas schon in diesem Augenblick Fremdgewordenes, war schmerzhafter als der finanzielle Verlust, obschon sie an dem noch jahrelang zu knabbern hatte. Die unter die Schrägen gebastelte Küche in dieser Wohnung war dann auch wieder ihr Kunstwerk. Und der Innenausbau des Tinyhouse wird das nächste sein und natürlich das Tinyhouse als Ganzes. Deshalb hat sie sich das ja gewählt. Ohne Kunstwerk, irgendein kleines Kunstwerk, wäre Alex tot.
Kunst heißt für sie nicht, aus dem Vollen schöpfen. Kunst ist, das Beste daraus machen. Mach halt das Beste draus, für viele ein achselzuckender Satz. Aber nicht für sie. Das Beste, wenn es das wirklich ist, wenn es das gerade unter beschränkten Bedingungen wirklich ist, leuchtet immer. Polier es, geh noch mal drüber, sei zärtlich, und es wird leuchten.
Was sie aus dem Umschlag zieht, ist eine Hochzeitseinladung. Für das edle Material der Klappkarte, exakt die Mitte zwischen Papier und Pappe, müsste das Wort haptisch erfunden werden, wenn es es nicht schon gäbe. Innen ist in gediegenem Grau Text gedruckt. Aber den Platz ringsum füllt blaue Tinte. Es ist ganz schön lange her, dass Alex einen handschriftlichen Brief bekommen hat, und das hier kann man schon so nennen. Die Girlanden einer typisch weiblichen Schrift. Alex selbst hat nie so geschrieben, aber Hunderte ihrer Schülerinnen. Während deren Aufsätze um optische Perfektion bemüht waren, als gäbe sie dafür die Eins, hat die Schreiberin hier die Ränder in alle Richtungen gefüllt. Man muss die Karte beim Lesen drehen. Die Unterschrift ist, auf dem Kopf stehend, ganz oben auf dem letzten freien Streifchen gelandet: Wibke Wieczorek, geb. Müller, entziffert sie.
Erinnern Sie sich noch an mich? Ich erinnere mich gut an Sie. Gut im doppelten Sinne, liebe Frau Mattmann! Sie haben mir in der Jugend sehr geholfen. Ohne Sie und das Theater wäre ich nicht die, die ich bin. Am Ende lief manches schräg – das war ja ein Lieblingswort von Ihnen. Und dann waren Sie weg. Sonst hätten wir vielleicht beim Abiball schon Schwesternschaft getrunken. Es wäresehrschön, wenn Sie zu unserer Hochzeit kämen. Gerne mit Partner. Dominik würde sich wirklich freuen, Sie kennenzulernen. Ich habe ihm viel von Ihnen erzählt. Auf dem Standesamt waren wir schon, nun kommt die große Sause!
Vorne auf der Karte ist ein Schwarz-Weiß-Foto eingedruckt, auf dem sich eine junge Frau mit hübschem, pausbäckigem Gesicht und üppigen Formen – das figurbetonte Kleid verunklart nichts – an einen jungenhaften Mann im Anzug schmiegt. Dominik. Schön und passend. Sein Haar ist dunkler als ihres. Die kleinen Wülste unter seinen lächelnden Augenschlitzen und die ganz am Ende hochgebogenen Mundwinkel lassen ihn etwas schüchtern und sehr nett erscheinen. Kein Draufgänger, denkt Alex, ein Auf-sie-Eingeher, und sie hat das Bild, dass dieser Mann seine Frau nach einem anstrengenden Tag fragt, was sie trinken will, es ihr mixt und zum Sofa trägt und ihr dann die rübergestreckten Füße massiert. Alex würde jetzt gerne von Händen, die nicht ihre eigenen sind, angefasst werden, und das meint sie gar nicht in erster Linie erotisch, in zweiter vielleicht.
Das Bild, das reale, ist alles andere als ein Schnappschuss. Es will etwas Gültiges zeigen. Ein gutes Bild. Wenn auch sehr konventionell. Auch Sause ist ein überraschend altmodischer Ausdruck. Keine Jugendsprache, auch nicht von vor zehn oder zwanzig Jahren. Alex würde das Wort höchstens ironisch gebrauchen. Aber bei der jungen Frau, da ist sie sich sicher, ist nicht die gleiche Ironie im Spiel. Eher eine neue, verspielte Ernsthaftigkeit.
Die vornehme Karte, und dann schreibt sie einfach rein, statt einen Brief beizulegen. Das gegenderte Schwesternschaft, aber dann nimmt sie ganz traditionell den Namen des Mannes an und legt den eigenen ab. Und dass sie ihn mit geb. anfügt, macht es noch traditioneller. Die Sorge, nicht wiedererkannt zu werden, kann eigentlich nicht der Grund für Letzteres sein: So viele Wibkes gab es in der Theater-AG nicht, das wissen sie beide, und das Foto ist doch eindeutig. Zum ersten Mal fällt Alex auf, wie verquer das Wort Mädchenname ist: Erst wenn du keines mehr bist, kannst du einen kriegen.
Ob die Braut nach der Seltenheit und dem Klang gegangen ist? Wieczorek schafft eine Alliteration, Müller ist Dutzendware. In Alex’ Augen wäre das trotzdem kein hinreichender Grund. Aber es ist ja nicht ihr Name, sondern Wibkes. Jedenfalls machen diese wie beim Mikadospiel ineinandersteckenden, in verschiedene Richtungen weisenden Pfeile sie neugierig. Und was ihr Herz berührt: die kleine energische Unterstreichung des sehr.
Wibke hat sich gemacht. Sie ist ähnlich beleibt wie damals, als sie zu ihr in den Spielraum kam. Aber sie hat eine ganz andere Ausstrahlung. Die Augen leuchten, und darum ist auch der Körper ein anderer. Zwischendrin, in der Oberstufe, hatte sie abgenommen. Alex, die immer schlank ist, das sind ihre Gene plus ihr unstillbarer Bewegungsdrang, denkt: Warum sehen wir so ein Runter und Rauf, so ein Jo und Jo als Niederlage? Man könnte auch von Körperkleidern sprechen. Ein Kleid muss man nicht sein Leben lang tragen.
Als sie zu Beginn der Zehnten in die Theater-AG kamen, war Wibke eindeutig die Mitgeschleppte. Ariane warf ihre rotblonde Mähne, sie war ihre eigene Bühne. Brauchte eigentlich keine, wollte umso mehr darauf. Wibke war die, die, wie es bei Freundinnenpaaren in der Pubertät oft ist, den Plural vollmachte. Sie litt unter ihrer Leibesfülle. Sie war die im Schlepptau, die sich abschleppte an sich selbst.
Das ist Alex in all den Berufsjahren immer wieder schwergefallen, so zu tun, als hätte sie einen weniger scharfen Blick, als sie ihn nun mal hat. Frauen verzeiht man im Lehrerberuf Gnadenlosigkeit weniger als Männern, nach wie vor.
Aber dann gab es diese eine Situation. Die erste Performance, in der das dicke Mädchen alle überrascht hat – mit seiner Wahrheit. Eine Performance, die man, während sie ablief, kaum aushielt, doch an deren Ende der erleichtert und ungläubig lächelnde Teenager auf einmal berührend schön war. Und das ist kein Pädagogengeschwätz. Alex hat es so empfunden und nicht nur sie, auch die Gleichaltrigen, was natürlich für Wibke viel wichtiger war. Sie hätte sie hinterher umarmen mögen, aber das wäre gerade das Falsche gewesen, das war ihr klar. Sie haben mir sehr geholfen. Wie selten man das als Lehrerin hört. In Alex’ Erinnerung hat sie nichts dazugetan, oder fast nichts, alles kam von dem Mädchen. Vorher hätte man ihr eine solche Wucht nicht zugetraut, und auch hinterher schloss sich das wieder, die übergroße Wunde, deren Zeigen eine solche Wirkung gehabt hatte. Gott sei Dank, muss man wohl sagen.
Alex war es sechsunddreißig Jahre lang wichtig, dass Lehrer ein unmöglicher Beruf ist. Hier kann man Erfolg nicht machen, man kann keine Menschen fertigen. Du gibst Raum, und das ist eigentlich alles. Im Spielraum gewann das damals Gestalt. Die Trauer über seinen Verlust versetzt ihr auch jetzt noch einen Stich. Und plötzlich muss sie an die Erfahrung denken, die sie leider nie hat machen können, die einer Schwangerschaft. Aber die Erfahrung kennt sie trotzdem. Vielleicht mehr als manche Frau, die einmal im Leben ein Kind gekriegt hat und dann noch auf einem Kaiserschnitt bestand, um alles planen zu können. Sie blickt von ihrem Dach über die vertrauten Hinterhäuser und leicht schäbigen Höfe zum Fluss, von dem sie ein kleines Stück sehen kann, durch das die Schiffe fahren. Ihr Nachmieter wird das nicht mehr können. Sie schließen die letzte Baulücke. Die Erben versilbern das Grundstück, nachdem ihre starrsinnige Ahne, die mit einem halben Dutzend Katzen in der letzten Kriegsruine der Stadt hauste, mit fast hundert das Zeitliche gesegnet hat.
Sie weiß nicht, ob sie jemals Kunst gemacht hat in ihrem Kellertheater. Ihre Aufführungen waren, wenn sie ehrlich ist, jedes Mal eine Spur krampfig und gewollt. Gewisse Momente der Proben unwiederholbar. Das Eigentliche war immer das Innere, geschah in der Gruppe. Aber Wibkes Performance war Kunst. Geballte Kunst. Mit fünfzehn hat sich das Mädchen entschieden, eine Baumwurzel zu sein, nein, dazu gestanden, dass sie nun mal keine zarte Blüte ist, sondern eine knubbelige Baumwurzel. Mit fünfzehn konnte sie die Straße sprengen.
Am Ende ihrer Dienstzeit sieht die Lehrerin noch einmal in ihrem Privatkino – Theater baut Privatkinos in die, die es lieben – eine Szene vom Anfang eines Schuljahrs. Wie immer hatte sie Aushänge gemacht und einige vielversprechende Schüler gezielt angesprochen. Alle sind geschmeichelt, die meisten erscheinen dann doch nicht. Aber acht kamen vorige Woche. Mal wieder sieben Mädchen und bloß ein Junge. Beim ersten Treffen wurde nur geredet. Doch was heißt nur? Alex hat die Erfahrung gemacht, wenn sie die Jugendlichen direkt fragt, was sie spielen wollen, nennen sie Filme, Serien, Fernsehformate. »So was wie …« Aber sie will nichts nachspielen. Deshalb ist sie dazu übergegangen, sie zunächst in ein zielloses Gespräch zu verwickeln, fast wie ein Psychoanalytiker mit seiner gleichschwebenden Aufmerksamkeit. Erst mal kommen lassen. In der AG soll sich im Gegensatz zum Unterricht Frau Mattmann verdünnisieren. Alex soll eine Chance bekommen. Fürs Erste als verständnisvolle Zuhörerin, die dann doch einen überraschend lockeren Spruch bringt. Das war sie gern, die unkonventionelle Patentante, die sie cooler als die eigene Mutter finden. Eine, die sich reindenkt in die Labyrinthe der Pubertierenden, ihre Minotauren aushält. Die nicht immer gleich Antworten und Lösungen parat hat. Ein Grundproblem von Schule, durch die ganze Digitalisierung noch verschlimmert, ist ja, dass die Antworten vor den Fragen feststehen. Schule ist immer weniger einfach ein Ort und immer mehr eine künstliche Intelligenz, die die Schüler immer feiner programmiert. Solche Entwicklungen kann man wohl nicht aufhalten. Aber in der Theater-AG konnte sie es damals, ein Stück weit.
»Das nächste Mal bringt bitte einen Gegenstand mit«, hat sie am Ende des ersten Treffens gesagt. »Mein Ding. Und damit spielt ihr den anderen eine kleine Szene vor.« Die Nachfrage kam, ob das wirklich alles sein könne. »Klar. Ist ja dein Ding, nicht meins. Einen Tipp gebe ich euch noch. Nehmt nichts, was schon von sich aus eine klare Bedeutung hat. Nicht die Gitarre oder den Tennisschläger. Lieber etwas, dem du erst auf der Bühne die Bedeutung verleihst. Das ist spannender, für uns und für dich.«
»Kommen die dann in unserem Stück vor?«
»Wer?«
»Die Sachen, die wir mitbringen.«
»Das müssen wir erst mal sehen. Was das ist. Wer ihr seid.« Sie blickt das dicke Mädchen aus der 10c an, das noch geblieben ist, während ihre hübsche Freundin schon hell lachend mit den anderen ans Tageslicht zurückgekehrt ist. »Wer wir sind«, setzt Alex hinzu. »Weißt du, so eine Theatertruppe ist etwas ganz Eigenes. Ein Körper für sich, der sich erst mal finden muss.«
Sie weiß noch genau, dass sie das gesagt hat. Weil sie weiß, dass sie sich im nächsten Moment fragte, ob die Worte nicht angesichts der Überfülle der vor ihr Stehenden unsensibel waren. Muss jemand wie Wibke nicht aus jeder Erwähnung von »Körper« eine Anspielung heraushören? Aber irgendetwas nachzuschieben würde alles natürlich nur schlimmer machen.
»Ach so«, sagt das Mädchen. Es kramt umständlich in seinem Rucksack, man gewinnt den Eindruck, er sei innen viel tiefer als außen. Weiß sie, was sie sucht? Gibt es überhaupt, was sie sucht?
»Weißt du denn schon, was du nehmen willst?«
»Ich?«
»Als Ding.«
»Nee.« Das Mädchen lächelt entschuldigend. Erwartet sie einen Impuls der Lehrerin? Alex könnte sagen, sie solle doch etwas nehmen, was die anderen gar nicht sehen könnten. Etwas in diese Richtung, etwas Philosophisches. Aber das macht sie nicht. Sie schlägt keine Lösung vor, was sie auflöst, ist die Situation, die es in der Schule viel zu oft gibt, dass man bloß voreinander steht und redet, statt etwas zu tun. Mit einem Sprung ist die AG-Leiterin auf der Rampe, geht über die federnden Bretter, macht sich daran, die noch im Kreis stehenden Stühle zusammenzustellen. »Und man kann wirklich alles nehmen?«, hört sie die Zehntklässlerin halblaut sagen. Die Frage ist offenbar nicht mehr an sie gerichtet. Aber irgendeine Fledermaus von Frage hat ihr das Mädchen in die Höhle gehängt. So plump der Teenager, so zartknochig dieses im Dunkeln verborgene Tierchen. Alex gibt den überfeinen Sinnen von der Bühne aus Antwort, doch nicht wie eine Schauspielerin, sondern mit der Burschikosität des beschäftigten Bühnenarbeiters: »So ein Theater ist was Tolles. Wenn ich daran denke, wie lange ich um das hier kämpfen musste. Und jetzt habe ich den Spielraum auch schon sieben Jahre. Für manche war das ein Zuhause. Auch nach dem Abi kommen sie noch zu den Aufführungen, manchmal von weit her. Das war immer unser Motto: Wenn du hier oben stehst, bist du cooler als die unten. Weil du dich traust. Tschüs, Wibke.« Die Angesprochene dreht sich, schon nah an der Tür, ertappt um und hebt im Halbdunkel kurz die Hand. »Tschüs.«
Und nun steht sie drei Stufen über dem kleinen Zuschauerraum im Lichtkreis des Spots. Im Dunkel die Kameraden, die die Challenge, wie sie es nennen, allesamt schon hinter sich haben. Man war freigiebig mit Lob: quid pro quo. Ariane war nach einhelliger Meinung die Beste. Sie ließ eine rote Kordel sich verwandeln vom Springseil zur Schlange, rang und erwürgte sich fast mit ihr. »Weil ich so heiße«, hat sie danach schlicht erklärt. »Das ist doch die mit dem roten Faden.« Und wieder hell aufgelacht. Der Präsentationsnachmittag ist zur Gruppeninitiation geworden, Alex ist zufrieden. Bei so was ruft sie nicht auf. Wer dran ist, ist dran. Als nur noch Wibke übrig war und sich ein paar Sekunden nichts rührte, hat sie sich gezwungen, nicht zu ihr hinzuschauen, sondern wie eine erwartungsvolle Theatergängerin weiter auf die Bühne, ins leere Licht. Sie wollte zeigen, dass sie den kreativen Kräften der Schüler vertraut, aller Schüler. Schließlich kam Wibke. Ihr Schritt war auf den Stufen deutlich zu hören, wirklich ein Auftritt. In der Hand trug sie eine Plastiktüte, gespannt von etwas Länglichem darin. Sie stellte sie vor sich an der Rampe ab und achtete darauf, dass die Tüte nicht zufällig zum Publikum hin offen stand. Dann richtete sich das Mädchen auf und sah zum ersten Mal jemanden direkt an, den Spot. Er blendet sie – aber sie kneift die Augen nicht zusammen –, ihr entschlossenes Gesicht erstrahlt.
Wibke bückt sich wieder und holt – wie laut eine Plastiktüte ist – eine Rolle Klarsichtfolie hervor. Sie fängt bei den Fußgelenken an, sich zu umwickeln, fesselt sie, drückt die Folie noch mal an. Das Mädchen beginnt zu sprechen. Es erzählt von alltäglichen Situationen, in denen es gehänselt, beleidigt und ausgegrenzt wurde, weil es dick war. Dabei wandert es kreisend, indem eine Hand hinten die Rolle der anderen übergibt, an sich hinauf. Die Folie blitzt im Licht, sie knistert. Das Reißgeräusch, wenn die Hände entschieden ein weiteres Stück von der klebrigen Rolle abziehen. Bei jeder Runde dreht sich Wibke erst zur einen, dann zur anderen Seite, achtet aber darauf, frontal zu sprechen. In knappen Worten erzählt sie dem Spot ihre Geschichten, von denen die erste in der Grundschule spielt und die letzte erst ein paar Tage her ist. Bis über die Schultern und Oberarme, ja sogar um den Hals wickelt Wibke sich ein, umschließt sich mit einer durchsichtigen, undurchlässigen Hülle, die sie eng umspannt. Wie eine zweite Haut, sagt man. Doch es ist keine Haut. Es ist die Präsentation auf einem Markt. Die Wülste ihres Bauchs werden unbarmherzig betont, ihre Figur, die das Gegenteil von tailliert ist. Nun sieht man deutlich, die Fünfzehnjährige ist eigentlich noch ein Kind. Ein massiges Kind, das aber noch keine ausladenden Hüften hat und noch keinen Busen, den Jungs sexy fänden. Wäre sie fraulich, das Ganze wäre obszön. Aber erträglicher als so. Was sehen die Gleichaltrigen? Eine gespannte Stille liegt über dem Raum, dessen Dunkel gnädig ist, aber einen auch allein sein lässt mit seinem Blick. Müsste Alex nicht eingreifen? Sie ist selbst wie in Folie gepackt. Klar ist ihr, alles, was sie jetzt tun könnte, wäre eine Beschämung mehr. Ob sie die Lehrerinnenstimme erhebt und unüberhörbar Einhalt gebietet oder ob sie zur Wand schleicht und das Arbeitslicht wie arktisches Wasser einbrechen lässt, die Kunst würde in sich zusammenfallen. Die Theaterlehrerin wäre als Lügnerin, als Verführerin entlarvt. Aber was das Schlimmste wäre: Das Mädchen stünde als nackte Wurst da, vor allen. Und nun ist es ohnehin zu spät: Eine froststarre, statuenartige Puppe glitzert im Licht. Die Performerin lässt die Rolle fallen. Ein Moment Schweigen.
Dann stehen alle auf und klatschen heftig. Langanhaltender Applaus, Wibkes Name wird skandiert. Alex macht mit. Sie ist so erleichtert. So etwas hat sie noch nie erlebt. Als sie sich scheu umblickt, hat ein Mädchen Tränen in den Augen, und auch bei dem Jungen glitzert es feucht.
Zwei Schülerinnen, Ariane und eine andere, steigen spontan auf die Bühne und befreien Wibke. An einer Stelle ist die Folie so dick gewickelt, dass sie sie beim Abziehen wie ein Strick einschnürt und nicht reißen will. Schon ist der Junge, der Friedemann heißt, zur Stelle, hat sein Taschenmesser vom Schlüsselbund gefummelt und reicht es ihnen: »Aber sei vorsichtig, immer vom Körper weg.« Wibke steht noch auf den Bühnenbrettern im Kreis dessen, was von ihr abgefallen ist, da umarmen sie beide Mädchen, halten sie und sich eine ganze Weile fest. Ein Wesen aus drei, man ist einander ein Zelt. Friedemann steht unten vor der Bühne, er lächelt Alex, die immer noch schlaff auf ihrem Platz sitzt, zu, als wollte er sagen: So sind sie eben, die Mädchen.
Wibkes Performance wurde in der AG