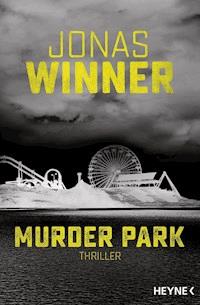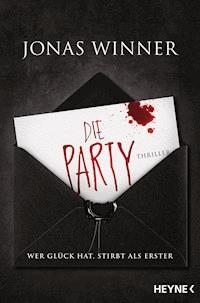6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sammy ist elf und gerade mit seinen Eltern nach Berlin gezogen. Im Luftschutzbunker der alten Jugendstilvilla, die die Familie im Grunewald bezogen hat, macht er eine verstörende Entdeckung. Ein vollkommen verängstigtes Mädchen, nicht viel älter als er, ist dort unten in einer Zelle eingesperrt, die man mit Gummifolie ausgekleidet hat. Nur durch einen winzigen Schlitz hindurch kann er sie sehen. Am nächsten Tag ist die Zelle leer, das Mädchen verschwunden. Und für Sammy kann es dafür eigentlich nur einen Grund geben: seinen Vater.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Jonas Winner
Die Zelle
Thriller
Knaur e-books
Über dieses Buch
Sammy ist elf und gerade mit seinen Eltern nach Berlin gezogen. Im Luftschutzbunker der alten Jugendstilvilla, die die Familie im Grunewald bezogen hat, macht er eine verstörende Entdeckung. Ein vollkommen verängstigtes Mädchen, nicht viel älter als er, ist dort unten in einer Zelle eingesperrt, die man mit Gummifolie ausgekleidet hat. Nur durch einen winzigen Schlitz hindurch kann er sie sehen. Am nächsten Tag ist die Zelle leer, das Mädchen verschwunden. Und für Sammy kann es dafür eigentlich nur einen Grund geben: seinen Vater.
Inhaltsübersicht
PROLOG
Berlin. Schwarzes Aufflackern einer nächtlichen Erinnerung. Dunkelheit. Feuchtigkeit. Kälte. Eine fahle Morgensonne. Trübes Nachmittagslicht. Endlose Nächte.
Wenn ich an Berlin zurückdenke, sehe ich eine Stadtwüste vor mir, Brandmauern, Sackgassen, Baugruben – in Schwärze erstarrt. Feucht glänzende Pflastersteine, vor dunkelgrauem Himmel aufragende Häuserfassaden. Ich sehe Blätter vor mir, dunkel und nass, ich rieche die Fäulnis des vermodernden Laubes. Ich sehe Gaslaternen vor mir, deren Licht im Nebel verschwimmt. Ich sehe Gesichter vor mir, bleich und spitz, ich höre das Tappen der Schritte, das Rascheln der Mäntel, das Flüstern der Stimmen. Wenn ich an Berlin zurückdenke, habe ich einen Geschmack von ranzigem Fett im Mund, den Geruch von Kohl und Kohlen in der Nase. Wenn ich an Berlin zurückdenke, bekomme ich kaltnasse Handflächen und spüre, wie eine Unruhe in meine Beine fährt. Ich höre Gebrüll und sehe nicht, wer so schreit. Ich höre dumpf hämmernde Elektromusik und tappe durch unterirdische Bunkeranlagen. Wenn ich an Berlin zurückdenke, sehe ich Kiefernwälder und Sandboden vor mir, Bretterverschläge und verlassene Straßen. Verstohlene Blicke, Schweigen, Angst und immer wieder Nächte, die niemals enden.
Wenn ich an Berlin zurückdenke, ist es, als ob sich eine kalte Hand, leblos wie Gummi und klebrig wie Honig, auf meinen Mund legt.
Seine Hand.
Die Hand des Fleischwolfs.
Er soll entlassen werden. Morgen schon. Nach fast zwanzig Jahren. Gestern habe ich das Schreiben bekommen. Aus Berlin. Aus einem der Steinpaläste, in denen die unzähligen Behörden untergebracht sind.
Ich sitze am offenen Fenster. Vor mir ein Himmel so weit, dass man ihn mit einem Blick nicht fassen kann. Wasser am Horizont, die Menschen in der Ferne so groß wie Ameisen, Fahrzeuge wie Spielzeugautos, die die Avenues hinunterrollen. Die Sonne scheint, der Tag beginnt, aber die Erinnerung an Berlin, an die Stadt weit im Osten Europas, ist wie ein dunkler Schleier, der sich vor die Sonne geschoben hat. Es ist wie ein verfluchter Nachhall, der nach mir greift. Morgen ist es so weit, die Gitter werden zurückgeschoben, sein Hals wird sich nach vorn recken, die Linie durchbrechen, die den Übergang zur Freiheit markiert. Er wird mit einem Fuß die Linie übertreten und plötzlich – mit einem gewaltigen Satz – im Freien stehen, dem Gemäuer entkommen, den Mauern entrückt. Er wird nicht länger gebändigt sein, er wird sich in Freiheit entfalten und seine Fühler ausstrecken.
Die Nachricht seiner Entlassung hat mich zurückgeworfen in eine düstere Zeit. Ich dachte, ich hätte sie hinter mir gelassen – für immer –, doch jetzt kreisen meine Gedanken wieder darum. Ich will aufschreiben, was damals geschehen ist. Was wirklich passiert ist! Es soll zur Warnung dienen. Es soll mich von dieser Zeit endlich heilen.
Ach was! Ich schreibe es auf, weil es mich erstickt, weil die Erinnerung an diese wenigen Tage, damals, vor fast zwanzig Jahren, in einem Berlin der Schwärze, des Schreckens und des Todes, in mir schwelt wie ein Gift und ich nicht anders kann, als endlich zum Stift zu greifen, diesen Stapel Papier zu nehmen, und aufzuschreiben, was ich erlebt habe.
Damals …
In Berlin …
In einem Sommer vor fast zwanzig Jahren …
Als ich ein magerer Junge war – großäugig, neugierig, verspielt und nicht älter als elf.
Teil I
1
Ich weiß noch, wie wir in Berlin ankamen. Mein Vater und mein Bruder waren wenige Wochen zuvor bereits mit den Möbelpackern vorgefahren. Meine Mutter, ich und unser Au-pair-Mädchen Hannah, das bereits drei Jahre zuvor mit uns nach London gezogen war, sollten etwas später mit dem Flugzeug nachkommen.
Es war ein heißer Tag, wir waren in aller Frühe aufgestanden, um den Flieger zu erwischen, und als wir endlich landeten, hatte ich das Gefühl, die nackte Haut meiner Beine, die unter den kurzen Hosen hervorkamen, würde am Plastik der Sitze festkleben, so sehr glühte die Luft.
Mein Bruder Linus und mein Vater warteten am Gate, an dem wir herauskamen. Ich hatte sie vier Wochen lang nicht gesehen und gleich den Eindruck, sie hätten sich in der kurzen Zeit schon ein wenig verändert. Lag es am ungewohnten Haarschnitt meines Bruders, der neuen Jacke meines Vaters, an einem bestimmten Gesichtsausdruck, den sie sich zugelegt hatten? Ich weiß es nicht. Die Begrüßung war jedenfalls herzlich.
Ein Taxi wartete schon auf uns am Ausgang.
»Ich weiß«, erklärte mein Vater mit einem Blick zu meiner Mutter, »ein Großraumtaxi wäre besser gewesen, aber es war leider keins mehr verfügbar. Meinst du nicht, dass dieses hier auch geht?«
Es ging so leidlich. Es war eng. Ich saß hinten, eingepfercht zwischen Hannah und meiner Mutter, mein Bruder passte nicht mehr hinein. Er meinte, das machte nichts, er würde auch mit dem Bus nach Hause finden. Die Koffer, wir hatten noch einiges an Gepäck mitgebracht, waren in den Laderaum gestopft worden, aber eine Tasche – ich weiß noch genau, wie schwer sie war – stand auf meinen Knien und bohrte sich mit einer scharfen Kante in meine Oberschenkel. Mit einem heftigen Ruck fuhr der Wagen an, gelenkt von einem gedrungenen Glatzkopf am Steuer, den ich die ganze Fahrt über kein Wort sagen hörte, dessen Funkgerät aber unaufhörlich Meldungen und Aufrufe ausstieß, dass ich den Eindruck bekam, ganz Berlin wäre eine Art Ameisenhaufen, und alle seine Bewohner wären ständig über die genaue Position und Geschwindigkeit aller anderen Bewohner informiert.
Um Luft zu bekommen, hatte mein Vater vorne das Seitenfenster heruntergelassen, und ein scharfer Fahrtwind blies mir ins Gesicht, hauchte eisig über die verschwitzten Schultern, die nicht ganz die Rückenlehne berührten und in denen ich ein leises Ziehen von der unbequemen Position verspürte. Gleichwohl war ich froh über den Luftzug, denn – merkten es die anderen nicht? Ich beugte mich ein wenig vor und sog die Luft durch die Nase ein. Erst war es nur ein Hauch gewesen, wie eine verwaschene Erinnerung, ein Hauch so fein und dünn, dass es mir gelungen war, ihn zu verscheuchen. Kaum hatte ich ihn vergessen, kam er jedoch wieder. Ein unangenehmer Geruch, ein strenger Geruch, ein Geruch, von dem ich unwillkürlich Abstand gewinnen wollte, der Geruch nach etwas Verfaultem, aber nicht süßlich, kein Aasgeruch, der ähnlich abstoßend gewesen wäre, eher ein Geruch nach Darm und Verdauung, ein Gestank nach Hundeexkrement, wie ich mir angewidert eingestehen musste, ein Gestank, der wieder und wieder heraufstieg aus dem Fußraum, in dem unsere Schuhe standen. Oder hatte sich ein vorheriger Fahrgast in dem Taxi erbrochen?
Ich warf meiner Mutter einen Blick zu, aber sie hatte den Kopf ganz zurückgelehnt und die Augen geschlossen, sichtlich angestrengt von der Reise und erschöpft. Wahrscheinlich zog der Fahrtwind so durch die Kabine, dass sie gar nichts roch. Auch Hannah, auf der anderen Seite, wirkte ganz ungestört, wie sie durch das Seitenfenster die Häuser und Geschäfte musterte, an denen wir vorbeifuhren. Der Stiernacken des Taxifahrers, daneben mein Vater, der sich mit einer Hand an dem Bügel über seinem Fenster festhielt, eine Sonnenbrille aufgesetzt hatte und starr durch die Windschutzscheibe nach vorne schaute.
Mir war schlecht. Der Geruch unerträglich. Einen zähnefletschenden Hund sah ich vor mir, in dessen Magen sich wer weiß welche Bakterien tummelten und in dessen Haufen auf dem Bürgersteig vor dem Flughafen einer von uns hineingetreten sein musste.
Das soll Berlin sein? Die Stadt, in die wir jetzt zogen? Ich wollte nicht hierher, hatte noch nie hierhergewollt. Die Jahre in London hatten mir gut gefallen, ich hatte Freunde in meiner Klasse gehabt, viel unternommen, das Haus geliebt, in dem wir gelebt hatten.
Diesen Umzug hatte ich nicht gewollt. Meine Mutter aber hatte ein Engagement an der Oper in Berlin bekommen, und es war nichts zu machen gewesen. Meinem Vater war es egal gewesen, für ihn war nur wichtig, dass er ein Arbeitszimmer bekam, in dem er sein Material ausbreiten und in Ruhe komponieren konnte. Als Kollegen meiner Mutter ihr dann auch noch ein Haus in Grunewald vermittelten – »das ist ein Viertel von Berlin«, erklärten mir meine Eltern, weil mir das nichts sagte –, noch dazu für eine vergleichsweise günstige Miete, gab das den Ausschlag, und der Entschluss stand fest: Wir würden nach Berlin ziehen, da konnte ich mich noch so sehr gegen sträuben, es würde nichts ändern.
Also waren Linus und mein Vater vorgefahren, hatten das Haus schon einmal in Beschlag genommen, und Mama, ich und Hannah waren jetzt nur noch mit ein paar Koffern nachgereist.
»Hier ist es.«
Ich schlug die Augen auf, die ich inzwischen ebenfalls geschlossen hatte, und sah es über die grünen Zipfel einer Hecke lugen: ein Türmchen, ein steiles Dach, ein Erker mit bunten Glasscheiben. Ein Haus, fast eine Art Spielzeugburg mit Fenstern in allen erdenklichen Größen und Formen.
»Eine Jugendstilvilla«, jetzt erinnerte ich mich wieder, so hatten meine Eltern gesagt, »du wirst sehen, sie wird dir gefallen, es ist eine echte Jugendstilvilla in Grunewald.«
Ich sprang aus dem Taxi. Der Gestank ließ nach. Wenigstens etwas. Ich schüttelte mich. Noch ein paar Minuten, und ich hätte mich wahrscheinlich zwischen den beiden Vordersitzen übergeben. So aber behielt ich das Flugzeugessen bei mir und rannte an meinem Vater vorbei zu einer Pforte, die im Zaun offen stand und hinter der ein geschwungener Weg ein paar Meter bis zum Eingang der Villa durch einen hübsch angelegten Steingarten führte.
Linus war noch nicht da, mit dem Bus brauchte er natürlich länger. Also blieb es meinem Vater überlassen, uns das Haus zu zeigen. Meine Mutter hatte ihre Sonnenbrille ins Haar geschoben, und ich konnte sehen, dass sie recht angetan war, zugleich aber in Gedanken weit entfernt, wahrscheinlich schon bei dem Termin, den sie am gleichen Nachmittag noch in der Stadt hatte.
»Dein Zimmer ist oben, Sammy.« Mein Vater gab mir einen Klaps auf den Rücken. »Willst du es dir schon mal anschauen?« Er nickte mit dem Kopf zur anderen Seite der prächtigen Halle, die wir betreten hatten. Dort führte eine ganz mit Holz getäfelte Treppe nach oben.
»Ja, gleich.« Ich zögerte. Ein wenig wollte ich noch bei ihnen bleiben, jetzt, wo mein Vater uns gerade so schön herumführte.
Denn so großartig die Villa auch war – ein Gedanke drängte sich mir mit geradezu quälender Hartnäckigkeit auf: Was soll ich die ganzen Sommerferien über in diesem Haus machen?
Mein Bruder war damals ja bereits seit ein paar Wochen in der Stadt und kurz vor den Sommerferien noch in seiner neuen Schule eingeschult worden. Ich wusste, dass er auf Anhieb ein paar Jungen in seiner Klasse kennengelernt hatte, mit denen er sich gut verstand und für die Ferien schon verabredet hatte. Ich hingegen hatte meine Klasse noch in London beendet und sollte erst im September neu eingeschult werden. Das aber hieß, dass ich außer meiner Familie in Berlin niemanden kannte. Was also sollte ich sechs Wochen lang –
»Nun los, lauf schon, sieh dir dein Zimmer an!«
Noch einmal wollte ich mich nicht dagegen sträuben. Ich rannte zur Treppe und sprang die Stufen hinauf. Einen Grundriss hatten wir bereits vorher bekommen, so dass ich wusste, welches Zimmer meins war. Mit weit aufgerissenen Augen betrat ich es. Es war ein wunderbar heller Raum, durch dessen Fenster ich fast den ganzen Garten überblicken konnte, sowie ein Stück der Straße, auf der wir mit dem Taxi gehalten hatten. Über eine große Glastür konnte ich sogar einen schmalen Balkon betreten, der nur zu meinem Zimmer gehörte.
Ich ging zur Balkontür und sah hinunter auf den Rasen, der sich fast wie ein Teppich vom Haus bis zum Pool am anderen Ende des Grundstücks ausbreitete. Meine Eltern und Hannah mussten unten durch eine der Gartentüren bereits hinausgetreten sein, denn ich konnte sie über das Gras schreiten sehen. Zugleich aber lag der Garten so im Schatten, dass ich sie für einen Moment – so dunkel war es dort, wo nicht die gleißende Sonne hinfiel – kaum richtig erkennen konnte.
Ich drehte mich um, schaute zurück in mein Zimmer – und zuckte zusammen. Braunschwarze Flecken. Im gleichen Moment hatte ich ihn in all seiner Widerwärtigkeit auch schon in der Nase. Den Geruch, der mich im Taxi fast wahnsinnig gemacht hatte, den Geruch nach Verdauung, Säure und tierischen Gasen, den Gestank nach Innereien und Ausscheidung. Bestimmt fünf schlammige Flecken zogen sich quer über den beigen Teppich, der in meinem Zimmer bereits ausgelegt war, bis zur Balkontür, vor der ich stand. Ich spürte, wie sich meine Halsmuskeln verkrampften. Vorsichtig, um sie nur ja nicht zu berühren, hob ich meine linke Sandale und sah mir die Sohle an. Sauber. Jetzt die rechte.
Da saß es.
Feucht. Glänzend. Zerquetscht.
Und zugleich schlug mir eine solche Wolke von dem Gestank in die Nase, dass ich förmlich glaubte, mein Gesicht unfreiwillig, aber dadurch nicht weniger heftig in die fleckige Masse gedrückt zu haben. Instinktiv presste ich meinen rechten Oberarm vor Mund und Nase, fühlte, wie sich mein Magen zusammenzog und Säure meine Speiseröhre hinaufstieg. Ein Kribbeln überfiel mein Gesicht, und doch konnte ich den Blick nicht von der Masse lösen, in der ich jetzt glaubte, kleine Bläschen zu erkennen, die fast schimmerten wie Seifenblasen, leicht spritzend platzten und neue Stufen des Gestanks freigaben. Endlich hatte ich die Sandale vom Fuß gelöst und ließ sie, ohne sie noch einmal zu berühren, neben die Balkontür auf den Boden fallen. Dann rannte ich aus dem Zimmer, wobei ich peinlich genau darauf achtete, die schmierigen Flecken auf dem Teppich nicht zu betreten.
So war es, als wir am Rotkehlchensteig ankamen, der kleinen verwinkelten Straße, an der die Villa lag.
Und so begannen die Ferien.
»Hast du nicht schon die Bücher vom kommenden Schuljahr?«, meinte mein Vater zwei Tage später. Die verschmutzte Sandale und der Teppich waren längst gereinigt. Mein eigentliches Problem, was ich sechs Wochen lang allein zu Hause machen sollte, hatte sich jedoch nicht so schnell lösen lassen. »Es wäre vielleicht keine so schlechte Idee, wenn du dich auf den neuen Stoff ein wenig vorbereiten würdest.«
Klar, das konnte ich machen, und was ich außerdem tun wollte, war, mir aus der nahe gelegenen Stadtbibliothek stapelweise Romane auszuleihen und sie im Schatten der herrlichen Bäume zu lesen.
Ferien! War es nicht wunderbar? Worüber sollte ich mich beklagen?
Das Haus stand noch voller Kartons, die zum Teil noch nicht ausgepackt waren. Manchmal konnte ich Linus und seine Freunde hören, die bei geöffnetem Fenster oben in seinem Zimmer saßen und lachten. Dann wieder sah ich Hannah in einem weißen Sommerkleid über den Rasen gehen, oder ich hörte aus dem Seitenflügel des Hauses, dass mein Vater die Kopfhörer ausgestöpselt hatte und sich etwas über die Lautsprecher auf seinem Klavier vorspielte. Dunkle, aufbrausende Klänge, die zu der Filmmusik gehörten, an der er gerade arbeitete.
Meine Mutter war meist nicht zu Hause, sie verbrachte die Tage bis spätabends in der Stadt bei den Proben. Doch das kümmerte mich nicht. Ich sprang in meiner noch nassen Badehose in den lauwarmen Pool und hielt den Kopf so lange unter Wasser, wie ich konnte. Tauchte ich auf, und die unheimlichen Klänge meines Vaters drangen noch immer aus seinem Arbeitszimmer, drehte ich mich auf den Rücken, dass die Ohren unter Wasser lagen, und streckte nur den Mund zum Luftholen durch die Oberfläche nach oben.
Ein träger, heißer Sommer in Berlin würde das werden, dachte ich mir, ein Sommer im Garten und in den kühlen Räumen des noch ungewohnten Hauses.
Doch ich sollte mich täuschen. Der Sommer wurde nicht sonnig und verschlafen. Es wurde der Sommer des Fleischwolfs. Eines Fleischwolfs, der mich in seine Zähne bekommen und in sich hineingedreht hat. Hinein in seine stählerne Kehle und die Kerben, die das Fleisch zerhacken und zerschneiden.
Mein Fleisch.
Kennt ihr das? Das Gefühl, man würde sich blutig reißen, man würde aufgerieben werden, dass die Wunden vielleicht nie mehr heilen? Wenn die Augen aufgehen, so weit, wie man nie wusste, dass sie aufgehen können? Wenn man erlebt, wie das, was um einen herum geschieht, unwiederbringlich zerfleischt, was man einmal war? Das ist es, was in diesem Sommer geschehen ist, in diesem Sommer, der so träge und faul mit Sonne und Nachmittagen am Pool begann.
2
Es war der erste August, das werde ich nicht vergessen. Gut drei Wochen waren vergangen, seitdem wir in Berlin eingetroffen waren. Es war schwül. Das Gras schimmerte schon fast bräunlich, so heiß war es. Ich saß auf einer der Birken, die unweit vom Gartenteich auf der westlichen Seite des Grundstücks standen, und hatte von dort aus einen guten Überblick über das Gelände. Auf Bäume klettern? Das hatte es in London nicht gegeben. Hier aber stand das Grundstück voller Bäume, und wenn man sich einen der Korbstühle an einen Stamm stellte, gelangte man problemlos an die unteren Zweige. Weiter oben war es dann fast wie eine Leiter. Man konnte es sich auf einem der Äste bequem machen, den Vögeln zusehen und darüber nachdenken, wie hoch man noch klettern wollte, ohne zu riskieren, dass die ganze Krone abbrach.
Ich konnte ihn aus dem Haus kommen sehen, hinten aus der Tür, die auf die Sonnenterrasse führte. Er hatte bereits beim Frühstück sehr angespannt gewirkt, und als ich ihn jetzt über den Rasen gehen sah, hatte ich den Eindruck, er würde den Kopf tief zwischen die Schultern ziehen. Schon in den letzten Tagen war mir aufgefallen, dass meinem Vater der Umzug nach Berlin nicht gutgetan zu haben schien.
»Es ist nichts, mach dir keine Sorgen, Sammy«, meinte meine Mutter, als ich sie darauf angesprochen hatte, »dein Vater … du kennst ihn doch. Es fällt ihm nicht immer leicht, die richtigen Noten zu finden. Sie haben ihn gebeten, die ganze Reihe zu vertonen, das sind, ich glaube, drei Filme. Und es sind keine einfachen Filme, weißt du?«
»Nicht? Wieso nicht, worum geht es in ihnen denn?«
Meine Mutter hatte mich angelächelt und mir liebevoll in die Augen gesehen. »Das willst du gar nicht wissen. Sie sind nichts für Kinder, ich habe sie mir selbst noch nicht angeschaut. Mir liegen solche Filme nicht.«
Ihr liegen solche Filme nicht.
Ich hatte mit dem Kopf auf meinem Kissen gelegen und zu ihr hochgesehen.
»Wenn du willst, spreche ich mit Papa, vielleicht zeigt er dir mal ein Stück.«
»Ja … ja, vielleicht.« Ich war schon immer neugierig gewesen, die Streifen zu sehen, für die mein Vater die Filmmusik schrieb. Ab und zu zeigte er mir einen Abschnitt, gleich auf Video in seinem Arbeitszimmer, aber nur, wenn es sich um eine Teenagerkomödie handelte, oder um eine Romanze. In den letzten Jahren jedoch – das hatte schon in London begonnen – waren es eher düstere Filme gewesen, die sie ihm schickten.
»Er würde gern mal wieder für eine Komödie oder einen historischen Film arbeiten«, hatte meine Mutter mir an dem Abend am Bett erläutert, »aber manchmal ist es eben nicht so einfach, die besten Aufträge zu kriegen. Dann nimmt dein Vater, was er bekommen kann. Ihm ist es vor allem wichtig, dass er überhaupt arbeiten kann.«
Es waren nicht die großen Hollywoodblockbuster mit den berühmten Stars, für die er die Filmmusik schrieb, wie sie mir erklärte, es waren eher billige Produktionen, die unabhängig finanziert wurden, Filme, die nur auf Video herauskamen. Für die Produzenten dieser Filme aber war die Musik meines Vaters genau das, was sie suchten. Schwere, dunkle und unheimliche Musik, die ganze Welten, Schatten und Gestalten vor mein geistiges Auge zauberte, wenn ich sie gedämpft durch die Tür seines Arbeitszimmers kommen hörte.
Gebückt, er lief gebückt über den Rasen, gebückter noch vielleicht, als ich ihn jemals zuvor hatte laufen sehen. Schon beim Frühstück, ich erwähnte es ja, war mir aufgefallen, dass er gereizt und angestrengt gewirkt hatte. Bereits in den vergangenen Tagen, seitdem wir in Berlin waren und das Haus bezogen hatten, hatte ich bemerkt, dass sein Hals ein wenig krumm gewachsen zu sein schien, der Hals meines Vaters, eines Mannes, der sonst in seinem Auftreten immer etwas Beschwingtes, ja geradezu Leichtfüßiges gehabt hatte.
Nun wirkte er geduckt. Nicht übermäßig, nur ein wenig – und doch war es unverkennbar.
»Es ist wegen der Filme, die er vertonen soll«, hatte meine Mutter bei unserem Gespräch gesagt, »sie wollen … ich meine, dein Vater hat nicht immer Glück mit dem, was er macht.« Sie hatte einen Blick zur Tür geworfen, aber es war nur Linus gewesen, der an meinem Zimmer vorbei zum Bad gelaufen war. »Die Leute, die ihm seine Aufträge geben, wollen nicht immer so wie er. Aber das gibt sich bestimmt bald wieder, du wirst sehen.«
Ich schaute ihm nach. Er fuhr sich mit der Hand durch das ein wenig ausgewachsene Haar, das ihm in schweren Büscheln in die Stirn gefallen war. Schon hob ich den Arm, um ihn zu rufen, hielt mich dann aber doch zurück, denn ich wusste, dass er tagsüber meist nicht gestört werden wollte.
»Tut mir leid, Sammy, es ist nicht deinetwegen«, das hatte er mir bereits mehrfach erklärt, »es ist die Arbeit. Ich stecke manchmal so in Gedanken, dass ich gar nicht so schnell umschalten kann. Das verstehst du doch, oder? Ich muss dann zusehen, dass ich mein Pensum schaffe, also das, was ich an einem Tag fertigbekommen muss. Und wenn ich mich einmal in eine Sequenz vertieft habe, will ich auf gar keinen Fall mehr abgelenkt werden. Ich weiß, du meinst es nicht böse, aber es kann schon störend sein, einfach reden zu müssen.« Er hatte geblinzelt, als er mir das sagte, und seine Augen hatten einen leicht abwesenden Ausdruck angenommen. Aber ich liebte es, ihm zuzuhören, wenn er mit mir über seine Arbeit sprach, über das Komponieren, das mir vorkam wie eine Geheimwissenschaft.
»Das kann nur dein Vater«, sagte meine Mutter dazu, »er sieht die Klänge wie Landschaften vor sich. Er muss sie nur noch aufschreiben, so schnell, wie er kann. Bevor sich diese Landschaften aus Träumen und Phantasien verflüchtigen wie Wolkenscharen, die verfliegen, wenn ein kräftiger Windstoß hineinfährt.«
Normalerweise kam es gar nicht dazu, dass mein Vater und ich aneinandergerieten, normalerweise war ich tagsüber, wenn er arbeitete, in der Schule. Am späteren Nachmittag dann, wenn ich zu Hause war, hatte ich meist den Eindruck, dass er nicht mehr so angespannt war. Aber hier in Berlin war alles anders, hier in Berlin waren Sommerferien, die Schule würde erst in ein paar Wochen beginnen, hier in Berlin war ich den ganzen Tag über zu Hause – und er auch.
Mein Vater schritt über den Rasen, ohne sich umzusehen. Ich ließ die Hand sinken. Besser nicht stören. Was hätte ich ihm auch sagen sollen? »Papa, hier! Hier oben!« Ich wusste doch, wie er mich ansehen würde. »Nimm’s mir nicht übel, Sam, aber ich habe leider gerade gar keine Zeit für so was.«
Wofür aber dann?
Ich klemmte meine Füße unterhalb des Astes übereinander, um mich besser umdrehen zu können, und sah ihm nach. Er lief quer über den Rasenplatz, der südlich vom Haupthaus angelegt war, und bog in eine schmale Heckenallee ein, die in den hinteren Bereich des Gartens führte. Der Rosengarten, das kleine Buchsbaumlabyrinth, das Beet mit den Kräutern … jenseits der mannshohen Hecke, hinter deren Zweigen ich ihn gerade verschwinden sah, lagen einige der verwunschensten Ecken des weitläufigen Gartens, der zu der Villa gehörte.
Musst du denn nicht an deinem Schreibtisch sitzen, Papa?
Ich liebte meinen Vater. Ich liebte es, wenn er mich ansah, ich liebte es, wenn er mich anlächelte, wenn er mich ansprach, wenn er mich etwas fragte und ich an seinen Augen ablesen konnte, wie sehr er sich über mich freute. Ich liebte eigentlich alles an ihm, ich liebte es sogar, wenn er mir zu erklären versuchte, warum er gerade keine Zeit für mich hatte. Alles, was er machte, war spannend, sinnvoll und bedeutsam, es schien fast etwas Magisches von ihm auszugehen, das nie deutlicher war, als wenn ich die Musik aus seinem Zimmer quellen hörte.
Langeweile. Und Neugierde. Das war es, was mich antrieb, als ich mich von dem Ast, auf dem ich saß, herunterschwang, am Stamm der Birke herunterrutschte und schräg über den Rasen zu der Hecke lief, hinter der er kurz vorher verschwunden war.
Augenblicke später konnte ich seinen dunklen Pullover am Ende des Heckengangs sehen, dann hatte mein Vater die kleine Hütte erreicht, an der die Hecke mündete. Ich ging hinter einem Busch in Deckung und spähte zwischen den Zweigen hindurch. Nie zuvor hatte ich ihn bei dieser Hütte gesehen. Ich kannte den verwitterten Verschlag natürlich, hatte auch schon versucht, durch das verschmutzte Fenster hineinzusehen, da das Innere jedoch ständig im Dunkeln lag, nichts erkennen können. Die Tür war immer abgeschlossen gewesen, deshalb hatte ich die Hütte bisher nie betreten. Gebannt beobachtete ich, wie mein Vater einen Schlüssel aus seiner Hosentasche holte und die Tür damit aufsperrte. Kurz darauf zog er sie von innen wieder hinter sich zu. Mit angehaltenem Atem lauschte ich. Aber es knackte nicht noch einmal. Abgeschlossen schien er die Tür von innen nicht mehr zu haben.
Er legt sich in dieser Hütte auf eine Pritsche, spukte es mir durch den Kopf, seine Augen tasten die Dunkelheit ab, er kann sich dort besser konzentrieren. Oder? Er ist an eine schwierige Stelle gelangt, es fällt ihm schwer, die rechten Noten zu finden! Ich sah einen Schatten von innen an dem schmutzigen Fenster vorbeigleiten. Dort in der Hütte ist er den Schatten und Abgründen, die er in seiner Musik einfangen soll, einfach näher!
Während die Gedanken, ohne sich zu verfestigen, diffus durch meinen Kopf tanzten, hatte ich meine Position hinter dem Busch aufgegeben und war bis zur Hütte geschlichen. Durch das Fenster zu spähen, wagte ich nicht. Von außen konnte man zwar nicht hineinsehen, von innen aber musste man es doch bemerken, wenn sich ein Kopf vor die Scheibe schob.
Ich kauerte vor der Tür auf dem Boden und legte ein Ohr an das Holz. Und wenn er die Tür jetzt aufstieß? Wie jämmerlich würde ich zu ihm aufsehen? Aber ich hatte doch nichts getan! Ich hab dich hierherkommen sehen, Papa, ich wollte nur schauen, was du machst.
Das … war doch nicht verboten! Er hatte ja nicht gesagt, dass ich ihm nicht folgen durfte. Er hatte mich beim Frühstück doch kaum eines Blickes gewürdigt, ja kaum wahrgenommen. Bitte, Papa, nicht, ich hab doch nichts Böses gewollt, ich wollte nur sehen, was du hier machst!
Und doch wusste ich es genau, spürte es mit jeder Faser meines Körpers. Ich hatte ihn so noch nie laufen gesehen, ich hatte ihn so noch nie schauen gesehen. Ich wusste, dass er mich nicht hier haben wollte. War es das, was mich umso mehr an dieser Tür hielt, der Grund, warum ich von ihr nicht abrückte? Der Grund, warum ich minutenlang davor hockte, die Klinke in der Hand, den mageren Oberkörper gegen das Holz gepresst? Es kam mir so vor, als könnte ich ihn atmen hören, gleich hinter der dünnen Pforte, schwer atmen, auf der Suche nach dem, was er brauchte, nach den richtigen Tönen, den richtigen Ideen, den richtigen Eingebungen. Und mit einem Mal war es mir so klar, als könnte ich durch die alte Holztür hindurchsehen wie durch Glas. Er war nicht mehr dort. Hinter der Tür. In der Hütte.
Es riss mich förmlich auf die Beine. Mit hastigen Schritten eilte ich um den Verschlag herum. Das verschmutzte Fenster. Die von Efeu überwachsenen Mauern. Die Holztür, an der ich gekauert hatte. Außer dem Fenster und der Tür führte kein Weg nach draußen – aber weder durch das eine noch durch die andere hatte er die Hütte verlassen.
Im nächsten Moment drückte ich die Klinke vorsichtig herunter und zog die Tür geräuschlos auf. Ich sah, wie mein Schatten von dem Licht ausgeschnitten wurde, das in das Innere der Hütte fiel.
Gerätschaften. Spinnweben. Eine Holzkiste mit Kohlen. Und im sandigen Boden eine Falltür, die in die Tiefe führte.
Sonst nichts.
Die Hütte war leer.
3
Die Falltür im Boden der Hütte war aus massiven Holzbalken gezimmert. So robust, dass man sich ohne Bedenken daraufstellen konnte. Aber ich wollte mich nicht daraufstellen. Mein Vater musste durch sie hindurch verschwunden sein. Es gab sonst keine andere Möglichkeit. Ich wuchtete die Falltür hoch und musste mich mit meinem ganzen Körper dagegenstemmen, um sie vollständig aufzubekommen. Ein schwarzer, kreisrunder Schacht führte darunter in die Tiefe, erhellt nur am obersten Ende von dem Licht, das durch Fenster und Tür in die Hütte fiel. Der Boden war nicht zu erkennen. In die Klinkerbausteine jedoch, aus denen der Schacht gemauert war, waren rostige Eisenstufen eingelassen.
Ich zögerte nicht lange. Rufen wollte ich ihn nicht. Hören konnte ich auch nichts. Wie lange hatte ich vor der Tür des Schuppens gekauert? Ich schwang ein Bein in den Schacht und hielt mich am Rand fest. Mit dem anderen Fuß tastete ich in die Tiefe, bekam die nächste Eisenstufe mit der Sohle meiner Sandale zu fassen. Verlagerte mein Gewicht und schauderte, als mein Kopf unter den oberen Rand des Lochs tauchte.
Es waren vielleicht drei oder vier Meter, die der Schacht in die Tiefe führte. Hinab in einen Tunnel, der waagerecht verlief und von dem der Schacht, den ich hinabgeklettert war, senkrecht nach oben wie ein Schornstein abging. Meine Augen hatten sich ein wenig an die Dunkelheit gewöhnt, und ich konnte Staubpartikel in dem schwachen, weißen Licht tanzen sehen, das durch den Schacht von oben einfiel. Der Tunnel war trocken, roch nur ein wenig modrig, aber nicht allzu durchdringend. Vorsichtig tastete ich mich ein paar Schritte in der Dunkelheit vorwärts.
Papa?
Ich drehte mich um. Von meinem Vater war nichts zu sehen. In dieser Richtung jedoch konnte ich einen matten Schein erkennen, der weiter hinten im Tunnel schwamm. Ich beschloss, erst einmal dorthin zu gehen. Als ich das Licht erreicht hatte, stellte ich fest, dass es von einer Neonröhre herrührte, die leise knisternd vor sich hin summte und in einem Seitentunnel angebracht war.
Ich hatte schon davon gehört, dass Berlin zum Teil noch von den Luftschutzanlagen aus dem Zweiten Weltkrieg durchzogen war. Zu Hunderttausenden hatten die Berliner in den Stollen Schutz gesucht, während die Bomber der Alliierten die Gebäude über ihnen in Schutt und Asche legten. Der Tunnel, den ich von der Neonröhre erhellt sah, schien jedoch jünger zu sein, jünger als der Klinkersteinschacht, den ich hinabgeklettert war, und jünger, viel jünger auch als unsere Villa. Statt aus Steinen gemauert, war dieser Stollen aus Beton gegossen und wirkte eher wie ein Relikt aus dem Kalten Krieg als aus dem Zweiten Weltkrieg.
In der feuchtkühlen Luft leicht fröstelnd, schritt ich den Tunnel entlang. Ein ganzes System, es ist ein ganzes System von Stollen, Nischen und Gängen, ging es mir durch den Kopf. Eine Stadt. Eine unterirdische Stadt. Da sah ich eine Stahltür, die wenige Schritte vor mir aus dem Tunnel herausführte. Ich blieb vor ihr stehen. Matt schimmerte das Metall in dem Licht der Neonröhre, die keine zwanzig Schritte hinter mir knisterte.
Es war eine vollkommen verstaubte und ebenso vollkommen eingerichtete Bowlinghalle, die ich hinter der Tür entdeckte. Komplett mit vier Bahnen und einer Galerie, von der aus man einen Blick über die ganze Anlage hatte. Eine Lounge-Ecke, in der Sessel um einen geschwungenen Tisch herumstanden, Metallwagen, auf denen die schweren Kugeln lagen, eine Theke im Hintergrund. Eine Anlage original im Stil der fünfziger Jahre. Nierentische. Flamingofarbene Stoffe. Verchromte Barhocker.
Ich strich mit einem Finger über die Theke, hinter der auf einem Glasregal Flaschen aufgebaut waren. Gefüllte Flaschen, seit Jahren nicht mehr geöffnet. Für einen Moment glaubte ich das Stimmengemurmel der Menschen hören zu können, die einst hier gespielt haben mussten, die Partylaune, die geherrscht haben musste, ja, fast glaubte ich, den Zigarettenrauch noch in der Luft riechen zu können, die Miniröcke der Mädchen zu sehen, die Schmalztollen der jungen Männer. Berlin, die Stadt der Amerikaner.
Das hatte sogar ich bereits mitbekommen, dass die Stadt nach dem Krieg in Zonen aufgeteilt worden war. Und den Südwesten, in dem unsere Villa lag, hatten die Amerikaner sich geschnappt, die von den Berlinern geliebt wurden, weil sie gutgelaunt waren und freundlich. Im Südwesten hatten sie sich in die Villen einquartiert, ihre Kasernen hochgezogen, im Südwesten waren sie mit ihren Jeeps und Militärfahrzeugen über die alten Berliner Alleen gefahren.
Ich stand hinter der Theke und hatte ein gedrungenes Glas mit dicken Wänden vor mich hingestellt, eine quadratische Flasche in der Hand. Das Knirschen des Schraubverschlusses. Ich hielt mir die Öffnung der Flasche unter die Nase. Ein herber, scharfer Geruch, aber nicht unangenehm. Whisky.
Wein hatte ich bei meinen Eltern schon mal gekostet, Bier sowieso, Whisky noch nie. Ich goss mir einen Schluck ein, schnupperte an dem Glas. Gleichzeitig fiel mein Blick auf ein Brett, das unter der Theke angebracht war und auf dem ein alter Plattenspieler stand. Erst jetzt bemerkte ich, dass es in der Bowlinghalle nicht so dunkel war wie in dem Tunnel. Dicht unter der Decke befanden sich langgestreckte Schlitze, die oberhalb des Erdbodens lagen und durch die das Licht fiel, das die Halle erhellte. Die Schlitze waren so schmal, dass sie mir, obwohl ich ja bereits seit Wochen über das Grundstück gestromert war, bisher nicht aufgefallen waren. Wahrscheinlich lagen sie hinter der Garage, oder jenseits des Pools in einem Teil des Gartens, den ich bislang noch nicht erkundet hatte. Ich beschloss, dass ich gezielt einmal nach den Lichtschlitzen suchen wollte, wenn ich wieder oben war. Dann lagen meine Lippen an dem Glas, und ich probierte einen Tropfen von dem Whisky. Würzig schoss mir die warme Flüssigkeit in den Mund. Ich schluckte herunter und hob den Deckel des Plattenspielers hoch, den ich auf dem Brett unter der Theke entdeckt hatte. Wieder diese asymmetrischen Formen mit den abgerundeten Ecken. Flamingofarben und beige. Eine Schallplatte lag auf. Ich drehte sie so, dass ich die Schrift in der Mitte lesen konnte.
Elvis, All Things Are Possible, Las Vegas 1971.
Ich hob den Tonarm und schob ihn nach vorn. Nichts. Ich schwenkte ihn nach hinten, und es klickte. Ganz langsam begann sich die Platte auf dem Teller zu drehen. Behutsam senkte ich den Tonarm auf das schwarze Vinyl.
»But Daddy was a lazy …«
Es war Elvis Presley, seine Band schepperte im Hintergrund. »… working on the chain-gang …«
Die Bläser, das Klatschen, Rock ’n’ Roll. Er spielte in Las Vegas, aber plötzlich stand er hier in der Halle, fast schien es, als würde ein kleiner Elvis in seiner schwarzen Glitzeruniform auf der Theke tanzen. Ich nippte an meinem Glas und sah der Schrift auf der Platte dabei zu, wie sie sich im Kreis drehte. Trank noch einen Schluck. Und musste husten.
»Thank you.« Cool. Wie er das sagte. »Thank you.« Ganz kurz, ohne viel Aufhebens, aber doch … man hatte das Gefühl, er würde sich wirklich bedanken. »Thank you.«
Schon begann das nächste Lied. Ein Chor, ein Stimmenchor, und über den anderen Stimmen die von Elvis: »All things are possible …«
Ein seltsames Gefühl von Traurigkeit saß in dieser Musik.
Ich starrte auf die Plattenhülle, die neben dem Apparat auf dem Brett stand. Elvis in seinem schwarzen Kostüm, ein Ausfallschritt nach vorn, das Mikrofon an den Mund geschoben, die Augen geschlossen. Das klang anders als die Musik, die ich aus dem Radio kannte. Natürlich wusste ich, dass Elvis auf irgendeine unschöne Weise vor langer Zeit gestorben war. War es das, was man in dieser Musik hörte? Dass er sein Leben in jeden dieser Songs gesteckt hatte? Ein paar hundert oder tausend Mal, wie oft er sie eben gesungen hatte – und dann war von seinem Leben nichts mehr übrig gewesen? Oder war es der Whisky, der mir zu Kopf zu steigen begann?
Abrupt wandte ich mich von dem Plattenspieler ab und kam hinter der Theke hervor. Mein Blick schweifte über den Wagen, auf dem die dunkelroten und blauen Kugeln aufgereiht waren, blieb an den Bowlingbahnen hängen. Es waren keine Kegel aufgestellt. Ich trat auf die Dielen der linken, äußersten Bahn und lief bis zu ihrem Ende durch. Dort, hinter der Bahn, lagen die Kegel in wildem Durcheinander auf dem Boden. Weiß, umgestoßen, und schwer, wie ich bemerkte, als ich zwei von ihnen hochnahm und aufstellte.
Elvis sang im Hintergrund. Der kleine Plattenspieler schaffte es kaum, die Bowlinghalle mit Tönen zu füllen. Aber Elvis legte sich voll in seine Musik: »Then sings my soul …« Der Chorus im Hintergrund, die Trompeten. »Thank you, thank you.« Er stieß das hervor, presste das hervor, schenkte einem den Song, drei, vier Minuten, länger dauerte es nicht, da hieß es schon wieder: »Thank you«. »Thank you, meine Zeit läuft ab.«
Ich hatte die übrigen Kegel aufgestellt und war an den Anfang der Bahn zurückgekehrt. In der Hand, die Finger in die Öffnungen gefädelt, eine dunkelrote, schwere Bowlingkugel. Mit Karacho schlug sie auf die glattgescheuerten Dielenbretter und holperte über den Staub und die Körnchen, die sich über die Jahre dort abgelagert hatten. Ich hatte sie vollkommen falsch geworfen, sie kam ins Trudeln, taumelte in die Seitenrinne, und lief an den Kegeln vorbei ins Aus. Ich drehte mich um und holte mir die nächste Kugel vom Wagen. Auch diese schlug schwer auf die Bahn, rollte diesmal aber schon besser nach hinten durch, rumpelte gegen den äußersten Kegel, riss ihn um, und krachte in den Hohlraum am Ende der Bretter. Nächste Kugel. Ich schielte zu dem Glas, das ich auf der Theke abgestellt hatte, und spürte ein warmes Kreiseln. Nachher würde es Abendessen geben, ich musste mir unbedingt vorher den Mund spülen. Und morgen musste ich Linus die Anlage zeigen.
»Something in the way she moves …«
Sie war so alt, die Musik war so alt. Ich trank den Rest aus dem Glas – ein größerer Schluck, als ich eigentlich beabsichtigt hatte – und trat entschlossen zurück an die Bahn.
»Komm schon!« Ich zischte die Worte richtig zwischen den Zähnen hervor. Während meine ersten beiden Würfe noch zaghaft gewesen waren, nur Probeschüsse, schleuderte ich diese Kugel jetzt mit aller Kraft von mir. So heftig, dass ich fast hinterhergestürzt wäre. Sie taumelte nicht mehr über die Bretter, sie schoss dahin, wie magisch von den Kegeln angezogen, hüpfte und sprang und knallte mitten zwischen die weißen Bolzen, riss sie um, dass es schepperte und krachte, fast schien sie sie in Stücke zu fetzen, so flogen die Holzzapfen von der Bahn.
»STRIKE! Linus, das musst du mir erst mal nachmachen!«
Voller Begeisterung rannte ich über die Bahn, um die Kegel neu aufzustellen. Die Bretter polterten unter dem Tritt meiner Sandalen. Oder?
Ich blieb stehen, eher verblüfft als beunruhigt. Legte den Kopf ein wenig auf die Seite.
Elvis schnurrte im Hintergrund weiter. Das Scheppern, mit dem die Kugel in die Kegel gefahren war, schien noch in der Halle zu hängen. Und noch etwas.
Da!
Da war es wieder.
Ein hohles Klingen. Klopfen. Metallisch. Hallend. Gedämpft.
Poch, poch, poch.
Ich atmete flach.
»Say the things we used to say …«
Poch, poch, poch.
Ich schüttelte den Kopf.
»Thank you.«
Ich sprang über die Bahn wieder zurück, hinter die Theke, an den Plattenspieler und hob den Tonarm hoch, mitten im Lied. »Treat me like a fool –«
Stille.
Poch, poch, poch.
Was war das? Es war ein Klopfen. Natürlich, jemand klopfte.
Aber …
Ich spürte, wie mir das ungewohnte Getränk bitter aufstieß. Die Kugel, die Kegel, die Bretter, die Halle.
Poch, poch, poch.
Zuerst war es nicht zu hören gewesen, dessen war ich mir vollkommen sicher. Erst jetzt, nachdem meine Kugel in die Kegel geknallt war. Ich warf einen Blick zu der Stahltür, durch die ich die Halle betreten hatte. Dann zur Decke, dort verliefen Leitungen und Rohre, aber so hoch, dass ich an keine der Metallverkleidungen mein Ohr legen konnte.
Stille. Nichts.
Wie lange war ich schon hier unten? Eine Stunde? Fast.
Ich lief zu der Tür, die aus der Halle herausführte. Jenseits des Scheins der Neonröhre verloren sich die Schläuche und Verschalungen an der Decke in der Dunkelheit des Tunnels. Plötzlich spürte ich einen kühlen Hauch, einen leichten Windzug an meiner Wade, als ob irgendwo eine Tür oder eine Klappe oder Luke aufgegangen wäre. Und im gleichen Moment hatte ich den Eindruck, noch jemand würde sich in dem Tunnel befinden. Noch etwas.
Ich musste rasch zweimal keuchen, so überrumpelt war ich von der Gewissheit, gesehen zu werden. Beobachtet, aus dem Dunkeln des Tunnels heraus. Ich kniff die Augen zusammen und glaubte, einen schwarzen Schatten durch die Dunkelheit gleiten zu sehen. Und dann sah ich ihn wirklich.
Den Hund.
Groß wie ein Kalb. Schwarz wie ein Panther. Mit einem majestätischen Kopf, traurigen Augen und Beinen, die wirkten, als stünde er auf Stelzen. Ich kannte mich mit Hunderassen nicht so gut aus, aber das war eine Dogge, das wusste selbst ich. Das Tier stand an einem Mauervorsprung, der das Licht der Neonröhre ein wenig abschirmte, und sah zu mir herüber.
Wenn der Hund auf mich zusetzt, die Gedanken überschlugen sich in meinem Kopf, und mein T-Shirt klebte klatschnass am Rücken, wenn er auf mich zusetzt, dann … Wegrennen hat keinen Sinn! Ich muss die Arme hochreißen, Hauptsache, er erwischt mich nicht im Gesicht.
Schemenhaft konnte ich im Dunkeln erkennen, dass das Tier ein Hundehalsband trug.
Er gehört hier in die Nachbarschaft, beschwor ich mich, während ich vorsichtig einen Schritt nach dem anderen rückwärts machte. Meine Hand tastete an der Mauer entlang, und ich ließ den Hund nicht aus den Augen.
Alles in Ordnung, Wauwau, alles in Ordnung, Sammy, ihr kennt euch nur nicht, das ist kein Problem. Gleichzeitig war mir klar, dass ich dabei war, tiefer in den Tunnel hineinzugehen. Das Tier stand zwischen mir und dem Schacht, der wieder nach oben führte, es schnitt mir praktisch den Weg ab.
Bestimmt eine Minute lang schaute der Hund zu mir, als ob er Witterung aufnehmen würde. Dann lief ein Zittern durch seinen muskulösen Körper, er zuckte mit dem Kopf und drehte sich um. Ich hörte seine Pfoten über den Boden klicken und beobachtete, wie er mit eleganten, fast zeitlupenartigen Sätzen von mir weg an der Neonröhre vorbeilief, unter dem Schacht nach oben hindurch, und im Dunkeln des jenseitigen Tunnelendes verschwand.
Ich holte Luft. Eine Dogge. Völlig harmlos. Wahrscheinlich gab es in den Stollen hier unten irgendwo eine Luke, die sich in einem der Nachbargärten öffnete und durch die der Hund hindurchgekommen war. Kein Grund zur Sorge. Er hatte ja noch nicht einmal geknurrt. Vielleicht, dachte ich jetzt, wo er fort war, könnte ich mich sogar mit ihm anfreunden. Mit so einem riesigen Hund würden sich die endlosen Sommertage sicher rasch herumbringen lassen. Hatte er das Geräusch gemacht, das mir in der Bowlinghalle aufgefallen war? Poch, poch, poch. Mit seinen Tatzen?
Und dann fiel mir wieder ein, was mich dazu gebracht hatte, mich hier unten herumzutreiben.
Wo ist er? Wo ist mein Vater?
Ich schaute in die Richtung, in die ich rückwärts vor dem Hund zurückgewichen war. Das trübe Flackern der Neonröhre reichte in den düsteren Schlund vor mir nur als kleine Lichtpfütze inmitten einer kreisrunden Lache von Schwärze.
Es hatte keinen Sinn. Ich konnte in ein Loch stürzen, mich sonst wie verletzen. Hier unten würden sie mich nicht so schnell finden. Es war höchste Zeit, dass ich umkehrte.
Entschlossen trat ich den Rückzug an. Richtung Luft. Richtung Licht. Wieder mit der Hand an der Mauer entlangtastend, vorsichtig einen Schritt vor den anderen setzend.
4
Es war eine Wölbung, eine Rundung, aber kein Mauervorsprung. Nein, eine metallische Ausbuchtung. Meine Hand war auf dem Weg zurück zur Neonröhre darüber gestrichen. Auf dem Hinweg hatte ich die Ausbuchtung nicht bemerkt, aber da hatte ich ja auch die Mauer auf der anderen Seite berührt.
Vorsichtig fuhr ich mit den Fingern über die Rundung. Jetzt, wo ich mich ganz darauf konzentrierte, konnte ich fühlen, dass sich so etwas wie ein Plättchen in ihrem Zentrum befand. Ein Plättchen, das oben eine Verlängerung hatte und durch einen feinen Stift auf der Kuppe der Ausbuchtung befestigt war.
Ich berührte es, und es klickte. Ganz leise, ganz fein. Aber es hatte sich bewegt. Behutsam stieß ich seitlich mit dem Finger dagegen. Der Stift hielt es fest, das Plättchen selbst aber verrutschte um eine Winzigkeit zur Seite. Ich schob den Finger weiter, es ruckte zur Seite mit, und dann brach ein Lichtstrahl aus dem Zentrum der Ausbuchtung heraus, durchschnitt weiß und fahl das Dunkel des Tunnels, landete auf meinem Gesicht.
Ich hielt den Atem an. Ein leichter Lufthauch war zu spüren, der aus der Öffnung herausdrang. Ein oder zwei Zentimeter vielleicht, viel größer war der Durchmesser der Öffnung nicht, aber doch groß genug, um es zu versuchen. Ich verengte mein Auge zu einem Schlitz und brachte es genau in den Lichtkegel, der aus der Öffnung herausfiel.
Das Erste, was mir auffiel, war der Geruch, der aus der Öffnung strömte, ein Geruch, der etwas Frisches, Lebendiges an sich hatte. Ein Geruch, der nicht abstoßend war und zugleich doch falsch. Er gehörte nicht hierher, nicht in diesen Staub hier unten, nicht in diese Finsternis.
Langsam gewöhnte sich mein Auge an das Licht. Rosa. Was ich auf der anderen Seite sah, war rosa, beige, Haut.
»He!« Ich flüsterte. Jetzt hatte es zu stampfen begonnen, mein Herz in der Brust. »He!«
Es war eine Hand.
Was ich auf der anderen Seite sah, war eine Hand. Sie bewegte sich, die Hand bewegte sich, und ein Schlitz tauchte auf, der Schlitz zwischen den Fingern.
»Wer bist du, hörst du mich?« Ich flüsterte.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: