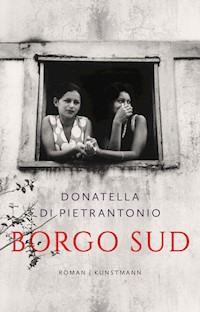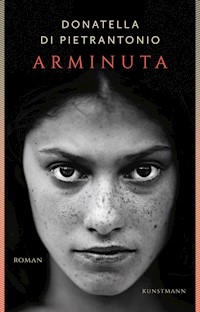Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kunstmann, A
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Amanda in das Dorf in den Abruzzen zurückkehrt, genügt ein Blick ihrer Mutter, um zu erkennen, dass etwas nicht stimmt. In den ersten Tagen in Mailand hatte ihre Tochter die Lichter der Stadt in den Augen, doch jetzt scheint sie nur noch verschwinden zu wollen. Mit Schrecken blickt Lucia auf das Schweigen ihrer Tochter und erinnert sich an jene Nacht vor dreißig Jahren, in der nur ein Zufall sie vor dem Schlimmsten bewahrt hat. Unter dem Wolfszahn, auf dem Land, das ihrer Familie gehört und für das sich jetzt ein Immobilienspekulant interessiert, stehen noch die Überreste des Campingplatzes, an dem sich vor vielen Jahren das Schreckliche ereignet hat. Alle waren an diesem Abend hier versammelt. Die Hirten, die Besitzer des Campingplatzes, die Jäger, die Carabinieri, die Alten und die Jungen, das ganze Dorf. Alle außer den Mädchen, die schon nicht mehr existierten. Mit ihrer rauen, lebendigen und poetischen Sprache, die uns das Gewicht eines abweisenden Blicks und den Klang einer unbeantworteten Frage spüren lässt, erkundet Donatella Di Pietrantonio in diesem Roman eine existenzielle Spannung zwischen den Generationen und Geschlechtern und stellt uns vor die Frage, ob grade unsere Wunden, unsere Verletzungen, unsere Narben nicht unser bedeutsamstes Erbe sind. Ausgezeichnet mit dem Premio Strega 2024 und dem Premio Strega Giovani 2024
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Donatella Di Pietrantonio
Die zerbrechliche Zeit
Roman
Aus dem Italienischen von Maja Pflug
Verlag Antje Kunstmann
Für alle Frauen, die überlebt haben
Es gibt keinen natürlichen Tod: nichts von dem, was dem Menschen geschieht, ist jemals natürlich, denn seine Anwesenheit stellt die Welt infrage.
simone de beauvoir, Ein sanfter Tod
INHALT
AMANDA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
DIE MÄDCHEN
1
2
3
4
5
6
7
8
DER DENTE DEL LUPO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DIE FLUCHT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DAS KONZERT
1
2
3
4
DANK
AMANDA
1
Die Unordnung, die ich am Morgen vorfinde, erinnert mich daran, dass ich nicht mehr allein bin. Amanda ist zurückgekommen, ich sehe mich um und stolpere über ihre Spuren: auf der Sofalehne ein Teller mit Brotkrümeln, im Glas der Rest eines Getränks. Die Decke liegt zusammengeknüllt in einer Ecke, neben dem immer auf derselben Seite umgedrehten Buch.
In letzter Zeit ist mein Schlaf weniger leicht, ich höre sie nicht mehr im Haus herumgehen. Nur manchmal, wenn ich mich auf die Seite drehe, vibriert bei ihren späten Schritten sogar der Fußboden meines Zimmers.
Ich weiß nicht, um wie viel Uhr sie aufwachen wird. Ich trinke meinen Kaffee, stelle die Kekse und die einzige Tasse auf den Tisch, die noch aus ihrer Kinderzeit stammt. Durchs Fenster fällt die Sonne darauf, beleuchtet die Kuh mit dem Grasbüschel im Maul.
Das leere Töpfchen lasse ich auf dem Herd stehen, ein Zeichen, das bedeuten soll: Mach dir Milch warm. Sie kann den Kaffee hineinschütten, der noch in der Kanne ist, oder das Ganze ignorieren. Sie kann meine Fürsorge schätzen oder sich darüber aufregen, dass ich sie wie ein Kind behandle.
Ich begreife nicht, wie ihre Arbeitszeiten sind, wenn ich es so nennen kann, für mich ist ihr Kommen und Gehen undurchschaubar. Jede diesbezügliche Frage verärgert sie. Ich versuche, sie bei den Mahlzeiten zu treffen.
Ich sorge dafür, dass etwas Nahrhaftes im Kühlschrank ist, falls sie das Frühstück überspringt. Die perfekten Schalen der Eier beruhigen mich. Sie ist immer noch sehr dünn, meine Tochter.
Ich räume Schuhe und Pantoffeln vom Teppich, richte das Sofa her. Falls jemand käme, würde ich mich genieren wegen der Unordnung. Amandas Handy unter der Decke ist ausgeschaltet.
Ich kann gehen. Heute bin ich bei Opa, schreibe ich ihr auf ein Blatt. Ich leg es neben die Vase mit den gelben Tulpen. Male noch ein Herz für sie dazu, das ich gleich wieder ausradiere.
2
Mein Vater wohnt auf halber Strecke zwischen dem Dorf und dem Berg. Er ist nicht auf dem Feld, heute Morgen sitzt er verdrossen am steinernen Kamin. Daheim vergeht ihm die Zeit nicht, Zeitung lesen ermüdet ihn, und der Fernseher bringt nur Geschwätz.
»Du musst mit mir wohin gehen«, sagt er.
Der Tag ist so durchsichtig, dass es fast wehtut. Er hat nie eine Sonnenbrille getragen, kneift die Lider zusammen, wenn ihn das Licht blendet. Kurve um Kurve fahren wir mit seinem alten Fiat Brava bergan, mir geht ein Ohr auf, dann das andere, und ich höre den Motor lauter. Er konzentriert sich aufs Fahren, sein Profil zuckt bei jedem Schlagloch im Asphalt, die Nase wird immer schärfer, die Lippen sind zusammengepresst. Irgendwann kommt er zu sich, fragt mich nach Amanda.
»Sie hat noch geschlafen«, sage ich, und dann schweigen wir wieder.
Vor uns der Berg. Das neue Grün klettert in die Höhe, färbt den hundertjährigen Buchenwald und das, was die Schäfer il nudo nennen, das Grasland, wo keine Bäume mehr wachsen. Oberhalb des Graslands ist es noch Winter.
Allmählich wird ihm die Straße vertrauter, wer weiß, wie oft er hier zu Fuß gegangen ist, als sie noch ein Schotterweg war oder nur ein Pfad. Jetzt könnte er mit geschlossenen Augen fahren. Er schaut aus dem Fenster: Dort unten, wo der Streifen bebauter Felder ist, wurde er geboren, und fünfundzwanzig Jahre später kam auch ich dort auf die Welt. In diesem Tal war er jung, ich nur Kind. Hier ging er auf die Jagd und hat manchmal gewildert.
Schon lange waren wir nicht mehr zusammen im Gebirge, ich weiß gar nicht, wie lange. Er öffnet das Fenster ein bisschen, atmet tief. Er vergisst das Emphysem und die Aortenstenose, seine hohlen Wangen nehmen Farbe an. Die Luft, die er hier oben hinter sich gelassen hat, hat ihm immer gefehlt.
Wir erreichen sein Ziel, er parkt am Straßenrand.
Der Kiosk der Sceriffa steht noch, auch ohne sie. Ich erinnere mich, wie ich inmitten der Ausflügler an den Tischen auf dem Vorplatz saß, im Rauch der Fleischspießchen. Oder ich half beim Bedienen, wenn es nötig war.
Die Buchen streifen mit ihren sprießenden Blättern fast das Dach.
»Dieses Waldstück gehört noch uns, merk es dir für später«, sagt mein Vater und zeigt auf den alten Naturbesitz der Familie.
Später bedeutet, wenn er nicht mehr da ist. Ich kann dann bei der Forstpolizei einen Antrag stellen und Holz für den Winter schlagen, erklärt er mir. Er weiß, dass ich das nicht tun werde, er hat bei mir zu Hause noch nie ein Feuer im Kamin brennen sehen.
»Hast du mich bis hier heraufgefahren, um mir den Wald zu vermachen?«, scherze ich.
»Es geht nicht nur um das, was du siehst.«
Er überquert die Straße und biegt in einen grasüberwucherten Weg ein. Lustlos folge ich seinem schmerzgeplagten Schritt, ich weiß, was auf dieser Seite liegt.
Das Schild des Campingplatzes sah in meiner Erinnerung anders aus, es hat ein paar Buchstaben verloren, und das M hängt verkehrt herum da, in ein W verwandelt. Ein Brombeerzweig rankt sich um das mit einem Vorhängeschloss gesicherte Tor, ich wusste nicht, dass mein Vater einen Schlüssel hat. Er stemmt es mit Gewalt auf, überwindet die Reibung der Eisenstäbe am wieder höher gewordenen Boden, geht auf die wenigen, nun ungenutzt verfallenden Backsteingebäude zu. Unter einem Vordach die Reihe der Waschbecken für die Gäste, etliche vandalisch zerstört, wie auch die herausgerissenen Toilettentüren. Wir gehen an der Längsseite des Schwimmbeckens entlang, er immer einige Schritte voraus. Abfall und zerbrochene Zweige am Grund, ein Bäumchen wächst darin, schmächtig, am falschen Ort. Weiter vorn erkennt man die Stellplätze für die Zelte nicht mehr, die Vegetation hat sie sich zurückerobert.
»Sagst du mir mal, warum wir hergekommen sind und wer dir den Schlüssel gegeben hat?«
»Ich wollte dir zeigen, wie heruntergekommen hier alles ist.«
Ich zucke die Achseln, jetzt habe ich es gesehen, wir können auch wieder gehen. Der Platz interessiert mich nicht.
»Das alles gehört dann auch dir, später«, sagt er.
Ein Alarmzeichen steigt in mir vom Magen auf und schnürt mir die Kehle zu.
»Unmöglich. Du hattest dieses Grundstück doch verkauft.«
Das habe er lange versucht, es sei ihm aber nicht gelungen, gesteht er.
Ich schweige eine Weile im Chor der Vögel. In regelmäßigen Abständen das Solo des Kuckucks.
»Nach dem, was geschehen ist, wollte es niemand mehr, nicht einmal geschenkt.« Es klingt fast, als wolle er sich rechtfertigen.
»Ich auch nicht, der Platz macht Angst.«
Ich habe lauter gesprochen, das Echo wirft die letzten Silben zurück. Notgedrungen wird es meins sein, ich bin seine einzige Erbin.
»Dieser Tage gehen wir zum Notar wegen der Schenkung.«
Da ist sie, die Macht, die mein Vater immer noch über mich ausübt, die bereits getroffenen Entscheidungen, die ich nicht ändern kann.
»Ich werde sie nicht annehmen, ich habe schon genug Sorgen.«
Ich kehre ihm den Rücken und mache mich auf den Weg zum Auto. Das Liebesgezwitscher aus dem Wald höre ich nicht mehr. Dieses ganze Wiedererwachen im April betrifft mich nicht.
3
Mailand oder nichts. So redete sie im letzten Schuljahr über ihre Zukunft. Im Dorf bleiben, keinesfalls. Mailand war die Stadt, wo ihr Leben wirklich stattfinden würde.
Den ganzen Sommer bereitete sie sich vor, in den heißesten Mittagstunden fand ich sie auf dem Bett, die Haare mit einem Bleistift hochgesteckt, und mit einem anderen machte sie Kreuzchen auf die Tests. Sie ging wenig und lustlos aus: Wer ihr Nachrichten schrieb oder sie anrief, gehörte für sie schon der Vergangenheit an.
Meine Vorschläge wollte sie gar nicht hören: Rom war zu nah, Bologna zu provinziell.
»Und deine Klassenkameraden, warum gehen die dorthin?«
»Denen fehlt der Mut, sie bleiben in der Sicherheitszone.«
In einem Kaufhaus wählten wir einen großen und einen kleinen Koffer aus. Sie wolle etwas Stabiles, auch wenn sie nur zu Weihnachten und zu Ostern zurückkommen würde, informierte sie mich.
»Komm du mich ab und zu besuchen«, antwortete sie auf die stummen Vorhaltungen meines Blicks. »Das wird dir guttun.«
Im September begleitete ihr Vater sie zur Aufnahmeprüfung an der Staatlichen Universität. Amanda rief mich direkt davor an. In der Stimme die Mischung aus Angst und Verwegenheit, die ich an ihr kannte.
Mit den Lichtern der Stadt in den Augen kam sie zurück.
»Es ist, als sei man in Europa«, sagte sie.
Sie hatten an den Navigli zu Abend gegessen. Es war eine Art Touristentrip gewesen, schloss ich aus dem bisschen, das sie erzählte. Ich fand sie strahlend, nach zwei mit ihrem Vater verbrachten Tagen.
»Das echte Schnitzel ist nicht das, was du machst.« Mitleidig legte sie mir eine Hand auf die Schulter.
Als sie ihm sagte, dass sie angenommen war, hatte der Großvater ein Bankkonto mit tausend Euro für sie eröffnet. »Jedes Mal, wenn ich meine Rente kriege, überweise ich dir fünfzig oder hundert Euro«, versprach er ihr.
Ihm schien es unmöglich, dass sie von so weit weg Geld abheben konnte. Und rätselhaft, was sie studieren würde: Internationale Beziehungen und Europäische Institutionen. Aber er hatte gehört, wie sie die Nachrichten kommentierte, mit dieser Empörung in der Stimme.
Mein Vater war stolz auf seine einzige Enkelin, zweiunddreißigste von über vierhundert. Anfangs hatte er eine Weile gebraucht, bis er die Farben dieser Neugeborenen akzeptieren konnte, die beinah rosafarbenen Haare, die nicht aus unserer Familie kamen.
Auch ich war stolz auf ihre Punktezahl beim Aufnahmetest. Dass ich halb gehofft hatte, sie würde ihn nicht bestehen, hatte ich mir selbst verschwiegen. Eine kleine, tief in ihrer Höhle verborgene Schlange wollte sie noch bei sich behalten.
Ich kaufte ihr Bettwäsche und Handtücher, Schlafanzüge und alles Nötige, woran die Mädchen nicht denken. In wenigen Tagen brachte ich ihr bei, die Waschmaschine zu bedienen, die dunklen Teile im Schatten aufzuhängen. Sie würde ein bisschen die Welt entdecken, das, was ich nicht geschafft hatte.
Ich begleitete sie im Zug nach Mailand, die Koffer wogen schwer.
»Wenigstens die Bettwäsche hätten wir ja dort kaufen können, oder?«, sagte sie.
Aber die war leicht im Vergleich zu den Gläsern mit fertigem Sugo. Sie würden monatelang reichen, ich hatte langfristig für sie gekocht. Nur mit dieser Übung habe ich mich überzeugt, dass sie ohne mich überleben würde.
Der Aufzug war kaputt. Schwitzend keuchten wir gemeinsam die etwas düstere Treppe des Mietshauses hinauf. Das Mädchen, das uns aufmachte, hat Amanda gemustert und ihr das Zimmer gezeigt.
»Komm nachher rüber, den Vertrag unterschreiben«, hat sie gesagt.
Die anderen waren nicht zu sehen. Im Zimmer schäbige Möbel und Wollmäuse in den Ecken. Amanda schien nicht darauf zu achten. Sie behielt mich nur kurz da, gerade lang genug, um ihr zu helfen, ein paar Sachen im Schrank zu verstauen.
»Ich gehe noch ins Bad«, habe ich gesagt, bevor ich ein Taxi gerufen und sie allein gelassen habe.
Ich saß auf der Kloschüssel, die Kacheln auf dem Boden so verdreckt. Aber sie waren nicht wirklich schmutzig, nur zu alt. Vor der Badewanne der Plastikvorhang mit kleinen Elefanten, der Putzplan hing an der Tür. Ein Fragezeichen wartete darauf, von Amanda ersetzt zu werden.
Das Funktaxi würde mich wieder zum Bahnhof bringen. Ich umarmte sie fest. »Ruf mich an, wenn du da bist«, sagte Amanda und machte sich los.
Es war das erste Mal, dass sie mich darum bat.
4
Eineinhalb Jahre später nahm meine Tochter einen der letzten Züge. Danach war es nicht mehr möglich, Mailand oder irgendeinen anderen Ort in Italien zu verlassen. In den Livesendungen sah ich Leute, die sich auf den Rolltreppen drängten, die Bahnsteige entlangliefen. Ich suchte im Gewimmel auch nach ihr, nach ihrem flammend roten Haarschopf. Sie sprach derweil per Telefon mit mir. Vielleicht schaffe ich es, einzusteigen. Ich stellte mir vor, wie sie sich mit dem Koffer durchkämpfte, schmächtig, wie sie war. Alle wollten Richtung Süden.
Sie kam um zehn Uhr abends, mit zwei Stunden Verspätung. Ein Junge reichte ihr Unmengen Gepäck aus dem Waggon. Danach stieg er aus, um vor der Weiterfahrt eine halbe Zigarette zu rauchen.
Instinktiv wollte ich mich nähern, sie hielt mich mit der Hand zurück. Es könnte gefährlich sein, sagte sie.
Im Auto stellte sie das Radio an, lehnte sich im Sitz zurück und ließ den Kopf baumeln, als schliefe sie. Zum Reden war sie zu müde, nur das Allernötigste.
Warum hast du dieses ganze Zeug mitgeschleppt?«, fragte ich sie. »In ein paar Wochen ist der Notstand vorbei, dann macht die Uni wieder auf.«
»Was weißt du denn? Das kann man nicht vorhersehen.«
Zerstreut musterte sie das steinerne Tor zum Dorf, den segnenden Heiligen in der Nische.
Zu Hause schaltete ich den Backofen an, um ihr die Pasta aufzuwärmen, sie machte ihn wieder aus.
»Ich esse morgen.«
Sie ging mit dem Rucksack in ihr Zimmer, der Rest blieb im Wohnzimmer liegen. Hinter ihrer Tür hörte ich kein Geräusch mehr.
Später öffnete ich die Koffer, sie enthielten die bunte Bettwäsche, die ich ihr gekauft hatte. Mit den Baumwolltüchern in den Händen hatte ich das dumpfe Gefühl, an dieser Rückkehr sei etwas Undurchschaubares, Endgültiges.
Am Morgen ließ ich sie schlafen. Sie musste sich von den Strapazen der Reise erholen. Allerdings hatte sie nichts gegessen. Und am Vortag hatte sie nicht einmal Zeit für ein Brötchen gehabt, bevor sie in den Zug gestiegen war. Und an Bord war der Service ausgefallen.
Ich begann die Stunden zu zählen wie damals, als sie klein war und zur Stillzeit nicht aufwachte. Danach hatte sie dann wilden Hunger, biss mir mit ihren scharfen Kiefern in die Brustwarzen.
Amanda aufzuziehen war schmerzhaft gewesen. Ich verstand sie nicht, verstand nicht, was sie von mir wollte. Ich fürchtete mich davor, mit ihr allein zu bleiben. Nachts legte mein Mann sie sich auf die Schulter und spazierte mit ihr durch die Wohnung, nachdem er die Schlafzimmertür geschlossen hatte, um mich schlafen zu lassen.
Im Wartezimmer beim Kinderarzt erkannten die anderen beim ersten Schrei ihrer Kinder, was los war. Meine Tochter weinte, und ich wusste nicht warum. Mein Busen war prall, und doch löste sie sich manchmal plötzlich und brüllte. Also war die Milch nicht gut, dachte ich. Ich drückte mir einen Tropfen auf den Finger und leckte daran. Vielleicht wurde das, was für mich süß schmeckte, auf ihrer kleinen Zunge bitter. Ich erinnere mich, dass ich sie geschüttelt habe, damit sie mit dem Geschrei aufhörte, aber nicht zu fest.
Jetzt, zwanzig Jahre später, erfasste mich eine neue Unruhe, als Amanda nicht aufwachte. Elf Uhr, zwölf Uhr. Wer weiß, ob sie in Mailand die Nacht zum Tag gemacht hatte wie als Säugling. Ich begann in der Wohnung Lärm zu machen, klapperte mit Töpfen, rückte Möbel. Aber nur Rubina merkte es. Von unten hörte sie mich auf dem Balkon rumoren und winkte mir mit der Hand: Komm runter. Sie saß in einem Liegestuhl, den Rock über die Schenkel hochgeschoben und die Ärmel aufgekrempelt.
Ich setzte mich auch in die wohltuende Märzsonne.
»Amanda ist zurückgekommen. Du hast ihre Wäsche aufgehängt.«
Sie fragte mich, wie es ihr gehe, und ich wusste es nicht. »Müde«, antwortete ich. »Sie lernt nun eine Weile hier zu Hause.«
Rubina nickte mit geschlossenen Augen. Aber ich hatte in den Koffern keine Bücher gefunden.
»Jetzt müssen wir uns notgedrungen ausruhen, alle stillhalten«, sagte sie und drehte ihre Arme auf die weißere Seite. Sie bedauerte, dass die Chorproben ausfielen.
»Die letzten Male waren wir bei dem Zigeunergesang lockerer.« Sie trällerte leise den Anfang.
Mir war nicht nach Reden zumute, ich wartete nur darauf, dass meine Tochter aufwachte. Ab und zu sah ich unauffällig auf die Uhr. Um halb zwei sagte ich: »Ich gehe hinauf.«
In der Wohnung konnte ich nicht klar sehen, weil meine Augen noch von der Sonne geblendet waren. Ich klopfte an ihre Tür, dann ging ich hinein. Sie lag unter der Decke, den Kopf unter dem Kissen verborgen.
Ich deckte ihr Gesicht auf, einen Augenblick sah sie mich an, als erkenne sie mich nicht.
»Ich bin in Quarantäne, geh raus«, sagte sie. »Ich esse in meinem Zimmer.«
»Wir setzen uns an die beiden Tischenden, er ist lang genug.«
Finster richtete sie sich auf.
Ich habe das Zimmer gelüftet, während sie sich in der Küche ihren Teller Gnocchi holte. Kaum hatte sie fertig gegessen, schloss sie sich wieder ein.
In jener Nacht, mehr gegen Morgen, weckte mich eine weiche Bewegung auf der anderen Seite des Bettes. Amanda hatte sich ganz klein und rund zusammengekauert, den Rücken zu mir gewandt. Ich weiß nicht, wie lange ich reglos da lag, überrascht. Dann begann sie zu weinen. Stimmlos, nur zuckend und schniefend. Dann umarmte ich sie ganz sacht, so gut ich konnte. »Frag mich nichts«, sagte sie nur.
Es war das letzte Mal, dass ich meiner Tochter so nah war. Vor mehr als einem Jahr.
5
In jenen Wochen schlief Amanda. Sie tagsüber, ich nachts. Eule und Lerche. In Schichten bewohnten wir die gemeinsamen Räume, manchmal gerieten wir aneinander.
Gegen zwölf erfasste mich Unruhe, ich wollt sie irgendwie wecken. Lange fuhrwerkte ich im Flur vor ihrer Zimmertür mit dem Staubsauger herum, als häufte sich dort der ganze Dreck der Wohnung. Ich wusste, dass es zwecklos war, aber vielleicht würde das Geräusch auf voller Lautstärke ihr im Schlaf vermitteln, dass draußen vor ihren geschlossenen Lidern und vor ihrem Zimmer das Frühlingslicht herrschte, das Leben.
»Du musst aufstehen und Schluss«, brüllte ich einmal.
Einen Moment lang streckte sie den Kopf halb heraus. Ein traniger Blick für mich.
»Und was mach ich dann?«
Ich schlug ihr eine Reihe von Dingen vor: essen, lernen, im Viertel spazieren gehen, ein bisschen Gymnastik.
Punkt für Punkt antwortete sie. »Ich habe keinen Hunger. Ich habe keine Bücher. Gymnastik brauchst du selber, du bist in den Wechseljahren.«
In der Luft hing der muffige Geruch ihres immer geschlossenen Mundes. Ich packte einen Zipfel des Lakens, zog es mit einem Ruck weg und deckte ihren gekrümmten Körper auf, im Schlafanzug mit den paarweisen Kirschen.
Sie sprang auf, stieß mich mit aller Kraft zurück. Der Schrank hielt mich aufrecht. Ich wollte nicht umfallen.
»Probier das nie wieder«, sagte ich zu ihr, die Hände an die Schranktür gepresst.
Sie setzte sich aufs Bett. Unter der Lampe, die sie nachts brennen ließ, die Masse der stumpfen Haare, alle Rottöne verblasst.
»Wasch dich, du riechst nicht gut.«
Sie reagierte nicht. Eine Weile blieb ich noch vor ihr stehen. Die Wut legte sich langsam, wich aus den Gesichtern. Wir nahmen Maß, um nicht zu Feindinnen zu werden.
Irgendwo unter dem Bett läutete ihr Telefon. Ich hatte es schon vorher gehört, lange. Meine wortlose Frage: Warum antwortest du nicht? Nacheinander kassierte sie die Töne, dann kam eine SMS.
»Das Frühstück steht noch da, das Mittagessen auch«, sagte ich zu ihr. Es war drei Uhr nachmittags.
Später rauschte das Wasser im Bad und ich empfand eine Erleichterung, die an Freude grenzte. Also lauschte ich ab und zu. Es gab noch einen Spalt, durch den meine Stimme flüstern konnte.
Ich riss in ihrem Zimmer das Fenster auf, die Luft stürmte frisch in die Unordnung herein. Mit der Furcht, ertappt zu werden, streckte ich meinen Arm unterm Bett aus. Ein Lorenzo hatte mehrmals angerufen, und auch Papa. Ich schob das Telefon wieder dahin, wo es vorher gelegen hatte.
Zu meiner Beruhigung hörte ich aus dem Bad immer noch das fließende Wasser und dann den Föhn. So weit war es schon mit mir gekommen: eine Mutter, die glücklich war, dass die Tochter sich wusch. Parfümiert trat sie heraus, die Haare fielen ihr duftig über die Brust, die nussbraun gesprenkelten Augen waren grüner. Sie schloss sich nicht wieder im Zimmer ein, sondern verschwand.
Ich antwortete ihrem Vater und versuchte mich zu erinnern, wie lange er mich nicht angerufen hatte.
»Was ist los?«, fragte er.
Er war besorgt, seit Wochen war es ihm nicht gelungen, am Telefon mit ihr zu sprechen.
»Wenn’s bloß das ist, mit mir spricht sie auch nicht«, erwiderte ich. »Und auch mit sonst niemandem.«
»Aber was macht sie da bei dir?«
»Nichts.«
»Und kannst du sie nicht etwas aufmuntern?«
Nein, das gelang mir nicht, auch jetzt gelingt es mir noch nicht. Er konnte gern vorbeikommen und es probieren, wenn er meinte. Bei der Gelegenheit würde ich ihm erneut bestimmte Fragen stellen, an die er sich gar nicht mehr erinnerte. Und vielleicht würde er sogar die Pullover mitnehmen, die im Schrank liegen geblieben waren. Sie liegen immer noch da. Ab und zu hole ich sie heraus, aus Angst vor Motten. Ich breite sie aus, halte sie gegen das Licht, um zu prüfen, ob Löcher darin sind. Nein, keine Löcher, Qualitätswolle. Ich falte sie wieder zusammen und lege sie zurück, in zwei Stößen.
»Ich kann nicht weg«, sagte Dario.
Nun, dann konnte ich ihm auch nicht helfen.
Mein Vater ist wütend auf mich, weil ich mich nicht um die Papiere für die Scheidung kümmere. Weder du noch dieser Schlappschwanz tut etwas, knurrt er. Es stimmt, uns verbindet diese Unterlassung und noch anderes, das wir nicht kennen. Amanda ganz bestimmt.
Wenn ich von ihm sprechen muss, bin ich immer noch in Verlegenheit. »Mein Mann« klingt verkehrt, Ex-Mann trifft nicht zu, Vater meiner Tochter, ich weiß nicht.
Amanda sah ich dann vom Balkon aus. Mit einer Hand kämmte Rubina sie, mit der anderen schnitt sie ihr die Haare. Sie waren im Garten, in der Sonne. Nur ganz wenig, bremste Amanda sie und zeigte ein paar Zentimeter mit Daumen und Zeigefinger. Nur die gespaltenen Spitzen.
6
Mein Vater hat eine Messe bestellt, wie jeden Mai, seit er Witwer ist. Eine Woche vorher setzt er die Brille auf und sucht in einem alten, vor wer weiß wie langer Zeit von der raschen Hand meiner Mutter geschriebenen Telefonbüchlein nach Don Arturo. Er legt das Datum fest und benachrichtigt dann die engen Verwandten, deren Nummern er auswendig weiß. Als Letzte ruft er mich an.
Diesmal ist es wichtiger, nach der Enttäuschung vom letzten Jahr. »Gedenke ihrer nur in deinem Herzen«, hatte der Pfarrer ihn von Weitem getröstet. Er war beleidigt gewesen, er dachte jeden Tag an sie, auch ohne dass ihn jemand daran erinnern musste.
Am Telefon spricht er mit mir über den Gemüsegarten, wir verhandeln darüber, wie viele Tomatenpflanzen gesetzt werden sollen, aber er hat schon entschieden, mehr als zweihundert, wie gewöhnlich. Das ist seine Herausforderung an das Alter, die Krankheiten.
»Bring auch Amanda mit in die Kirche«, sagt er zum Schluss. So versetzt er mich in einem Augenblick von der feuchten Erde, die Wurzeln und Samen aufnimmt, an meinen wundesten Punkt.
»Ich weiß nicht, ob sie Donnerstagnachmittag nicht arbeitet«, gebe ich zu bedenken.
»Ist das etwa eine Arbeit?«, fragt er. »Falls es so ist, nimmt sie sich eben frei, für die Oma.«
Amanda nutzt den Vorwand, den ich schon für sie angekündigt habe, niemand kann ihre Schicht in der Bar übernehmen.
Sie will nicht mit. Sie wird sich nicht den Blicken der Verwandten aussetzen, an denen ihr nichts liegt. Einzig der Blick des Großvaters könnte sie verletzen, sie wird ihn meiden.
Ich versuche später noch einmal, sie zu überreden, als ich ihr an der Badzimmertüre begegne. Dort pflege ich ihr aufzulauern.
»Du glaubst doch selber nicht an diese Messen«, sagt sie mit halb mitleidiger, halb verächtlicher Miene.
Mein Vater sieht mich allein aus dem Auto steigen und verkneift sich einen Kommentar. Er plaudert mit dem Pfarrer auf dem asphaltierten Kirchenvorplatz. Es ist eine der wenigen Kirchen auf dem Land, die noch geöffnet sind, Beton und Backstein der Siebzigerjahre. Sie stößt mich jedes Mal ab.
»Ich kann dir keinen Rat geben, Don Artu, von dem Zeug verstehe ich nichts.«
Seit Kurzem züchtet Don Arturo Trüffel in einem kleinen Keller, den er besitzt.
Unter Beachtung der Abstandsregeln nehmen wir Platz, er und ich vorne. Er dreht sich um, sieht nach, wer da ist und wer fehlt.
Über dem Altar finde ich das plumpe Fresko mit den zwei Engelgruppen wieder, mit einem Gott im Strahlenkranz in der Mitte. Mir fehlt der Weihrauchduft, und mir fehlt meine Mutter, für die Dauer dieses Gottesdiensts zu ihrem Gedenken. Vielleicht könnte sie mir mit Amanda helfen.
Meine Mutter ist an jedem Tag, jedem Monat, jedem Jahr ihrer Krankheit gestorben. Nacheinander sind ihr alle ihre Fähigkeiten abhandengekommen: beim Dreschen für zwanzig Personen kochen, eine Stickerei aus »Mani di Fata« kopieren, ihre einzige Enkelin anlächeln.
»Signora, willst du ein Kaninchen kaufen?«, fragte sie mich, als wir sie schon verloren hatten.
Zuletzt hat sie auch meinen Vater verloren, hat aufgehört, nach ihm zu rufen. Ich war schon länger nicht mehr ein und dieselbe Person für sie. Ich veränderte mich jedes Mal, von der Signora, die das Kaninchen kaufte, wurde ich zur Diebin, die ihr das Geld aus der Nachttischschublade stahl.
Heute würde sie uns zärtlich betrachten, Mann und Tochter, so allein in der ersten Bank, beide mit einem in der Brust verschlossenen Schmerz. Sie würde unsere Hände nehmen, um uns zu trösten. Ich versuche mir die Wärme ihrer Berührung vorzustellen.
Bei der Predigt sagt Don Arturo ein paar Worte über die fleißige Frau, die sie gewesen sei, immer an der Seite ihres Mannes. Ich weiß nicht, ob sie im Vollbesitz ihrer Kräfte gewollt hätte, dass man sich so an sie erinnert. Eine unermüdliche Arbeiterin, wiederholt der Pfarrer ein wenig rhetorisch. Ihm gefällt diese beruhigende, partielle Wahrheit. Er weiß nicht, dass meine Mutter krank werden musste, um sich auszuruhen. Vorher hat ihr Mann ihr keine Pause gegönnt, er wollte sie als Mann auf dem Feld und als Frau im Haus.
Die Messe dauert ewig, so, wie es mir schon als Mädchen vorkam. Ich spreche die Gebete nicht mit, ich bekreuzige mich nicht, nehme weder die Hostie entgegen, noch knie ich mich hin. Singen darf man nicht, und Kirchenlieder haben mir sowieso nie gefallen. Manchmal mochte ich die Stimmen, aber die andächtige Frömmigkeit der Texte störte mich. Don Arturo toleriert meine distanzierte Anwesenheit, möglicherweise hofft er noch, dass ein Wort von ihm mich bekehrt. Immerhin erhebe und setze ich mich mit den anderen. Früher reichte ich auch meinen Banknachbarn die Hand, jetzt wird das Friedenszeichen nicht ausgetauscht, man schaut sich nur an. Ich hatte unseren alten Hausarzt hinter uns nicht gesehen. Auch er ist für meine Mutter gekommen. Ich könnte über Amanda mit ihm reden, weiß aber nicht, was ich ihm über meine Tochter sagen soll. Vielleicht, dass sie zu nichts Lust hat.
Beim Vaterunser atme ich erleichtert auf, in Kürze gehen wir in Frieden.
Draußen begrüßen wir die Verwandten und einige aus dem Dorf, ohne sie zu berühren, eine Freundin meiner Mutter wartet abseits, bis die anderen gehen. Sie kann nicht widerstehen und umarmt mich. Die beiden kannten sich schon als Kinder, gingen zusammen zu den Nonnen, lernten sticken. Dann hatte sie einen aus dem Dorf geheiratet und ein leichteres Leben gehabt.
»Was macht Amanda, wie geht’s ihr?«, fragt sie liebevoll und begierig, großartige Ergebnisse zu hören.
»Vorerst studiert sie daheim«, lüge ich. »Sie hat auch einen Job gefunden, deswegen ist sie nicht dabei.«
»Ich erinnere mich noch an sie auf Omas Arm, sie war ihre ganze Freude.«