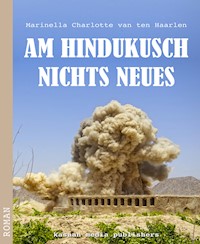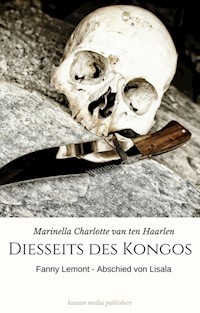
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Fanny, 14 Jahre alt, lebt in einem Haus an der Kongoschleife bei Lisala. Als ihr Ziehvater nicht mehr von einem Fischfang zurückkehrt, begreift Fanny, dass sie ab dem Zeitpunkt auf sich alleine gestellt ist. Ihr bleibt nur das kleine Kästchen mit dem verblichenen Bild ihres angeblichen Großvaters, einem weißen Belgier. Fanny weiß nichts über den Europäer, dessen Bild mit einigen Steinen und einer alten Karte von Belgien in dem Holzkästchen über Jahrzehnte gelegen hatte. Sie geht nach einem Fährunglück nach Kinshasa, lernt den Autoputzer Armande kennen, der nach einer Razzia der Polizei des Diktators Mobutu verhaftet wird. Fanny beschließt, nachdem sie Opfer in einem den Razzien folgenden Bombenanschlag wird, nach Europa zu fliehen, ihren Großvater zu suchen. Die Reise soll Jahre dauern. Sie sieht Afrika und die Probleme des Kontinents, lernt Kindersoldaten und die Armut, die Vorurteile und die Wege der Menschenschlepper kennen, bevor sie als junge Frau endlich in Belgien ankommt. Da geht die schier endlose Suche nach dem unbekannten Mann, nach ihrer eigenen Familie weiter.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Diesseits des Kongos
1. Teil Fanny Lemont „Abschied von Lisala“
Dank an alle, die mitgewirkt haben. BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenVorspann
Marinella van ten Haarlen
Diesseits des Kongos
1. Teil
Fanny Lemont
„Abschied von Lisala“
Roman
Deutsche Ausgabe (aus dem englischen und afrikaansen Original „Fanny Lemont“)
Dieses Buch ist erschienen bei kasaan media publishers
Ausgabe (E-Book), Juni 2022
ISBN: 978-3-96593-182-4
5. Ausgabe: Juni 2022
All Copyrights by Marinella ten Haarlen
In Cooperation with kasaan-media, Johannesburg
eBook edition
Dies ist ein Roman. Die geschilderten Ereignisse sind frei erfunden. Die geschichtlichen Ereignisse sind rein zufällig. Sie entsprechen dem Storyboard dieses Buches. Diese haben sehr wenig oder nichts mit der Realität und schon überhaupt nichts mit lebenden oder verstorbenen Personen zu tun. Das wäre rein zufällig. Sie orientieren sich lediglich an den damaligen und geschichtlichen Gegebenheiten.
Für J.F. und A.A.
Für meine Mutter und meinen Vater, für meine Brüder und meine Schwester
Erstes Kapitel
„Die Villa Laval am Kongo - Erinnerungen an die Kindheit“ (Aus dem Tagebuch der Fanny Lemont - Mai 1995)
Zweites Kapitel
Die Reise nach Kinshasa (aus dem Tagebuch der Fanny Lemont - Juni 1995)
Drittes Kapitel
Armande und der Abschied von der JugendDie Jahre in Kinshasa (aus dem Tagebuch der Fanny Lemont 1995-1997)
Viertes Kapitel
Aufbruch ins ferne Europa
Lisala, Provinz Mongala, im Norden der Demokratischen Republik Kongo
19. Oktober 2011
Fanny drehte sich um, blickte auf den riesigen Schatten, den der knorrige Baum in der Mittagssonne warf. Dann lächelte sie. Millionen kleiner Termiten liefen an der groben Rinde nach oben.
Am Ufer tat sich etwas. Viele Leute liefen zusammen, sicher war einer der Fischer verletzt zurückgekommen. Ein kleiner Junge mit einem rostigen, klappernden Handwagen lief an den Handwerkern vorbei, die träge unter den schweren Bohlen des Gerüstes ihr Mittagsschläfchen hielten.
„Auf der Straße raste ein Sammeltaxi vorbei, überholte ein Chukudu, das goldgelbe Bananen transportierte. Zusätzlich noch einen dicken Sack mit Maniok.
„Feldarbeit ist Frauensache!“, sagte Lucilla und starrte auf den Fluss, der sich hinter dem Urwald spiegelte. Tausende von Mücken, anderes Ungeziefer tänzelten über der schmutzig-braunen Wasseroberfläche, die Krokodile sonnten sich wie eh und je auf den vorgelagerten Sandbänken. Susanne spielte mit einer haarigen Spinne, die über ihre abgegriffene Schulfibel krabbelte.
„Du bist verhext, Susanne!“, rief Thierry. Lachte danach laut, schlug sich auf die Schenkel.
„Lass das Thierry, bist du verrückt geworden!“, herrschte Fanny den Jungen an. Er zuckte kurz zusammen, grinste aber dabei.
„Aber sie ist doch vergewaltigt worden!“, entgegnete der Junge. Machte eine obszöne Fingerbewegung.
„Ja, leider Thierry, leider. Vielen Frauen geht es in diesem Land so!“
„Ist doch selbst schuld, wenn die LRA kommt. Das hat mir mein Vater gesagt, die Frauen sind selbst schuld, weil sie verhext wurden.“
Susanne begann zu weinen. Fanny schüttelte den Kopf.
„Mein Vater ist bei der Force Publique, die haben immer Recht. Als Mobutu noch Zaire regierte, war alles hier besser.“
Ganz ruhig hörte sich Fanny die Worte des Jungen an, wandte sich zu ihrer Tochter.
Die anderen Kinder verstummten, schlugen sich die Fliegen vor der Nase weg.
„An der Missionsstation weiter vorne, bei dem ehemaligen belgischen Loch, mitten im Urwald, da liegen noch Leichen, die sehen aus wie Buschfleisch!“, lachte der Junge.
„Ich war gestern da, da liegen auch der Kadaver von Jean-Louis und die Knochen von den Geistern, die ihn verfolgten!“
Fanny runzelte die Stirn.
„Welchen Geistern?“, fragte Susanne, schlug den farbigen Stoff ihres Rocks um.
„Die Voodoo Geister, da liegt auch der Typ, sagt mein Vater, der vor euch hier drin gewohnt hat…...“
„Wer war das?“, fragte Fanny ungewohnt aggressiv.
„So ein alter Mann ohne Zähne, den haben die auf dem Landweg dahin gebracht …“
Fanny starrte den Jungen an, wusste nicht, ob sie ihn wegen seiner Kaltschnäuzigkeit zurechtweisen sollte oder wegen der Sache an sich.
Das Schiff blies das Horn. Legte langsam in einem Strudel von schwarzbraunem Wasser ab. Drei Wochen war das Kaufmannsschiff aus Kinshasa nun schon unterwegs, zog vier seitliche Pontons mit. Ein riesiger spitzer Berg mit verschiedensten Früchten, Maniok, türmte sich auf den schwimmenden Beibooten.
Säcke mit Reis und goldgelben Mais, reifen Bananen, ganze luftgetrocknete Affen nahm der stählerne Riese auf seine Reise Richtung Stanleyville mit.
„Muhamed Ali und George Foreman, 1974!“, tönte Thierry laut zu den anderen Kindern.
„Sei still, Thierry!“, schrie Susanne.
„Die Force Publique hat Jungs wie dir den Arm abgehakt, wenn sie nicht genug Kautschuk brachten! Sei froh, dass die weg sind. Dank Lumumba.“
Der drahtige Junge sprang auf, spuckte auf den Boden.
„Lumumba! Wer ist Lumumba? Er war so dumm, dass er sich in Säure auflösen ließ!“
Thierry rannte unter den Ästen des weitverzweigten Affenbrotbaumes durch. Verschwand hinter der frisch betonierten Terrasse. Fanny stand auf, nahm Susanne in die Arme, drückte sie.
„Meinst du, der Tote ist Papa Sese?“, fragte sie Fanny, sah ihr in die Augen.
„Ja!“, erwiderte die Kongolesin leise, blickte auf die Villa. Ließ ihre Schultern hängen.
„Ja, es ist Sese, nun wird er endlich ein christliches Grab finden!“, Fanny streichelte über das ebene Gesicht von Susanne, hakte sich bei ihrer Tochter unter.
„Komm wir gehen und suchen Sese!“
„Nur, wenn du mir die ganze Geschichte erzählst …!“
„Komm mit, es ist ein weiter Weg, ich werde sie dir erzählen.“
Fanny streichelte über das Gesicht von Susanne.
184
Erstes Kapitel „Die Villa Laval am Kongo - Erinnerungen an die Kindheit“ (aus dem Tagebuch der Fanny Lemont - Mai 1995)
Erstes Kapitel
„Die Villa Laval am Kongo - Erinnerungen an die Kindheit“ (aus dem Tagebuch der Fanny Lemont - Mai 1995)
Die Straße Zaires und des Kongos war der Kongo. Er war Leben und Tod, Armut und Reichtum zugleich. Ein reißender Strom, dessen Windungen durch die dünnen Schneisen des Galeriewaldes flossen. Eine Zeit lang auch ruhig dahindümpeln konnte.
Das trübe, bräunliche Wasser war an diesem Morgen ein schillerndes Spiegelbild der intensiven Sonne.
Das alte Kaufmannsschiff mit seinen immer geschäftigen Händlern, sollte innerhalb der nächsten Minuten festmachen. Vom Horizont her ragte der rostige Schiffsleib mächtig empor, wurde begleitet von Unmengen des grünbräunlichen, wie seidensilbern schimmernden Wasserfarns. Aus den beiden Schornsteinen wich schwarzer schwerer Rauch, der sich über den Fluss in der gesamten Breite wie ein Totenschleier legte.
Fanny sah auf das Gewässer, erspähte jedoch das kleine Boot, das leuchtende dreieckige Segel nicht mehr, mit dem der verschrobene Papa Sese zum Fischen vor Stunden aufgebrochen war. Längst wollte er schon zurück sein, dachte sie besorgt. Sichtlich immer nervöser spielte sie mit einem abgefallenen Blatt eines Bananenbaums am beginnenden Waldpfad. Wo früher, als Fanny noch klein war, scheue Sitatungas in der Morgendämmerung, im zarten dünnen Nebel ästen.
Wie immer wollte Fanny die großen, silbrig glänzenden Fische an Madame Theodora, an das Küchenpersonal des Schiffes, verkaufen, um ein paar Zairis zu verdienen.
Die Sirene klang dumpf, pfiff. Riss sie unvermittelt aus ihren Gedanken.
Der Steg aus morschem fauligem Holz verband nunmehr den Fluss mit dem satten undurchdringlichen Grün des beginnenden Galeriewaldes. Eine ockerblaue Echse huschte über den Anleger, züngelte zwei, drei Mal.
Plötzlich schlug die Schiffglocke dreimal hell und laut.
Der stechende Geruch der im Schiffsleib brennenden, glühenden, zischenden Kohle überdeckte die vielen verschiedenen Aromen, die aus den Garküchen entlang der Anlegestelle kamen.
Wie ein übervölkerter Bienenstock wirkte das alte Schaufelradschiff. Mama Thobert grillte große grüne Schmetterlingsraupen in der voluminösen runden Pfanne, würzte diese mit der speziellen, leider geheimen, Kräutermischung nach.
Auf den Decks erwachte nunmehr das Leben. Jetzt wo die Menschen, Passagiere gleichermaßen aus nah und fern, heranströmten, um einträgliche Geschäfte mit den angereisten Händlern auf dem Oberdeck zu tätigen und unter den Augen des wachsamen, an allem Handel prozentual beteiligten Kapitäns Alphonse abzuwickeln.
Es schien, als ein riesiger Schwarm Timalien aufflog und kurz danach wieder auf den vernieteten Aufbauten des alten Kahns landete, dass sich der Himmel einen Augenblick verdunkelte. Neugierig beobachteten die blau gefiederten Tiere von da aus das muntere Treiben an Bord. Während die ersten Edelsteinhändler mit grauem, schön gegeltem Haar, schwarz geschürfte Diamanten von einem recht umtriebigen Pygmäen kauften. Wahrscheinlich hatte der kleine Mann mit dem vernarbten, auffällig grobporigen Gesicht, diese, in einer geheimen Stelle, in den unendlichen Weiten des Urwaldes gegraben. Die beiden Männer wurden sich schnell handelseinig. Gegen abgegriffene US$ und einen gebrauchten, aber durchaus funktionierenden Benzingenerator, tauschten beide prall gefüllte Beutel.
Wally, der berüchtigte Diamantenhändler aus Kinshasa, betrachtete durch eine riesige reflektierende Lupe die trüben, noch ungeschliffenen Steine, die er auf einem alten, grob gehobelten Holztisch vor sich auf einem roten weichen Samttuch ausbreitete.
Eine unerwartet lange Schlange bildete sich vor seinem Tisch. Da war auch Pierre, der einen grünen, mit blauen Streifen durchzogenen Malachit in seiner verkrüppelten, fingerlosen Hand hielt. Ein paar gelblich-blau funkelnde Steine, deren Ecken scharfkantig, wie gezackt waren. Diese Mineralien zeigte er dem kritischen Wally gleich im Anschluss.
Unaufgefordert legte Wally ein paar Tausender, ein großes Paket abgewetzter Scheine, auf den Tisch. Von Papa Sese wusste Fanny, dass Wally seine Gegenüber natürlich immer wieder betrog, indem er riesige Haufen kleiner Scheine mit Papier dazwischen legte, damit seine zahlreichen Lieferanten, trotz des erbärmlichen Betrages, den er ihnen zahlte, an das große Geld glaubten.
Aber das Geld blieb auf dem Schiff. Da waren die umtriebigen Textilhändler, die allwissenden Apotheker, die allerlei Medizin verkauften, in kleinen grünen Schachteln anpriesen, flink heimliche Kräutermischungen zubereiteten.
Das Schiff schaukelte, die stark korrodierte Ankerwinde quietschte. Auf der Anlegerbrücke warteten weitere Reisegäste, die zahlreiche sperrige Kartons mit Waren aller Art, geknüpfte Matten und sorgsam gegerbtes Krokodilleder in der Hand hielten. Aufgeregt sprachen sie ein Kauderwelsch aus Lingála und Französisch und anderen Dialekten durcheinander.
Der bärtige Alphonse, der eine ölverschmutzte, von Fliegen überzogene Mütze trug, rauchte hastig eine dünne Filterzigarette. Blickte von der weit ausgelegten Brücke ein paar Mal durch sein Fernglas, auf den reißenden, mit allerlei Strudeln versehenen Fluss. Suchte das Wasser vor ihm, mit seinen zusammengekniffenen Augen, nach Sandbänken, nach weiteren Untiefen ab. Er machte dies immer, genau an dieser Stelle. Es war zu einer Gewohnheit geworden. In der Biegung, etwas weiter den Fluss folgend, lag ein ausgeschlachtetes Wrack am Ufer. Der rostige ausgeweidete Leib der Costermanstad. Sie war zweimal in ihrem Betriebsleben gesunken. Das erste Mal im Bürgerkrieg 1960, Fanny erinnerte sich an die Geschichte des tagelang auf dem Fluss brennenden, treibenden Schiffes. Immer wieder hatte Papa Sese davon erzählt.
Einst der Stolz eines Kapitäns, der mit dem Handel auf dem Kongo ein riesiges Vermögen verdient hatte. Schon seit Jahrzehnten ruhte es zwischen dem gigantischen ufersäumenden Schilf und den krumm gewachsenen, dichten Palmen, die in dem bräunlichen Wasser den angrenzenden Strand umgaben.
Plünderer hatten vor bestimmt fünf Jahren, versuchte sich Fanny zu erinnern, während sie immer noch auf die Rückkunft vom Papa Sese wartete, den Schiffsmotor aus dem stählernen Bauch geschweißt, diesen auf einen Kahn geladen, ungehindert wie einen edlen Goldschatz hiernach nach Kinshasa geschleppt, wo sie sicherlich einige Tausend Zairis dafür bekommen hatten.
Papa Sese konnte danach wochenlang nicht fischen, weil das Öl schmutzig, schwarz wie ein tausendfacher Regenbogen auf der Oberfläche des Flusses schwamm und gleich den vorzeitigen Tod für jeden Fang brachte.
Die sonst hellen Kiemen der dunkelroten, manchmal golden glänzenden Fische, deren Namen Fanny nicht kannte, waren über Wochen schwarz und entzündet gewesen.
Sese jedoch litt unter Problemen, etwas zu essen zu besorgen. Er knüpfte tagelang an den zerrissenen Netzen. Lange danach schimpfte er lautstark auf die fremden Männer, die von weit herkamen und diesen Irrsinn begangen hatten. Jetzt klaffte ein riesiges Loch aus dem einstigen Stolz der Flotte von Kapitän Philippe.
Nach und nach wurde Fanny ungeduldig, raffte sich den roten Wickelrock mit den blauen Streifen, der im Wind wehte, band die langen lockigen Haare zu einem großen, fast steif abstehenden Zopf zusammen. Sichtlich nervös sah sie erneut auf die Uhr. Das grau verwaschene Plastikarmband rahmte die japanische Digitaluhr ein.
Es war 10:30 Uhr.
„Nein, 5 Minuten vor halb elf Uhr!“, beruhigte sie sich selbst wieder nach wenigen Augenblicken.
Auf dem Zwischendeck verrichtete der allseits gefürchtete Zahnarzt sein blutiges Handwerk, gegen viel Geld und große Schmerzen. Er erlöste den einen oder den anderen der Schürfer, Arbeiter aus dem Urwald, von seinen fauligen, meist schwarz vereiterten Zähnen. Danach gingen die Mineure zu den Prostituierten ins untere Deck, die dort schon grell geschminkt, leicht bekleidet in einer Reihe saßen. Wie Hühner auf einer Stange, lächelten, riefen sie den Männern, die von dem Zahnarzt zurück auf das Mitteldeck strebten, zu. „Schlimmer ging es nicht mehr!“, das verkündete Abbé Villard in seiner letzten Weihnachtsansprache vergangenes Jahr, während des alljährlichen Gottesdienstes am Pier etwas weiter unten, am seidenen Strand bei den murrenden und feixenden Fischern.
Wally brüllte etwas Unverständliches, wie jedes Mal. Es kam auf dem Oberdeck zu einer kurzen, jedoch heftigen Rangelei. Eine schwitzende, sehr korpulente Frau aus der Küche des Schiffes öffnete eine metallene Luke, rauchte eine Zigarette. Sie betrachtete dabei das allgemeine Menschengewühl vor sich auf dem Platz am Steg und rief dann wild nach den Händlern, die ein paar schwarz-weiß-leibige Hühner in den beengten, hölzernen Käfigen brachten. Noch flatterten diese auf und nieder, als ahnten sie zu dem Zeitpunkt schon, was ihnen bevorstand oder bald widerfahren würde.
Ein dicker unangenehmer Luba brachte das Federvieh an den Eingang zur Küche, bekam sein Geld, ging danach. Er trug einen verschlissenen grauen Anzug und ein zu enges verschwitztes Hemd. Zog seinen viel zu voluminösen Hut auf dem Kopf bis ins Gesicht. Dort ein paar Meter weiter, an der Seite des Schiffes, saßen die geselligen Bier- und Schnapshändler, die die Flaschen auf hölzerne Planken stellten und dort zum Verkauf feilboten. Sie versuchten mit den angebotenen Alkoholika ihr Auskommen zu bestreiten. Der Dicke mit dem Hut kaufte zwei Flaschen von dem billigen, aus Maniokmaische gebrannten Schnaps. Dem in den braunen Flaschen. Zog mit diesen von dannen.
Fanny verspürte Durst auf eine selbst gemachte Limonade.
Ihr Ziehvater kam nicht zurück, sie verstand es nicht. Zumal das Schiff innerhalb der nächsten Minuten fahrplangemäß ablegen musste und das schwimmende Handelshaus erst in einer Woche, auf dem Rückweg aus der Hauptstadt, mit neuer Ware zurückkommen würde.
Vielleicht war der Motor des alten Bootes kaputtgegangen oder die Ausbeute des heutigen Tages war so karg, dass es sich überhaupt nicht lohnte, diese anzubieten.
„Sage ihm“, meinte die dicke Frau aus der Küche, die plötzlich über Fanny an der langen metallenen Reling des Zwischendecks stand, ziemlich geringschätzig, „dass ich lange genug auf den stinkenden Fisch gewartet hätte!“
Die langen, wie Krallen wirkenden Nägel der Frau waren rot lackiert, wirkten wie blutig, dazu trug sie einen violetten Wickelrock, von dem das Palmölfett in feinen Perlen triefte.
Ihre Lippen waren dick und wulstig, boten einen fremden Kontrast zu der Erscheinung der Frau. Sese hatte Fanny irgendwann einmal, vor zwei oder drei Wochen erzählt, dass sie trank und schon sehr schwer krank war.
„Es tut mir leid, ich weiß nicht, wo er ist!“
Die Dicke nickte etwas gelangweilt, drückte ihr Gesicht an eine der korrodierten Stahlstreben der Mittelbauten und zuckte gleichgültig mit den Schultern.
Dann winkte sie ab, rief die anderen Fischer, die sich hinter Fanny versammelt hatten und schon alle Arten von Fischen auf einer Holzstange aufgereiht der Köchin entgegenhielten. Das fetteste Exemplar, von mindestens einem Meter Länge und silbrig glänzender Schuppung, kaufte sie, nachdem sie fachmännisch Kiemen und die trüben, jedoch schwarzen Augen des Fisches kontrollierte.
Ein Bündel Scheine wechselte den Besitzer. Ein paar Männer hievten den schweren länglichen Körper des Fisches in die Küche der Fähre. Zwei Minuten später kamen die Fischer mit der Schwanzflosse und dem Kopf des Tieres wieder heraus. Warfen diese in einem hohen Bogen hinter dem Schiff wieder zurück in den Kongo, wo sich dann Hunderte von Vögeln in Sekunden über die Kadaverreste hermachten.
Die „Foufou“ war schon hinter dem Horizont, entlang des Kongos verschwunden. Müll, andere stinkende Abfälle und Unrat aller Art waren zurückgeblieben und trieben, von ganzen Vogelschwärmen begleitet, immer weiter ab. Es war lange nach 17:00 Uhr, ab und zu war das Kreischen von ein paar Flamingos in weiter Ferne zu hören. Die Grillen zirpten dazu. Ein zotteliger alter, grauhaariger Hund trank gierig aus dem Strom, danach legte er sich wieder in das schattige Unterholz neben einen Baum. Sese war immer noch nicht zurück, die Minenarbeiter waren verschwunden. Es wurde wieder ruhig am Anleger.
Fanny wurde jedoch unruhig, nach weiterem langem Warten, Fanny besah sich die gezogenen blutigen Zähne, die noch auf dem Platz vor der Mole lagen. Dann beschloss sie, zurück zu dem Haus auf dem alten Minengelände zu gehen. Sie konnte Sese immer noch nicht sehen. Das Boot war mit der Unendlichkeit des Stromes verschwommen und darin aufgesogen worden.
Es war stickig und warm, an diesem frühen Nachmittag des 12. Januar 1995, als sie den schmalen Pfad entlang, durch den dichten, von vertrauten Mahagonibäumen und von Schlingpflanzen umwickelten Gummibäumen gesäumten Wald zurückging. Das nervtötende Gegröle einer Gruppe kleiner grüner Affen begleitete sie bis nach Hause.
Im Wohnzimmer war es kühl, feucht und modrig.
Der alte Dieselgenerator brummte laut, erstarb, als der Kraftstoff ausging.
„Wie üblich!“, fluchte Fanny.
Das Haus war vor vielen Jahren, kurz nach der Revolution am 30. Juni 1960, nochmals weiß gekalkt worden. Es verfügte über eine lange Geschichte. Gehörte einst einem wohlhabenden belgischen Minendirektor, aber das war schon über 30 Jahre her. Schon zu lange zurück, als dass Fanny die Zusammenhänge verstehen konnte. Damals wurden Diamanten geschürft, überall große und kleine funkelnde Steine aus einem tiefen Loch im Wald, zumeist hinter dem Haus, geholt. Als die Belgier, die einstigen Besatzer, wie Sese die ehemaligen Kolonialherren nannte, gingen, war der Direktor der Mine gleich an der Villa, neben dem noch blühenden Gemüsegarten erschlagen und vergraben worden. Zumindest lag er neben seiner schon 1956 an Malaria verstorbenen Frau. Das Grab besaß einen verwitterten, mit allerlei grünen, wild wuchernden Pflanzen überwachsenen grauen Stein, der jetzt Platz für viele Insekten bot.
In dem quietschenden Bett des ehemaligen Direktors schlief normalerweise Sese, aber nun saßen Ungeziefer und eine herrlich bläulich schimmernde Libelle auf der schmutzigen, löcherigen Decke.
Direktor Laval war den Erzählungen nach, von einer wütenden streikenden Menge Arbeitern, regelrecht gelyncht worden. Das aber war in den vielen Wirren der Unabhängigkeitsunruhen der trudelnden Kongokrise geschehen. Den Kopf des Belgiers fand man erst viel später und bestattete diesen dann auch, als man das Grab Jahre nach den tragischen, aber revolutionären Tagen mal wieder geöffnet hatte.
Lavals Kopf war durch eine tiefe Hiebwunde gespalten worden und die neugierigen Arbeiter konnten ihn nur noch an seinen blonden, noch am kahlen weißen Knochenschädel vorhandenen Haaren, überhaupt identifizieren.
Es ging das Gerücht, dieses hielt sich auch hartnäckig, so erzählte Papa Sese, dass der Ex-Direktor 200 Karat Diamanten mit ins Grab genommen hatte. Die Ausbeute eines ganzen Jahres. Wahrscheinlich war er deshalb ausgegraben worden.
Nur Laval wusste kurz vor seinem grausamen Tod, wo sich die so begehrten Steine befanden, wo er diese vergraben hatte. Irgendwann suchte jeder nach diesen mysteriösen Diamanten. Der ganze Landstrich lebte davon, die Diamanten zu finden, aber niemand fand etwas.
Papa Sese entdeckte einmal hinter einem alten, mit Ölfarben gemalten Bild, auf dem leuchtende grüne Landschaften und seltsame Gemäuer in einem Land zu sehen waren, das Sese Belgien nannte, in einer Mauernische ein paar alte belgische Franc. Aber da lebte Mama Sese noch. Fanny hörte von ihr allerlei Geschichten und Märchen aus einem Buch, das Laval in seinem reich sortierten Bücherschrank hinterlassen hatte.
Zum Essen für diesen Abend waren noch ein paar Früchte da. Überreife Mangos und ein paar Bananen. Fanny aß, lutschte die Bananen, als es später Abend wurde und sich die Dämmerung wie ein Schleier über das Land senkte. Nun wurde sie angespannt, war alleine in der geräumigen Villa.
Das Mauerwerk knirschte ab und zu laut und mit einem seltsamen Hall. Fanny zog sich in das Zimmer neben dem Schlafzimmer von Papa Sese zurück. Darin stand ein altes Metallgestell. Die Matratze war durchgelegen, roch nach Schweiß und Schimmel, aber Fanny schlief wunderbar auf ihr.
Die Kleider hingen in dem Schrank oder darin, was davon nach Jahrzehnten noch über war. Ein hölzernes, schimmelndes Gerippe. Von weißen und grauen vertrockneten Würmern zerfressen.
Noch einmal ging sie in der beginnenden Nacht runter zum rauschenden Fluss. Sese kam nicht. Auch konnte sie ihn nicht ausmachen, nach ein paar Minuten ging sie wieder zurück zu dem Haus. Der Kongo verlief wie ein Unheil bringender Geist hinter ihr. Toste. Schäumte. Fanny blieb nochmals auf dem geschwungenen engen Pfad stehen. Hielt inne. Sie verspürte Hunger und urplötzlich auch Angst. Blickte durch das über ihr liegende Blätterdach neben dem im Dunklen liegenden Haus. Betrachtete für einen Moment den Mond und die Sterne, die sich hinter dem klaren, mit einigen dunstigen Wölkchen versehenen Himmel abzeichneten. Es wurde kälter, sie machte geschwind ein Feuer mit nassem Holz, das ordentlich qualmte. Weiß wirbelte der Rauch auf, biss in den Augen, die Scheite begannen langsam zu glimmen. Dann loderten die Flammen, deren äußerste feurige, orangerote Zunge nach oben flackerte. Die Batterien des Radios waren leer, schon seit Tagen.
Sese und sie hörten sonst immer die Nachrichten aus dem fernen Kinshasa und der restlichen Welt. Es gab so furchtbar viele Sprachen, dachte Fanny. Zuckte zusammen, drehte sich um. Die Schatten der Nacht verschwanden in dem angrenzenden Gebüsch.
Sese war in seiner Jugend einmal in Kinshasa gewesen. Prächtige Bauten, funkelnde farbig lackierte Autos und immer genug zu essen. Sese hatte feine Kleider getragen, wie die Leute, die da über die Boulevards flanierten. Dort gab es auch Weiße.
Mama Sese war in Lubumbashi geboren worden.
Eigene Kinder hatten beide keine, deswegen hatten sie Fanny nach dem Tod der Eltern aufgenommen. Fanny war in Sambia geboren worden. Auch dort tobte einst einer der vielen Kriege Afrikas, ihre Eltern mussten fliehen. Die junge Frau erinnerte sich nicht mehr. Runzelte die Stirn, spielte mit einem spitzen Stock in der Glut. Fanny war noch ganz klein, drei Jahre alt, als sie zurück in den Kongo kamen.
Angeblich war ihre leibliche Mutter an Typhus gestorben. Der Vater, ein großer Mann mit leuchtenden weißen Zähnen und starken Händen, die sie immer kitzelten. Er fand damals Arbeit in einer Mine.
Das hieß, er hatte sich diese einfach genommen. Da war niemand außer einer Handvoll anderer Leidensgenossen, die in dem unheimlichen tiefschlammigen Loch nach funkelnden Steinen, Tag für Tag, ohne Klagen gruben. Wuschen und wuschen, dann wieder gruben. Wenn sie einmal Glück hatten, das war recht selten, fanden sie einen kleinen Stein in der trüben, stinkenden Brühe.
Verhökerten ihn dann an Wally oder einen der anderen fahrenden Händler, der ihn in eines der vielen verschiedenfarbigen Ledersäckchen steckte.
Richtig böse, er lächelte zynisch und hässlich, dachte Fanny über Wally. Angeblich handelte dieser auch mit Waffen. Aber wer tat das hier nicht!
Als Mama Sese tot war, blieben Papa Sese und sie zusammen. Bei den übellaunigen Fischern. Fanny konnte danach zwei Jahre zur Schule gehen, zumindest den Grabstein ihres Vaters lesen und die Bibel, mehr schlecht als recht. An was ihr Vater, er hieß Antoine, gestorben war, vermochte sie nicht zu sagen. An sich wusste es niemand. Es war nur der Tod, der jeden irgendwann dahinraffte. Irgendwie, irgendwann in der Mine. Alle starben früh, keiner wurde alt, wahrscheinlich, weil sie so schwer arbeiteten.
Nach dem Tod von Mama Sese wollte der gebrochene Papa Sese Fanny zu einem bekannten Waisenhaus nach Kinshasa bringen, zu den Nonnen der katholischen Kirche. Aber irgendwie war dem mürrischen Mann damals wohl der Weg zu weit und er hatte sich so an Fanny gewöhnt, die auf seinen Knien saß und ihn aus ihren tiefen braunen Augen mit langen schwarzen Wimpern ansah.
Nun saß sie Stunden an dem wärmenden Feuer, sie fühlte sich allein und verlassen. Sese ließ sie alleine zurück. Oft war das Mädchen in den vergangenen Jahren mit ihm auf den Fluss gefahren. Sie lernte, wie sie das Netz spannen musste und hielt es, wenn sich die zappelnden, schon noch nach Luft schnappenden Fische vor dem nahenden Tod noch einmal wanden, auf den morschen Planken des Bootes hochsprangen.