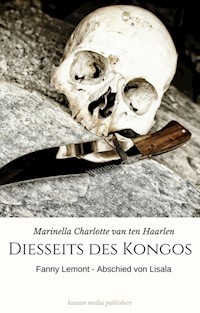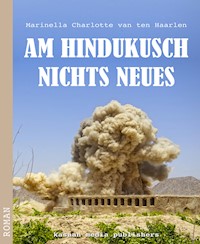
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Über die Sinnlosigkeit des Krieges: Eine junge Bundeswehr–Soldatin erlebt den Krieg in Afghanistan in allen Facetten. Sie wird Zeugin der chaotischen Umstände und der zahllosen Menschenrechtsverbrechen der Kriegsparteien, verliert Freunde und gewinnt neue dazu. Zurück in der Heimat trifft sie desillusioniert auf ihre ehemaligen Gegner, die mittlerweile in Bremen leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Am Hindukusch Nichts Neues
Über die Sinnlosigkeit des Krieges: Eine junge Bundeswehr – Soldatin erlebt den Krieg in Afghanistan in allen Facetten. Sie wird Zeugin der chaotischen Umstände und der zahllosen Menschenrechtsverbrechen der Kriegsparteien, verliert Freunde und gewinnt neue dazu. Zurück in der Heimat trifft sie desillusioniert auf ihre ehemaligen Gegner, die mittlerweile in Bremen leben.BookRix GmbH & Co. KG80331 MünchenUnverhoffte Rückkehr
Marinella Charlotte van ten Haarlen
Am Hindukusch
Nichts
Neues
Deutsche Ausgabe
Dieses Buch ist erschienen bei kasaan media publishers
bookrix edition
Es gilt die ISBN Nummer von bookrix
1. Ausgabe: April, 2019
All Copyrights by Marinella Charlotte van ten Haarlen, 1980-2017
In Cooperation with kasaan media, Johannesburg, South Africa
Bremen, Nîmes, 2014
Dies ist ein Roman. Die geschilderten Ereignisse sind frei erfunden. Die geschichtlichen Ereignisse sind rein zufällig. Sie entsprechen dem Storyboard dieses Buches. Diese haben sehr wenig oder nichts mit der Realität und schon überhaupt nichts mit lebenden oder verstorbenen Personen zu tun. Das wäre rein zufällig. Sie orientieren sich lediglich an den damaligen und geschichtlichen Gegebenheiten.
Nîmes, République française
FSK ab 18 Jahren
Für J.F. und A.A.
Ohne Dich wäre das Buch nicht möglich gewesen,
für R.M.S.
Meiner Lektorin A.M.M.
Würde hat etwas mit Dir zu tun, G.S.
Auch für Dich, F.
Und auch für Euch G. und C.
Für meine Mutter und meinen Vater,
meine Geschwister.
Der Roman soll auch eine graue, letzte
Hommage an meine Bremer Jahre darstellen.
Zu Ehren der Freien und Hansestadt Bremen.
Natürlich ist dieses Buch dem Titel nach angelehnt an das unsagbar gute, noch immer gültige Werk von Erich Maria Remarque.
Jedoch hat sich, seit Remarque sein Werk veröffentlichte, nur sehr wenig verändert. Die Technologie, vielleicht der Stand der Bildung, aber der Wille zum Frieden ließ auch nach dem Zweiten Weltkrieg nach einigen, wenigen Jahren nach. Wenn es diesen überhaupt jemals gegeben hatte.
Dieser Roman beruht auf Reportagen und der tatsächlichen Hilfe vieler.
Gewidmet denen, die dem Frieden dienten, zumindest versuchten, diesem Ziel gerecht zu werden. Denen, die fielen für ein sinnloses Unterfangen.
In einem Krieg, der laut den Politikern ein Friedenseinsatz war.
Was für eine schäbige Lüge, wie der Grund, aus dem Afghanistan angegriffen wurde.
Die Politik ab 2001 wirkt wie ein schlechtes Drehbuch.
Bin Laden war ein Gewächs seiner Zeit und der Gier des gelebten Neokapitalismus. Die, die ihm folgten, ISIS etc., waren die brutalen Enkel derer, die die Schlächter auf den Plan riefen.
Jedoch, Bin Laden war mit den westlichen Grundwerten wohlvertraut und spielte den Revolutionär einer Kaste von blutrünstigen Reformatoren des Islams. Er war für die neokonservativen Kräfte der richtige Mann am exakten Ort zur passenden Zeit.
Er war nicht nur das Synonym des Terrors, sondern schlicht des Bösen, sicherlich nicht des Glaubens Islam.
Es war die Zeit der Lügen und der gelebten Intoleranz auf beiden Seiten, Anfang des Jahrhunderts. Ein seit Jahrzehnten schwelender Konflikt suchte seine Akteure und fand diese überraschend schnell.
Die Gier derer nach Macht zu befriedigen, die sonst ihre Ziele hätten aufgeben müssen. Das Streben nach Öl, nach einer Grundordnung, die die, die befreit werden sollten, überhaupt nicht wollten. Wahrscheinlich auch nicht verstanden. Die nichts von diesem Frieden kannten, da sie nur den Krieg, die blutige Diktatur einzelner Systeme erlebt hatten.
Gewidmet auch denen, die den Gedanken von Professor Schumacher weiterführten, der dem vorbauen wollte, was sein politischer Enkel, Gerhard Schröder, aus seltsamen Kadavergehorsam gegenüber einem mutmaßlichen Kriegsverbrecher, George W. Bush, und seiner zweifelhaften Administration tat. Was die Bundesregierung anrichtete, einen Teil des eigenen Volkes verarmen ließ, um diesen unheiligen Krieg der vermeintlichen Christen gegen die Moslems zu führen, ist unbeschreiblich und wird sich in den folgenden Jahren noch soziopolitisch rächen.
Die Ignoranz dieser Tage stellte letztendlich die Weichen in eine Diktatur, die sich nur langsam entwickelte.
Die Folgen des 11.9.2001 waren recht für den Masterplan einer sterbenden Großmacht, USA, die sich über alle Regeln der Zivilisation hinwegsetzte.
Die CIA ist und war nicht die Heilsarmee, ebenso wenig wie die NSA.
Eine ganze Glaubensgemeinschaft wurde zum symbolischen Feindbild für den Feldzug für das Öl, weil man sich nicht anders zu behelfen wusste. Weil man, so wahr man einem Gott half, in diesen Tagen des Verrats an allen zivilisatorisch erworbenen Errungenschaften vergaß, wie viele Soldaten gefallen, wie viele Soldaten im Zweiten Weltkrieg nicht nach Hause gekommen waren.
Ein toter Soldat war schon zu viel!
Ganze Völker wurden von den Amerikanern bespitzelt, belauscht und gedemütigt.
Daraus entwickelten sich populistische Personalien, wie Erdogan und sein Hang zur Todesstrafe, sein Hang zur Unterdrückung ganzer Völker.
Trump dürfte das schlimmste Beispiel sein. Jedes Wort über ihn ist zu viel.
Für den, den man vermeintlich jagte, Osama Bin Laden, wurde es ein bequemes Spiel: Katz und Maus.
Niemand sah ihn, hörte ihn, nur das Säbelrasseln der Amerikaner, die die Geister selbst gerufen und geduldet hatten, war laut vernehmbar. Von Bin Laden kannten wir, die Bürger dieser Welt, nur den Schatten, nicht aber seine Version der Geschichte. Vor einem ordentlichen Gericht hätte man seine Ansichten und die Darstellung des unbeschreiblichen Verbrechens vom 11. September 2001 und anderer zumindest anhören können.
Mit geschickt inszenierten Bildern aus dem Lageraum des Weißen Hauses untermalt, wurde Bin Laden dann gerichtet oder zum Schweigen gebracht, je nach Betrachtungsweise.
Junge Menschen, die nach Afghanistan gingen, kamen gebeugt und seelisch zerstört zurück aus einem Land ohne Hoffnung, ohne Anspruch auf den, auch in Kabul, ersehnten Frieden.
So blieb eine weitere Lüge der internationalen Politik wie ein böser Fluch auf den Menschen hängen. Angst durch die verschärften Sicherheitsgesetze ermöglichte die Kontrolle, die Errichtung von einer scheinbaren Demokratie in der Demokratie, ohne diese eine Form der gewollten Diktatur zu nennen.
Marinella Charlotte van ten Haarlen
Nîmes / République française, 2017
Bloubergstrand, Cape Town / South Africa, 2017
Unverhoffte Rückkehr
Anfang Mai 2010, Hansestadt Bremen
Der ICE bremst so plötzlich, so heftig ab. Ein rotes Signal reißt mich aus den nicht enden wollenden Tagträumen.
Aber ich will in den Träumen bleiben, ich will mich nicht losreißen, weil die Realität zu schmerzhaft ist.
Die sonst so bodenständige Schwerkraft hört auf zu existieren.
Es klappert, vibriert, schaukelt. Es tost. Es rattert, ist still, gleitet dahin, rattert wieder. Verstummt fast mit einem gequälten Pfeifen. Es klingt wie ein träges Atmen. Wie ein knirschender, monotoner Blasebalg.
Langsam, mit starkem Widerwillen, kehre ich zurück in diese so grausame, bedrohliche, jedoch so beharrliche Wirklichkeit des realen, des existierenden Lebens. Ich sträube mich davor, dann aber reiße ich mich los aus dem friedlichen Wachtraum einer Welt ohne Menschen, ohne mich. Ohne Gegenstände, einfach aus einem bestehendem Vakuum. Ich will nur in dem Licht treiben.
Ich strecke, recke den seelenlosen Kopf aus meinem so ovalen, gleichförmig geschwungenen Schneckenhaus, das ich von innen bemalt, verziert habe; in dem ich glücklich bin, in dem ich nichts mehr bin als der nackte Körper.
Es riecht, es stinkt förmlich, wie eine mit Urin angesetzte Mischung. Eine Übelkeit erregende Melange aus abgestandenem, gezuckertem Kaffee aus silbernen Thermoskannen. Der Geruch nach schalem, über den blauen Teppich laufenden Bier aus zerknautschten, nunmehr über den Boden scheppernden Büchsen. Dazu mengt sich der Gestank von billigem, aus Asien importiertem Blümchen-Parfüm und faulenden, vergorenen Exkrementen aus der Toilette hinter mir.
Die Tür geht automatisch auf und zu, auf und zu. Jede Minute zweimal, wie ein warmer, stickiger Wind, der den Automatismus, Mechanismus unsichtbar antreibt.
Wie das Leben an sich. In sich.
Ein Kind schreit, weint.
Jetzt passiert der Waggon, die vielen Waggons hinter diesem, wie ein, in den sich auftürmenden, schäumenden Wellen schlingerndes Schiff mit lautem, deutlich vernehmbarem metallischen Knacken, wohlvertrautem Klicken eine der vielen, folgenden, der letzten Weichen.
Die metallenen Räder drehen sich wieder schneller, gleichmäßiger.
Die ersten, wichtigen, nahezu stechenden Sonnenstrahlen des nach diesem kalten Winter beginnenden Frühlings fallen warm durch das getönte, geschwungene Panoramafenster der nahezu leeren, unbesetzten 2. Klasse – wie ein leuchtender, in sich ausgebreiteter Fächer.
Ein Servicewagen, der von einem lustlosen, unaufmerksamen Mitarbeiter geschoben wird, klappert, klingt hohl, wie leer. Er eckt in einem der engen Gänge an.
Endstation Bremen, Bremen Hauptbahnhof.
Es ist 10 Uhr. Kurz danach. Ich sehe auf die schwarzen, filigranen Zeiger, die sich in Zeitlupe zu bewegen scheinen.
Wie meine Erinnerung, wie mein Leben.
Mir wird klar, ich komme ohne Beine, nur mit gerade verheilten Stümpfen nach Hause, nach Deutschland.
In meine früher so geliebte Heimat.
Bremen, kehre ich nun zurück?
Finde ich zu mir, erneut?
Aber was ist Heimat?
Die saftig grünen Wiesen mit Buntgefleckten, die abseits stehen an der verrosteten Badewanne, die zur Tränke umfunktioniert ist, und gemächlich wiederkäuen.
Wo ist sie, diese Heimat?
Wer hat diese mir genommen?
Ein Stück Fleisch ist aus mir herausgeschnitten. Aus mir, mir nichts, dir nichts, kupiert?
Arthur Rosebery spendet mir vom MP3 Spieler Spread a Little Happiness.
Die Erinnerung an Afghanistan, an den Straßen–Bazar. An das kleine, zierliche Mädchen, das im Auftrag seiner Mutter die Platten ihres ehemaligen sowjetischen Liebhabers verkaufte.
Woher der Vater des kleinen Mädels die alten Schellack Schätze hatte, bevor ihn Mujaheddin an den Betonsockeln einer ehemaligen Tankstelle aufhängten, mit langen Säbeln zerteilten, wusste niemand mehr. Er war einfach vergessen wie die abscheuliche Tat, die sein Leben beendete.
Wer hat es gewagt, mir den Glauben an alles zu nehmen, diesen zu verkehren in seltsame, unbewusste, stumpfe Gleichgültigkeit?
Nach allem, was ich sah, erlebte, in diesem so fremden, kargen, wunderschönen Land der Paschtunen?
Das Land, für das ich kämpfte?
Für den Sold eines jeden Soldaten. Aber gegen welchen Feind eigentlich?
Gegen uns selbst wahrscheinlich, für die Macht und die ungestillte Gier einiger.
Weniger für uns.
Nein, für den alleinigen Glauben, dieser zivilisierte, der heilige, aber einzige christliche Glaube.
Es war wie bei den alten, längst vergessenen Kreuzrittern, die gen dem fernen, wohl aber so wertvollen Jerusalem ritten, liefen, segelten - der Sonne entgegen. Mit funkelnden, schweren Rüstungen, entgegen derer, die sie für bekämpfenswert hielten.
Es wurde nachträglich in der langen, absurden Geschichte der Menschheit zu einem unbestrittenen, blutigen Ruhmesblatt umgeschrieben.
Die geschlagenen Akteure bewährten sich in diesem Stück, in dem sie sich selbst nicht mehr zurechtfanden.
Richard Löwenherz kam hoch zu Ross zurück nach England, um seinen intriganten Bruder zu vertreiben. Robin Hood, ein zu seiner tristen Zeit ausgewiesener Dieb, gefürchteter Räuber, wurde in den Dekaden danach zu einem Volkshelden verklärt, verzaubert.
Die gelebte, die verstandene Wahrheit sah und sieht immer anders aus.
Waren wir die modernen Tempelritter? Unterlagen wir auch dieser unerklärten Mystik?
War das versiegende Öl diesmal der Schatz?
Der gefestigte Glaube, der eine Gott nur ein Vorwand?
Wenige Freunde, viele erkannte und unentdeckte Feinde, Spitzel, Drogenhändler, kleine und große. Schieber, Kriegsgewinnler, Kriegsverlierer. Gedemütigte, durch Jahrzehnte geprägte, tief traumatisierte Frauen, die sich aus der Burka befreiten, den nächsten Tag wieder anzogen, weil sie sich nackt fühlten. Oder, weil sich ihre Männer so fühlten inmitten einer zerrissenen, durch den fortwährenden Krieg geprägten Gesellschaft. Kinder ohne Perspektive, mit starrem, kaltem und entschlossenem Blick.
Für wen kämpfte ich?
Für wen jetzt?
Wenn nicht für mich selbst, sicher nicht mehr für meine zivilisatorisch gefärbten Überzeugungen.
Deutschland? Europa?
Die freie, so entwickelte Welt, die Krieg führen muss, um sich selbst am Leben zu erhalten.
Wie ein gefräßiges, böses Raubtier, das die Schwachen in der Herde der Völker erlegt.
Nein, der Glaube, der christliche Glaube?
Nein, diesmal ist es die NATO, deren wirtschaftliche Interessen. Die der mächtigen, reichen Öl- und Waffenlobby, der gescheiterten Banken, derer, die gierig den Bonus am Ende des Jahres erwarten. Und auch bekommen. Auf immer und ewig.
Europa und Amerika.
Ein Handy klingelt zwei Reihen weiter, eine alte Melodie spielt auf. Etwas aus den 1930er Jahren. Ein Stück aus einem verrauchten, vom feinen Parfüm und dem Schweißgeruch der erschöpften Tänzer erfüllten Club, in dem abgegriffene, cremefarbene Elfenbeinfilterspitzen auf dem polierten runden Mahagoni liegen.
Die Band macht gerade Pause, auf die abgestellten Instrumente fällt das fahle Mondlicht durch ein milchiges Fensterglas. Ein Champagnerkorken knallt. Frauen mit langen Federboas, grell geschminkt mit dickem Rouge, kichern in einer Ecke. Ich stehe auf, will tanzen, wo ist mein Tänzer, wo ist der Mann, der nach herbem Rasierwasser duftet?
Es kommt eine knabenhafte Frau im schwarzen Zweiteiler. Die Nadelstreifen sind auf dem Stoff wie lange Nähte aufgezogen, fransen hier und da schon einmal aus.
Die Kapelle spielt nicht, die Figuren, die Szene in meiner Fantasie verschwimmt. Sie platzt mit einem lauten, unerbittlichen Knall.
Ich will swingen, sehe meine nicht vorhandenen Füße, die so tänzeln, die sich so schnell bewegen können. Wenn sie nur da wären! Wo sind sie? Vor meinen Augen sehe ich das zerfetzte Fleisch in der Sonne Afghanistans faulen. Knochige, hungrige Hunde, die an meinen blutigen Unterschenkeln mit ihren spitzen, langen Zähnen kauen, beißen, reißen. In den gierigen Mäulern von Hyänen und Schakalen werden die Reste meiner Knochen zerkaut. Ich will sie zurück, die Beine gehören mir!
Ich schreie still.
Für einen winzigen, fast unmerklichen Moment lenkt es mich ab. Ich versuche wieder zu entfliehen. Immer noch blättere ich in der bunten Frauenzeitschrift. Sehe sehnsüchtig die kommende Sommermode, kurze Röcke, wehende Miniröcke. Lange, bunte Kleider.
Wer war ich, wer bin ich?
Was bin ich?
Ein armseliger Krüppel. Eine Beinlose aus Afghanistan!
Der mit dem verlebten, kantigen Gesicht, der unrasierte Mann, der mir gegenübersitzt, nervös auf seinem Platz herumrutscht, versucht schon die ganze Zeit mit mir ins Gespräch zu kommen. Er lächelt immer freundlich, hilflos, blickt verschämt auf die schmerzenden Stümpfe, um die die schlaffe Uniformhose gewickelt, geknotet ist. Er liest derweil BILD-Zeitung.
Jetzt wirft doch die hilflose politische Opposition der Regierung vor, dass sie wegen der Tanklastzüge bei Kunduz lügt. Ein jeder von uns ahnt das. Zumindest die, die da waren. Das ist wieder eine Schlagzeile wert.
Blut verkauft Auflage.
Generäle und Minister Kriege.
Die Politik macht die Kriege für Zeitungen.
„Niemand glaubt euch Politikern mehr!“, schreie ich mir stumm, wie gelähmt, zu.
„Ihr sollt das Volk regieren, nicht das Volk verwahren. Für eure eigenen, ach so schäbigen Interessen, die uns als unbedingter Fortschritt verkauft werden.“
King Karzei und die Regionalbahn nach Dellbrück
Es gab eine der wenigen Spuren zu einem privaten Waffenhändler in der Provinz Helmand. Helmand war weit entfernt. Und was hatte ein Waffenhändler in Helmand mit einem falschen deutschen Hubschrauberpiloten zu tun?
Holger war die Angelegenheit unheimlich. Am Abend begannen die Trümmer zu rauchen. Ganz von alleine. So mir nichts, dir nichts. Von den Händen eines Gotteskriegers angezündet. In den Trümmern lag für mich auch die Idee der Befreiung Afghanistans - die konnte es nicht geben, solange die Taliban nur durch US-Sicherheitskräfte ersetzt wurden. Ein Platzhalter wurde durch den nächsten getauscht und so weiter. Wer der Pilot war, fand auch sicherlich der Chefermittler des Militärischen Abschirmdienstes in Kabul nicht heraus. Zumindest waren die Jungs am Abend eingetroffen. Ein buntes, unangenehmes Völkchen. Der Major des MAD wirkte wie ein Quizmaster, er stellte ständig Fragen.
„Vielleicht soll er es auch nicht herausfinden“, bemerkte Holger und schaufelte Unmengen von Ravioli in sich hinein, die er in der Mikrowelle im Casino von Camp Nikolaus zubereitet hatte. Einige waren geplatzt und sahen aus wie kleine Männchen nach einem Bombenangriff der Amerikaner.
„Die brauchen den Umsatz, um den Krieg führen zu können“, entgegnete ich ihm. Nach dem Essen fraß er die Tabletten regelrecht in sich hinein. Es dauerte noch Wochen, ehe ich herausfand, dass er Antidepressiva schluckte. Eigentlich war er nicht mehr diensttauglich, aber auch das stand auf einem anderen Blatt. Am Morgen darauf fand eine afghanische Patrouille die beiden toten Besatzungsmitglieder aus dem abgestürzten Hubschrauber. Den Verwundungen nach waren sie vor ihrem Tod gefoltert worden. Es gab gleich einen Verdächtigen, den alle hier King Karzai nannten. Das allerdings klang hier wie ein Schimpfwort. Dieser Mann war zweifellos ein allseits verdächtiges Phantom. Niemand hatte ihn je gesehen, gesprochen, gehört oder ihn leibhaftig zuordnen können. Wobei leibhaftig den Nagel auf den Kopf traf. King Karzai war der Geist aus der Flasche, aus der Büchse der Pandora. Angeblich war er in einem Kölner Vorort aufgewachsen, einmal in Chorweiler, dann im Kölner Osten, bei Dellbrück. Gleich neben einem Restaurant mit rheinischen Spezialitäten. Gerüchte besagten, King Karzai sei immer mit der Regionalbahn bis an den Bahnhof Dellbrück gefahren, darüber wusste jeder alles - auch dass er immer bei McDonald‘s am Barbarossaplatz in Köln zu finden war, einem Joint nie abgeneigt gewesen war, auch gerne betete.
Früher, Anfang des Jahrtausends, las er Bravo oder andere Jugendzeitschriften, mehrfach soll er in Messerstechereien wegen Mädchen verwickelt gewesen sein. Auch über seine Mutter, die nach seinem Verschwinden genauso rätselhaft untertauchte, wusste jeder alles und nichts. Seit 2002 war King Karzai einer der treuesten Gefolgsleute Osama Bin Ladens. Weder den einen noch den anderen sah man irgendwo. Manchmal wurde er auch Dummy Karzai genannt.
King Karzai war eines von vielen Phantomen, die die USA geschaffen hatten, um sich überhaupt einen Gegner vorstellen zu können. Er versteckte sich, der langbärtige und drahtige Asket, der wie Bin Laden nur vom Koran lebte. Essen war out, natürlich auch jegliche Form des Vergnügens.
Unvermittelt meinte Heiko, als er das letzte Stück Ravioli aus der Dose löffelte: „Ich wette mit dir, eines Tages sitzen Clinton, Rice und Obama zusammen und spielen der Welt ein gigantisches Theater vor dem Fernseher vor. Da wird es computeranimierte Männchen geben. Hubschrauberlandungen, wie damals in der Wüste bei Teheran, als sie die Geiseln aus der Botschaft befreien wollten - dann in schattiger Nacht, ein paar Mauern auf Grünlicht-Bildschirmen“, er dachte nach, „bestimmt ein Pool, in dem Bin Laden gebadet hat und dann die Erfolgsmeldung, dass der meistgesuchte Terrorist auf der Welt beim gezielten Einsatz der Ledernacken getötet wurde. Die Leiche wird eingeäschert und niemand wird den toten Bin Laden je wiedersehen - schwuppdiwupp!“
„An Märchen glaube ich nicht mehr, zumindest seit ich in Camp Nikolaus meinen Dienst an der Freiheit versehen darf“, stand ich auf, mir war schlecht. Aber Heiko lag richtig.
Heiko wusste, woher auch immer, dass es Millionen an Bord des Helikopters gewesen waren, frisch banderoliertes Geld aus einer Bank in Genf in der Schweiz.
Was hatte die Bank in der Schweiz damit zu tun?
Ich fühlte mich wie ein Herz Jesu-Kind.
Markus, der mir von Anfang an suspekt gewesen war, spielte wieder Ballerspiele auf der Konsole, diesmal erschoss er kleine Afghanen. Kinder und Frauen zählten nur die Hälfte.
Tagsüber fuhr er die ferngesteuerten Panzer der Pioniere.
Das Gehämmer der virtuellen MGs ging die halbe Nacht, dann schlief auch der Blondschopf Markus ein. Er schrie immer im Schlaf und er rief nach seiner Mutter, seinem Vater. Er war ein armes, sehr verlassenes Schwein. Die meisten im Zug mieden ihn, aber seine Zeit hier war in wenigen Tagen abgelaufen. Als schon der erste Hahn krähte, ein Tier aus Deutschland, das große Probleme mit der Zeitumstellung hatte, schlief auch ich ein.
Am Morgen danach war wieder der alte Trott da und es wurde über Tom Neumann geredet, er schien der nächste untragbare Geist in der Truppe zu werden. Im Casino begann das Gras zu wachsen, wenn auch nur sinnbildlich.
„Er hat Berichte gefälscht, folgt man diesem Hajo von den Feldjägern. Er sollte die Afghanen in einer Form darstellen, die recht ungünstig war, um halt Säuberungen gegen die Taliban durchführen zu können! Angeblich entsteht eine neue militärische Gruppe, die auch mit Syrien und dem Irak verbunden ist.“ Noch verstand ich nicht, was Heiko damit meinte, aber Tage später, nach meinem ersten Patrouillengang, schon.
„Die Feldjäger“, äffte er einen der Unteroffiziere nach, die sich wie die Aufpasser aufspielten, mischte ein wenig Hitler hinein, was mich extrem abstieß und der geschundenen Truppe der Feldjäger Unrecht tat.
„Wenn die Schupos ganze Kerle wären, wäre Neumann nicht mehr zurückgekommen und die Weiberärsche wären nicht hier. Die sollen in der Küche Kartoffeln putzen und sonst für unser Wohl sorgen, Truppenbetreuung eben, aber nicht in der kämpfenden Truppe.“
Für ihn waren wir - und daraus machte er, während er zahlreiche Erdnüsse verspeiste, keinen Hehl - keine Soldaten, sondern allenfalls Störenfriede innerhalb des Zuges. Er reduzierte uns Frauen in seinen weiteren schwülstigen Ausführungen auf zwei Brüste mit wachen Augen und extrem kleinem Gehirn.
„Stell dir mal vor, wir werden von den Gegnern Hopps genommen und Ihr werdet vergewaltigt, willst du von einem Kameltreiber ein Kind kriegen?“ Er verachtete augenscheinlich die einheimische Bevölkerung zutiefst, ich nahm die Karten auf, bemerkte beiläufig:
„Ich habe eine Spritze dafür bekommen.“
„Wenn es man Spritzen gegen die Taliban gäbe. Die regieren das Land bald wieder und wir sind umsonst hier gewesen.“ Jörn ging und Heiko winkte ab.
„Arschloch!“, der Ton war brutal und dem Umstand des Krieges angemessen.
„Sexistisches Nazi-Arschloch“, fügte ich hinzu und legte den Stich vor Heiko auf den Tisch, der daraufhin sein Gesicht verzog.
King Karzai, der Anti-Held, rückte nochmals in unser Blickfeld, als wir am Abend neue Nachrichten aus Kabul bekamen. Eines seiner angeblichen Verstecke war durch eine Pioniereinheit aufgefunden worden. Das war genauso unglaubwürdig wie die Pioniere von „Yellowstone“, die flugs - ich wollte es gar nicht glauben, als Heiko es mir erzählte - die Liegenschaften von „Loops“ übernommen hatten. Der Vizepräsident der Sicherheitsfirma war in seiner gepanzerten Limousine in Kabul, auf einer Ausfallstraße, in die Luft gesprengt worden. Er regnete danach in kleinen Stücken vom dieselgeschwängerten Himmel über der afghanischen Hauptstadt.
Als sich der Pulverdampf legte, die Fetzen des 1,90 m Hünen aus Wisconsin aus dem Wrack geholt wurden, übernahm „Yellowstone“ die Geschicke der Firma.
Damit waren auch die Unannehmlichkeiten wegen der Maschine, in der die Landsknechte der „Loops“ aufgefunden worden waren, schnell geklärt.
„Ich kann und will es nicht glauben“, erklärte Heiko, der wieder Ravioli in sich hineinstopfte, „das Geld und die Edelsteine wurden an „Yellowstone“ zurückgegeben.“
In der Nacht träumte ich schlecht. Was hieß schlecht, so schlecht, dass ich ständig versuchte, vor mir zu fliehen. Immer wieder wurde ich von Alpträumen geplagt, seitdem ich in Camp Nikolaus angekommen war. Diese Bildfolgen waren so real wie die Wirklichkeit, der ich mich zumindest im Schlaf entziehen wollte.
Selbst in der Nacht marschierten wir, die Kameraden liefen vor mir wie Schatten, die ich zwar an den Stimmen und den Schritten erkennen konnte, jedoch nicht an den Gesichtern. Mein Traum spielte sich in Deutschland ab - an der Bahnstation in einem Vorort von Bremen, Lesum. Manchmal war ich auf dem Weg zu einer Freundin durch die Tristesse der Bremer Vororte gereist. Verlassene Geschäfte, die in der Flaute der Lehman-Pleite nach und nach zumachten. Mehr und mehr wirkte das Umfeld eines chinesischen Restaurants wie eine Wüste am Wasser. Da lief unser Zug nun durch, ich wunderte mich, wie die Realität uns einholte. Heiko schrie etwas, er stand neben einem ausgebrannten Bus der BSAG. Ich konnte ihn nicht verstehen, vielleicht wollte ich die Wortfetzen auch nicht hören. Jörn war verletzt, er lag mit einem Bauchschuss am Boden. Langsam breitete sich eine riesige Blutlache unter ihm aus, bis ein Zucken durch seinen Körper ging. Dann war er tot. Einfach so und nicht anders. Tot. Ich hörte in diesem Moment die Melodie eines Liedes von Donovan „Catch the Wind“, sie verging nach wenigen Takten und verebbte.
Das Metall des verkohlten Linienbusses qualmte noch. Der schwarze Rauch zog über die Gleise in ein angrenzendes Wohngebiet, aus dem plötzlich die Schüsse einer Maschinenpistole zu hören waren.
Wir gingen hinter einem grauen Stromkasten der Bahn in Deckung. Ein Pick-up rauschte in einiger Entfernung vorbei. Auf der Ladefläche standen bärtige Männer hinter einem schweren Maschinengewehr, das auf das Dach aufgeschweißt worden war. Eine Schwalbe überflog den mit bunten, herbstlichen Blättern geschmückten Baum zwischen uns und den Guerillas, die augenscheinlich nun auch in Bremen kämpften. Ich spürte den Wind auf meiner Haut, den Geruch der Heimat.
Eine Lokomotive rollte schnell vorbei, die Taliban oder wer auch immer es war, eröffneten das Feuer. Zu meinem größten Erstaunen wurden die Salven erwidert. Querschläger flogen nur knapp über unsere Köpfe. Im nächsten Augenblick, der unsichtbare Feind war verschwunden, fanden wir eine ganze Familie, die augenscheinlich bei lebendigem Leib verbrannt worden war. Schrecklich verkohlte Leichen, deren Gesichter wie die einer Mischung von Schwein und Insekt wirkten. Ich wagte einen Blick in die weite Ebene des Bremer Umlandes. Ich sah tausende Menschen ziehen. Am Horizont, dort, wo nur noch Salz- und Sandkämme sich abwechselten. Nichts war mehr erhalten, die unbekannten Krieger jagten die Flüchtenden. Einen bewussten Moment wirkte es auf mich wie der sprichwörtliche Exodus.
Kurz darauf explodierte eine Handgranate, jemand schrie im letzten Moment: „Gas!“ Es war zu spät. Alle erstickten innerhalb weniger Sekunden, auch ich, die durch den Erstickungstod im Traum wiedererwachte.
Ich war schweißgebadet, nach einer Zigarette am Fenster trottete ich langsam zur Dusche. Der mörderische Traum rettete in dieser Nacht Marco das Leben, seltsam. Er hatte sich schon vor einigen Stunden die Schlagadern aufgeschnitten, langsam blutete er unter der laufenden Dusche aus. Der Nebel verdeckte ihn und der Umstand, dass die Wachtposten Karten spielten, sich am Gameboy langweilten. Rekruten, die sich in ihrer Haut weder in Deutschland noch hier wohl fühlten.
Der Sani konnte Marco noch gerade so retten und ich besorgte mir einen Roman aus der Bibliothek. Etwas über die Liebe zwischen einem alternden Bären und einer Maus, die den Bären kurz vor dessen Tod erheiterte. Es wirkte wieder so real, dass ich das Buch nach wenigen Minuten zur Seite legte und in meiner eigenen Gedankenwelt versank. Irgendwann in den frühen Morgenstunden döste ich ein. Es roch nach Kohlrouladen aus der Dose, dazu noch Pommes.
Funduk
Wieder in der Realität Afghanistans angekommen, waren wir erneut auf Patrouille. Nichts geschah, als wäre Frieden. Mich wunderte nur, dass kein einziger Mensch, weder Freund noch Feind zu sehen war.
An einem verlassenen Funduk hielten wir an, schwärmten aus, wie es das beste Handbuch einem jeden Soldaten zu vermitteln wusste.
King Karzai sollte, laut Stab, in der Nähe gewesen sein, war mit einem riesigen Tross von Männern, die keinerlei Spuren irgendwo hinterlassen hatten, unterwegs. Er war durch die Scheiße gezogen, an der wir jetzt standen. Ein afghanischer Scout, der recht ratlos nach Spuren im gefrorenen Matsch des kalten Herbstmorgens suchte, blieb stehen. In diesem Moment trat ich hinter den massiven Stamm des in der Krone zerschossenen Baumes und wartete ab. Für mich war es so, als würden uns Tausend Augenpaare beobachten. Ich erinnerte mich an meinen Traum aus der Nacht zuvor.
Der Feind war nahe, in diesem Augenblick so nah, wie er nur sein konnte, langsam richtete ich die MP auf das Gebüsch hinter den Kameraden. Es blieb noch ruhig.
„Sie ziehen sich zurück!“, murmelte Heiko leise, niemand suchte das Gefecht, es waren zu viele. In diesem Moment fragte ich mich, warum die Taliban uns nicht einfach vernichteten. Die Kriegsführung war asynchron.
„Das waren Taliban-Dealer, aber niemals das Phantom, unser aller Freund King Karzai“, stellte Heiko fest und trank aus der Wasserflasche Kaffee, den er wohl mit Schnaps vermischt hatte. Auch bei ihm lösten sich die sozialen Strukturen schnell auf.
Er setzte sich auf einen Stein, wischte sich die Stirn, die mit Schweiß unter dem Helm benetzt war. „Da haben wir nochmals Glück gehabt.“ Ich schwieg. Von Glück konnte man hier wohl kaum reden. Der Begriff schien aus dem Dari-Wörterbuch gestrichen.
Die Angreifer kannten unsere Taktik genau. Wahrscheinlich zogen sie sich deswegen zurück und wollten mögliche Angriffe ins Leere laufen lassen.
Vielleicht stimmte das Gerücht, dass es eine ganze Anzahl von Kämpfern gab, die zuvor bei der Bundeswehr ausgebildet worden waren, nun mit langen Bärten und ziemlich geländegängigen Eseln durch die Gebirge Afghanistans zogen. Der MAD warnte davor. Eine der weiblichen Agentinnen, die an einen Paschtunen herangeschleust worden war, der sich im Rauschgiftgeschäft breitgemacht hatte, war eher überrascht, dass sie in der Gruppe Deutsch reden konnte. Die Taliban lasen die BILD Zeitung und den Playboy.
Gekreuzigte Friedenstaube
Noch immer suchte der Divisionsstab nach dem Beweis, dass einige Soldaten in Afghanistan einen lebhaften Handel mit Gütern aller Art betrieben. Zunächst aber war eine andere Geschichte vorrangig, die, so lustig sie klang, nicht einer gewissen Tragik entbehrte.
Vor einigen Wochen war an der Grenze zu Usbekistan durch eine Patrouille ein Fahrradfahrer angehalten worden. Man wollte zuerst überhaupt nicht glauben, was man da hörte: Ein Ex-68er, ein Hippie aus irgendeiner Kommune in Berlin, hatte sich in den Kopf gesetzt, ein weiteres Vietnam, im Namen der Deutschen, zu verhindern. So war er wohl im Jahr zuvor, schon im Frühjahr, als die Temperaturen stiegen, von Deutschland mit dem Fahrrad über Russland nach Usbekistan, und von da aus weiter nach Afghanistan, aufgebrochen.
In dem unübersichtlichen Grenzgebiet war er wochenlang von Drogenhändlern festgehalten worden, die ihn schließlich gehen ließen. Einer der einheimischen Informanten, die für Stengler arbeiteten, teilte dem entgeisterten Major schon lange vorher mit, dass sich ein deutscher Friedensaktivist zwischen den Fronten bewegte.
Stengler hatte dem Vernehmen nach zwei Tage nur noch rumgebrüllt und die halbe Division auf die Suche nach der unbekannten Friedenstaube entsandt. Daraus entstand die „Operation Vollpfosten“, die zunächst urkomisch begann, dann aber, mit zunehmender Gewissheit, dass der nicht mehr lebte, nach dem wir suchten, zu einer Last für die gesamte Kompanie wurde.
Unser Tagesbefehl lautete: Jedes verfallene Haus an der Strecke von Kilometer 6 bis 9,3 zu durchsuchen, ob sich der Zivilist immer noch in dem mutmaßlichen Kampfgebiet aufhielt.
„Wie sollte er das überlebt haben?“, fragte mich Heiko, als wir auf den Mannschaftswagen stiegen. Fünfzehn andere Soldaten, die schon zuvor Erfahrung gesammelt hatten, sowohl im Kongo vor den Wahlen als auch im Kosovo, saßen mit auf.
Ich war Heiko noch eine Antwort schuldig, zuckte jedoch mit den Schultern. Ich hielt mich an meinem Gewehr fest, während sich der Lkw in Bewegung setzte. Hotte, der einzige, den ich zu dem Zeitpunkt namentlich kannte, krächzte, seit Tagen plagte ihn eine eitrige Mandelentzündung.
„Derzeit ist die Personaldecke so dünn, dass sie selbst Hotte noch mitnehmen“, lachte der Sani, den ich nicht mochte, weil er sexistische Sprüche machte. Und selbst diese waren so langweilig und alt, dass sie, wahrscheinlich Generationen zuvor, auf irgendwelchen Hauptschulen noch nicht mal mehr in der kleinen Pause erzählt werden konnten.
Der MAN nahm eine seitliche Trasse, von der die Vorhut ausging, dass diese minenfrei war. Mehrfach war es in den letzten Wochen zu schweren Explosionen gekommen, als Fahrzeuge der internationalen Streitmacht auf Landminen aus Belgien gefahren waren. Niemand verfügte über eine Erklärung, wie die belgischen Minen nach Afghanistan gekommen waren. Den Amerikanern kosteten sie zwei Soldaten, die mit dampfenden und verdrehten, blutigen Leibern wie Müll in einer Tüte auf die Ladefläche eines GMC geladen wurden, der sich dann, wohin auch immer, in Bewegung setzte.
Es war Spätsommer, früher Herbst in Afghanistan.
Die Fahnen der Gräber im Wind schienen sich zu verfärben, die Blätter zunächst noch nicht. Aber es begann mit Raureif und dann kam Frost. Fauliger Geruch stieg aus zahllosen Erdlöchern auf, die wir auf dem Weg passierten, hier und da eine Trümmerlandschaft, das Gerippe einer abgestürzten amerikanischen Drohne, die sich danach selbst in die Luft gesprengt hatte. Wie auch immer das möglich gewesen war.
Kilometer 6,4 brachte die Erleuchtung. Zumindest, was den unliebsamen Touristen betraf, der zwischen den Linien mit einem handelsüblichen Rennrad aus dem heimischen Supermarkt hin und her geradelt war.
Hinter einer Mauer, die zunächst, auch in ihrer klobigen Größe, keinen Sinn auf mich oder andere aus unserem Zug machte, versteckten sich weitere kleine Mauern. Darin waren Vierecke aus Stein angelegt worden.
„Eine Zisterne!“, meinte Heiko, der diese Konstruktionen schon einmal in einem abendfüllenden Programm eines Nachrichtensenders im Mystery-Magazin gesehen hatte.
Wir sicherten, schwärmten aus. Überall flossen kleine Bäche und ein stetes Rinnsal in das Tal, das sich danach teilte. Von einer Wand gingen Steine ab. Helmut sprang zur Seite, gerade im letzten Augenblick, bevor er von einem gewaltigen Quader aus luftiger Höhe getroffen wurde.
Ein verfallener Wasserweg folgte - dort hing der Friedensaktivist, sein Fahrrad war unter das Kreuz genagelt worden. Es war das erste Mal, dass ich einen gekreuzigten Menschen sah. In seinem Gesicht stand das Leid der letzten Stunden, die der Mann gelebt hatte. Der Feldwebel, diesmal Heiner Platzeck, ein sonst ruhiger Mann aus Niedersachsen, blickte zu dem Gekreuzigten auf. Nur leicht schüttelte er mit dem Kopf.
„Machen Sie den Zivilisten ab!“, befahl er knapp, dabei verzog er die Mundwinkel und griff sich seltsamerweise an die Hinterpartie seines Helmes. Er fotografierte den Toten ein paar Mal von allen Seiten mit dem Handy.
„Wenn ich ehrlich bin, will ich nicht glauben, was ich sehe“, murmelte Heiko und grinste, als er seitlich im afghanischen Sand das Päckchen Drum erblickte.
Das Gepäck des Deutschen lag verstreut unter dem Kreuz. Darunter auch eine Haschpfeife und ein Bild einer jungen Frau, wahrscheinlich in den späten 1960ern aufgenommen. Der Wind spielte mit der Fotografie, trieb sie wieder gegen einen vertrockneten Busch, von dem die Aufnahme nach wenigen Sekunden wieder abfiel.
Schon seit Wochen erhärteten sich die Nachrichten, dass eine islamistische Elitegruppe, deren Haupt-Tross sich in die von Unruhe geprägten Länder Arabiens infiltrierte, systematisch Jagd auf Europäer und andere Ausländer machte. Hier präsentierte uns eine verblendete Einheit ein Schauspiel, das seinesgleichen in der bisherigen Besatzungsgeschichte von Camp Nikolaus suchte. Zahlreiche Chronisten gaben sich aus jeder Generation der ankommenden Soldaten für das Schönen der Heldentaten deutscher Soldaten am Hindukusch hin.
Der Krieg war der Beginn der neuen Völkerwanderung, das wollte festgehalten werden.
Die Hände des Berliner Radfahrers waren fast völlig zerrissen, sein Penis vor dem Tod abgeschnitten worden. Offensichtlich war er mit heißen Zangen, die über einem Feuer zum Glühen gebracht worden waren, lange und ausgiebig gefoltert worden. Der Tod war vor mehr als einer Woche eingetreten. Zahlreiche Raubvögel hatten ganze Stücke aus dem Leib des Toten gerissen. Andere Aasfresser waren nicht in der Lage gewesen, in diese Höhe, in der der Friedensaktivist aufgehängt worden war, mit ihren Mäulern zu reichen. Der Feldwebel machte mit seinem Handy wieder einige Fotos aus verschiedenen Perspektiven. Sonst sagte er nichts.
Der Feldwebel Platzeck machte selbst Meldung über Funk, diese war dürftig und knapp. Wie in einer Prozession wurde danach das Kreuz zu Boden gelegt, die Nägel aus den Händen und den Füßen entfernt. Dabei bewegte sich der Körper plötzlich, zahlreiche Kameraden schreckten zurück. Durch den Fäulnisprozess waren Gase entstanden, die den Körper unwillkürlich zu krampfartigen Konvulsionen führten. Es war schaurig.
Die Leiche, die erbärmlich stank, wie Tod eben roch, verschwand in einem schwarzen Plastiksack und wurde durch vier Kameraden mit einem gewaltigen Bogen auf die Ladefläche des MAN's geworfen. Noch suchten wir nach dem Penis, den wir aber nicht mehr fanden. Es hatte etwas vom heimischen Ostern. Über der Schlucht, in der das Kreuz gestanden hatte, breitete sich nach und nach die Abendsonne aus. Der MAN brauchte eine ganze Zeit, um aus dem Tal wieder herauszukommen. Im Augenwinkel beobachtete ich einen einsamen Reiter, der am anderen Ende der Felskette, hoch auf einem Pferd, unserem Treiben durch ein Fernglas zuschaute. Wahrscheinlich war er über unser Entsetzen tief befriedigt, hatte er doch augenscheinlich nichts anderes zu tun.
Im Camp Nikolaus wieder angekommen, wurden das Kreuz, das neongelbe Fahrrad und der Leichnam des Friedensaktivisten samt Gepäck, den zwei Satteltaschen und einem Rucksack, wieder abgeladen. Die Leiche sollte noch am Abend vom Flughafen in Kunduz, nach Usbekistan und von da aus nach Deutschland ausgeflogen werden. Samt Fahrrad.
Es waren die ersten Tage in einem Land, das Heiko den Mond getauft hatte. Widerwillig stocherte er in seinem Joghurt herum, suchte die einzelnen Früchte und löffelte diese. Eigentlich war er ein Einzelgänger, wie er bei einer Partie „Mensch Ärger Dich Nicht“ erklärte. Aber nach wenigen Sätzen verstummte er, auch er hatte die Leiche des gekreuzigten Mannes fotografiert. Wieder und wieder sah er sich das Bild an. Irgendwann wurde es mir zu blöd, und ich verabschiedete mich ins Bett. Er nickte nur und wünschte mir „Eine gute Nacht!“
Heiko versank in Lethargie, die ich nicht zu deuten verstand - die Waschmaschine lief noch, der Geruch von Lenor erfüllte den gesamten Trakt, in dem wir untergebracht waren.
Wer das Gerücht in die Welt setzte, konnte später niemals geklärt werden. Es kursierte, dass die amerikanischen Sondereinheiten den Radler ans Kreuz genagelt hatten.
Möglich war alles, jedoch aus welchem Grund?
Es war eines dieser Geheimnisse des Krieges, das niemand zu ergründen wusste. Das Gerücht war dennoch in der Welt, und es konnte nur von jemandem stammen, der bei unserer Patrouille dabei gewesen war. Ich tippte, ohne mit der Wimper zu zucken, auf Heiko. Dazu, und dieser Umstand machte ihn noch verdächtiger, gab es noch ein Bild des gekreuzigten Radfahrers in einem Forum im Internet, in dem, wenn auch oberflächlich, Nachrichten aus Afghanistan ausgetauscht wurden.
Tage darauf hörte ich von einem Unteroffizier des Divisionsstabs, dass nicht wenige die amerikanischen Eliteeinheiten in Verdacht hatten, den Berliner hingerichtet zu haben. Dieser war mittlerweile in der Heimat angekommen und als Thomas Lange, ein harmloser Kiffer aus dem Bezirk Prenzlauer Berg, identifiziert worden. Lange hatte sich, so konnte ich lesen, schon Anfang der 1980er Jahre in der Friedensbewegung sehr engagiert und war nach und nach mit seinen Ideen von einer gleichen und sozialen Gesellschaft aus den einzelnen Arbeitskreisen der neu entstandenen Grünen verdrängt worden. Einen Träumer wollten die machthungrigen Alternativen nicht. Gerade seine Ideen wurden dann später aber von den Eliten der Parteien vertreten, wenn es darum ging, die Seele des Volkes vor der Wahl zu streicheln und auf Stimmenfang zu gehen.
Damals, als alles begann, wohnte Lange noch in Westberlin, in Kreuzberg, in einer kleinen Studentenbude, und ging seinem Studium der Literaturwissenschaft und Philosophie nur widerwillig nach. Er galt schon in diesen Tagen als absoluter Sonderling und wurde von den meisten gemieden. In Erscheinung trat er noch einmal bei der Friedenskundgebung 1983 in Bonn. Etwas im Zusammenhang mit seinem Tod stimmte nicht, ständig bekam Major Stengler neue Anfragen von der Staatsanwaltschaft in Berlin, wohin die Leiche zur Beerdigung überführt worden war. Nun lag er auf dem Friedhof in Moabit, dort waren die Gräber günstiger und wahrscheinlich hatte der Magistrat der Stadt ein Sozialbegräbnis bezahlen müssen.
Stengler wollte von jedem einzelnen der bei der Patrouille anwesenden Soldaten wissen, ob einem von uns etwas Sonderbares oder Ungewöhnliches aufgefallen war. Niemand konnte etwas sagen, und außer mir, war den anderen der einsame Reiter am Berg nicht aufgefallen. Damals machte ich einen Fehler, den ich später noch bitterlich bereuen sollte, aber das konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht wissen. Ich war neu im Krieg und musste, so sehr ich auch darauf trainiert war, die Spielregeln erlernen. Vorerst reichte es mir, dem ewig mogelnden Heiko die Mau-Mau Regeln näherzubringen, die er, wie vieles andere, missachtete.
So gewonnen, so zerronnen
Doch deutete der Verdacht in Richtung einer amerikanischen Eliteeinheit, die sich gerne mit den Tötungsarten der Taliban aus der Affäre zog. Folter, darauf schienen die Amerikaner in Afghanistan spezialisiert zu sein! Nicht nur die regulären Truppen, sondern auch die, die im Auftrag des Pentagons unterwegs waren, um hinter der Front zu säubern. Der ganze Krieg bekam für mich innerhalb von Tagen einen faden Beigeschmack, der sehr an das Wüten der deutschen Wehrmacht im 2. Weltkrieg in besetzten Gebieten erinnerte.
Heiko war derweil damit beschäftigt, der Legende, oder vielmehr, den vielen Legenden eines riesigen Goldschatzes nachzugehen, den angeblich die Sowjets angehäuft hatten, während sie Afghanistan besetzt hielten, und den sie zurücklassen mussten, als sie abzogen.