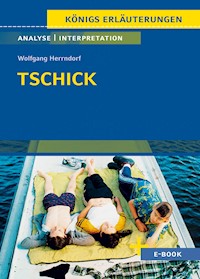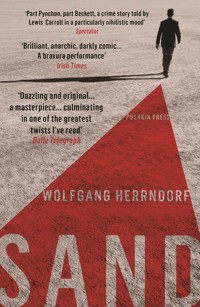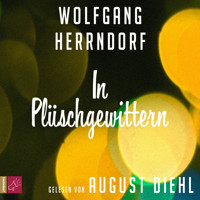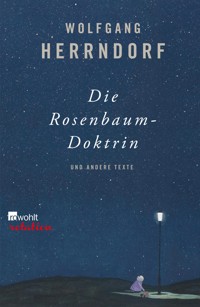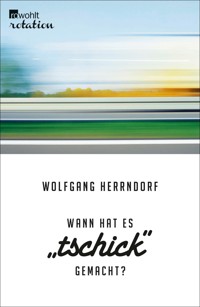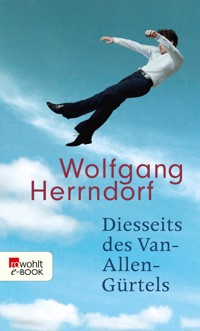
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Zwangsbekanntschaft zweier Kunstakademiestudenten wächst sich zu einer uneingestandenen Dreiecksgeschichte aus, die auf der Brenner-Autobahn zu einem unrühmlichen Abschluss kommt. Ein Krankenpfleger setzt sich mit dem Geld eines Patienten nach Asien ab und endet in der Polizeistation eines japanischen Fischerdorfs. Ein Mittdreißiger und ein verzogener Halbstarker unterhalten sich auf einem einsamen Balkon über den Kosmos. – Die Verlorenheit von Herrndorfs Figuren ist groß, und die erzähltechnische Raffinesse sowie der Unterhaltungswert seines Buches sind es auch. «Es geht also doch: Man kann auf Deutsch intelligente und zugleich extrem lustige Geschichten schreiben.» (Süddeutsche Zeitung) «Nicht realistisch, sondern gegenständlich, gläsern und geheimnisvoll, komisch und unheimlich, mitreißend und abstoßend … Ein kurzes langes Buch voller nie nachlassender Spannung.» (Gustav Seibt) «Seinen zwischen Normalität und Perversion lavierenden Trauergestalten haftet nichts Belehrendes, nichts Schwerfälliges an. Diese Habenichtse aus Brandenburg oder Berlin werden von einer federleichten Prosa getragen, und diesen scheinbaren Widerspruch erzählerisch zu gestalten, darin besteht die nicht geringe Leistung Wolfgang Herrndorfs.» (Neue Zürcher Zeitung) «Wenn der Sinn der Literatur darin besteht, Dinge zu verändern, dann sind Wolfgang Herrndorfs Erzählungen keine Literatur.» (Frankfurter Rundschau) «Sechsmal unterhält er bestens und bringt die Oberflächen zum Tanzen, und immer achtet er sorgsam darauf, dass sich darunter wirklich nichts finden lässt. Wenn sich dennoch die eine oder andere Lebenswirklichkeit findet, ist das nicht mehr Herrndorfs Sache, genauso wenig wie die Einschätzung: Besseres als diese Geschichten kann der Popliteratur im Moment nicht widerfahren.» (Der Tagesspiegel) «Ein dolles Buch.» (Die Zeit)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Wolfgang Herrndorf
Diesseits des Van-Allen-Gürtels
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Die Zwangsbekanntschaft zweier Kunstakademiestudenten wächst sich zu einer uneingestandenen Dreiecksgeschichte aus, die auf der Brenner-Autobahn zu einem unrühmlichen Abschluss kommt. Ein Krankenpfleger setzt sich mit dem Geld eines Patienten nach Asien ab und endet in der Polizeistation eines japanischen Fischerdorfs. Ein Mittdreißiger und ein verzogener Halbstarker unterhalten sich auf einem einsamen Balkon über den Kosmos. – Die Verlorenheit von Herrndorfs Figuren ist groß, und die erzähltechnische Raffinesse sowie der Unterhaltungswert seines Buches sind es auch.
«Es geht also doch: Man kann auf Deutsch intelligente und zugleich extrem lustige Geschichten schreiben.» (Süddeutsche Zeitung)
«Nicht realistisch, sondern gegenständlich, gläsern und geheimnisvoll, komisch und unheimlich, mitreißend und abstoßend … Ein kurzes langes Buch voller nie nachlassender Spannung.» (Gustav Seibt)
«Seinen zwischen Normalität und Perversion lavierenden Trauergestalten haftet nichts Belehrendes, nichts Schwerfälliges an. Diese Habenichtse aus Brandenburg oder Berlin werden von einer federleichten Prosa getragen, und diesen scheinbaren Widerspruch erzählerisch zu gestalten, darin besteht die nicht geringe Leistung Wolfgang Herrndorfs.» (Neue Zürcher Zeitung)
«Wenn der Sinn der Literatur darin besteht, Dinge zu verändern, dann sind Wolfgang Herrndorfs Erzählungen keine Literatur.» (Frankfurter Rundschau)
«Sechsmal unterhält er bestens und bringt die Oberflächen zum Tanzen, und immer achtet er sorgsam darauf, dass sich darunter wirklich nichts finden lässt. Wenn sich dennoch die eine oder andere Lebenswirklichkeit findet, ist das nicht mehr Herrndorfs Sache, genauso wenig wie die Einschätzung: Besseres als diese Geschichten kann der Popliteratur im Moment nicht widerfahren.» (Der Tagesspiegel)
«Ein dolles Buch.» (Die Zeit)
Über Wolfgang Herrndorf
Wolfgang Herrndorf, 1965 in Hamburg geboren, hat Malerei studiert und unter anderem für die «Titanic» gezeichnet. 2002 erschien sein Debütroman «In Plüschgewittern», 2007 der Erzählband «Diesseits des Van-Allen-Gürtels» und 2010 der Roman «Tschick», der zum Überraschungserfolg des Jahres avancierte. Wolfgang Herrndorf wurde u.a. mit dem Deutschen Erzählerpreis (2008), dem Brentano-Preis (2011), dem Deutschen Jugendliteraturpreis (2011), dem Hans-Fallada-Preis und dem Leipziger Buchpreis (2012) ausgezeichnet. Wolfgang Herrndorf starb am 26. August 2013.
Weitere Veröffentlichungen
In Plüschgewittern
Tschick
Sand
Arbeit und Struktur
Die Rosenbaum-Doktrin (E-Book Only)
Bilder deiner großen Liebe
Gesamtausgabe
Inhaltsübersicht
Der Weg des Soldaten
Die praktischen Prüfungen waren leicht. Nicht, dass ich Bäume ausgerissen hätte oder so, aber ich konnte sehen, dass das um mich herum auch keiner tat. Die meisten hätte man nach dem ersten Tag aussortieren können. Abends lag ich in der Jugendherberge und starrte die Decke an, den Handtuchspender, den Spiegel. Ich fand es albern, in dem Alter in einer Jugendherberge, aber ich war nicht der Einzige. Zehn oder zwölf Mitbewerber, man erkannte sich an den Mappen.
Am dritten Tag, vor der mündlichen Prüfung, wurde auf meinem Zimmer einer krank. Franco Cosic. Er bekam starkes Fieber und Halsschmerzen, und wir wussten nicht, was wir machen sollten. Er war nicht krankenversichert. Deutsch sprach er nur mit schwerem Akzent. Alle fünf Minuten schmiss er seine Decke auf die andere Seite, schweißgetränkte T-Shirts hingen über ihm am Doppelstockbett wie tibetische Wimpel.
«Meine Lippen brennen, Wahnsinn», sagte er.
Ich ging in die Apotheke, täuschte seine Symptome vor und kam mit einem Schmerzmittel und einer eigentlich rezeptpflichtigen Flasche Hustensaft zurück. Er starrte mit glasigen Augen durch mich hindurch, während er trank.
«Mein Freund», sagte er.
Der Hustensaft enthielt Codein, und wir ließen die Flasche kreisen. Hendrik, der Dritte auf unserem Zimmer, bekam einen stundenlangen Redeanfall. Er redete von seiner Freundin, von seinem Urlaub, von Politik. Hauptsächlich von seiner Freundin. Er fand es aufregend, das Tier mit den zwei Rücken und solche Dinge zu sagen. Zwischendurch legte er immer dem Kranken die Hand auf die Stirn und meinte, es sei seine Pflicht als Arzt, ihn darauf aufmerksam zu machen, dass er die Nacht nicht überstehen würde. Franco lachte verunsichert, und Hendrik sagte, er kenne sich aus, er sei Pfleger an der Berliner Charité.
Ich erinnere mich nicht mehr an viel von diesem Abend, aber wie ein Foto blieb eine Zehntelsekunde in meinem Kopf hängen. Als ich das Licht ausschaltete, zeigte der Spiegel über dem Waschbecken mein seligstes Lächeln. Das kam nicht nur vom Codein. Ich hatte noch nie in meinem Leben Künstler gesehen. Ich hatte eine Reihe von Übermenschen erwartet oder wenigstens Personen mit unglaublich interessanten Ansichten, mit Augen von Holbein oder Mündern von Mengs. Erleichtert schlief ich ein.
Am nächsten Morgen ging es Franco tatsächlich etwas besser, und er konnte aufstehen. Nur seine Stirn sah aus wie mit Schmirgelpapier bearbeitet, da er sich die ganze Nacht lang die Schweißtropfen mit einem Leinentuch abgewischt hatte. Er fürchtete, wegen seiner mangelhaften Deutschkenntnisse nicht genommen zu werden, und ich beruhigte ihn, indem ich Witze über unsere Mitbewerber machte, Neohippies und Abiturientinnen mit aquarellierten Tagebüchern.
Hendrik war noch so redselig wie am Abend zuvor, und er flog nach einer Minute aus der Prüfung. Dabei war es eigentlich keine Schwierigkeit. Die Prüfungskommission stellte vollkommen belanglose Fragen, es war alles längst entschieden. Mich fragte man, was ich von Paul Klee hielte, und ich antwortete: nichts. Franco wurde gefragt, was er für Ernährungsgewohnheiten habe. Am Nachmittag konnten wir uns immatrikulieren.
Anschließend fuhren wir Hendrik mit dem Mercedes zum Bahnhof. Mein Onkel hatte mir den Mercedes für eine Woche geliehen, damit ich an meinem neuen Studienort gleich alles klarmachen konnte, wie er es ausdrückte. Während der Fahrt fing Hendrik an durchzudrehen. Er würde nicht aufhören, an seiner Entwicklung zu arbeiten, sagte er. Seine Radierungen seien nicht zu schwach, eher zu subtil, hätten die Professoren gemeint, nächstes Jahr werde er sich erneut bewerben.
«Das ist die korrekte Position», sagte Franco und biss auf seinen Fingernägeln rum.
«Dann bis nächstes Jahr», sagte ich.
Als wir auf dem Gleis standen und Hendrik hinterherwinkten, kamen mir die ersten Zweifel. Der Nürnberger Bahnhof gehört zu den deprimierendsten Bahnhöfen der Welt, alles wie geleckt, wie in einer 5000-Einwohner-Stadt. Ich wusste plötzlich nicht mehr, was ich hier wollte. Franco warf zwei Paracetamol ein und kaufte ein Sixpack am Kiosk, und weil wir uns nirgends hinsetzen konnten, setzten wir uns in den Mercedes und fuhren um die Stadtmauer herum. Aus unerklärlichen Gründen ist diese mittelalterliche Stadtmauer komplett erhalten. Es war ein trüber Spätherbsttag. Franco war ganz aufgekratzt und schrie immer «Mein Freund!» und haute mir beim Fahren auf die Schulter. Er hatte nicht damit gerechnet, die Aufnahmeprüfung zu bestehen. Den ganzen Abend fuhren wir im Kreis und hielten nur an, um neue Sixpacks zu kaufen.
«Ist ganz Deutschland so», sagte Franco nach einer Stunde. Frustrierende, kleine Straßen. Frustrierende, sandsteinfarbene Fachwerkbauten. Vom Auto aus gesehen war es irgendwie amüsant. Aber länger als fünf Tage hierzubleiben erschien mir verwegen. Franco wollte am nächsten Tag nach Spanien, um seine Wohnung aufzulösen. Als wir noch betrunkener waren, fing er an, von seinem südländischen Temperament zu erzählen (seine Haut war weiß und schorfig wie die eines Polarforschers), und noch später warf er die Arbeiten aus dem Fenster, die er während der praktischen Prüfung gemacht hatte.
«Kannst du nichts mitnehmen!», rief er, und große, schmierige Pappen segelten hinter uns durch die Nacht.
Nach der einunddreißigsten Umrundung der Stadtmauer blieb das Auto liegen, mitten auf der Straße, ohne Vorwarnung. Wir lagen vor einem Platz, der Plärrer hieß, an der südwestlichen Ecke der Altstadt, und Franco fing an zu kichern. Er lachte, er zeigte mit dem Finger auf das Straßenschild und lachte, und ich lehnte mich über das Lenkrad nach vorn und schloss die Augen. Nichts passierte. Der Verkehr floss um das Hindernis, die Tram versetzte den Wagen in Schwingungen, aber nichts passierte. Nicht mal hupen konnten sie hier.
Es war leicht, ein billiges Zimmer in einem Studentenwohnheim aufzutreiben. Bevor Franco nach Spanien gefahren war, hatten wir abgemacht, wer als Erster eine Wohnung fände, würde den anderen solange bei sich wohnen lassen. Ich hängte für Franco einen Zettel mit meiner neuen Adresse ans Schwarze Brett der Akademie, aber Franco blieb verschwunden.
Das Studium war ein Desaster. Unsere Professorin erschien genau einmal die Woche, ließ sich Bilder zeigen und redete mit uns, als wären wir Fünfjährige. Für jeden Studenten hatte sie einen eigenen Satz. Frau Reifkarst, Sie lesen zu wenig. Herr Brüschke, denken Sie mal über Ihr Menschenbild nach. Es war unglaublich. Mein Satz lautete: Sie sind innerlich unbeteiligt. Jedes Mal, wenn ich Arbeiten zeigte: Sie sind innerlich unbeteiligt. Ich wusste nie, was damit gemeint war. Meinen Mitstudenten schien dieses Gerede nicht gerade den Schlaf zu rauben. In der Aufnahmemappe hatten die meisten Bleistiftzeichnungen und kleine Landschaften transportiert, nach zwei Wochen an der ABK malten sie mannshohe Leinwände mit Schrubbern voll. Viele kamen von Waldorfschulen und lasen Faschistenliteratur. Sie saßen in der Klasse und diskutierten sogenannte Wahrnehmungen, und am Wochenende fuhren sie mit zwei großen Taschen voller schmutziger Wäsche zu ihren Eltern.
Schon bald versuchte meine Professorin, mich rauszuschmeißen. Sie habe sich in mir getäuscht. Das größte Problem stelle meine Haltung dar. Wahrscheinlich wäre ich lieber Insektenforscher geworden, oder warum würde ich den ganzen Tag im Unterholz vor der Akademie rumkriechen? Alles, was ich bisher gemacht hätte, sei Mist.
«Mist!», sagte sie.
Ich sagte, dass mir der Gedanke auch schon gekommen sei.
«Sehen Sie! Sie geben sich nicht die geringste Mühe, mich zu verstehen», rief sie. «Ich gebe Ihnen gute Ratschläge, und Sie hören nicht zu. Ich sage Ihnen, Sie müssen in sich hineinfühlen, und Sie tun es nicht. Vielleicht ist da ja nichts? Haben Sie mal darüber nachgedacht? Sie sind vielleicht nicht doof, aber das reicht hier nicht. Sie müssen empfinden. Empfinden! Wenn das so weitergeht, schmeiß ich Sie raus, am Semesterende, ich kann das.» Sie zog ihre Mundwinkel zu einer Art Lächeln nach unten, und ich machte, um sie nicht zu enttäuschen, einen innerlich unbeteiligten Eindruck.
Das Studium war aber nicht mein Hauptproblem. In der ersten Zeit war ich fast ausschließlich damit beschäftigt, mir auf dem Flohmarkt Möbel und Bettwäsche und Teller und Töpfe zu kaufen und mich mit Franco Cosic herumzuschlagen. Irgendwann nämlich stand Franco vor meiner Tür. Er hatte einen Seesack in der Hand, ein Bügeleisen in der anderen, und er war vollkommen begeistert und bekifft. Er hielt meinen Zettel, den ich am Schwarzen Brett vergessen hatte, hoch und schwenkte ihn wie einen Liebesbrief, und ich umarmte ihn. Ich hatte keine sozialen Kontakte geknüpft, seit das Studium begonnen hatte, ich kannte niemanden im Umkreis von 500 Kilometern, und ich umarmte ihn leidenschaftlich. Er roch, als hätte er seit Wochen nicht geduscht. Das Bügeleisen hatte er im Müll gefunden und mitgenommen, weil er meinte, ich könne es vielleicht reparieren. Am Anfang besaß Franco überhaupt kein Geld, und es bestand keine Aussicht, ihn aus meiner Einzimmerwohnung wieder rauszukriegen.
Tagsüber fuhren wir an die Akademie. Abends hockten wir an meinem Tisch, der aus zwei Pappkartons und einem Resopalbrett bestand, und ich wurde immer gereizter. Ich muss jeden Tag eine gewisse Zeit mit mir allein sein, sonst drehe ich durch, und Franco tat das Menschenmögliche, damit ich durchdrehte. Sein kompletter Besitz bestand aus neunzehn Teilen, aber er schaffte es, diese neunzehn Teile so in meiner Wohnung zu platzieren, dass sie überall obenauf lagen und alles versperrten. Er erzählte von kroatischen Kindheitserlebnissen. Ich hatte keine ruhige Minute. Es war unmöglich, einander aus dem Weg zu gehen. Wenn ich abends in einer Ecke saß, um ein Buch zu lesen, fragte Franco nach fünf Sekunden: Was machst du da? Was ist das für ein Buch? Worum geht es? Liest du mir vor?
Aus Rache nahm ich irgendwann das Geschütz aus dem Regal. Schopenhauer.
«Was ist das für ein Buch?», fragte Franco. «Liest du mir vor?»
Und ich las ihm vor. Stundenlang. Franco war begeistert. Er verstand kein Wort, dafür war sein Deutsch zu schlecht, und, um ehrlich zu sein, auch ich verstand kein Wort. Aber an ein Aufhören war nicht zu denken. Franco war außer sich, dass ich so schwierige Bücher kannte. Nach jedem zweiten Satz stellte er eine Verständnisfrage. «Was ist die Objektität des reinen Willens?» Ich wusste es nicht, aber während ich es erklärte, begriff ich es manchmal selbst. Nach jedem Abschnitt gab ich eine Zusammenfassung. Ich las, ich erklärte, und wenn ich nicht weiterwusste, preschte Franco in die Lücke und brachte alles mit indischer Seelenwanderung und Heisenberg’scher Unschärferelation in Verbindung, seinen zwei Lieblingsgedanken. Er fragte, ob ich ihm zustimmen könne. Ich antwortete, dass ich ihn für geisteskrank hielte, und er wurde wütend wie ein kleines Kind. Trotzdem las ich ihm jetzt nächtelang Schopenhauer vor, denn alles andere war noch schlimmer.
Irgendwann fiel die Heizung aus. Ich lieh mir einen Heizlüfter, aber der erwärmte das Zimmer nur auf zehn oder zwölf Grad. Wenn ich jetzt abends aus der Akademie zurückkam, lag Franco meistens in meinem Bett, das er den ganzen Tag nicht verlassen hatte.
«Ich habe eine Vision gehabt», sagte er mit ersterbender Stimme. «Willst du wissen?»
«Nein», sagte ich.
Ich setzte in der Küche Wasser auf, ohne die Handschuhe auszuziehen, und sah aus dem Fenster. Aus einem gelbschwarzen Himmel fiel Schnee und taumelte über die vierspurige Straße. Ein Polizeiauto hielt neben einer Schneewehe. Der Beifahrer stieg aus, trat mit einem Fuß in die Schneewehe, und ich erinnerte mich wieder daran, dass ich von Anfang an gewusst hatte, dass diese Stadt nichts für mich war.
«Ich hatte furchtbaren Hunger», sagte Franco. «Aber ich konnte nicht aufstehen. Mir war zu kalt. Ich musste die ganze Zeit ans Totsein denken. Wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte … oh Mann. Aber ich hab nur auf die Wand gestarrt, und dann plötzlich habe ich dieses Wort auf der Wand realisiert. In großen klaren Buchstaben. Wie vor meine Stirn geschlagen. UNTERKALT.»
Er machte eine Kunstpause. Ich konnte hören, wie er unter der Bettdecke raschelte.
«Gibt es das Wort?»
«Nein», sagte ich.
«Ist das nicht phantastisch?», rief er. «Ich werde ein Objekt machen. UNTERKALT!»
«Großartig», sagte ich. «Schreib’s dir auf, damit du’s nicht vergisst.»
Schließlich gelang es mir, Franco bei Alexander unterzubringen, einem Kommilitonen. Alexander hatte eine Zweizimmerwohnung und kam mit Franco besser klar als ich. Franco musste sich auch nicht an der Miete beteiligen. Nur einmal erzählte Alexander, dass Franco ihm mit Schopenhauer auf die Nerven gehe. Man könne mit ihm keine Busfahrkarte kaufen, ohne dass er vom freien Willen anfange. Alexander tat so, als ob es ihn aufregen würde, aber in Wirklichkeit gefiel es ihm. Er war Lehrerkind und stand auf Ausgetickte.
An der ABK traf man Franco selten in irgendwelchen Kursen. Wenn man ihn fragte, was er den ganzen Tag mache, antwortete er: Nachdenken. Er bequatschte alle Studenten, keiner hielt es lange aus. Ich kriegte mit, dass er anfing, hinter meinem Rücken rumzuerzählen, was für ein wahnsinniges Genie ich sei. Er erzählte jedem, der es nicht hören wollte, dass ich ein wahnsinniges Genie sei, und hüllte sich auf Nachfragen in geheimnisvolles Schweigen. Wenn er mich am Ende eines langen Ganges entdeckte, schrie er über hundert Meter Entfernung: «Ah, der Herr Schopenhauer! Habe die Ehre!»
Selbst unter den Durchgeknallten an der ABK war Franco eine Ausnahmeerscheinung, auch was seine Arbeiten betraf. Obwohl ich Konzeptkunst neben Gitarrenmusik und Totalitarismus zu den großen Irrtümern des zwanzigsten Jahrhunderts rechne, muss ich zugeben, dass Francos Gebastel mich erschütterte. Neben den Installationen seiner Mitstudenten nahmen sich Francos Objekte aus wie der Weihnachtsbasar der Bodelschwinghschen Anstalten. Es war schwer, nicht in Tränen auszubrechen.
Manchmal erkundigten sich Mitstudenten bei mir nach Franco, und ich erklärte ihnen hinter vorgehaltener Hand, er entstamme einer kroatischen Kriegsverbrecherdynastie. Seine vier älteren Brüder seien alle hochrangige Militärs, nur er, der Jüngste, ein missratenes Pazifistenschwein. Der Vater habe ihn in die Geschlossene einweisen lassen, aus Gründen der Familienehre. Vor einem halben Jahr die Flucht nach Spanien, das Studium erfolge auf Anraten seines Analytikers. Franco selbst könne über diese Dinge nicht sprechen.
Wie Franco tatsächlich auf seine Umgebung wirkte, konnte man daran sehen, dass acht von zehn Leuten diese Geschichte glaubten. Noch Jahre später bekam ich sie in unterschiedlichen Versionen immer wieder zu hören, abenteuerlich ausgeschmückt mit Ustascha-Häuptlingen und Elektroschocks.
Noch schlechter als mit Studenten kam Franco mit Studentinnen klar. Er war nicht besonders attraktiv, und seine euphorische Art konnte auch das gutmütigste Rudolf-Steiner-Häschen in die Flucht schlagen. Die Art und Weise, wie er versuchte, beim anderen Geschlecht zu landen, ließ mich irgendwann vermuten, dass er noch Jungfrau war. Er behandelte weibliche Wesen wie Gottheiten. Ich versuchte ihm zu erklären, worin sein Fehler bestand, aber alles, was ich vorbrachte, war ihm noch unverständlicher als die Geschichte der abendländischen Philosophie. Er sagte, er wolle überhaupt keine Frau kennenlernen.
Eines Morgens, in einer Pause beim Aktzeichnen, zog Franco ein zusammengefaltetes Foto aus seinem Portemonnaie. Es war ein Ausriss aus einer offenbar spanischen Tageszeitung, das grobgerasterte, verschwommene und atemberaubende Bild eines jungen Mädchens. Die Züge ebenmäßig, bis auf ein Auge, das schief im Kopf drinstand.
«Meine Freundin», sagte Franco.
Ich zweifelte nicht eine Sekunde lang, dass er der Person auf dem Foto noch nie begegnet war. Er erzählte, er habe sie vor Jahren auf einer Ausstellung kennengelernt, sie sei eine große Künstlerin. Er schreibe ihr täglich, leider antworte sie selten, aber wenn er endlich die Wohnung vom Sozialamt bekäme, würde sie auch nach Deutschland ziehen. Er schilderte die Freundlichkeit des Sachbearbeiters vom Sozialamt in den glühendsten Farben, dann erzählte er begeistert von seinem UNTERKALT-Projekt, das gerade gescheitert war, was er zum Teil des Konzepts erklärte. Dann redete er davon, wie er sich ein Loch in die Hose gerissen hatte, und zeigte mir das Loch. Alles im Tonfall äußerster Euphorie. Und diese Euphorie deprimierte mich immer am meisten. Egal, was passierte oder nicht passierte, Francos rauschhafter Zuneigung zum Leben konnte nichts etwas anhaben. Wenn er seinen Schal verlor, entdeckte er die Faszination der Kälte. Wenn wir eine Stunde zu Fuß im Schneegestöber durch die Stadt liefen, um ins Kino zu gehen, weil unser Geld für Kino und U-Bahn nicht reichte, und wenn wir nicht reinkamen, weil das Kino ausverkauft war, war Franco begeistert.
«Wieder acht Mark gespart!», sagte er. «Wir werden uns großartig amüsieren.»
«Mit acht Mark», sagte ich.
Vor einem Supermarkt fing er an, Einemarkstücke in die Einkaufswagen zu stecken, acht Stück insgesamt. Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass man, um die gesamte Schlange von Einkaufswagen abzulösen, nur eine einzige Mark brauchte.
«Du bist so schlau!», sagte er, schob die Wagen wieder ineinander und löste zwei Zehnerreihen aus, eine für mich, eine für ihn.
«Was soll ich damit?», sagte ich.
Es war mühsam, die Wagen durch die nächtlichen Straßen zu schieben. Zum Wohnheim am Kettensteg ging es einen Berg hinauf. Franco steuerte die Mauer an, die fünfzehn Meter in die Pegnitz hinabführte, und sagte, ich solle ihm helfen. Aber es war aussichtslos, die Wagen am Stück über die Mauer zu kriegen. Wir hatten sie kaum den Berg raufschieben können, anheben war unmöglich. Also investierte Franco noch mal zwei Mark und spaltete die Wagen in Fünfergruppen. Die hievten wir stöhnend in den Fluss, eine nach der anderen.
«Ihr Arschlöcher!», rief Franco. «Könnt ihr mich hören? Ich hasse euren Scheißkapitalismus, ihr Arschlöcher!»
Niemand hörte ihn. Es war Nacht, und die Leute schliefen und mit ihnen die Leidenschaften, die sie für dieses Gesellschaftssystem empfinden mochten. Flach und silbern blinkten die Einkaufswagen unten im Fluss, von kleinen Wellen überspült. Früher oder später würden sich Schlamm und Treibgut in ihnen verfangen.
«Noch zwanzig Mark, und du kannst den ganzen Fluss stauen und die Altstadt versenken», sagte ich, und lange standen wir dort oben im Schneegestöber und schauten hinunter und rauchten, und Franco versicherte mir ein ums andere Mal, was für ein ausgezeichneter Mensch ich sei.
Es schneite die ganze Woche. Dann kamen frostklare Tage mit einer grellen, tiefstehenden Sonne, die schräg durch die Fenster der Mensa schien. Ich saß allein in der Mensa und las. Meine Heizung war noch immer nicht repariert. Als Franco sich zu mir an den Tisch setzte, waren seine Augen so durchsichtig und fiebrig wie bei unserer ersten Begegnung in der Jugendherberge. Er rührte sein Essen kaum an. Ich fragte, was los sei, und er beugte sich über den Tisch und flüsterte: «Mara kommt.»
«Was ist Mara?»
«Meine Freundin.»
«Hat sie dir geschrieben?»
«Sie kommt», sagte Franco und zeigte geradeaus.
Eine zierliche, dunkle Frauengestalt öffnete die gläserne Tür zur Mensa. Sie war in einen schweren Mantel gehüllt, der auf dem Boden schleifte, und sie hatte einen Koffer in der Hand. Franco legte sein Besteck parallel auf den Teller. Er gab sich große Mühe, es lautlos und konzentriert und wirklich parallel hinzulegen, dann ging er der Frau entgegen und begrüßte sie, indem er ihr die Hand hinstreckte. Sie nahm sie nicht.
Zwei Tage später wurde ich von ihnen zum Essen eingeladen. Franco hatte gekocht und alles, Alexander schaute verlegen auf seinem mit Kerzen und Weinflaschen vollgestellten Küchentisch herum. Ich stellte mein Sixpack dazu.
«Darf ich vorstellen: das Genie!»
Ich lächelte. Mara schwieg. Den ganzen Abend redete nur Franco. Es war sehr anstrengend, und ich verabschiedete mich zeitig. Francos Benehmen Mara gegenüber machte mich fast krank. In einem fort fragte er, ob alles in Ordnung sei, schenkte Wein nach und sprang vom Stuhl auf, sobald sie einen beliebigen Gegenstand mit den Augen berührte. «Möchtest du noch Salz? Möchtest du Pfefferminzplätzchen? Möchtest du dich hinlegen?» Irgendwann sagte Alexander: «Lass doch mal gut sein», und Mara schaute Alexander an. Ich wusste nicht mal, ob sie Deutsch sprach.
Natürlich zog auch Mara bei Alexander ein. «Nur, bis sie eine eigene Wohnung haben», sagte Alexander. Aber es war klar, dass sie nie eine eigene Wohnung haben würden.
Mara hatte die üblichen Klischeekrankheiten wie aufgeschlitzte Unterarme, und ihre Zigaretten drückte sie immer auf den Fingerknöcheln aus, wenn man nicht hinguckte. Aber sonst war sie vollkommen in Ordnung. Und sie sah tatsächlich genauso aus wie auf dem Foto, genauso atemberaubend und auch genauso verschwommen, sodass es immer ein bisschen wirkte, als ob sie im Schatten stünde oder etwas weiter weg. In ihrem Beisein wurde Franco unsichtbar. Er redete doppelt so viel wie sonst, aber er konnte nicht verhindern, dass er unsichtbar wurde, eine fahrige Hirtenfigur im Hintergrund einer Marienverehrung.
«Es ist nicht Freundschaft, sondern reines Mitleid, dass ich sie ihm nicht längst ausgespannt habe», sagte Alexander einmal im Suff zu mir, und ich dachte: Alexander ist wirklich noch blöder, als er aussieht. Aber dann dachte ich, dass ich den Gedanken ja so oder so ähnlich auch schon gehabt hatte. Dazu kam, dass lange Zeit unklar blieb, was Franco und Mara eigentlich miteinander verband. Ständig liefen sie hintereinanderher, aber nie sah man eine Berührung zwischen ihnen.
Mara schrieb sich nicht an der ABK ein, arbeitete aber mit an Francos Projekten. Ein paar Wochen lang bauten die beiden Computerzubehör aus Streichhölzern. Irgendwann kamen sie – ich weiß nicht, ob Franco oder Mara – auf die Idee, einen Zinnsoldaten zu schlucken, um dann ein Röntgenbild vom Verdauungstrakt zu machen. Sie warfen eine Münze, Mara verlor und schluckte den Soldaten. Auf dem Röntgenbild war nicht viel zu erkennen, der Soldat hatte sich im Magen quer gelegt. Beim zweiten Versuch weigerten sich die Ärzte bereits, Mara zu röntgen. Mit ihren Fingerknöcheln und der Erklärung, den Soldaten wieder nur zufällig geschluckt zu haben, stand sie kurz vor der Einweisung. Am Ende benutzten die beiden einen Spanienaufenthalt, um weitere Röntgenaufnahmen machen zu lassen, auf denen der Soldat im Profil zu erkennen war. Die spanischen Ärzte fanden es nicht außergewöhnlich, dass jemand jeden Tag einen Soldaten verschluckte.
«Das Militär auf dem Weg zum Arsch», sagte Franco, während er die Bilder mit Tesa an Alexanders Küchenfenster heftete.
«Ein wichtiger Beitrag zur Geschichte des Pazifismus», sagte ich und schaute Mara an, die die Kohorten von Spielzeugsoldaten, die durch ihren Körper marschiert waren, offenbar gut verkraftet hatte.
«Ich bin der Krieg», sagte Mara. «Ich verzehre den Soldaten.»
«Mara ist der Krieg!», wiederholte Franco emphatisch.
«Bei euch hackt’s doch», sagte ich.
Als ich Franco das nächste Mal begegnete, schleppte er einen ausrangierten Leuchtkasten durch die Akademie. Mein eigenes Studium war zu diesem Zeitpunkt längst Vergangenheit. Ich hatte angefangen, als Aushilfe in einer Karosserielackiererei zu arbeiten, wo ich feststellte, dass man mit sechzehn Arbeitsstunden in der Woche einigermaßen überleben konnte. Das beruhigte mich. Trotzdem ging ich weiterhin regelmäßig an die Akademie, um mich von meiner Professorin demütigen zu lassen. Sie drohte weiterhin, mich rauszuwerfen, tat es aber nie. Es gefiel ihr im Grunde, zwischen all den anthroposophischen Idioten einen reinrassigen Idioten zu haben.
«Reg dich nicht auf. Ich muss dich übrigens was fragen», sagte Franco. Er stellte mir den Kasten auf die Füße, begann ein ziemliches Rumgerede und verlangte meinen Wohnungsschlüssel. Er brauche neutrales Gelände.
«Du verstehst schon», sagte er.
Ich verstand kein Wort. Es dauerte eine Weile, bis er Klartext redete, und auch dann verstand ich ihn noch nicht. Mara habe einen anderen.
«Was?»
«Ich habe Haare gefunden. Lange blonde Haare.» Er legte den Kopf schief und zupfte an meinen Haaren herum, die nicht besonders lang, aber blond waren. «Ich habe ihm einen Brief geschrieben. Ich werde diesen Menschen treffen und die Situation reinigen.»
«Ja und?»