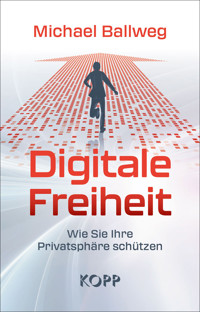
11,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kopp Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Goodbye Google, Apple, NSA & Co.
So holen Sie sich Ihre digitale Freiheit zurück!
Die digitale Welt bietet unzählige Vorteile, doch sie birgt auch Gefahren, die oft unsichtbar und heimtückisch sind. Mit diesem Buch erhalten Sie das nötige Wissen und die Werkzeuge, um diese Gefahren zu erkennen und sich dagegen zu wappnen. Entdecken Sie, wie Sie Ihre Privatsphäre bewahren, Ihre Daten schützen und so Ihre persönliche Freiheit verteidigen können - ganz ohne auf den Komfort moderner Technologien verzichten zu müssen. Lassen Sie sich aufklären und inspirieren: Digitale Freiheit ist möglich, und sie beginnt mit einem bewussten Umgang mit Ihrem Smartphone.
Das Smartphone: unser täglicher Begleiter - und gleichzeitig eine mobile Wanze!
Ein wichtiges Instrument, um in unsere Privatsphäre einzudringen, sind die so nützlichen Smartphones. Keiner will auf sie verzichten. Würde George Orwell eine Neuauflage seines Klassikers 1984 schreiben, spielten die Smartphones mit Sicherheit eine zentrale Rolle darin.
Lassen Sie nicht zu, dass Ihr Smartphone nahezu Ihr ganzes Leben an Big Tech und die Geheimdienste übermittelt!
Doch unsere digitale Freiheit wird nicht nur durch unsere Handys bedroht. Digitale Überwachungsmethoden, Gesichtserkennung, der digitale Euro, dessen Einführung bevorsteht, der milliardenschwere Handel mit unseren Daten - unser Leben ist für Regierungen, Geheimdienste und Unternehmen zu einem offenen digitalen Buch geworden. Bis jetzt!
Wie wir uns davor schützen können, das verrät Michael Ballweg, erfahrener IT-Unternehmer, Softwareentwickler und Gründer der Querdenken-Bewegung, in diesem Ratgeber.
Ihr Wegweiser in die digitale Freiheit:
- Entwickeln Sie ein Bewusstsein für die digitalen Risiken (jede E-Mail, die Sie verschicken, ist zum Beispiel eine offene, für jeden zugängliche digitale Postkarte).
- Emanzipieren Sie sich von Google, Apple und anderen Datenkraken durch die Verwendung von speziell ausgewählter Open-Source-Software.
- Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen: Verwenden Sie die neuen Freiheits-Handys mit dem alternativen Betriebssystem GrapheneOS.
Michael Ballweg bietet seinen Lesern eine umfassende Anleitung, wie sie sich vor digitaler Überwachung schützen, ihre Privatsphäre bewahren und in einer zunehmend überwachten Welt digitale Freiheit erlangen können. Machen Sie »Big Brother« zum »Big Loser«.
Sind Sie bereit, die Kontrolle über ihr digitales Leben zurückzugewinnen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
1. Auflage November 2024
Copyright © 2024 bei Kopp Verlag, Bertha-Benz-Straße 10, D-72108 Rottenburg
Alle Rechte vorbehalten
Satz und Layout: Mohn Media Mohndruck GmbH, Gütersloh Covergestaltung: Nicole Lechner
ISBN E-Book 978-3-98992-066-8 eBook-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
Gerne senden wir Ihnen unser Verlagsverzeichnis Kopp Verlag Bertha-Benz-Straße 10 D-72108 Rottenburg E-Mail: [email protected] Tel.: (07472) 98 06-10 Fax: (07472) 98 06-11
Unser Buchprogramm finden Sie auch im Internet unter:www.kopp-verlag.de
Vorwort
Liebe Freiheitsliebende und Mitstreiter,
wir leben in Zeiten des Umbruchs. Einer Zeit, in der es nicht mehr nur um politische Entscheidungen oder wirtschaftliche Krisen geht, sondern um Grundsätzliches: um unsere Freiheit, unsere Selbstbestimmung und um die Frage, in welcher Welt wir leben wollen.
Die Entwicklungen der letzten Jahre haben deutlich gezeigt: Das System, das vorgibt, uns zu schützen, nutzt jede Gelegenheit, um uns zu überwachen, zu kontrollieren und unsere Rechte Stück für Stück zu beschneiden. Wir sehen dies überall – ob bei der Zensur auf digitalen Plattformen, der Einführung von Zentralbank-Digitalwährungen oder der zunehmenden Überwachung unserer Kommunikation.
Doch genau in diesen Herausforderungen liegt auch unsere Chance. Die Chance, uns aus diesem System zu befreien, indem wir uns selbst ermächtigen und neue, freie Strukturen schaffen. Strukturen, die unabhängig sind von den Kontrollmechanismen der großen Techkonzerne und Regierungen. Strukturen, die uns ermöglichen, selbstbestimmt zu leben und zu handeln.
Die Bewegung Querdenken-711 entstand genau aus diesem Geist heraus. Wir stehen für Freiheit, Frieden und Wahrheit. Wir stehen für eine Gesellschaft, in der jeder Mensch seine Meinung frei und ohne Angst vor Repressionen oder Zensur äußern kann. Und wir stehen für Eigenverantwortung – für die Überzeugung, dass jeder von uns aktiv daran arbeiten muss, die Welt zu gestalten, in der wir leben wollen.
Dabei geht es nicht nur um Proteste auf der Straße, sondern darum, wirkliche Alternativen zu schaffen. In der digitalen Welt bedeutet dies, dezentrale Systeme zu nutzen, die uns von den großen Konzernen unabhängig machen. Mit dem Projekt Digitaler Aktivist arbeiten wir genau daran. Es ist Zeit, uns die Kontrolle über unsere Daten und unser digitales Leben zurückzuholen.
Die Geschichte hat gezeigt, dass echte Veränderung immer von Menschen ausgeht, die mutig vorangehen und neue Wege beschreiten. Dies hat Mahatma Gandhi in Indien und Václav Havel in der Tschechoslowakei vorgemacht. Beide haben durch friedlichen Widerstand und den Aufbau paralleler Strukturen gezeigt, dass es möglich ist, sich einem unterdrückenden System zu entziehen – und genau das ist auch unsere Aufgabe.
Lassen Sie uns gemeinsam die Schritte gehen, die dazu nötig sind. Lassen Sie uns der Welt zeigen, dass es einen anderen Weg gibt – einen Weg der Freiheit, der Selbstbestimmung und des Friedens.
Voll Freude an Veränderung und mit tiefem Vertrauen in unsere gemeinsame Kraft,
von Herzen
Ihr Michael
Kapitel 1: Als Schlafwandler in den Überwachungsstaat – eine Bestandsaufnahme
KAPITEL 1
Als Schlafwandler in den Überwachungsstaat – eine Bestandsaufnahme
Das Smartphone gehört längst zu unserem Alltag – vom Schulhof bis ins Seniorenwohnheim möchte keiner auf diesen digitalen Helfer verzichten. Und wie sehr wir auf unser Handy, das ja sehr viel mehr kann als nur telefonieren und E-Mails verschicken, angewiesen sind, bemerken wir spätestens, wenn das Gerät aus irgendwelchen Gründen einmal ausfällt. Gut beraten ist, wer dann ein Zweithandy zur Verfügung hat. Im Jahr 2023 belief sich die Zahl der Smartphone-Nutzer in Deutschland nach Angaben des Bundesverbandes Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (Bitkom) auf rund 68,5 Millionen. 1 Das heißt, über 94 Prozent aller in Deutschland lebenden Menschen benutzen ein Smartphone. In Österreich besitzen 89 Prozent aller Personen im Alter ab 15 Jahren ein Handy, 2 in der Schweiz sind es über 93 Prozent, also ebenfalls so gut wie alle. 3
Die Bezeichnung »Smartphone« wurde »1999 von dem schwedischen Unternehmen Ericsson geprägt. Das erste heute noch als Smartphone bezeichnete Mobiltelefon wurde 2007 auf den Markt gebracht (das erste iPhone von Apple). Seit 2013 sind die jährlich weltweit neu verkauften Mobiltelefone mehrheitlich Smartphones.« 4 Ohne Frage konstatieren wir hier den faszinierenden globalen Siegeszug eines Produkts. Aber ein Smartphone ist nicht nur ein Gerät zur Kommunikation, mit dem man Bilder und Videos aufnehmen, mit seinen Freunden weltweit kommunizieren, Waren bestellen und bequem sein Wertpapierdepot steuern kann, sondern es ist längst zum Statussymbol avanciert, das den Geschmack des Besitzers und dessen Sinn für Ästhetik widerspiegelt.
Und die Nachfrage nach den jeweils neuesten Modellen scheint keine Grenzen zu kennen. So wurden im Jahr 2023 weltweit rund 1,17 Milliarden Smartphones produziert. Marktführer ist nach wie vor Samsung mit einem Marktanteil von beinahe 19 Prozent, gefolgt von Apple und Xiaomi mit 15,8 beziehungsweise 14,8 Prozent.
Jede Wette: Den meisten Menschen (es gibt sicher ein paar Handy-Verweigerer) ist ihr Smartphone ans Herz gewachsen. Gestatten Sie, liebe Leserin, lieber Leser, dass ich Sie trotzdem (oder gerade deshalb) an dieser Stelle mit einer bedauerlichen Wahrheit konfrontiere: Ihre Smartphones sind nichts anderes als mobile Wanzen. Die Stasi hätte ihre große Freude daran gehabt, dass Sie immer und überall Ihre mobilen Wanzen dabeihaben und Ihre Daten freiwillig abliefern.
Der eine oder andere von Ihnen mag grundsätzlich schon etwas vorsichtiger im Umgang mit dem Handy sein und vertrauliche Gespräche lieber über das gute alte Festnetztelefon führen. Doch machen Sie sich bitte keine Illusionen: In diesem Fall tauschen Sie nur eine mobile Wanze gegen eine stationäre aus. Die führenden Digitalkonzerne, die in vielen Fällen auch mit Behörden und Geheimdiensten eine sehr lukrative Kooperation pflegen, nutzen ihre Marktmacht gnadenlos dazu aus, eine umfassende Überwachung all unserer Aktivitäten umzusetzen. Und das Handy ist hierfür ein hochwirksames Instrument. Niemand weiß, wozu diese Daten neben der Erstellung von Persönlichkeitsprofilen noch genutzt werden. In harmloseren, aber nervenden Fällen werden Sie mit ungebetener Werbung überschwemmt. In gravierenderen Fällen wollen Behörden an für sie relevante Informationen gelangen und/oder Ihnen aus diesen sozusagen einen digitalen Strick drehen. Weshalb Ihr Handy eine mobile Wanze ist und was Sie vor allem dagegen tun können, erfahren Sie im vorliegenden Buch. Ich stelle Ihnen später das Freiheits-Handy vor, mit dessen Hilfe Sie sich von den großen Techkonzernen emanzipieren und Ihre digitale Freiheit zurückerobern können. Digitale Freiheit – darum geht es mir. Da sich dieses Anliegen aber nicht auf den Umgang mit dem Smartphone beschränkt, möchte ich, bevor ich zum Freiheits-Handy komme, grundsätzlich auf das Thema »digitale Freiheit« eingehen und Sie hierfür sensibilisieren. Eine gezielte diesbezügliche Sensibilisierung der Gesellschaft erscheint mir dringend geboten.
Schon im Jahr 2021 warnte Gerd Gigerenzer: »Politiker und Bürger gehen schlafwandelnd in Richtung Überwachung.« 5 Gigerenzer, Psychologe, ehemaliger Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und seit 2020 Direktor des Harding-Zentrums für Risikokompetenz an der Universität Potsdam, sprach damals von einer »Entmündigung der Menschen« und plädierte für mehr Privatsphäre und Würde der Bürger. Außerdem konstatierte der Wissenschaftler: »Es fehlt den Deutschen an digitaler Kompetenz.« Ich würde nicht so weit gehen und den Deutschen die Kompetenz per se absprechen, habe aber sehr wohl den Eindruck, dass es an digitaler Information und der bereits angesprochenen Sensibilisierung fehlt.
Oft genug höre ich den reichlich unbekümmerten Einwand: »Na und? Sollen sie meine Daten doch haben, wenn sie damit glücklich werden. Ich habe ja nichts zu verbergen.« Doch es geht nicht darum, ob Sie etwas zu verbergen haben. Es geht vielmehr um Ihre Privatsphäre, um Dinge, die den Staat, Unternehmen oder sonstige Datenkraken einfach nichts angehen. Um den Whistleblower Edward Snowden zu zitieren: »Zu argumentieren, dass Sie keine Privatsphäre brauchen, weil Sie nichts zu verbergen haben, ist so, als würden Sie sagen, dass Sie keine Meinungsfreiheit brauchen, weil Sie nichts zu sagen haben.« 6
Ihre Daten sind für manche Institutionen, Unternehmen oder Behörden bares Geld wert. Und seien wir ehrlich: Würden Sie es zulassen, dass irgendwelche Techkonzerne, Behörden oder Werbeleute permanent in Ihrem Girokonto herumschnüffeln, weil Sie ja nichts zu verbergen haben? Sicherlich nicht.
Dass wir, um noch einmal den Psychologen Gerd Gigerenzer zu zitieren, »schlafwandelnd in Richtung Überwachung« unterwegs sind und in nicht allzu ferner Zukunft Zustände wie im total überwachten China haben könnten, halten manche für übertrieben und schieben solche Mahnungen und Warnungen gar mit der verbalen Totschlagkeule der »Verschwörungstheorie« beiseite.
Aber genau das ist das Gefährliche an der digitalen Überwachung: Sie wirkt zunächst wie Magnetismus. Man spürt sie nicht, man sieht sie nicht, man hört sie nicht. Man nimmt sie meist erst wahr, wenn es zu spät ist. Die digitale Überwachung vollzieht sich schleichend.
George Orwell 2.0
Sicher kennen Sie den dystopischen Roman 1984 von George Orwell. Der britische Autor und Journalist wurde am 25. Juni 1903 in Motihari in Britisch-Indien geboren, war zunächst Beamter und begann später mit dem Schreiben. Sein erstes wichtiges Werk war die 1945 erschienene Fabel Animal Farm. Nach dem Tod seiner Frau lebte Orwell abgeschieden an der Westküste Schottlands. Dort entstand die 1948 erschienene Dystopie 1984. In diesem Roman beschreibt der Autor einen totalitären Staat mit lückenloser Überwachung, Unterdrückung und Folter. Eines seiner bekanntesten Zitate, das aktueller denn je ist, lautet: »Wenn das Denken die Sprache korrumpiert, korrumpiert die Sprache auch das Denken.«
Wer heute den Roman 1984 liest, gewinnt den Eindruck, man müsste dieses literarische Werk nur ein wenig aktualisieren – und schon würde es die Realität der Gegenwart widerspiegeln. In der Tat gibt es viele Parallelen. Was Orwell allerdings nicht voraussehen konnte, sind die ungeahnten Möglichkeiten der digitalen Überwachung. Und diese begegnet uns nicht nur im Umgang mit unseren Handys, sondern bald auch bei den Bezahlprozessen.
Als vor einigen Jahren die ersten kritischen Bücher über das drohende Bargeldverbot erschienen, hielten viele die darin enthaltenen Warnungen für Panikmache oder »Verschwörungstheorien«. Vor allem die Deutschen und Österreicher liebten doch ihr Bargeld. Also werde es kein Politiker und kein Notenbanker wagen, ihnen die Scheine und Münzen zu entziehen und damit die einzige Möglichkeit, bar zu bezahlen. Selbst als die 500-Euro-Scheine allmählich aus dem Verkehr gezogen wurden, klingelten bei den meisten Bürgern noch keine Alarmglocken. Ganz im Gegenteil. Ein wenig erinnert das Verhalten der Menschen in dieser Hinsicht an Herrn Biedermann aus Max Frischs Drama Biedermann und die Brandstifter. Man bemerkt, dass da üble Dinge laufen, versucht aber, sie sich schönzureden und zu verharmlosen. Wird so schlimm schon nicht werden, denn bekanntlich wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Die Deutschen und Österreicher werden sich ihr Bargeld schon nicht nehmen lassen.
Doch wie sieht die Situation rund 40 Jahre nach der Veröffentlichung von Orwells Roman 1984 aus? Die deutsche Bargeldliebe »erkalte«, berichtete die Tagesschau im Juli 2024 und berief sich dabei auf eine aktuelle Bezahlstudie der Deutschen Bundesbank. 7 Gemäß dieser wurde im Jahr 2023 fast jede zweite Zahlungstransaktion bargeldlos abgewickelt, also entweder mit Karte, Smartphone oder Smartwatch. Der Anteil der bargeldlosen Bezahlungen sei 2023 auf 49 Prozent gestiegen, nachdem es bei der letzten Befragung der Bundesbank im Jahr 2021 noch 42 Prozent gewesen seien.
»War on Cash«
Man darf die Aussagekraft dieser Studie sicher in einem Punkt anzweifeln. Denn in die Untersuchung flossen auch Internetkäufe ein, bei denen die Bezahlung mit bargeldlosen Systemen wie Kreditkarte, Bankkarte, PayPal und so weiter schon immer gang und gäbe war. Mit zunehmendem Online-Shopping steigt logischerweise auch der Anteil bargeldloser Zahlungen. Aber auch der von Großkonzernen, Regierungen, Finanzinstituten und NGOs wie der Gates-Stiftung befeuerte »War on Cash« zeigt in Deutschland allmählich Wirkung.
Wie immer, wenn es gilt, der Daten der Menschen habhaft zu werden (und darum geht es letztlich auch bei Bargeldrestriktionen oder einem eventuellen Bargeldverbot), wird mit subtilen Methoden gearbeitet. So soll das Smartphone natürlich nicht als mobile Wanze wahrgenommen werden, sondern als nützlicher Helfer im Alltag und als Kommunikationsmittel. Man kann zum Beispiel Bilder und Videos via WhatsApp oder E-Mail verschicken und Freunde und Bekannte ein bisschen neidisch machen. Früher schickte man Ansichtskarten, heute eben Bilder, Videos und Textnachrichten. Jeder, der möchte und über die nötigen technischen Voraussetzungen verfügt, kann sie sich anschauen.
Doch wer seine Einkäufe künftig nur noch mit Karte, Smartphone oder Smartwatch bezahlt, hinterlässt digitale Spuren, mit deren Hilfe man die Konsumgewohnheiten des Betreffenden ausschnüffeln und komplette Bewegungsprofile erstellen kann. Gönnen Sie sich beispielsweise an einem anderen Ort als in Ihrer Stammkneipe, in der Sie bestens bekannt sind, mittags einen Lunch und bezahlen bar, dann kennt niemand Ihren Namen und niemand weiß, woher Sie kommen.
Menschen, die ihre Daten arglos preisgeben, werden für ihr »kooperatives« Verhalten belohnt. Diese Strategie ruht im Wesentlichen auf drei Säulen:
Convenience, also Bequemlichkeit: Der Kunde braucht sich um wenig zu kümmern. Den Umgang mit dem Smartphone beherrscht heute schon jedes Kind, denn die großen Techkonzerne machen es uns so einfach wie möglich. Beim Einkaufen zahlen wir einfach mit Karte oder Smartphone. Wenn es nicht gerade mal wieder zu System- oder Stromausfällen kommt, geht das meist flott über die Bühne. Der Kunde muss auch kein Wechselgeld entgegennehmen, das seine Geldbörse beschwert. Und auch die Sorge, nicht genug Geld zum Einkauf mitgenommen zu haben, entfällt. Wer nicht ständig überlegen muss, ob das Geld im Portemonnaie ausreicht, kauft außerdem großzügiger ein und bringt folglich mehr Umsatz. Das wiederum freut den Händler.
Belohnung: »Geiz ist geil«, lautete einmal ein ebenso erfolgreicher wie blödsinniger Werbeslogan. Denn Geiz ist, psychologisch betrachtet, überhaupt nicht geil, sondern eine Art inneres Gefängnis. Geizige Menschen weisen das Etikett Geiz meist vehement von sich und behaupten, sie seien bloß sparsam und hielten »das Geld zusammen«. Jedenfalls reagieren die meisten Menschen stark auf Rabatte, Sonderangebote und Boni. Psychologen behaupten, Rabatte brächten Hirnareale in Wallung, die auch auf Kokain reagierten, und Gratisangebote könnten sogar geradezu rauschartige Zustände auslösen. Wenn also etwa ein Supermarkt oder ein Discounter allen Kunden einen Preisnachlass einräumt, die sich eine entsprechende App auf ihr Smartphone runterladen, dann werden viele diese Einladung annehmen. Und wenn das Busfahrticket ein paar Cent günstiger ist, wenn man es mit Karte oder Smartphone bezahlt, dürfte auch dies auf eine entsprechende Resonanz stoßen. Dabei sollte an und für sich doch längst klar sein: Niemand hat etwas zu verschenken. Räumt man Ihnen also einen Rabatt oder Bonus dafür ein, dass Sie eine App auf Ihrem Handy installieren, dann zahlen Sie den damit verbundenen Vorteil letztlich mit Ihren eigenen Daten.
Diskreditierung: Barzahler stehen – vor allem dann, wenn es um größere Summen geht – oft unter Generalverdacht. Sie sind potenzielle Steuerhinterzieher und Geldwäscher. »Nur Großmütter und Ganoven zahlen noch bar«, lautet ein verleumderisches Argument der interessengesteuerten Bargeldgegner.
Auch der Einführung des digitalen Euro, also der europäischen Variante der Central Bank Digital Currency (CBDC), welche bis zum Jahr 2027 geplant ist, steht eine Mehrheit der Deutschen offenbar gleichgültig oder sogar befürwortend gegenüber. Sie können oder wollen es nicht nachvollziehen, dass der E-Euro ein staatliches Kontroll- und Überwachungsinstrument werden kann. Der E-Euro wird von vielen als eine Art »staatlicher Bitcoin« betrachtet, ist aber eher das Gegenteil, denn er ist programmierbar – und damit lassen sich die Bürger steuern. Doch die Frage muss erlaubt sein: Brauchen wir den E-Euro überhaupt? Nein, wir brauchen ihn nicht. Wer es vorzieht, unbar zu zahlen, hat schon heute zahlreiche Möglichkeiten. Er kann seine Debit- oder Kreditkarte zücken, mit dem Smartphone oder der Smartwatch zahlen, den Rechnungsbetrag überweisen oder mithilfe von Zahlungsdienstleistern wie PayPal begleichen. Uns steht (noch) Bargeld zur Verfügung und natürlich der Bitcoin. Weshalb also ein zusätzliches Zahlungsmittel wie den E-Euro einführen? Die Antwort ist ganz simpel: Er ist ein weiteres Überwachungsinstrument, und zwar ein höchst effizientes. Jonas Groß, der Vorsitzende der Digital Euro Association (DEA) und in dieser Funktion sicher kein dezidierter Gegner des E-Euro, bringt die Gefahr auf den Punkt: »Letztlich kann so eine digitale Währung in alle Richtungen ausgestaltet sein. Also es kann von der Privatsphäre her komplett transparent sein oder komplett anonym ohne Limits. In diesem Spektrum bewegen wir uns.« 8 Es stellt sich mit anderen Worten die Frage, ob die digitale Zentralbankwährung als Überwachungs- und Erziehungsinstrument genutzt wird – wie zum Beispiel in China – oder die europäischen Behörden den Schutz unserer Daten und mithin unserer Privatsphäre eher streng auslegen. An die letztgenannte Möglichkeit glaubt wohl niemand, der die staatliche Vorgehensweise während der Coronahysterie erlebt hat.
Machen wir uns bitte nichts vor, liebe Leserin, lieber Leser: Wenn ein Staat die Möglichkeiten zur Kontrolle und Lenkung seiner Bürger hat, dann wird er sie auch nutzen. Vielleicht nicht so exzessiv wie in China, sondern subtiler und immer gekoppelt an gutmenschliche Ziele. Ein fiktives Beispiel: Es könnte zum Schutz des Klimas beitragen, wenn Rentner nicht mehr so häufig in Urlaub führen und stattdessen zu Hause in ihrer Heimat ihren Ruhestand genössen. Um das zu erreichen, müssten die künftigen Rentenzahlungen ausschließlich in E-Euro ausgezahlt und diese so programmiert werden, dass die staatliche Digitalwährung nur in einem Radius von vielleicht 100 Kilometern einsetzbar ist.
Sie denken immer noch, gerade der deutsche Staat würde sehr zurückhaltend mit den Daten seiner Bürger umgehen und Überwachungsinstrumente nur einsetzen, um Verbrechen wie Terror, Kinderpornografie, Geldwäsche und Steuerhinterziehung wirksam zu bekämpfen? Dann lassen Sie uns doch bitte einen Blick zurück ins Jahr 2005 werfen. Damals führte die Bundesregierung die automatisierte Kontenabfrage ein – wie üblich unter dem Vorwand, Steuerhinterziehung und Geldwäsche einzudämmen. Seither können vor allem Finanz- und Sozialämter sowie Arbeitsagenturen die sogenannten Kontostammdaten eines jeden Bürgers abfragen. »Zu den Kontostammdaten zählen zum einen die Kontonummer, das Eröffnungs- beziehungsweise Auflösungsdatum eines Kontos, zum anderen aber auch Name, Anschrift, Geburtsdaten, vorhandene Bausparverträge und Wertpapierdepots der Kontoinhaber«, heißt es in einer Stellungnahme der Bundesregierung. 9 Die Abfrage erfolgt grundsätzlich über das Bundeszentralamt für Steuern, ohne dass der Betroffene etwas davon erfährt.
Von dieser Überwachungsmethode wird seit einigen Jahren exzessiv Gebrauch gemacht. Die Medien berichten von ständig neuen Rekorden bei den Fallzahlen. So wurden im Jahr 2015 noch 98 000 Anfragen registriert, 2022 waren es schon über 294 000 (aktuellere Zahlen lagen zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht vor). 10 Allein dieses Beispiel zeigt, dass ein Überwachungsinstrument, sobald es eingeführt ist, intensiv genutzt wird.
Dass sich der programmierbare digitale Euro zur Überwachung und Erziehung der Menschen eignet, ist unbestritten. Also wird man von diesen Möglichkeiten auch Gebrauch machen. Welche dystopischen Features des E-Euro und anderer digitaler Zentralbankwährungen auf uns zukommen könnten, beschreiben die Autoren Michael Brückner und Jessica Horn in ihrem Buch Digitale Zentralbankwährung – wenn E-Euro & Co. zum staatlichen Kontroll- und Überwachungsinstrument werden:
Die Souveränität der Menschen im Umfang mit Geld wird deutlich eingeschränkt. So könnte das digitale Zentralbankgeld teilweise nur bis zu einer bestimmten Summe pro Monat beziehungsweise pro Jahr ausgegeben werden dürfen (zum Beispiel für angeblich klimaschädigende Flugreisen, alkoholische Getränke, Tabak, Süßigkeiten usw.). Da der digitale Euro wie erwähnt programmierbar ist, können etwa Steuerungs- und Kontrollfunktionen eingebaut werden, ferner Ablaufdaten, kontinuierlicher Wertverlust im Zeitablauf sowie eine Nachverfolgung des »ökologischen Fußabdrucks« aller Einkäufe.
Denkbar sind des Weiteren regionale Restriktionen. Das heißt, das Geld darf nur in bestimmten Ländern ausgegeben werden. Das beträfe zum Beispiel Auswanderer, die außerhalb der EU leben, aber eine deutsche Rente beziehen.
Zeitliche Restriktionen: Möglicherweise muss das Geld in bestimmten Zeiträumen ausgegeben werden (daraus resultiert dann quasi ein »Konsumzwang«, um eine lahmende Konjunktur anzukurbeln).
Kontrolle durch die Regierung beziehungsweise Behörden: Nicht die Menschen entscheiden darüber, wie sie ihr Geld ausgeben, sie sind vielmehr vom Wohlwollen der Regierung abhängig. Im Extremfall können die Menschen über digitales Zentralbankgeld für systemkonformes Verhalten belohnt oder für Aufmüpfigkeit (etwa gegen einen neuen Impfzwang) bestraft werden.
Die Bestrafung von »Aufmüpfigkeit« wird nach Einführung des digitalen Euros viel einfacher werden. Kritischen Bürgern, gegen die Sanktionen verhängt wurden, kann der Zugang zu Konten mit digitaler Zentralbankwährung problemlos entzogen werden, sobald sie auf einer Sanktionsliste stehen, ohne dass sich ein Staat bei der Umsetzung von Sanktionsentscheidungen auf Banken verlassen muss.
Das derzeitige dezentralisierte System mit Tausenden von Banken kann nicht so leicht gehackt werden wie ein zentrales System mit digitaler Zentralbankwährung. 11
Wer schnüffelt am intensivsten?
Mit der staatlichen Überwachung der Bürger ist es wie mit der Bürokratie: Zwar wird allenthalben betont, man müsse diese auf das absolut notwendige Maß beschränken und dort, wo sie unnötig, ja sogar kontraproduktiv sei, gezielt abbauen, doch in Wirklichkeit geschieht genau das Gegenteil: Sowohl die staat-liche Überwachung als auch die Bürokratie nehmen stetig zu, und Datenschutz- sowie Antibürokratiebeauftragte erweisen sich als fürstlich bezahlte Papiertiger. Als die sogenannte Ampelkoalition im Jahr 2021 ins Amt kam, gelobten ihre Protagonisten, die Eingriffe des Staates in die bürgerlichen Freiheitsrechte stets gut zu begründen und in ihrer Gesamtwirkung zu betrachten.
Nun, gute Gründe finden sich immer, und so kommt eine im Jahr 2022 veröffentlichte Untersuchung mit dem Titel »Überwachungsbarometer für Deutschland« vom Freiburger Max-Planck-Institut zu Ergebnissen, die nicht gerade überraschen. Sie wurde von der Friedrich-Naumann-Stiftung in Auftrag gegeben und stellt fest, dass die staatliche Überwachung »fast exponentiell« gestiegen sei. 12 Auch wenn diese Studie nicht mehr taufrisch ist, lässt sie doch einen klaren Trend erkennen. Die Zahl der behördlichen Abfragen bei IT-Providern (Microsoft, Apple und Google) stieg von 21 704 im Jahr 2013 auf 58 413 im Jahr 2019. Tendenz: weiter steigend. Während im Rahmen der Geldwäschekontrolle 2009 nur 9756 Verdachtsanzeigen von Banken, Finanzdienstleistern, Rechtsanwälten, Steuerberatern und Maklern an die dem Zoll angegliederte Financial Intelligence Unit (FIU) erfolgten, waren es 2019 schon atemberaubende 114 914. Und wer mit wem telefoniert, SMS oder E-Mails austauscht, scheint die Behörden ebenfalls brennend zu interessieren. Im Jahr 2019 wurden fast 27 500 Anordnungen zur Erhebung von Verkehrsdaten erlassen (zum Vergleich: 2008 waren es noch rund 13 900).
Doch wer interessiert sich seitens des Staates so sehr für unsere Daten beziehungsweise – zugespitzt formuliert – wo sitzen die aktivsten und neugierigsten Schnüffler? Auch hierzu findet man in der erwähnten Studie Antworten: Es sind vor allem die Staatsanwaltschaften, das Bundeskriminalamt, die Bundespolizei, die jeweilige Landespolizei, Nachrichtendienste, Steuerbehörden, Zollbehörden, die Netzagentur, die Finanzaufsichtsbehörde BaFin und das Bundeszentralamt für Steuern.





























