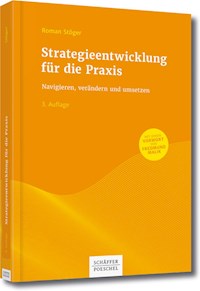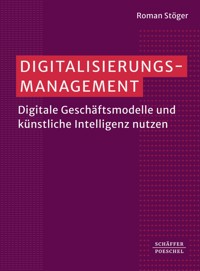
49,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schäffer Poeschel
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Digitalisierung hat einen tiefgreifenden Einfluss auf Branchen, Unternehmen und Geschäftsmodelle. Sie verändert nicht nur die Art und Weise, wie wir Geschäfte machen, sondern auch unsere Vorstellungswelten von Business. Gleichzeitig ist die Digitalisierung eine der wichtigsten Grundlagen für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz. In diesem Fachbuch werden die wirksamsten Konzepte und Instrumente für eine erfolgreiche Digitalisierung vorgestellt. Von einem gemeinsamen Digitalisierungsverständnis über eine solide Digitalisierungsstrategie bis hin zu einer effizienten Digitalisierungsstruktur und einer robusten Digitalisierungskultur – hier finden Sie das, was Sie für eine erfolgreiche Transformation benötigen. Das Buch enthält auch eine Toolbox mit praktischen Werkzeugen und Methoden, um die Digitalisierung in Ihrem Unternehmen wirksam umzusetzen. Darüber hinaus bietet es KI-Anwendungsimpulse, um das volle Potenzial der künstlichen Intelligenz auszuschöpfen. Ein Kennzahlen-Cockpit ermöglicht Ihnen die Überwachung und Steuerung Ihrer digitalen Transformation, während ein Glossar Ihnen bei der Klärung von Fachbegriffen hilft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
InhaltsverzeichnisHinweis zum UrheberrechtImpressumVerzeichnis der Darstellungen und ModelleVerzeichnis der Werkzeuge und BeispieleVerzeichnis der Anwendungen für die künstliche IntelligenzVerzeichnis der AbkürzungenEinleitung: Wirksamkeit als Schlüsselkompetenz im Zeitalter der Digitalisierung1 Digitalisierungsverständnis1.1 Die Digitalisierungsdefinition erarbeiten1.2 Die digitale Transformation verstehen1.3 Die digitale Disruption erkennen1.4 Das Digitalisierungsbenchmarking anwenden1.5 Die Wettbewerbsposition bestimmen1.6 Die digitale Veränderung anstoßen2 Digitalisierungsstrategie2.1 Das digitale Geschäft analysieren2.2 Das Digitalisierungsleitbild erarbeiten2.3 Die digitalen Anwendungsfelder bestimmen2.4 Den digitalen Kundennutzen verbessern2.5 Die digitale Customer Journey gestalten2.6 Die Digitalisierungsstrategie entwickeln3 Digitalisierungsstruktur3.1 Das digitale Geschäftsmodell entwerfen3.2 Das digitale Funktionenprogramm entwickeln3.3 Die Digitalisierungsorganisation definieren3.4 Die digitalen Schnittstellen gestalten3.5 Die Digitalisierungskostentreiber steuern3.6 Die digitale Produktivitätsstrategie erarbeiten4 Digitalisierungskultur4.1 Die digitale Unternehmenskultur gestalten4.2 Die digitale Veränderungsfähigkeit stärken4.3 Die digitale Alte Welt verlassen4.4 Die Digitalisierungsstakeholder erreichen4.5 Das digitale Verbesserungsprogramm einführen4.6 Die digitale Personalentwicklung forcieren5 Digitalisierungswirkung5.1 Die Digitalisierungsscorecards einsetzen5.2 Die digitale Agilität sicherstellen5.3 Die digitalen Schlüsselaufträge definieren5.4 Das Digitalisierungsmonitoring nutzen5.5 Das digitale Umsetzungscontrolling aufschalten5.6 Den Digitalisierungsresultatbericht einsetzenAnhangKennzahlen für das DigitalisierungsmanagementGlossar für das DigitalisierungsmanagementLiteraturZum AutorStichwortverzeichnisBuchnavigation
InhaltsubersichtCoverTextanfangImpressumHinweis zum Urheberrecht
Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.
Bitte respektieren Sie die Rechte der Autorinnen und Autoren, indem sie keine ungenehmigten Kopien in Umlauf bringen.
Dafür vielen Dank!
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Print:
ISBN 978-3-7910-6299-0
Bestell-Nr. 12070-0001
ePub:
ISBN 978-3-7910-6300-3
Bestell-Nr. 12070-0100
ePDF:
ISBN 978-3-7910-6301-0
Bestell-Nr. 12070-0150
Roman Stöger
Digitalisierungsmanagement
1. Auflage, Januar 2025
© 2025 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH
Reinsburgstr. 27, 70178 Stuttgart
www.schaeffer-poeschel.de | [email protected]
Bildnachweis (Cover): Stoffers Grafik-Design, Leipzig
Produktmanagement: Dr. Frank Baumgärtner
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Der Verlag behält sich auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor. Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart Ein Unternehmen der Haufe Group SE
Sofern diese Publikation ein ergänzendes Online-Angebot beinhaltet, stehen die Inhalte für 12 Monate nach Einstellen bzw. Abverkauf des Buches, mindestens aber für zwei Jahre nach Erscheinen des Buches, online zur Verfügung. Ein Anspruch auf Nutzung darüber hinaus besteht nicht.
Sollte dieses Buch bzw. das Online-Angebot Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte und die Verfügbarkeit keine Haftung. Wir machen uns diese Inhalte nicht zu eigen und verweisen lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung.
Verzeichnis der Darstellungen und Modelle
Die Digitalisierung als Motor für Transformation: Modell
23
Das Navigationssystem der Digitalisierung: Modell
26
Steuerungsebenen im Navigationssystem der Digitalisierung: Modell
27
Digitalisierungsdefinition: Modell
32
Orientierungsgrößen für die digitale Transformation: Modell
38
Disruptionstreiber: Modell
42
Digitalisierungsbenchmarking: Modell
46
Digital Five Forces: Modell
51
Digitalisierungscamp: Modell
55
Analyse der Digitalisierung des Marktes: Modell
60
Digitalisierungsleitbild: Modell
65
Digitalisierungsmatrix: Modell
68
Kundennutzen durch Digitalisierung: Modell
72
Digitale Customer Journey: Modell
76
Digitalisierungsstrategie: Modell
81
Digitales Geschäftsmodells: Modell
88
Digitale Schlüsselthemen für Funktionen: Modell
93
Digitales Funktionendiagramm: Modell
99
Digitale Schnittstellengestaltung: Modell
103
Digitalisierungskostentreiber: Modell
108
Digitale Produktivitätsstrategie: Modell
112
Digitale Unternehmenskultur: Modell
119
Erfolgsfaktoren für das Changemanagement in der Digitalisierung: Modell
122
Systematische Müllabfuhr der Alten Welt: Modell
128
Steuerung der Digitalisierungsstakeholder: Modell
131
Digitale Performancetreiber: Modell
135
Digitales Personalentwicklungsprogramm: Modell
139
Digitalisierungsscorecard: Modell
144
Agiles Projektvorgehen: Modell
148
Digitale Schlüsselaufträge und Zielvereinbarungen: Modell
153
Kernthemen für das Digitalisierungsradar: Modell
157
Digitales Umsetzungscontrolling: Modell
161
Digitalisierungsresultatbericht: Modell
164
Verzeichnis der Werkzeuge und Beispiele
Digitalisierungsdefinition: Werkzeug und Beispiel (Anlagenbau)
34
Digitalisierungsstatus: Werkzeug und Beispiel (Anlagenbau)
35
Transformationsszenario: Werkzeug und Beispiel (Großhandel)
40
Disruptionsradar: Werkzeug und Beispiel (Versicherung)
44
Digitalisierungsbenchmarking: Werkzeug und Beispiel (Pharma)
48
Digitales Wettbewerbscockpit: Werkzeug und Beispiel (Hotel)
53
Digitalbaustein: Werkzeug und Beispiel (Handel)
56
Digitalisierungsmarktcockpit: Werkzeug und Beispiel (Bauunternehmen)
62
Digitalisierungsleitbild: Werkzeug und Beispiel (Chemie)
66
Digitalisierungsfelder: Werkzeug und Beispiel (Versicherung)
69
Kundennutzen-Cockpit: Werkzeug und Beispiel (Logistik)
74
Customer Journey: Werkzeug und Beispiel (Krankenhaus)
78
Digitalisierungsstrategie: Werkzeug und Beispiel (Rohstoffhandel)
83
Digitalisierung des Geschäftsmodells: Werkzeug und Beispiel (Maschinenbau)
90
Digitales Funktionenprogramm: Werkzeug und Beispiel (Personal)
97
Digitales Funktionendiagramm: Werkzeug und Beispiel (Entwicklung)
101
Schnittstellenvereinbarung: Werkzeug und Beispiel (Versicherung)
104
Digitales Kostentreibermanagement: Werkzeug und Beispiel (Maschinenbau)
110
Digitale Produktivitätsstrategie: Werkzeug und Beispiel (Ministerium)
114
Diagnose und Entwicklung der Kultur: Werkzeug und Beispiel (Bank)
120
Change-Cockpit für die Digitalisierung: Werkzeug und Beispiel (Versicherung)
125
Systematische Müllabfuhr der Alten Welt: Werkzeug und Beispiel (Chemie)
129
Digitales Stakeholder-Cockpit: Werkzeug und Beispiel (Handel)
132
Digitale Stakeholder-Kommunikationsmatrix: Werkzeug und Beispiel (Handel)
133
Digitales Verbesserungsprogramm: Werkzeug und Beispiel (Logistik)
136
Digitaler Verbesserungsvorschlag: Werkzeug und Beispiel (Logistik)
137
Digitales Personalentwicklungsprogramm: Werkzeug und Beispiel (Pharma)
141
Persönliche Digitalisierungsagenda: Werkzeug und Beispiel (Vertriebsleiter)
141
Digitalisierungsscorecard: Werkzeug und Beispiel (Elektroindustrie)
146
Agiler Projektauftrag: Werkzeug und Beispiel (Onlineshop)
150
Digitalisierungsschlüsselauftrag: Werkzeug und Beispiel (Industrie 4.0)
155
Digitalisierungszielvereinbarung: Werkzeug und Beispiel (IT-Mitarbeiter)
156
Digitalisierungsradar: Werkzeug und Beispiel (Maschinenbau)
159
Digitalisierungsumsetzungscontrolling: Werkzeug und Beispiel (Versicherung)
163
Digitalisierungsresultatbericht: Werkzeug und Beispiel (Bank)
166
Verzeichnis der Anwendungen für die künstliche Intelligenz
Definition für KI
34
Transformationsszenario für KI
40
Disruptionsradar für KI
44
Benchmarking für KI
48
Wettbewerbscockpit für KI
52
Bausteine für KI
56
Marktcockpit für KI
61
Leitbild für KI
66
Anwendungsfelder für KI
69
Kundennutzen für KI
73
Customer Journey für KI
78
Strategie für KI
82
Geschäftsmodell für KI
89
Funktionenprogramm für KI
96
Funktionendiagramm für KI
101
Schnittstellenvereinbarung für KI
104
Kostentreibermanagement für KI
110
Produktivitätsstrategie für KI
113
Kulturentwicklung für KI
120
Change-Cockpit für KI
124
Systematische Müllabfuhr für KI
129
Stakeholder-Cockpit für KI
132
Verbesserungsprogramm für KI
136
Personalentwicklung für KI
140
Scorecards für KI
145
Agile Projektmethodik für KI
150
Schlüsselauftrag für KI
154
Radar für KI
159
Umsetzungscontrolling für KI
162
Resultatbericht für KI
166
Verzeichnis der Abkürzungen
AGI
Artificial General Intelligence
AI
Artificial Intelligence
AKV
Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortlichkeiten
ANN
Artificial Neural Networks
API
Application Programming Interface
AR
Aufsichtsrat
AR
Augmented Reality
ASI
Artificial Social Intelligence
AVOR
Arbeitsvorbereitung
B2B
Business to Business
B2C
Business to Customer
BANI
Brittle, Anxious, Non-linear, Incomprehensible
BANI
Brüchig, ängstlich, nicht-linear, unbegreiflich
BART
Balloon Analogue Risk Task
BD
Big Data
BDM
Big Data Management
BI
Business Intelligence
BIM
Building Information Modeling
BIOS
Basic Input Output System
BPO
Business Process Outsourcing
BPR
Business Process Reengineering
BR
Beirat
BR
Betriebsrat
BS
Betriebssystem
BSC
Balanced Scorecard
C2B
Customer to Business
C2C
Customer to Customer
CAD
Computer-Aided Design
CAGR
Compound Annual Growth Rate
CAx
CA-Techniken bzw. CA-Methoden
CB
Cognition Battery
CBM
Cloud Business Model
CBT
Computer Based Training
CBV
Capability Based View
CC
Cloud Computing
CDO
Chief Digital Officer
CF
Cashflow
CG
Corporate Governance
CI
Collective Intelligence
CIM
Computer-Integrated Manufacturing
CIP
Continuous Improvement Process
CISO
Chief Information Security Officer
CM
Cloud Model
CMDI
Content and Meta Data Identifier
CMP
Connectivity Management Platform
CNN
Convolutional Neural Network
CO
Cloud Organization
CPM
Critical Path Method
CPT
Continuous Performance Test
CPS
Cyber Physical Systems
CPU
Central Processing Unit
CR
Customer Response
CRM
Customer Relationship Management
CSR
Corporate Social Responsibility
DA
Data Analytics
DAO
Decentralized Autonomous Organisation
DB
Deckungsbeitrag
DBM
Digital Business Model
DD
Digital Dashboard
DDoS
Distributed Denial of Service
DET
Detection Error Trade-Off
DFMA
Design for Manufacture and Assembly
DFÜ
Datenfernübertragung
DIN
Deutsche Industrienorm
DL
Data Lake
DL
Deep Learning
DLZ
Durchlaufzeit
DM
Data Mining
DMS
Dokumentenmanagementsystem
DoD
Definition of Done
DSC
Digitalisierungsscorecard
DSGVO
Datenschutz-Grundverordnung
DSL
Digital Subscriber Line
DSM
Data Security Management
DTC
Digital Transformation Cockpit
DVC
Digital Value Chain
DVP
Digitales Verbesserungsprogramm
DVV
Digitaler Verbesserungsvorschlag
DWS
Data Warehouse System
EBIT
Earnings Before Interest and Taxes
EBT
Earnings Before Taxes
ECR
Efficient Customer (Consumer) Response
EDI
Electronic Data Interchange
EDM
Engineering Data Management
EER
Equal Error Rate
EMS
Enhanced Message Service
EPC
Elektronischer Produktcode
ERP
Enterprise Resource Planning
EVA
Economic Value Added
EVE
Ergebnisverantwortliche Einheit
F&E
Forschung und Entwicklung
FdZ/FmZ
Führen durch Ziele bzw. Führen mit Zielen
FIBU
Finanzbuchhaltung
FL
Fuzzy Logic
FMEA
Failure Mode and Effects Analysis
FMEA
Fehlermöglichkeiten- und -einfluss-Analyse
FPY
First Pass Yield
FTP
File Transfer Protocol
GDPR
General Data Protection Regulation
GF
Geschäftsführung
GH
Großhandel
GL
Geschäftsleitung
GNSS
Global Navigation Satellite Systems
GPS
Global Positioning System
GPT
Generative Pretrained Transformer
GPU
Graphics Processing Unit
GuV
Gewinn-und-Verlust-Rechnung
GWA
Gemeinkostenwertanalyse
HDMI
High Definition Multimedia Interface
HK
Herstellkosten
HMI
Human Machine Interface
HR
Human Resources
HRM
Human Resource Management
HTML
Hyper Text Markup Protocol
HTTP
Hyper Text Transfer Protocol
I 4.0
Industrie 4.0
ICAR
International Cognitive Ability Resource
IDD
Internet der Dinge
IDS
Intrusion Detection System
IKT
Informations- und Kommunikationstechnologie
IMS
Information Management System
IOT
Internet of Things
IP
Intellectual Property
IPC
International Patent Classification
ISCC
International Standard Content Code
ISDN
Integrated Services Digital Network
ISMS
Information Security Management System
ISO
Industrial Standard Organization
JIT
Just in Time
KBV
Knowledge-based View
KDD
Knowledge Discovery in Databases
KER
Kurzfristige Erfolgsrechnung
KI
Künstliche Intelligenz
KMU
Klein- bzw. mittelständisches Unternehmen
KNN
Künstlich neuronales Netz
KVP
Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
LA
Lenkungsausschuss
LAN
Local Area Network
LEH
Lebensmitteleinzelhandel
LLM
Large Language Model
M&A
Mergers and Acquisitions
M2H
Machine to Humans
M2 M
Machine to Machine
MAE
Mean Absolute Error
MBO
Management by Objectives
MBV
Market Based View
MER
Management-Erfolgsrechnung
MES
Manufacturing Execution System
MIS
Management-Informationssystem
ML
Machine Learning
MMI
Man Machine Interface
MOOC
Massive Open Online Course
MSP
Membership Service
MT
Mobile Technology
NGO
Non Governmental Organization
NFT
Non Fungible Token
NLP
Natural Language Processing
NPO
Non Profit Organisation
NT
Nanotechnologie
NSA
National Security Agency
OCR
Optical Character Recognition
OEM
Only Equipment Manufacturer
OT
Operational Technology
PAI
Predictive Artificial Intelligence
PDA
Personal Digital Assistent
PDDL
Planning Domain Definition Language
PDM
Product Data Management
PE
Personalentwicklung
PEAK
Planen, entscheiden, ausführen, kontrollieren
PERT
Program Evaluation and Review Technique
PIM
Product Information Management
PIN
Persönliche Identifikationsnummer
PIMS
Profit Impact of Market Strategies
PM
Projektmanagement
PM
Prozessorenmodell
PMI
Post Merger Integration
PMO
Project Management Organizsation
PnP
Plug and Play
POC
Proof of Concept
POS
Point of Sale
PPE
Produkt- und Prozessentwicklung
PPS
Produktionsplanung und -steuerung
PR
Public Relations
QFD
Quality Function Deployment
QM
Qualitätsmanagement
QZK
Qualität, Zeit, Kosten
R&D
Research and Development
RBV
Resource Based View
RFID
Radio Frequency Identification
RL
Reinforcement Learning
RNN
Recurrent Neural Network
ROCE
Return on Capital Employed
ROE
Return on Equity
ROI
Return on Investment
ROS
Return on Sales
RP
Rapid Prototyping
RPA
Robotic Process Automation
RSS
Rich Site Summary
RT
Real Time
RTD
Real Time Data
RTF
Real Time Forecasting
RW
Rechnungswesen
SAP
Systeme, Anwendungen, Produkte
SBU
Strategic Business Unit
SDK
Software Development Kit
SCM
Supply Chain Management
SE
Simultaneous Engineering
SGE
Strategische Geschäftseinheit
SGF
Strategisches Geschäftsfeld
SIM
Subscriber Identity Module
SIV
Soll-Ist-Vergleich
SJT
Situational Judgement Tests
SLA
Service Level Agreement
SM
Sensorikmodell
SM
Social Media
SMA
Systematische Müllabfuhr
SMART
Spezifisch, messbar, ableitbar, realistisch, terminiert
SMS
Short Message Service
SPS
Speicherprogrammierbare Steuerung
SQL
Structured Query Language
STN
Scientific and Technical Information Network
SWOT
Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats
TAN
Transaktionsnummer
TC
Target Costing
TCI
Test of Collective Intelligence
TDC
Technical Data Management
TEA
Test of Everyday Attention
TIM
Technical Information Management
TOM
Technisch-organisatorische Maßnahme
TOWS
Threats, Opportunities, Weaknesses, Strengths
TQC
Total Quality Control
TQM
Total Quality Management
TRL
Technology Readiness Levels
TSN
Time Sensitive Networking
TTP
Third Trusted Party
UC
Unified Communication
UI
User Interface
UMTS
Universal Mobile Telecommunication System
URL
Uniform Resource Locator
USB
Universal Serial Bus
USP
Unique Selling Proposition
VBM
Value Based Management
VPN
Virtual Private Network
VR
Verwaltungsrat
VR
Virtual Reality
VRML
Virtual Reality Modelling Language
VSM
Viable System Model
VUCA
Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity
VUKA
Volatilität, Unsicherheit, Komplexität, Ambiguität
VVV
Volume, Velocity, Variety
WAN
Wide Area Network
WEP
Wired Equivalent Privacy
WIL
Word Information Loss
WLAN
Wireless Local Area Network
ZV
Zielvereinbarung
Einleitung: Wirksamkeit als Schlüsselkompetenz im Zeitalter der Digitalisierung
Eine der bedeutendsten Entwicklungen des 21. Jahrhunderts ist die Digitalisierung. Wie kaum ein anderes Thema beherrscht sie Wirtschaft und Gesellschaft. Es gibt Weniges, was so komplex, vielschichtig und anspruchsvoll ist. Mittlerweile sind tausende Bücher, Artikel und Fachbeiträge erschienen, die das Thema aus unterschiedlichen Richtungen beleuchten und darstellen, wo Chancen und Vorteile, Gefahren und Risiken liegen. Was in Forschung und Veröffentlichungen nach wie vor zu kurz kommt, ist die Frage nach der Wirksamkeit der Digitalisierung. In diesem Buch wird aufgezeigt, wie aus den Potenzialen und Versprechungen der Digitalisierung echte Resultate werden. Es geht um bewährte Vorgehensweisen und Werkzeuge, wie sich ein Unternehmen digital entwickeln kann, das heißt: um den Schritt vom Wunsch zur Wirksamkeit.Wirksamkeit
Im Zentrum stehen nicht Technik, IT oder Datascience, sondern das gezielte Nutzen der PotenzialeNutzen der Potenziale, die durch Digitalisierung entstehen: 1) die Vernetzung von Menschen, Maschinen und Daten; 2) die Individualisierung von Produkten, Dienstleistungen und Informationen; 3) die deutliche Zunahme an Geschwindigkeit; 4) die Dezentralisierung bzw. Selbstorganisation und 5) die tendenzielle Auflösung von Branchen- und Unternehmensgrenzen. Das ist der Treibsatz der Digitalisierung und bewirkt die Steigerung von Innovationsleistung und Produktivität. Die Folge davon ist nicht selten die Veränderung von Geschäftsmodellen, Branchen und traditionellen Vorstellungswelten. Paradigmatisch dafür steht das Beispiel Uber: Dieses Unternehmen hat weder das Internet noch das Taxi erfunden. Es hat aber eine klassische Branche herausgefordert, indem es eine globale Lösung für ein seit jeher atomisiertes Geschäft auf den Markt gebracht hat. Der Ansatz ist denkbar einfach und nur über digitale Kommunikation möglich: Der Kunde bezahlt nicht für ein Taxiunternehmen, sondern für eine Taxifahrt.
Bei aller historischen Bedeutung und Transformation muss festgehalten werden, dass die Digitalisierung nichts an den Gesetzen des Wirtschaftens verändert. Im Zentrum steht nach wie vor die Frage: Ist der Kunde bereit, für eine digitale Lösung eine Rechnung zu bezahlen? Die Digitalisierung verändert aber alles hinsichtlich Veränderungsfähigkeit, Kompetenzaufbau und methodischer Fähigkeiten. Der Engpass sind nicht die Vorschläge, Potenziale, Chancen oder Ideen. Entscheidend ist die Umsetzungsstärke unserer Unternehmen. Und dies bedingt nicht eine Cloud oder das Silicon Valley, sondern kompetentes Management. Die Digitalisierung sollte daher als Anlass gesehen werden, das Unternehmen wieder einmal grundsätzlich auf den Prüfstand zu stellen. Die zentrale Frage für das Management lautet: Wie können wir die Potenziale der Digitalisierung in Nutzen und Resultate umwandeln?
Zur realistischen Sicht des Themas gehört auch eine kritische Reflexion der Digitalisierungkritische Reflexion der Digitalisierung.Es existieren drei Gefahrenfelder, die nachfolgend dargestellt werden. Eine erste Kritik lautet, dass durch Digitalisierung Arbeitsplätze verloren gehen und die Produktivitätsvorteile die Beschäftigungsquote reduzieren werden. Zudem werden Überwachung und eine qualitative Verschlechterung von Arbeitsverhältnissen befürchtet. Auswirkungen in der Arbeitswelt und innerhalb bestehender Beschäftigungsverhältnisse sind natürlich laufend zu prüfen; gleichwohl kann mit einer historischen Analogie gearbeitet werden. Bereits in der ersten industriellen Revolution im 18. Jahrhundert hat es die gut begründete Sorge gegeben, dass Arbeitsplätze in der Landwirtschaft und im Handwerk verloren gehen, was wiederum zu Massenarbeitslosigkeit und Verelendung führt. Das genaue Gegenteil ist eingetreten, und dasselbe Muster war auch bei allen anderen industriellen Revolutionen feststellbar – nicht zuletzt seit der Computerisierung in den 1970er-Jahren.
Gezielte ManipulationManipulation zur Beeinflussung von Menschen und Organisationen ist die zweite Gefahr. Die teilweise gesteuerte Wahl von Donald Trump und das fragwürdige Geschäftsmodell von Facebook sind stellvertretende Beispiele. Gerade hier haben mittlerweile Protagonisten der Digitalisierung selbst erkannt, dass diese Entwicklung aus dem Ruder laufen kann. So meint etwa Tim Cook, CEO von Apple: »Ich habe Nichten und Neffen, und ich erlaube ihnen nicht, dass sie einem sozialen Netzwerk beitreten.« Der Manager für Mitgliederwachstum bei Facebook, Chamath Palihapitiya, spricht die Gefahren für die Gesellschaft offen an: »Was wir schufen, zerstört den Zusammenhalt jeder Gesellschaft: An die Stelle von Bürgerdiskurs und Kooperation setzen wir Desinformation und Unwahrheit. Es geht nicht um ein paar Russen-Hacks, das ist ein globales Problem.« Und Jaron Lanier, Chefstratege bei Microsoft, fasst das Thema ernüchtert wie folgt zusammen: »One has this feeling of having contributed to something that’s gone very wrong.« Diese Beispiele aus der Süddeutschen Zeitung vom 14.05.2018 zeigen deutlich die Gefahren durch die neuen Technologien und Methoden auf. Demokratie, Menschenrechte und Freiheit müssen gegen Populisten und Diktatoren geschützt werden. Die Politik hat Antworten zu finden und sich gegenüber postfaschistischen und postkapitalistischen Strömungen zu wehren.
Negative Auswirkung digitaler Geräte, Medien und Kommunikationsweisen auf Menschen ist das dritte Kritikfeld. Überspitzt wird gerne von digitaler Degenerationdigitale Degeneration oder digitaler Demenz oder gar digitaler Debilität gesprochen. Vor allem für jüngere Menschen werden Beeinträchtigungen von Konzentration, Wahrnehmungsfähigkeit, körperlicher Fitness und Sozialverhalten befürchtet. Gespräche und Erfahrungsaustausch mit Eltern, Lehrern und generell mit allen, die mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen zu tun haben, vermitteln dieses Bild und führen rasch zu einer Bestätigung dieses Vorurteils. Auch an dieser Stelle gilt: Einerseits sind diese Phänomene oder Hypothesen wissenschaftlich zu untersuchen und im Fall echter Beeinträchtigung ist ihnen entgegenzuwirken. Andererseits hat es aber immer schon grundsätzliche Bedenken gegenüber neuen Medien und neuen Technologien gegeben. Bei der Erfindung des Automobils wurde davon gesprochen, dass der menschliche Körper für Geschwindigkeiten über 50 km/h nicht geschaffen sei. Nach Einführung des Radios bzw. Fernsehens kamen Zweifel auf, ob diese neuen Audio- bzw. optischen Wellen nicht gesundheitsschädlich seien.
Eine kritische Reflexion ist notwendig, weil die Digitalisierung nicht nur ökonomisch, sondern auch gesellschaftlich und politisch wirkt. Dies geschieht in Wissenschaft und Praxis, durch Nichtregierungsorganisationen, Unternehmungen und Regierungen. Eine verantwortliche Unternehmensführung sollte diese Dimension vor Augen haben und sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst sein.
Es mag paradox klingen: Was sich durch die Digitalisierung verändert hat, ist die Veränderung selbst, der Change. Erstens hat sich das Tempo beschleunigt. Früher hatte das Management im Normalfall viel mehr Zeit, sich auf eine Transformation einzustellen und neue Lösungen zu entwickeln. Heute muss vor allem die Umsetzung schneller funktionieren, weil alles transparenter geworden ist. Wenn ein Wettbewerbsvorsprung früher noch in Jahren gemessen wurde, sind es heute oft nur Monate oder Wochen. Zweitens konnte in der Vergangenheit ein kleiner Kreis von Personen die Veränderung bewirken. Jetzt müssen im Normalfall sehr viele Wissensträger, Entscheider und vor allem Umsetzer integriert werden, damit Lösungen entstehen. Und drittens bedeutet Digitalisierung, dass nicht isoliert Produkte, Prozesse oder Organisationseinheiten verändert werden, sondern das gesamte Geschäftsmodell. Genau das hat der damalige CEO von General Electric, Jeffrey Immelt, gemeint, als er die digitale Herausforderung darstellte: »Jedes Industrieunternehmen muss sich zu einem Softwareunternehmen entwickeln.« – das heißt weg von der »metal box« und hin zu Vernetzung, Intelligenz und Nutzen.
Durch Digitalisierung entsteht Transformation,Transformation das heißt ein Übergang von der heutigen sogenannten Alten Welt in eine digitale, sogenannte Neue Welt. Dieser Schritt ist für die meisten Menschen und Unternehmen deshalb so anspruchsvoll, weil wir unsere Gewohnheiten haben, aus einer meist erfolgreichen Vergangenheit kommen und die Alte Welt immer noch funktioniert. Verantwortung in der Führung bedeutet aber, die Grundlagen dieses Erfolgs permanent zu hinterfragen. Es geht darum, das Geschäft von der Zukunft aus zu verstehen und nicht eine erfolgreiche Vergangenheit unreflektiert fortzuschreiben.
Die Digitalisierung als Motor für Transformation: Modell
Die »Alte Welt«
Die »Neue Welt«
1. Veränderungen sind überschaubar, verlaufen relativ langsam und sind oft auf einzelne Themen beschränkt.
→
1. Veränderungen vollziehen sich deutlich schneller, umfassender und betreffen das gesamte Geschäftsmodell.
2. Grenzen des Unternehmens sind über Eigentum, Verträge, Waren, Dienstleistungen und Geldflüsse definiert.
→
2. Grenzen des Unternehmens verschwimmen und sind vieldimensional, zum Beispiel durch Einbindung des Kunden, Partnernetzwerke, Plattformen.
3. Entwicklung und Produktion enden mit der Markteinführung. Danach beginnt die Vorphase der nächsten Generation.
→
3. Entwicklung und Produktion beziehen sich auf den gesamten Lebenszyklus. Es gibt keine »nächste Generation«, sondern permanente Weiterentwicklung.
4. Verkauf ist der Schlusspunkt von Entwicklung und Vermarktung.
→
4. Verkauf ist der Beginn einer Kunden-, Echtzeit- und Response-Beziehung.
5. Marketing und Vertrieb sind auf den Verkauf ausgerichtet.
→
5. Marketing und Vertrieb maximieren Nutzen über den gesamten Lebenszyklus.
6. Eine Kundenbeziehung wird über einen Kauf definiert, indem das Eigentum vom Hersteller auf den Kunden übergeht.
→
6. Eine Kundenbeziehung wird über eine Nutzung definiert, die mit Eigentumsfragen nicht identisch ist.
7. Daten entstehen entlang der Wertschöpfungskette oder aus externen Quellen.
→
7. Daten entstehen in Echtzeit durch das Produkt bzw. die Anwendung und müssen in Nutzen übersetzt werden.
8. Datenqualität und -sicherheit liegen in der Verantwortung der IT.
→
8. Datenqualität und -sicherheit sind Handlungsfelder aller Funktionen.
9. Die Organisation besteht in hierarchisch getrennten Funktionen wie zum Beispiel F&E, Einkauf, Produktion, Vertrieb.
→
9. Die Organisation besteht in prozessorientierten Funktionalitäten, in denen es um Tempo, Vernetzung und Umsetzung geht.
10. Führung bedeutet direkte Führung von Mitarbeitern, top-down und von der Hierarchie bestimmt.
→
10. Führung ist vielschichtig und bedeutet die Führung von Kollegen, Chefs, Kunden, Wertschöpfungspartnern.
Als Voraussetzung der digitalen Transformation digitale Transformationmuss das Management zunächst ein gemeinsames Verständnis der erfolgsentscheidenden Themen entwickeln. Die Basis hierzu ist die Bereitschaft, das eigene Geschäft offen und selbstkritisch zu hinterfragen: In welchem Geschäft sind wir wirklich? Wo liegt der eigentliche Kundennutzen? Warum waren wir bisher erfolgreich? Wo sind die Grundlagen des Erfolgs von morgen? Erkennen wir rechtzeitig die neuen Entwicklungen? Sind wir vielleicht sogar dem Wandel voraus? Treffen wir rechtzeitig die notwendigen Entscheidungen? Sind wir schnell genug in der Umsetzung? In der digitalen Welt gilt eine einfache Gleichung: »Die Dynamik des Unternehmens muss mindestens so groß sein wie die Dynamik des Marktes.« Diese ursprünglich aus der Kybernetik abgeleitete Erkenntnis beschreibt die notwendige Veränderungsfähigkeit von Organisationen. Wenn diese Dynamik schwächer wird, fällt das Unternehmen zurück, wird vom Wettbewerb überholt und bleibt in der Alten Welt stecken.
Der wichtigste Orientierungspunkt für die digitale Welt ist und bleibt der Kundennutzen.Kundennutzen Das ist am Ende des Tages der Schlüssel zum Verständnis von Marktdynamik und Transformation. Kundennutzen ist die Quelle von Wettbewerbsvorteilen, Marktanteilen und Innovation. Jedes Unternehmen braucht dazu geeignete Radare und Sensoren in die Märkte, um Wandel und Veränderung wahrzunehmen. Hohe Gewinne, eine erfolgreiche Vergangenheit, starre Strukturen und ein hierarchisches Führungsverständnis können gefährlich sein, weil sie diese Signale des Marktes und der Zukunft nicht aufnehmen. Führungskräfte werden vor allem dafür bezahlt, das Geschäft von der Zukunft aus zu denken und Lösungen für langfristig gesunde Geschäfte zu entwickeln.
Die Digitalisierung muss immer unternehmerisch gestartet und diskutiert werden – beispielsweise die Themen Marktfokus, Produktivität, Wettbewerbsstärke, Profitabilität usw. Ein schwerer Fehler besteht darin, IT, Systeme und Data ins Zentrum zu stellen und erst nachher über mögliche Geschäfte nachzudenken. Das belegt die mittlerweile bedauerlich hohe Quote der nicht erfolgreichen Start-ups. Die Herausforderung für das Management besteht nicht in Data-Warehousing, Response Systems oder Cloud Solutions. Die Kunst der Führung ist es, all das zu verbinden und echte Resultate zu erzielen. Nicht »Big Data« steht daher im Zentrum, sondern »Big Results«.Big Results Auch wenn gerne davon gesprochen wird, dass Daten das Gold des 21. Jahrhunderts sind, so zeigt die digitale Praxis auf, dass das nicht stimmt. Daten an sich bewirken gar nichts, schaffen keine Werte, verursachen nur Kosten und erhöhen die Komplexität. Zu Gold werden Daten nur, wenn sie in Lösungen für Kunden und Unternehmen umgewandelt werden.
Die Digitalisierung führt zu einer Veränderung von Führung und Organisation. Die meisten Menschen sind nach wie vor vom Organisationsverständnis des 19. Jahrhunderts geprägt: dominante Hierarchien, separierte Funktionen, ausgeprägte Innenorientierung, starre Planungszyklen und vieles mehr. All das hat in der alten Industriegesellschaft seine Berechtigung gehabt und viele Volkswirtschaften nach vorne gebracht. Die Digitalisierung fordert gerade dieses Unternehmens-, Management- und Arbeitsverständnis heraus. Die digitale Welt hält sich nicht an unsere organisatorischen Silos, an starre Stellenbeschreibungen und an Führungskräfte mit »bossy habits«. Zu Recht wird davon gesprochen, dass die industrielle Entwicklung in ein viertes Stadium eingetreten ist – Industrie 4.0. Ob Führung und Organisation auch entsprechend fortgeschritten sind, muss kritisch hinterfragt werden. Eher gilt der Spruch: Industrie 4.0 trifft auf Führung 1.0. Praxis und Wissenschaft haben noch nach Lösungen zu suchen, um im 21. Jahrhundert anzukommen. Corona hat hier einiges in Bewegung gebracht, der Prozess ist aber noch lange nicht abgeschlossen.
Die Vielfältigkeit der Digitalisierung kann in Form eines Navigationssystems dargestellt werden. Dieses befähigt das Management zu einer klaren Einordnung der Themen und hilft bei der Entscheidung über Schwerpunkte. Das Navigationssystem der Digitalisierung Navigationssystem der Digitalisierungbesteht aus einer Zeitdimension (X-Achse) und einer Komplexitätsdimension (Y-Achse). Die Zeitachse gibt den typischen chronologischen Verlauf der jeweiligen Themen an. Gemeint ist die Dauer der Diskussion, der Entscheidungsfindung und vor allem der Umsetzung. Die Komplexitätsachse definiert, wie stark die Komplexität der einzelnen Steuerungsebenen ausgeprägt ist. Dies betrifft vor allem die Größen Veränderungsgrad, Veränderungsgeschwindigkeit, thematischer Umfang und Grad der Beeinflussbarkeit. In den meisten Fällen gilt, dass weniger komplexe Themen auch eine geringere zeitliche Ausdehnung haben.
Das Navigationssystem der Digitalisierung – Modell
Entlang der beiden Achsen des Navigationssystems können vier Steuerungsebenen der Digitalisierung Steuerungsebenen der Digitalisierungidentifiziert werden. Die Ebenen haben einen unterschiedlichen Intensitätsgrad hinsichtlich der Digitalisierung und vor allem unterschiedliche Auswirkungen auf Strategie, Struktur, Kultur, Führung, Changemanagement und Umsetzung.
Die erste Ebene ist die analoge Fortsetzung des heutigen Geschäftsmodells. Dies bedeutet, dass das jeweils aktuelle Geschäftsmodell ohne digitale Weiterentwicklung bestehen bleibt. Auch das ist eine klare Managemententscheidung zur Digitalisierung. Im Fokus steht die Marktdurchdringung mit bestehenden Produkten bzw. Dienstleistungen. Zusätzlich kann eine Professionalitäts- bzw. Produktivitätssteigerung ohne digitale Methoden erfolgen. Wenn ein Versicherungsunternehmen eine Vertriebsoffensive in neue Länder startet, hat diese Maßnahme zwar strategische Bedeutung, kann aber zur Gänze ohne digitale Weiterentwicklung getroffen werden. Vor dem Hintergrund des Digitalisierungshypes muss betont werden, dass diese erste Ebene im digitalen Navigationssystem in vielen Fällen eine unkomplizierte, pragmatische und erfolgswahrscheinliche Variante darstellt.
Die digitale Optimierung innerhalb des aktuellen Geschäftsmodells ist die zweite Ebene. Im Kern ist dies eine kontinuierliche Verbesserung des heutigen Businessansatzes, ohne dass eine grundlegende, digitale Veränderung stattfindet. Bestehende Produkte, Dienstleistungen bzw. Prozesse werden mit digitalen Methoden verbessert, aber nicht in einen komplett anderen Kontext gestellt. Daher ist diese Ebene eine inkrementelle Nutzung der Digitalisierung. Das Ausrüsten von Personenkraftwagen mit digitalen Features wie etwa Abstandsmelder oder Melder von Verbrauchs- und Wartungsdaten ist ein Beispiel für diese Ebene. Es bedeutet einen verbesserten Kundennutzen, verändert aber weder die Kundengewohnheiten noch das Fahrzeug, den Hersteller oder die Branche.
Die digitale Weiterentwicklung des heutigen Geschäftsmodells. digitale Weiterentwicklung des heutigen Geschäftsmodellsstellt den dritten Navigationslevel dar. Waren die ersten beiden Ebenen noch isoliert auf einzelne Themen bzw. Marktleistungen bezogen, so geht es hier um die Ausweitung des Geschäftsmodells an sich. Dies erfolgt noch ohne eine Veränderung der Wettbewerbslogik. Produkte bzw. Dienstleistungen werden digitalisiert und ergeben neue Formen von Wertschöpfung und Prozessen. Wenn ein Maschinenbauunternehmen seine Produkte mit Sensorik und künstlicher Intelligenz ausstattet, dann wird dies zu keiner Substitution des Marktes führen, aber neue Geschäftsmöglichkeiten erschließen, wie beispielsweise Wartungsverträge und Preismodelle über den kompletten Lebenszyklus.
Viertens geht es um die Disruption durch ein neues, digitales Geschäftsmodell.Disruption durch ein neues, digitales Geschäftsmodell Dies ist die radikalste Form der Digitalisierung, weil ein existierendes Geschäftsmodell durch ein neues, digitales ersetzt wird. Markt und Wettbewerb werden somit neu sortiert. Diese Disruption wird aufgrund einer echten Innovation durch digitale Produkte, Dienstleistungen bzw. Wertschöpfungsansätze ausgelöst. Falls es sich nicht um ein Start-up handelt, wird diese Disruption wahrscheinlich auch zu einer Neuaufstellung bzw. zu einer Neuerfindung des Unternehmens führen. Die prominenten Beispiele von Amazon, Uber, Apple und Airbnb stehen stellvertretend für diese vierte Ebene der Digitalisierung und zeigen zugleich auch, dass dies die seltenste und riskanteste Option darstellt.
Steuerungsebenen im Navigationssystem der Digitalisierung: Modell
1.
Analoge Fortsetzung des bestehenden Geschäftsmodells
1. Beibehaltung des Geschäftsmodells ohne digitale Weiterentwicklung
Marktdurchdringung mit den vorhandenen Produkten bzw. Dienstleistungen
Professionalitäts- und Produktivitätssteigerung des Unternehmens ohne digitale Methoden
2.
Digitale Optimierung innerhalb des aktuellen Geschäftsmodells
1. kontinuierliche Verbesserung des bestehenden Geschäftsmodells ohne grundlegende, digitale Veränderung
Optimierung vorhandener Produkte, Dienstleistungen und Prozesse mit digitalen Methoden
inkrementelle Nutzung der Digitalisierung
3.
Digitale Weiterentwicklung des heutigen Geschäftsmodells
1. digitale Ausweitung des Geschäftsmodells ohne Veränderung der Wettbewerbslogik
Digitalisierung vonProduktenbzw.Dienstleistungen im Rahmen des bestehenden Geschäftsmodells
digitale Weiterentwicklung der Wertschöpfung bzw. der Prozesse
4.
Disruption durch ein neues, digitales Geschäftsmodell
1. Substitution eines bestehenden Geschäftsmodells durch eine digitale NeusortierungdesMarktes
echte Innovation durch digitale Produkte, Dienstleistungen bzw. Wertschöpfungsansätze
Neuaufstellung bzw. Neuerfindung des Unternehmens
Professionelles unternehmerisches Steuern setzt ein digitales Navigationssystem voraus. Mit dem Ansteigen der Ebenen von eins bis vier steigen Komplexität, Dauer, Anforderungen und Veränderungsgrad. Die Ansprüche an das Management sind entsprechend unterschiedlich. Während auf der ersten Ebene noch mit der Einstellung und den Methoden der Alten Welt geführt werden kann, verändert sich in Richtung der vierten Ebene nicht nur das Geschäft, sondern auch die Art der Führung. Das bedeutet nicht, dass auf der vierten Ebene besser geführt werden muss, sondern einfach anders. Das digitale Navigationssystem kann eingesetzt werden, um die grundlegenden Fragen zur digitalen Aufstellung des Unternehmens aufzuwerfen und einen realistischen Blick auf den Markt und nach innen zu werfen. Digitalisierung bedeutet nicht zwangsläufig, dass die vierte Ebene im Fokus steht. Vielmehr geht es darum, dass ein pragmatischer Digitalisierungsansatz pragmatischer Digitalisierungsansatzgewählt wird, der zum Geschäft und zum Unternehmen passt.
Die Digitalisierung ist weder neu noch revolutionär. Vieles von dem, was wir heute mit »digital« bezeichnen, ist bereits vor Jahrzehnten beschrieben worden. Die Pioniere der Computerwissenschaften und vor allem der KybernetikKybernetik haben bereits Mitte des 20. Jahrhunderts die Bedeutung von Vernetzung, Daten, Informationen, Real Time und Cyberspace erkannt: Norbert Wiener etwa in seinem bahnbrechenden Buch Control and Communication in the Animal and the Machine (1948) oder Ross Ashby in An Introduction to Cybernetics (1956). Stellvertretend für viele stehen Namen wie John von Neumann (Computertechnologie), Gregory Bateson (Kommunikationstheorie) und Claude Shannon (Informationstheorie). Bereits in den 1950er-Jahren hat Stafford Beer die Prinzipien der Kybernetik auf Wirtschaft und Unternehmen angewendet, beispielsweise in seinem Buch Cybernetics and Management (1959). All dies zeigt auf, dass viele Phänomene und Eigenschaften der Digitalisierung alles andere als Erfindungen unserer Zeit sind. Fundamentale Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen existieren schon seit Jahrzehnten. Die klassische Kybernetik liefert eine sehr gute und praktikable Grundlage für das richtige Verständnis der Digitalisierung.
Als vorläufiges Fazit können Hypothesen zur Digitalisierung Hypothesen zur Digitalisierungformuliert werden. Die erste lautet, dass die Digitalisierung definitiv nichts an den Gesetzen des Wirtschaftens verändern wird. Auch in Zukunft entscheiden Kundennutzen, Marktanteil, Innovation, Produktivität, Profitabilität, finanzielle Stabilität und Attraktivität für gute Leute. Jede digitale Lösung muss sich daran messen lassen, ob der Kunde bereit ist, eine Rechnung zu bezahlen, und ob die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens verbessert wird. Zweitens: Die Digitalisierung erhöht die Anforderungen an die Veränderungsfähigkeit von Unternehmen, Mitarbeitern und Führungskräften massiv. Dieser Change wird immer vernetzter, schneller und umfassender. Die dritte Hypothese ist eine Fortsetzung der zweiten: Die Digitalisierung ist zuallererst ein Thema der Unternehmensführung und erst in weiterer Folge eine Angelegenheit von Spezialisten, IT oder Technik. Deswegen sind Methoden und Werkzeuge erforderlich, um die richtigen Diskussionen zu führen, entsprechende Entscheidungen zu treffen und rasch in die Umsetzung zu gehen.
Im Zentrum dieses Buches steht das Management der Digitalisierung.Management der Digitalisierung, das heißt Veränderungsfähigkeit, Professionalität und Wirksamkeit von Menschen und Organisationen. Dies leitet auch die einzelnen Abschnitte des Buches. Im ersten Teil geht es darum, das gemeinsame Digitalisierungsverständnis zu entwickeln, das heißt, die Transformation zu verstehen, Umfeld und Wettbewerb richtig einzuschätzen und den Digitalisierungsprozess anzustoßen. Teil zwei beinhaltet die Digitalisierungsstrategie. Schwerpunkte sind Leitbild, Geschäftsmodell und die künftige Ausrichtung des Unternehmens. Im dritten Teil wird dargestellt, wie die Struktur eines Unternehmens die Digitalisierung aktiv unterstützen kann. Thematisch geht es um Schnittstellen, Prozessaufträge und generell um Produktivitätsmethoden. Teil vier behandelt die wesentlichen Themen der Digitalisierungskultur. Neben kulturellen Aspekten geht es um Veränderungsfähigkeit, Kommunikation und die Entwicklung von Mitarbeitern und Führungskräften. Im fünften Teil werden die Methoden vorgestellt, die benötigt werden, um die Digitalisierung auch umzusetzen. Digitalisierungsscorecard, Agilität, Digitalisierungscontrolling und Resultatbericht stellen sicher, dass Wirkung entsteht.
Digitalisierung und künstliche Intelligenz (KI) Künstliche Intelligenzhängen klarerweise thematisch zusammen. Stark vereinfacht kann formuliert werden: Jede KI-Lösung setzt ein digitales System voraus, aber nicht jedes digitale System ist gleichzeitig KI. Und ebenso zugespitzt kann Amazon als Beispiel zur Unterscheidung verwendet werden: Anfang der 2000er-Jahre hat Amazon mit einem digitalen Geschäftsmodell den Bucheinzelhandel revolutioniert. An der Wertschöpfungslogik hat dies aber nichts verändert, das heißt Autor, Verlag, Produktion, Vertrieb. Mit KI ändert sich nicht nur der Bucheinzelhandel, sondern das gesamte Geschäftsmodell. Autoren, Verlage und Handelskanäle sind nicht mehr notwendig, weil die KI individualisierte Bücher in Echtzeit verfassen kann. Und genau dadurch wird auch ein Amazon überflüssig. Dieses Beispiel zeigt auf, dass die KI vieles von dem, was die Digitalisierung ausgelöst hat, steigert bzw. in völlig neue Bahnen lenkt.
Digitalisierung ist nicht KI, gleichwohl können die meisten Management-Methoden der Digitalisierung für die KI verwendet werden. Unter dem Gesichtspunkt von Wirksamkeit und Professionalität gibt es keine fundamentalen Unterschiede zwischen dem Management von Digitalisierung und dem Management von KI. Praktisch alle Methoden und Instrumente des Buches können für beides verwendet werden. Logik und Aufbau der einzelnen Kapitel sind durchgängig, das heißt die Inhalte werden kompakt vorgestellt und mit Praxisfällen, Modellen und Werkzeugen erläutert. Dies soll das gemeinsame Verständnis erleichtern und den Erarbeitungsprozess beschleunigen. All dies stellt sicher, dass ein rascher Einstieg in die Themen gelingt, Diskussion und Entscheidung zügig verlaufen und umsetzungsorientiert vorgegangen wird. Am Ende des Buches werden die wichtigsten Kennzahlen und ein Glossar für das Digitalisierungsmanagement zusammengefasst. Das Buch muss nicht zwingend von vorne bis hinten gelesen werden. Es ist so geschrieben, dass der Einstieg an jeder Stelle erfolgen kann. Damit ist sichergestellt, dass die Inhalte sofort angewendet und genutzt werden können. Das Buch stellt bewährte und pragmatische Instrumente zur Verfügung. Es ist anwendbar für Unternehmen, Geschäftsfelder, Kunden, Produkte, Dienstleistungen, Start-ups und Projekte. Damit folgt es der sinngemäßen Definition Peter Druckers: Management ist der Beruf der Wirksamkeit und des Resultate-Erzielens.