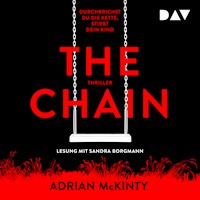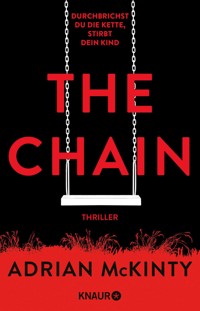9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Sean-Duffy-Serie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
»Die Reihe gehört zweifellos zu den besten Krimiserien, die derzeit im Buchhandel erhältlich sind.« Jörg Kijanski, krimi-couch
Gejagt von unbekannten Kräften, bedroht von internen Ermittlungen, unter Druck gesetzt von der Mutter seines Kindes, versucht er, einen der wahnwitzigsten Mordfälle seiner Laufbahn aufzuklären, ohne dabei sein eigenes Leben zu verlieren.
Belfast 1988: Ein Mann wird mit einem Pfeil im Rücken tot aufgefunden. Es waren wohl kaum Indianer, und auch Robin Hood dürfte als Täter nicht in Frage kommen. Und da das Opfer eh nur ein Drogendealer war, könnte man sein kurioses Dahinscheiden ruhigen Gewissens zu den Akten legen. Doch Inspector Sean Duffy tut sich schwer damit, Morde zu den Akten zu legen – auch wenn seine Vorgesetzten ihn dazu drängen und der Haussegen bei der jungen Familie Duffy gerade reichlich schief hängt. Und noch jemand möchte Duffy zum Aufgeben zwingen: Eines Nachts findet er sich im Wald wieder, wo drei bewaffnete, maskierte Gestalten ihn dazu zwingen, sein eigenes Grab auszuheben …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 464
Ähnliche
Adrian McKinty
Dirty Cops
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Peter Torberg
Suhrkamp
Dirty Cops
Police at the station and they don’t look friendly,Police at the station and they don’t look friendly to me …
Tom Waits, Cold Water (1992)
Die Alpträume sind nicht unterschiedlich, da ja bereits zwei opponierte Spiegel ausreichen, ein Labyrinth zu schaffen.
Jorge Luis Borges, Sieben Nächte (1977)
Prolog
Trau keinem Special Agent
Blaudunkel, rotdunkel, gelbdunkel.
Schnee glitzert in den Senken. Zwischen den wie in einem Zoetrop flackernden Baumstämmen tauchen der Große Bär und der Polarstern auf.
Der Wald ist uralt, Überbleibsel der riesigen Holozän-Bewaldung, die einst ganz Irland bedeckte, nun aber fast vollständig verschwunden ist. Riesige fünfhundert Jahre alte Eichen, knorriger, weitverzweigter Weißdorn, Rosskastanien mit roter Rinde.
»Das gefällt mir nicht«, mault der Mann hinter dem Bewaffneten.
»Damit musst du dich jetzt einfach abfinden, ich kriege auch nasse Füße«, erwidert der Mann mit der Waffe.
»Das mein ich nicht. Ich mein diese verfluchten Bäume. Ich seh so gut wie nichts. Das gefällt mir nicht. Das ist unheimlich, aber echt.«
»Ach, jetzt reiß dich mal zusammen, du Heulsuse.«
Dabei ist es hier in den grobschlächtigen Schatten der ehrwürdigen Eichen, vier Stunden nach Mitternacht, in der Mitte von Nirgendwo, während Irland schläft und träumt, tatsächlich unheimlich …
Der kleine Anstieg ist trügerisch, er ist so steil, dass er mir den Atem raubt, und wenn das so bleibt, brauche ich meinen neuen Inhalator. Aber der liegt natürlich im Handschuhfach, weil ich mir noch nicht angewöhnt habe, ihn überallhin mitzunehmen. In ein paar Minuten macht das allerdings keinen Unterschied mehr. Eine Kugel in den Kopf ist die schnellste Kur gegen eine Asthmaattacke.
»Beeil dich gefälligst«, knurrt der Mann mit der Waffe und bohrt mir zur Bekräftigung die hässlich stumpfe Nase des Revolvers in den Rücken.
Ich erwidere nichts darauf, stapfe weiter durch Brennnesselgestrüpp und Farne und steige über mächtige, flechtenbewachsene Eibenwurzeln.
Ein paar Minuten gehen wir schweigend weiter. Opfer. Killer. Helfershelfer. Das blanke Klischee. Exakt dieselbe Szene hat sich im ländlichen Ulster seit 1968 mindestens tausend Mal so abgespielt. Ich selbst war der diensthabende Beamte bei einem halben Dutzend solcher Fälle, in denen die Leichen mit dem Gesicht nach unten in einem Sheugh gefunden wurden oder in einer Schlammgrube auf dem Hochmoor landeten. Stets weisen die Opfer Striemen an den Handgelenken auf, von Handschellen oder Fesseln, und die tödliche Verletzung ist ein Schuss in den Kopf hinter dem linken oder rechten Ohr aus weniger als einem Meter Entfernung und fast immer von oben.
Stapf, stapf, stapf, geht es den Hügel hinauf über einen schmalen Waldpfad.
Wenn ich entsprechend veranlagt wäre, dann könnte ich leicht an eine diesem Ort innewohnende Niedertracht glauben: Mondlicht, das die winterlichen Äste zu Vogelscheuchen verzerrt, der Geruch von verrottendem Moorholz und gleich neben dem Pfad, im Laub am Waldboden, diese hohen, beunruhigenden Geräusche, bei denen es sich wohl um den Todeskampf kleiner nachtaktiver Tiere handelt. Doch die Vermenschlichung der Natur ist noch nie mein Ding gewesen, und ich bin auch nicht sonderlich romantisch veranlagt. Nicht Gott, nicht die Natur und auch nicht der Erzengel Michael, Schutzpatron der Polizisten, werden kommen und mich retten. Ich muss mich selbst retten. Diese Männer werden mich umbringen, es sei denn, ich kann mich herausreden oder herauskämpfen.
Eine Brandschneise im Wald.
Himmel.
Ist es im Osten schon ein wenig heller? Vielleicht ist es später, als ich dachte. Das Verhör schien nicht allzu lang zu dauern, aber man verliert das Zeitgefühl, wenn man an einen Stuhl gefesselt ist und einen Sack über dem Kopf hat. Fünf Uhr früh? Halb sechs? Sie haben mir die Armbanduhr abgenommen, ich bin mir also nicht sicher, aber die Wespen und Schmeißfliegen sind schon aktiv, und wenn man die Ohren spitzt, hört man das erste Einsetzen des Morgengesangs: Amseln, Rotkehlchen, Ringeltauben. Für Kuckucke ist es noch zu früh im Jahr.
Wenn sie mich erschießen, wer wird dann Emma beibringen, welche Vögel auf welche Weise singen? Wird Beth weiterhin nach Donegal fahren, damit Emma Zeit mit den Großeltern verbringen kann? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird Beth nach alldem hier nach England gehen.
Vielleicht wäre das am besten so.
Dieses Land hat keine Zukunft.
Die Zukunft gehört den Männern mit den Waffen hinter mir. Von mir aus. Die letzten fünfzehn Jahre habe ich mein Bestes gegeben, um gegen die Entropie anzukämpfen und im Meer des Chaos für ein kleines Inselchen Ordnung zu sorgen. Ich bin daran gescheitert. Und nun zahle ich den Preis für dieses Scheitern.
»Na komm schon, Duffy, nicht trödeln«, sagt der Mann mit der Waffe. Wir überqueren die Schneise und verschwinden wieder im Wald.
Direkt vor uns flattert eine große alte Krähe von einem Weißdornast und warnt alle anderen Krähen, dass wir auf sie zustolpern.
Krah, krah, krah!
Ich habe Krähen schon immer gemocht. Sie sind gewieft. So klug wie die klügsten Hunderassen. Krähen erinnern sich noch nach Jahrzehnten an ein menschliches Gesicht. Sie können die guten von den bösen Menschen unterscheiden. Und wenn diese Verbrecher vergessen haben, was sie mit mir an diesem Morgen angestellt haben, werden sich die Krähen daran erinnern.
Darin liegt ein gewisser Trost. Noch bevor ich zählen konnte, hat mein Vater mir die Rufe der Vögel und die Namen ihrer Verbünde beigebracht. Ein Schof Enten, eine Kette von Rebhühnern, ein Schwarm Tauben, ein Trupp Lerchen, eine Brut …
»Schluss mit der Trödelei, schneller, Duffy! Ich weiß, was du vorhast! Geh schneller, verflucht«, sagt der Mann mit der Waffe.
»Der Anstieg«, sage ich und schaue ihm in das von einer Sturmhaube verdeckte Gesicht.
»Nicht umdrehen, weitergehen«, befiehlt er und drückt mir wieder den Revolver in den Rücken. Wenn meine Hände nicht gefesselt wären, könnte ich einen dieser Schubser dazu verwenden, ihn zu entwaffnen, so wie uns das 1980 der Armee-Sergeant im Selbstverteidigungskurs beigebracht hat. Wenn du die Waffe im Rücken spürst, drehst du den ganzen Körper plötzlich um die eigene Achse in Richtung des Schützen, so dass er nur Luft vor sich hat, reißt die Hände herum und packst die Schusshand. Dann kommt es ganz allein auf dich an – brich ihm das Handgelenk und schnapp dir die Waffe, oder tritt ihm in die Eier und schnapp dir die Waffe. Der Sergeant meinte, wenn man schnell genug sei, hätte man eine 75-prozentige Chance, den Gegner zu entwaffnen. Blitzschnelle Drehung, sofortiger Zugriff, kein Zögern. Wir alle wussten, dass der Sergeant sich diese Statistik aus den Fingern gesogen hatte, aber selbst eine zehnprozentige Chance ist immer noch besser, als sich wie ein räudiger Hund abknallen zu lassen.
Das alles ist heute Morgen allerdings reine Theorie. Meine Hände stecken hinter dem Rücken in Polizeihandschellen. Selbst wenn ich mich schnell genug umdrehen würde, könnte ich nicht nach der Waffe greifen, und wenn ich plötzlich losrennen wollte, würde ich wahrscheinlich stolpern oder von hinten erschossen werden.
Nein, am besten versuche ich, mit ihnen zu reden und sie zu überzeugen. Und falls das nicht funktioniert (und das wird es höchstwahrscheinlich nicht), dann werde ich irgendetwas versuchen müssen, wenn sie mir die Handschellen abnehmen und mir die Schaufel in die Hand drücken, um mein eigenes Grab zu schaufeln. Das steht schon mal fest. Wenn sie einfach nur einen Bullen hätten umbringen wollen, dann hätten sie mich schon im Versteck abgeknallt, meine Leiche auf irgendeiner Nebenstraße abgelegt und die BBC angerufen. Aber das haben sie mit mir nicht getan, ihr Auftrag lautet, mich verschwinden zu lassen. Deshalb der Spaziergang durch den Wald, deshalb der Mann mit der Schaufel hinter dem Mann mit der Waffe. Die Frage ist nur: Warum? Warum muss Duffy verschwinden, wenn doch die Ermordung eines Bullen ihrer Sache zum richtigen Zeitpunkt einen moralischen Schub geben würde?
Es kann nur einen Grund dafür geben. Wenn meine Leiche tatsächlich auftaucht, dann kriegt Harry Selden Ärger mit den Bullen, und Ärger mit den Bullen ist genau das, was Harry Selden trotz seiner Unschuldsbeteuerungen nicht braucht.
Der Hang wird steiler, und ich versuche, ruhiger zu atmen.
Immer mit der Ruhe, Sean, immer mit der Ruhe.
Ich umgehe eine riesige umgestürzte Eiche, die wie eine gefallene Gottheit daliegt. Die Erde ringsherum ist weich, ich rutsche auf einem großen Flechtenteppich aus und falle beinah hin.
»Schluss damit!«, knurrt der Mann mit der Waffe, so als ob ich das mit Absicht getan hätte.
Ich fange mich und gehe weiter.
Trödelei, hat er vorhin gesagt.
Ein Wort, das man heutzutage nicht mehr zu hören kriegt. Ein älterer Mann also. Älter als er klingt. Vielleicht lässt er mit sich reden …
Plötzlich fällt mir ein Lied im Viervierteltakt ein, das mein Großvater auf der Ziehharmonika gespielt hat:
My old man said »Foller the van, and don’t dilly dally on the way.«
Off went the van wiv me ’ome packed in it, I followed on wiv me old cock linnet.
But I dillied and dallied. Dallied and dillied,
Now you can’t trust a special like the old-time coppers,
When you’re lost and broke and on your uppers …
Die Ziehharmonika klang wunderbar, aber der Gesang … Mein Großvater, der aus einer sehr wohlhabenden Gegend in Foxrock, Dublin, stammte, konnte einfach keinen Londoner Akzent nachmachen, und wenn sein Leben davon abgehangen hätte.
Aber das ist schon komisch, oder? Seit fünfundzwanzig Jahren lauert das Lied irgendwo in meinem Gedächtnis.
O ja, Sean, die Ziehharmonika zu spielen, sieht fürchterlich kompliziert aus, aber wenn du den Bogen mal raus hast, geht es ganz leicht.
Wirklich?
Na klar. Probier’s mal, ich zeig dir, wie …
»Verdammt noch mal, beeil dich, du scheiß Bulle!«, sagt der Mann mit der Waffe. »Glaubst du, du hast eh nichts zu verlieren? Wir müssen uns damit nicht beeilen, weißt du? Wir müssen dich nicht schonen.«
»Das hier nennt ihr schonen?«
»Wir haben dir deine Eier gelassen, oder nicht?«
»Ich laufe so schnell ich kann. Versuchen Sie doch mal, mit den Händen hinter dem Rücken durch das Gelände zu stapfen. Wenn Sie die Handschellen abnehmen würden … die sind eh viel zu eng.«
»Schnauze! Niemand hat gesagt, dass du sprechen darfst. Also halt die Fresse und geh weiter, verflucht.«
»Okay. Okay.«
Stapf, stapf, stapf, den Hügel hinauf.
Der Hang wird wieder steiler, und der Wald wird lichter. Am Rand erkenne ich Schafweiden und Hügel, und der dunkle Fleck im Norden ist vielleicht der Atlantik. Wir sind nur eine dreiviertel Stunde mit dem Auto von Belfast entfernt, doch wir befinden uns in einer vollkommen anderen Welt, weit weg von Flugzeugen und Maschinen, weit weg vom Antlitz des Krieges. Ein anderes Irland, eine andere Zeit. Und ja, die Sterne sind jetzt erheblich weniger klar zu sehen, und die Sternbilder verblassen am eierschalenfarbenen Himmel. Die Sonne geht auf, aber die Sonne wird mich nicht retten. Wenn die Kerle auch nur halbwegs kompetent sind, und davon gehe ich aus, bin ich vor Tagesanbruch tot.
»Was ist denn nur mit denen los?«, murmelt der Mann mit der Waffe. »Beeilt euch gefälligst, ihr zwei!«, brüllt er die anderen an.
Man hat mir befohlen, mich nicht umzudrehen, aber das bestätigt meine Vermutungen. Von den fünf Mann, die mich entführt haben, wartet einer beim Wagen, einer unten am Pfad als Späher, und die anderen drei führen die Tat aus.
»Also los, keiner hat dir gesagt, dass du stehenbleiben sollst, weiter, Duffy!«, schimpft der Mann mit der Waffe.
Ich schüttle den Kopf. »Ich muss Luft holen. Ich hab Asthma«, erwidere ich. »Ich kriege schlecht Luft.«
»Gar nichts hast du!«
»Ich bin Asthmatiker. Haben sie bei meiner amtsärztlichen Untersuchung rausgefunden.«
»Was für eine Untersuchung?«
»Na, bei der Polizei. Ich dachte erst, das kommt nur vom zu vielen Rauchen, aber der Arzt meinte, ich hätte Asthma. Ich hab einen Inhalator.«
»Blödsinn!«
»Stimmt aber.«
»Hast du ihn dabei?«
»Nein. Der liegt im Handschuhfach von meinem Wagen.«
»Was ist denn los? Erledigen wir ihn hier?«, fragt einer der beiden anderen, als er zu uns aufschließt. Der, der sich über die unheimlichen Bäume beschwert hat. Der mit der Schaufel.
»Er behauptet, er hat Asthma. Er kriegt keine Luft, sagt er«, erklärt der Mann mit der Waffe.
»Aye, an so kalten Vormittagen wie heute kriegt man so was. Unser Jack hat Asthma«, erklärt der zweite Mann. Jünger als der Mann mit der Waffe, Jeansjacke, enge, verblichene Jeans, weiße Sneaker. Die Schaufel ist altmodisch: schwerer Holzgriff, gusseisernes Blatt, tiefer Schwerpunkt …
»Ich glaub nicht an Asthma. Asthma ist nur ein Märchen. Frische Luft, das ist alles, was man braucht«, verkündet der Mann mit der Waffe.
»Na, das erzähl mal der Ma von unserem Jack, die ist bei den besten Ärzten in ganz Waterside gewesen.«
Der dritte schließt zu uns auf. Er ist kleiner als die anderen. Er trägt eine braune Sturmhaube und eine Fliegerjacke.
Nein, kein er. Eine Frau. Sie hat während der Autofahrt kein Wort gesagt, aber mit etwas mehr Verstand hätte ich drauf kommen können, dass der Geruch im Wagen Parfüm war. Ich hatte es für den Wunderbaum gehalten. Sie hat ebenfalls eine Waffe dabei. Eine alte .45er. Schau sich das mal einer an. Aus US-Army-Beständen. 1930er ACP. Die hat bei irgendwem in der Schuhschachtel herumgelegen, seit die GIs im Zweiten Weltkrieg hier gewesen waren. Bei so einer Waffe hätte ich nicht lange zu leiden. Ich würde den Schuss nicht mal hören. Ein unmittelbares Auslöschen des Bewusstseins. Ich würde nichts spüren. Völlige Dunkelheit, einfach so. Und dann, wenn Father McGuigan recht hat, vergeht eine kaum wahrnehmbare Zeitspanne, bis der Leib am Jüngsten Tag wiederaufersteht …
»Ist es hier? Ist das die Stelle?«, fragt sie.
»Nein, noch ein kurzes Stück«, antwortet der Mann mit der Waffe.
»Können wir es nicht hier machen? Wir sind eh schon meilenweit von allen anderen entfernt«, sagt der Schaufelmann.
»Wir machen es dort, wo man es uns aufgetragen hat«, beharrt der Anführer. »Es ist eh nicht mehr weit. Hier, ich zeig’s euch.«
Er faltet eine auf dickes, grobes Papier selbstgezeichnete Landkarte auseinander. Eine solche Kartografie habe ich noch nie gesehen, voller esoterischer Symbole und Piktogramme, rätselhafter, sich überschneidender Pfade und Linien. Der Typ ist ein Exzentriker, der sich seine eigenen Landkarten zeichnet. Unter anderen Umständen würden wir wahrscheinlich prima miteinander auskommen.
»Was ist das denn? Irgendeine neue Generalstabskarte?«, fragt die Frau.
»Nein! Also wirklich nicht. ›Generalstabskarte‹, sagt sie.«
»Was denn dann?«
»Jeder sollte sich eine Landkarte seiner verlorenen Felder anlegen. Die eigene Landkarte. Mit eigenem Maßstab und eigener Legende«, führt der Mann mit der Waffe aus.
»Was meinst du mit ›verlorene Felder‹?«, fragt die Frau irritiert.
»Er zitiert Gaston Bachelard«, erkläre ich.
»Wer hat dich gefragt? Schnauze!«, faucht der Mann mit der Waffe.
»Welcher Gaston?«, will der Mann mit der Schaufel wissen.
»Schlag nach. Es gibt mehr im Leben als Pub, Wettbüro und Sozialamt, weißt du? Asthma, für’n Arsch! Es gibt kein Asthma. Ist euch aufgefallen, dass keiner von uns hingefallen ist? Habt ihr bemerkt, wie schnell sich unsere Füße an den Untergrund gewöhnt haben?«, fragt der Mann mit der Waffe.
»Eigentlich nicht«, erwidert die Frau.
»In der letzten halben Stunde haben unsere Augen Rhodopsin ausgeschüttet. Wir passen uns an die Dunkelheit an. Deswegen muss man ab und zu raus, weg vom künstlichen Licht. Gut für die Augen, gut für die Seele.«
»Rhodopsin?«, fragt die Frau.
»Ein Proteinrezeptor in der Netzhaut. Das ist die Chemikalie, die die Stäbchen im Auge verwenden, um Photonen zu absorbieren und Licht zu erkennen. Der Schlüssel zur nächtlichen Sehfähigkeit.«
»Wovon um alles in der Welt redest du, Tommy?«, fragt die Frau.
»Keine Namen!«
»Ach, was macht das schon, ob wir unsere Namen benutzen? Er ist doch sowieso bald tot«, meint der Mann mit der Schaufel.
»Egal, ob er bald tot ist oder nicht. So lautet die Regel! Keine Namen. Hört ihr eigentlich bei den Lagebesprechungen jemals zu? Solche Anfänger!«, murmelt »Tommy«, faltet die Landkarte zusammen und steckt sie beleidigt ein.
»Ist es noch weit?«, fragt die Frau.
»Also, weiter geht’s«, brüllt Tommy und richtet die Waffe wieder auf mich.
Stapf, stapf, stapf, den Hügel hinauf, aber ich muss zugeben, dass ich bei dieser kleinen Unterhaltung eine Menge gelernt habe. Der Mann mit der Waffe ist etwa 45, 50. Biologielehrer? All das Zeug über Proteinrezeptoren … nein, das hat er wahrscheinlich alles im New Scientist gelesen und sich daran erinnert. Nicht Biologie. Kommt mir nicht wie der Typ für einen naturwissenschaftlichen Hochschulabschluss vor. Geografie vielleicht. Hippie, vielleicht ein linker Radikaler, und der Akzent ist definitiv Derry. In den frühen Siebzigern sind wir höchstwahrscheinlich auf dieselben Demos gegangen. Katholisch, also wahrscheinlich Lehrer am St Columba’s College, an der St Joseph’s Secondary oder St Malachy’s National School. Damit kann ich schon eine Menge anfangen. Er ist der Anführer, ein paar Jahrzehnte älter als die anderen beiden. Wenn ich ihn umdrehen kann, ziehen die anderen mit.
Ein ziemlich großes »Wenn«.
»Rhodopsin, für’n Arsch. Ich bin hingefallen«, sagt Schaufelmann und reicht der Frau eine Wasserflasche. »Zwei Mal. Und abwärts wird es noch schlimmer. Achtet auf meine Worte. Wir werden alle auf die Schnauze fallen, werdet schon sehen.«
Der Wald wird ein wenig lichter, und im Westen sehe ich Scheinwerfer auf einer Straße. Allerdings fünfzehn Kilometer weg, und sie entfernen sich. Von dort ist also keine Hilfe zu erwarten.
Ein klarer, urwüchsiger Wind weht von der Hügelspitze herunter. Ich trage nur Jeans, T-Shirt und Doc Martens. Wenigstens ist es mein Glücks-T-Shirt, Che Guevara, handgedruckt und von Jim Fitzpatrick höchstpersönlich signiert. Wenn in ein paar Jahren ein Hundehalter oder ein Wanderer auf meine Leiche stößt und die Baumwolle bis dahin nicht verrottet ist, dann können sie mich vielleicht anhand des T-Shirts identifizieren.
»Jetzt seid vorsichtig!«, verkündet Tommy. »Hier ist es schlammig wie sonst was. Da drüben ist ein Sumpfloch. Da liegt ein totes Schaf drin. Aber wenn wir das hinter uns haben, sind wir da.«
Wir waten durch ein Gewirr aus Baumwurzeln und feuchter Erde und kommen schließlich an einer kleinen Talsenke an, die wohl der Hinrichtungsort sein soll.
Ein guter Platz, um jemanden umzubringen. Die umstehenden Bäume werden den Schuss dämpfen, und die überhängenden Äste schützen die Mörder vor den neugierigen Blicken aus Helikoptern und Satelliten.
»Wir sind da«, sagt Tommy und schaut noch einmal auf seine Karte.
»Es muss doch einen besseren Weg geben als diesen«, meint Schaufelmann erschöpft. »Guck dir meine Sneakers an. Das waren funkelnagelneue Schuhe! Nikes. Durchgeweicht bis auf die Socken.«
»Mehr hast du nicht zu sagen? ›Guck dir meine Sneakers an‹? Mecker, mecker, mecker. Hast du denn gar keinen Anstand? Das hier ist eine ernste Angelegenheit. Ist dir klar, dass wir heute Morgen jemandem das Leben nehmen?«, fragt Tommy.
»Klar ist mir das klar. Aber warum wir das in der Mitte von Nirgendwo auf halber Höhe einen verfluchten Berg hinauf machen müssen, ist mir überhaupt nicht klar.«
»Und ich dachte schon, dir wäre die Bedeutung der Aufgabe bewusst oder du würdest wenigstens die Natur genießen. Weißt du überhaupt, was das da sind?«, fragt Tommy und zeigt auf die überhängenden Äste.
»Bäume?«
»Ulmen! Nach allem, was wir wissen, die letzten Ulmen auf der Insel.«
»Ulmen? Nie im Leben.«
»Aye, als wenn du dich mit Bäumen auskennen würdest. Du kommst doch aus West Belfast«, knurrt Tommy.
»Es gibt in Belfast Bäume. Überall! Man muss ja nicht gleich im Wald leben, um zu wissen, was ein verfluchter Baum ist. Weißt du, wer im Wald lebt? Weggelaufene Irre. Überall. Und irgendwelche Kultanhänger. Hast du dir jemals The Wicker Man angeschaut? Und Großkatzen. Panther. In der Sunday World war neulich ein Foto von …«
»Gentlemen, bitte«, sagt die Frau, die sich zu uns gesellt hat. »Sind wir endlich da oder was?«
»Sind wir«, murmelt Tommy.
»Na dann, bringen wir es hinter uns«, sagt sie.
»Nimm ihm die Handschellen ab und gib ihm den Spaten«, sagt Tommy.
Schaufelmann macht mich los und lässt die Schaufel neben mir liegen. Die drei gehen ein paar Schritte zurück und lassen mir Platz. »Du weißt, was du zu tun hast, Duffy«, sagt Tommy.
»Ihr macht einen Riesenfehler«, sage ich zu ihm und schaue ihm in die braunen Augen hinter der Sturmmaske. »Euch ist nicht klar, was ihr da tut. Ihr werdet nur benutzt. Ihr …«
Tommy richtet die Waffe auf meinen Schritt.
»Ich schieß dir die Eier weg, wenn du noch ein Wort von dir gibst. Dann kannst du ohne Gemächt buddeln. Und jetzt halt die Schnauze und fang an.«
Ich reibe mir die Handgelenke, nehme die Schaufel und fange an zu graben. Der Boden ist feucht und weich und nachgiebig. Es wird keine zehn Minuten dauern, um ein flaches Grab zu schaufeln.
Die drei halten sich in gebührender Entfernung von der Schaufel. Sie mögen vielleicht neu in diesem Geschäft sein, aber dumm sind sie nicht.
»Ich bin froh, wenn das vorbei ist«, flüstert die Frau dem jüngeren Mann zu. »Ich würde für eine Tasse Tee sterben.«
»Und ich könnte eine Zigarette brauchen. Ich fass es nicht, dass ich die auf der Farm vergessen habe«, erwidert der Mann.
»Tee und Zigaretten, das ist alles, was den beiden einfällt, wenn wir jemandem das Leben nehmen«, brummelt Tommy.
»Für dich ist das kein Problem, du rauchst ja nicht. Ich …«
Ich schalte die Ohren auf Durchzug, und ihr Gemurmel ist nur noch Hintergrundrauschen.
Ich denke an Beth und Emma, während ich durch eine überraschende Schicht Kalk in all dem Torf grabe. Kalk.
An Emmas Lächeln und Beths grüne Augen.
Emmas Lachen.
Das soll das Letzte sein, an das ich denke. Nicht das Gebrabbel dieser irregeleiteten Idioten.
Schaufel.
Erde.
Schaufel.
Ich hab ja gewusst, dass der Tod bei meiner Art von Arbeit ein Berufsrisiko ist, aber es ist völlig absurd, dass dieser banale Fall eines toten Drogendealers in Carrickfergus hierzu geführt hat. Einen durchschnittlicheren Mord als den hier kann man sich in Ulster gar nicht denken. Lächerlich.
Erde.
Schaufel.
Erde.
Schaufel.
Luft …
Ich kriege schon wieder keine Luft. Ich schnappe nach …
schnappe nach …
Sie glauben, ich tu nur so.
Ich habe ihre Geduld überstrapaziert.
Jemand schubst mich, und ich falle hin.
Ich liege rücklings im schwarzen Torf.
»Also, knallen wir ihn ab«, sagt eine Stimme aus tausend Meilen Entfernung.
»Also gut.«
Über mir Baumwipfel, Krähen, Himmel.
Und gelbdunkel, rotdunkel, blaudunkel …
1
No hay banda
County Donegal ist sicherlich nicht der feuchteste Ort der Welt – ein Meter Niederschlag im Jahr sind hier üblich, und das ist gar nichts im Vergleich zu beispielsweise Mawsynram in Indien, wo schon mal zehn Meter und mehr fallen. Der entscheidende Unterschied liegt allerdings darin, dass der Regen dort während des Monsuns fällt, und der hält nur etwa zehn Wochen an. Den Rest des Jahres über ist es in Mawsynram wahrscheinlich ganz angenehm. Man könnte sich vorstellen, durch die Vorgebirge des Himalaya zu wandern oder eine geführte Tour zu den Teeplantagen von Barduar zu machen. In Donegal mag es nicht so viel regnen wie in Mawsynram, doch gleicht es das durch die Hartnäckigkeit des Regens wieder aus. In manchen Gegenden von Donegal wurden schon 300 Regentage registriert, und wenn man dann noch die Tage mit Nebel, Niesel und Schnee hinzurechnet, dann kommt man vielleicht auf vierzehn Tage, in denen nicht irgendeine Form von Feuchtigkeit vom Himmel fällt.
Es ist schon ziemlich paradox, dass Donegal, bis zur Erfindung der billigen Pauschalflüge nach Spanien, der beliebteste Urlaubsort vieler Menschen in Nordirland war. Alle meine Urlaubsreisen als Kind gingen nach Donegal, eine Abfolge von trostlosen Wohnwagenstellpätzen an windumtosten, kalten, verregneten Stränden. Und überall an diesen Stränden waren zahlreiche Eltern in dicken Wollpullovern und Südwestern zu sehen, die ihre kleinen zitternden Kinder mit der Anweisung in den Atlantik jagten, dass sie erst wieder herauskommen sollten, wenn sie sich ausgetobt hätten.
Meine Erinnerungen an Donegal waren also nicht sonderlich erfreulich, und als mein Vater in den Frühruhestand ging und meine Eltern in ein Häuschen in der Nähe von Glencolumbkille zogen, besuchte ich sie nicht allzu häufig.
Mit der Geburt von Emma hatte sich das alles natürlich geändert. Meine Eltern bestanden darauf, ihre Enkeltochter zu sehen, Beth und ich waren zu Weihnachten zu ihnen gefahren, und zum Frühlingsanfang waren wir wieder dort. Glencolumbkille liegt in der Gaeltacht, in der fast alle diese urige Donegalversion des Irischen sprechen. Ein kleiner, weiß getünchter Ort, wie direkt aus »Der Sieger« entsprungen: Ein Lebensmittelhändler mit Schanklizenz, ein Postamt, ein Pub, eine Kapelle, ein Golfplatz, ein kleines Hotel, ein Strand und ein Klippenweg. Ein nettes Fleckchen, wenn einen Regen und Langeweile nicht stören und auch nicht die Horden an Gastschülern aus Dublin, die ihr Irisch an einem ausprobieren. Als ich vors Haus trat, um Milch zu holen, fragte mich einer dieser Burschen: »Entschuldigung, Sir. An gabh tu pios caca?«
»Nein, ich möchte keinen Kuchen, danke.«
Er versuchte es erneut und fragte dieses Mal nach dem Weg zum Musikpavillon.
Langsam und geduldig erklärte ich auf Irisch, dass es in Glencolumbkille weder einen Musikpavillon noch eine Kapelle gebe.
Verwirrt legte der Bursche den Kopf schräg.
»Kein Musikpavillon. Keine Kapelle. No hay banda, il n’est pas une orchestre.«
»Oh, ich verstehe«, sagte er. »Nein, ich suche den Weg zur Strandhütte, da sollen wir uns treffen.«
»Die ist gleich da drüben am Strand. Und das Wort, nach dem Sie suchen, lautet bothán trá.«
»Vielen Dank, Opa«, sagte er und schlenderte davon.
»Opa«, murmelte ich, kaufte Milch und die Lokalzeitung und murmelte noch immer vor mich hin, als ich zum Haus zurückging, wo meine Ma und Beth sich über Bücher unterhielten.
Meine Mutter Mary hatte Beth sofort ins Herz geschlossen, und das, obwohl sie protestantisch war, nur Englisch sprach, wohlhabend und erheblich jünger war als ich, und, was am schlimmsten war, kein Fan von Dolly Parton.
»Und ›Little Sparrow‹ gefällt Ihnen auch nicht?«, hatte meine Ma gefragt, als sie von diesem Unheil erfuhr.
»Tut mir wirklich leid, Mrs Duffy, aber das ist einfach nicht mein Geschmack. Ich höre es mir aber gern noch einmal an, wenn Sie möchten«, hatte Beth versöhnlich gesagt.
Heute Morgen sprachen sie über Beths Master-Arbeit, die sie über Philip K. Dick schreiben wollte, worüber das vermiefte Englisch-Institut der Queens University nicht sonderlich erfreut war. Meine Mutter neigte eher zu der Ansicht der Universität, und insgeheim gab ich ihr recht.
»Aber Mr Dick ist doch gerade erst verstorben. Man weiß doch gar nicht, ob ein Schriftsteller irgendetwas taugt, wenn er nicht mindestens eine Generation lang tot ist«, sagte Ma.
Beth sah mich hilfesuchend an, doch dieses Minenfeld würde ich unter gar keinen Umständen betreten.
»Milch«, sagte ich und stellte die Packung auf den Tisch. »Und ich hab Dad die Zeitung mitgebracht«, fügte ich hinzu, verschwand schnell und überließ die beiden ihrem Thema.
Mein Vater hatte Beth ebenfalls ins Herz geschlossen und festgestellt, dass er die Gesellschaft seiner Schwiegertochter und des Enkelkinds so sehr genoss, dass er darüber gelegentlich sogar sein geliebtes Golf und die Beobachtung der Vogelwelt vergaß. Abends erzählte er uns in leisen Tönen von Emmas erstaunlichen Fortschritten im Gehen, Sprechen und dem Aufstapeln von Bauklötzen.
»Mit sechs Monaten kann sie schon sprechen! Und fast laufen. Man sieht es schon. Sie will laufen. Sie steht da und denkt darüber nach. Und sie sagt ›Opa‹! Ich hab’s genau gehört. Das Mädchen ist ein Genie. Ehrlich, Sean. Du solltest Französisch und Irisch mit ihr sprechen. Bis sie eins ist, kann sie beides fließend. Und du hättest sehen sollen, wie sie diesen Legoturm gebaut hat. Unglaublich …«
Das Häuschen meiner Eltern ging aufs Meer hinaus, und am anderen Ende des Hauses gab es ein kleines, schalldichtes Bücherzimmer mit einem großen, doppelt verglasten Fenster in Richtung Westen. Dads Plattenspieler war zwanzig Jahre alt, und seine Lautsprecher taugten nichts, aber seine Plattensammlung war vielschichtig und ziemlich gut. Seit er nach Donegal gezogen war, hatte er die Werke des englischen Komponisten Arnold Bax entdeckt, der den Großteil der Zwanzigerjahre in Glencolumbkille gelebt hatte.
Ich ging ins Bücherzimmer, suchte mir einen gemütlichen Sessel, um die Zeitung zu lesen, und legte Bax’ wirklich charmantes »November Woods« auf. Gleich nach dem merkwürdig gedämpften Höhepunkt, der einen an die Instrumentalmusik der frühen Michael-Powell-Filme erinnerte, kam Dad herein.
»Hallo, Sean, störe ich dich?«
»Nein, Dad, überhaupt nicht. Ich hör mir nur eine von deinen Platten an. Arnold Bax ist gar nicht übel, oder?«
»Nein, da hast du recht. Er ist wunderbar. Er klingt ganz leicht, aber nicht unbedeutend oder gar frivol. Seine beste Zeit überschnitt sich mit der von Bix Beiderbecke. Schade, dass die beiden nie zusammen gespielt haben. Bax und Bix. Verstehst du?«
»Ja, Dad«, sagte ich und unterdrückte ein Stöhnen.
Er setzte sich in den Lehnsessel neben mir. Mein Dad war jetzt 65, hatte noch üppiges weißes Haar, und durch die Gesichtsbräune von all dem Golfen und Vögelbeobachten wirkte er gesund und munter. Er hätte als älterer französischer Flaneur durchgehen können, wenn er nicht eine braune Hose, braune Sandalen (mit weißen Socken) und einen »Weihnachtspullover« mit Rentieren darauf getragen hätte.
Er reichte mir das Kreuzworträtsel aus der Irish Times und ein Wörterbuch. Das Buch gab ich ihm sofort zurück. »Das wäre ja gemogelt«, sagte ich. »Was suchst du denn?«
»Neun senkrecht.«
»Neun senkrecht: ›Möbelverkäufer wird’s betonen: Je größer das Regal, desto …‹ Die Lösung lautet ›Mehrfach‹, Dad. Adjektiv und Substantiv.«
»Ah, ich verstehe. Das ist eh das schlechteste Wörterbuch der Welt. Es ist nicht nur schrecklich, es ist schrecklich«, sagte er und kicherte dann derart unterdrückt, dass ich schon befürchtete, er würde sich dabei was antun.
»Hast du immer noch vor, morgen mitzukommen?«, fragte er schließlich. »Ich habe so das Gefühl, dass du nicht willst, Sohn.«
Mit den Gefühlen meines Vaters war alles in Ordnung. Ich wollte wirklich nicht. Morgen wollten wir zum Lough Derg fahren, etwa eine Viertelstunde landeinwärts, um uns mit dem Schiff zur Station Island übersetzen zu lassen und zum Purgatorium von St Patrick zu wallfahren. Das ging nur zwei Mal im Jahr: Im Sommer (wenn es nahezu alle taten) oder in der Fastenzeit. Die ganze Geschichte hatte vor 1500 Jahren begonnen, als Jesus Christus zur Ermutigung von St Patrick, seine Mission bei den gottlosen Iren fortzuführen, vom Himmel herniederkam und ihm eine Höhle auf Station Island zeigte, die direkt bis zum Purgatorium führte. Seitdem war diese Höhle ein bedeutender Wallfahrtsort für gläubige Katholiken aus ganz Europa. Mein Vater war nie sonderlich gläubig gewesen, aber Seamus Heaneys neues, buchlanges Gedicht »Station Island« über dessen eigene Pilgerreise nach Lough Derg hatte sein Interesse daran befeuert. Heaneys Gedicht und seine vielen liebenswerten Interviews im irischen Fernsehen und Radio hatten dem Ort einen spirituellen und philosophisch faszinierenden Beiklang gegeben, und in einem Augenblick der Schwäche hatte ich dem Wunsch meines Vaters, ich solle ihn begleiten, zugestimmt. Jetzt allerdings, am Vorabend unserer Reise, war ich überhaupt nicht erpicht darauf. Die Vorstellung, drei Tage fastend und betend mit meinem Dad zu verbringen, während wir mit einem Haufen gottesfürchtiger Irrer barfuß um eine feuchte, armselige Insel stapften, klang nicht nach meiner Vorstellung von Spaß.
»Ich freue mich, dass du immer noch begeistert bist, Sean. Das wird uns allen gut tun. Beth, Mary und Emma werden Zeit für sich haben, und wir kommen uns näher. Vielleicht auch näher zu Gott.«
»Ich dachte, du glaubst nicht an Gott. Jedenfalls hast du das Father Cleary gesagt.«
»Na ja, Sean, wenn du mal in mein Alter kommst, wirst du selber denken, es muss noch mehr geben zwischen Himmel und Erde … du verstehst?«
Ich wusste eigentlich auch nicht, ob ich an Gott glaubte, aber ich glaubte an St Michael, den Schutzpatron der Polizisten, und ich schuldete der Jungfrau Maria Dank, die vor knapp einem Jahr dabei geholfen hatte, Beth von der Abtreibung in Liverpool abzubringen.
»Möchtest du denn nicht lieber im Sommer wallfahren wie normale Leute?«, fragte ich.
»Nein. Der Papst meint, wenn du während der Fastenzeit eine Pilgerreise zu einem der alten Orte machst, dann wird diese besonders gesegnet sein.«
»Höret Alfred Duffy den Papst zitieren. Alfred Duffy, der Dr McGuinness dazu gezwungen hat, uns in der Schule von Darwin zu erzählen. Was ist denn mit dir los, Dad? Hast du einen Golfball an den Kopf gekriegt oder so was?«
Er grinste und lehnte sich mit blitzenden, wässrigblauen Augen zurück. »Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich dich fragen wollte. Machst du heute Abend bei dem Quiz mit? Wir haben noch nie gewonnen, aber mit dir im Team denke ich, haben wir eine gute Chance, die Kerle von der GAA endlich mal zu schlagen.«
»Ist das Ganze auf Englisch? Falls Beth mitkommen möchte?«
Dad lächelte, als der Name Beth fiel. »Ah, da hast du eine Gute erwischt. Du weißt, es macht uns nichts aus, dass sie, eine, na ja …«
»Rothaarige?«
»Protestantin ist.«
»Ach, ist sie das? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Na, das erklärt ja so manches.«
»Jetzt musst du sie nur noch heiraten, dann ist deine Mutter überglücklich.«
»Eine Hochzeit? Na komm schon, Dad. Unser Haufen auf der einen Seite der Kirche, und ihr Haufen auf der anderen?«, sagte ich, ohne die Tatsache zu erwähnen, dass Beth mir gedroht hatte, ich solle nicht mal auf die Idee kommen, ihr einen Antrag zu machen. »Außerdem ist Beths Vater nicht sonderlich gut auf mich zu sprechen«, fügte ich hinzu.
»Was macht er noch mal?«
»Er baut Häuser.«
»Er arbeitet mit den Händen. Gefällt mir.«
»Ich bezweifle, dass er, genau wie Gwendolen Fairfax, jemals einen Spaten überhaupt zu Gesicht bekommen hat. Er hat die Firma von seinem Vater geerbt. Er sitzt nur in seinem Büro herum und denkt sich die Straßennamen für seine neuen Baugebiete aus.«
»Wie benennt er sie denn?«
»Meist nach irgendwelchen nebensächlichen Mitgliedern der Royal Family. Oder nach Zeug aus der Bibel. Ich bin dem Mann nur zwei Mal begegnet, und ich glaube, er hätte versucht, mich mit seinen Golfschlägern zu erschlagen, wenn ich nicht bewaffnet gewesen wäre.«
»Ach, ein Golfer? Dann kann er so schlimm nicht sein. Welches Handicap hat er denn?«
»Handicap? Nun, er denkt, als würde er im 18. Jahrhundert leben, er ist stinkreich und zur Entspannung spielt er Golf in Down Royal oder segelt in seiner verflucht tollen Jacht herum. Sind das Handicaps genug?«
»Ja, du hast erwähnt, dass Beth Geld hat. Down Royal, hm. Da würde ich gern mal eine Runde drehen. Du könntest nicht vielleicht mal fragen, ob ich …«
»Nein, könnte ich nicht! Ich hab doch schon gesagt, er ist nicht mein größter Fan.«
»Vielleicht wäre er nicht so feindselig eingestellt, wenn du aus seiner Tochter eine ›ehrenwerte Frau‹ machst, wie man früher sagte.«
»Dad, vertrau mir, eine Heirat ist ausgeschlossen.«
»Nun, ich will dich nicht drängen. Jedes Mal, wenn ich versucht habe, dich zu etwas zu drängen, hat das nicht funktioniert. Ist mir um die Ohren geflogen, um ehrlich zu sein. Ich bedaure noch immer, dich auf dieses Vogelcamp auf Tory Island geschickt zu haben. Du hast dir die Augen ausgeweint und seitdem bestimmt kein Vogelbestimmungsbuch mehr in die Hand genommen.«
»Ganz recht. Bis zum heutigen Tag kenne ich nicht den Unterschied zwischen einer Amsel und einer Schwarzdrossel«, sagte ich, und mein Vater, den man leicht zufriedenstellen konnte, musste laut lachen (denn wie Sie ja sicher wissen, sind Amsel und Schwarzdrossel ein und dasselbe).
Das Dinner an jenem Abend war eine ausgelassene Angelegenheit. Einer von Dads Nachbarn hatte einen mächtigen Seebarsch gefangen, und Ma hatte ihn in einer Weißweinsauce mit Jakobsmuscheln und Kartoffeln gekocht, während Beth und ich Emma mit an den Strand nahmen und mit Steinen nach den Wellen warfen.
Wir saßen im Esszimmer unter den Porträts von John F. Kennedy und dem Hengst Shergar, dem Derbysieger (die beide in der Blüte des Lebens ermordet worden waren), im Kamin brannte ein Torffeuer, und der Regen prasselte gegen die Scheiben.
Beth, Emma und Ma blieben daheim, Dad und ich stapften zum Lost Fisherman wegen des wichtigsten Dorftermins der Woche, wenn man die Sonntagsmesse nicht mitzählte (was immer weniger Menschen taten, wo doch jede Woche ein neuer Kirchenskandal ans Licht kam). Dad stellte mich seinen Golferfreunden vor und meinte, mit mir im Team könnten sie die arroganten Mistkerle von der GAA, dem Irischen Sportverband, endlich schlagen.
Doch die GAA hatte an jenem Abend nichts zu bieten, und in der letzten Runde Allgemeinwissen ging es nur noch zwischen dem Golfclub und dem Bowlingclub um den Gewinn von 50 Pfund. Marty O’Reilly erklärte, dass es eine Stichfrage geben würde.
»Hier die Frage, und ich möchte, dass ihr bei der Antwort ganz präzise seid. Keine Zwischenrufe von den anderen Teams. Also gut, auf geht’s. Wie lauteten die ersten Worte, die von den Astronauten von Apollo 11 auf dem Mond gesprochen wurden? Alles verstanden? Gut. Die Antwort bitte wie üblich auf eine Karte schreiben und nach vorn bringen. Ich gebe euch zwei Minuten Bedenkzeit. Schluss damit! Kein Einflüstern von den anderen Teams!«
»Die ersten Worte vom Mond?«, fragte Davy Smith mit Panik in der Stimme, aber ich wusste, es gab keinen Grund zur Sorge, denn mein Dad grinste schon vor sich hin.
»Kein Problem, Alfred weiß es«, sagte ich.
»Weißt du es wirklich, Alfred?«, fragte Big Paul McBride.
»Schaut euch die Bowlingbrüder an. Die glauben die Antwort zu wissen, tun sie aber nicht!«, sagte Dad und rieb sich beinah die Hände vor Schadenfreude.
»Was soll das heißen, Dad?«
»Die meisten Leute glauben, dass die ersten auf dem Mond gesprochenen Worte lauteten: ›That’s one small step for man – that’s one giant leap for mankind.‹ Stimmt aber nicht. Es war auch nicht ›that’s one small step for a man‹, wie Armstrong behauptet. Das ist das, was Armstrong sagte, als er von der untersten Stufe der Leiter der Mondlandefähre stieg, aber Aldrin und er hatten bis dahin schon über eine Stunde lang geredet.«
»Und was waren die ersten Worte?«, fragte Jeanie Coulhouln ganz aufgeregt.
»Ich sag euch, was auch nicht die ersten Worte waren, nämlich: ›Houston, the eagle has landed.‹ Das glauben alle, aber das stimmt nicht«, beharrte Dad.
»Okay, das also auch nicht. Und wie lautet die richtige Antwort?«, fragte Jeanie.
»Tja«, meinte mein Vater und lächelte so selig wie Beda der Ehrwürdige. »Das wissen die meisten nicht, aber als die Mondlandefähre Lem die Oberfläche berührte, gab es ein kleines Licht, das ihnen verriet, wann sie tatsächlich gelandet waren. Ein Berührungslicht. Und kaum hatten sie die Mondoberfläche berührt, musste Buzz Aldrin an Armstrong melden, dass das Kontaktlicht an ist, damit der die Triebwerke ausschalten konnte. Also, sie kommen unten an, das Licht geht an, und Aldrin sagt: ›Contact light.‹ Also lauten die allerersten Worte, die auf dem Mond gesprochen wurden, ›contact light‹.«
»Und bist du dir sicher, Alfred?«, fragte Big Paul mit gezücktem Stift. »Das wäre das erste Mal, dass wir gewonnen hätten.«
»Ich bin mir sicher«, beharrte Dad.
Wir schrieben die Antwort auf unsere Karte. Der Bowlingclub schrieb seine Antwort ebenfalls auf, und beide reichten die Karten bei Marty ein.
Marty nahm das Mikrofon in die Hand und schüttelte sein verkniffenes altes Gesicht dramatisch hin und her. »Ladies und Gentlemen, ihr werdet es nicht glauben! Beide Teams haben eine falsche Antwort gegeben! Beide Teams liegen falsch, es gibt diese Woche also keinen klaren Gewinner, und wir werden den Topf teilen. Die Bowler haben geschrieben: ›that’s one small step for man‹, und die Golfer haben völlig den Verstand verloren und geschrieben: ›contact light‹, doch die richtige Antwort lautet natürlich: ›Houston, the eagle has landed!‹«
Als wir nach Hause kamen, hatte es aufgehört zu regnen, und wir trafen Beth, Emma und Ma am Ende der Gasse am Strand.
»Und wie ist es gelaufen? Habt ihr gewonnen?«, fragte Ma.
»Ich glaube, Dad will nicht darüber reden, am Ende hat es eine ziemliche Streiterei gegeben, lasst uns lieber reingehen und das Thema wechseln«, sagte ich schnell.
Dad hatte noch immer einen hochroten Kopf und sagte kein Wort; er verschwand im Bücherzimmer, und wir hörten disharmonische und wütende Musik. Vielleicht spielten Bix und Bax doch zusammen.
Am folgenden Morgen packte ich für die Wallfahrt nach Station Island. Graupel und Hagel trommelten gegen die Scheiben. Es war die erste Märzwoche, aber der Winter hatte uns noch immer fest in den Klauen. Ich saß auf dem Fensterbrett und schnappte nach Luft. In den letzten paar Wochen hatte ich Schwierigkeiten gehabt, in der Früh zu Atem zu kommen. Wenn ich mir keine Sorgen gemacht hätte, dass es sich um Krebs oder ein Emphysem handeln könnte, dann wäre ich schon längst zu einem Arzt gegangen. Das Rauchen hatte ich schon eingeschränkt, vielleicht sollte ich es ganz sein lassen?
»Wie geht’s dir, Sean?«, fragte Beth, und bevor ich antworten konnte, meinte sie: »Mach doch nicht so ein Gesicht, ich glaube, das wird für deinen Dad und dich ganz prima.«
»Willst du wirklich wissen, was ich davon halte?«
»Ist es etwas Positives?«
»Da fällt mir nichts ein. Nimmst du auch zwei Negative?«
»Nein.«
»Himmel, Beth, ich will wirklich nicht auf diese vermaledeite Wallfahrt gehen. Ich hab doch nur zugestimmt, weil ich dachte, er würde es wieder vergessen.«
»Sean! Telefon!«, rief meine Ma aus dem Wohnzimmer.
Ich ging den Flur entlang zu ihr und nahm den Hörer. »Hallo?«
»Sean, tut mir wirklich leid, dich im Urlaub stören zu müssen.«
Detective Sergeant McCrabban. Ich hatte seine nach Ballymena klingende, mürrische, zischende Art, Luft zu holen, schon erkannt, bevor er ein Wort gesagt hatte.
»Schon okay, Crabbie, alter Knabe. Ist mir ein Vergnügen, von dir zu hören.«
»Wie ist der Urlaub so?«
»Ganz okay, Crabbie. Es gießt in Strömen, aber was soll man in Donegal auch anderes erwarten? Alles okay bei euch?«
»Ja, alles okay.«
»Also, wie komme ich zu dem Vergnügen deines Anrufs?«
»Na ja, du hast gesagt, ich soll anrufen, falls es was Interessantes gibt.«
»Und, gibt es was Interessantes?«, fragte ich neugierig.
»Es hat einen Mord gegeben.«
»Was für eine Art von Mord?«
»Jemand hat einen Drogendealer umgebracht.«
»Klingt nicht sonderlich aufregend.«
»Nein, aber er wurde mit einem Pfeil ermordet. Man hat ihm einen Pfeil in den Rücken geschossen.«
»Indianer?«
»Nun …«
»Oder dieser Bösewicht aus Sherwood Forest, der den örtlichen Gesetzeshütern solche Schwierigkeiten bereitet?«
»Nun ja, da wäre noch eine Sache, die dich vielleicht interessieren könnte. Es handelt sich um den zweiten Dealer, der in ebenso vielen Tagen von einem Pfeil getroffen wurde.«
»Zwei Drogendealer. Und auf beide wurde mit Pfeilen geschossen?«
»Um ganz genau zu sein – und das ist ja in deinem Sinn –, handelt es sich um Bolzen aus einer Armbrust.«
»Von derselben Armbrust?«
»Wir haben den Bolzen noch nicht aus dem zweiten Opfer entfernen können. Wir haben es gerade erst entdeckt.«
»Verstehe. Und der erste Typ?«
»Der lebt noch.«
»Das ist gut. Nehme ich an. Und wo wurde er getroffen?«
»In den Rücken, genau wie Opfer Nummer zwei.«
»Hat er gesehen, wer geschossen hat?«
»Vielleicht, aber es ist wie immer: Er sagt nichts.«
»Natürlich nicht.«
»Und, kommst du zurück? Oder sollen Lawson und ich die Sache übernehmen? Liegt ganz bei dir, Sean, ich dachte, ich sag dir lieber Bescheid. Der erste Mord seit über einem Jahr, und dann auch noch so eine merkwürdige Sache …«
Ich sprach leise weiter. »Crabbie, nur unter uns, du rettest mir gerade das Leben, Kumpel. Hast du jemals vom Purgatorium von St Patrick gehört?«
»Nein.«
»Na, wie auch, du großer protestantischer Ungläubiger.«
Ich erklärte ihm schnell den Kern der Wallfahrt und was mein Dad unternehmen wollte.
»Du siehst also, Crabbie, wenn ich nach Carrickfergus zurückmuss, um diesen potenziellen Serienmord eines Armbrust schwingenden, selbsternannten Rächers aufzuklären, dann brauche ich nicht auf diese verfluchte Insel, um mir dort Warzen, Schimmel und Fußbrand zu holen.«
Crabbie war allerdings nicht der Mann, der religiöse Verpflichtungen leichthin abtat. »Nein«, entgegnete er nachdenklich. »Ich finde, du solltest diese Pilgerfahrt mit deinem Vater unternehmen. Es hört sich auf jeden Fall sehr heilig an, ehrlich.«
»Crabbie, hör zu, ich komme. Der Heilige Patrick und all die Sünder im Fegefeuer können warten.«
»Also gut, ich lasse niemanden an den Tatort, bis du hier bist. Wie lange brauchst du?«
»Es sind anderthalb Stunden bis Carrickfergus. Ohne das Baby im Auto wäre ich in einer Stunde da, aber so muss ich erst Frau und Kind absetzen und es unterwegs ruhig angehen lassen. Also neunzig Minuten. Vielleicht achtundachtzig, okay? Gibt es sonst noch was Neues?«
»Hast du schon von John Strong gehört?«
»Was ist mit ihm?«
»Er ist zu neuen Ufern aufgebrochen.«
»Zu den Himmlischen Heerscharen?«
»Er ist zum Assistant Chief Constable befördert worden.«
»Na, ist eh dasselbe. Endlich kommt mal jemand, den wir halbwegs leiden können, auf einen Befehlsposten.«
»Aye. Und was weißt du über Bulgarien?«
»Tja, ordentliche Abwehr, gutes Mittelfeld, nur im Angriff hapert es an Ideen. Warum?«
»Das erklär ich dir, wenn du hier bist. 15 Mountbatten Terrace, Sunnylands Estate«, gab Crabbie die Adresse durch.
»Sunnylands Estate – warum überrascht mich das nicht? Also gut, lass es ruhig angehen, Mann.«
Ich legte auf, setzte ein zerknirschtes Gesicht auf und ging in die Küche.
»Was ist denn los, Sean?«
»Ma, Dad, es tut mir wirklich leid, aber ich muss nach Carrickfergus zurück. Es hat einen Mord gegeben. Möglicherweise einen Serienmörder. Vielleicht sogar Selbstjustiz. Alle Mann auf Gefechtsstation für die Royal Ulster Constabulary Carrickfergus. Der Chef war in der Leitung. Die BBC. Ihr kennt das ja.«
»Was hat das alles zu bedeuten, Sean?«, fragte Dad.
»Ich muss nach Hause. Alle Mann an Deck. Wir müssen unsere Wallfahrt ein andermal machen.«
Ich sah, wie ihm die Erleichterung übers Gesicht huschte. »Ach, herrje. Ach, herrje. Was für eine Enttäuschung, Sohn. Ich wollte doch so gern gehen«, log er, dass sich die Balken bogen.
»Ich weiß, Dad. Ich wollte ja auch. Dann müssen wir es eben im Sommer machen, wenn das Wetter besser ist. Oder nächstes Jahr.«
»Ja! Wenn das Wetter besser ist.«
»Ein Mord, Sean? Du hast doch schon eine ganze Weile keinen Mord mehr gehabt«, meinte Ma.
»Nein. Der erste dieses Jahr. Ein Drogendealer, ein Pfeil in den Rücken.«
»Wie der Heilige Sebastian«, sagte Ma traurig.
»Der Heilige Sebastian wurde von vorn getroffen, Liebe. Mehrmals. Du erinnerst dich doch sicher an das Gemälde von Botticelli«, sagte Dad.
»Wen mein ich denn dann, dem in den Rücken geschossen wurde?«
»Jimmy Stewart in Der gebrochene Pfeil? Dem wurde in den Rücken geschossen. Er hat überlebt, aber die arme Debra Paget, seine Apachenfrau, die ist gestorben«, führte Dad aus.
»Debra Paget«, meinte Ma gedankenverloren.
»Will Geer hat auf sie geschossen, der später dann Grandpa Walton gespielt hat«, sagte Dad.
Das schlug die Richtung ein, die alle ihre Unterhaltungen nahmen, ich wusste also, dass ich sie auf der Stelle unterbrechen musste. Ich zeigte auf meine Uhr. »Tut mir wirklich leid mit der Wallfahrt, Dad. Ich hatte mich so darauf gefreut. Aber einer muss ja die Straßen sauber halten«, sagte ich, doch die beiden hörten mir schon nicht mehr zu.
»Lebt Jimmy Stewart eigentlich noch?«, fragte Ma.
»Und wie! Und gut in Schuss ist er. Er war doch erst letztes Jahr bei Gay Byrne in der Late Late Show«, betonte Dad.
»Debra Paget, der Name sagt mir was«, meinte Ma.
»Natürlich!«, beharrte Dad. »Sie war die Freundin von Elvis in Love Me Tender, und sie hat den Neffen von Chiang Kai-shek geheiratet. Im richtigen Leben, nicht in Love Me Tender.«
»Ach ja, richtig. Jetzt weiß ich wieder«, meinte Ma zufrieden.
Wieder zeigte ich auf meine Uhr. »Hört mal, Leute, es war toll, aber die Pflicht ruft.«
Wir packten unsere Taschen, umarmten meine Eltern und rannten hinaus in den Regen.
Ich suchte unter dem BMW nach einer Bombe und setzte Emma in den Kindersitz. Beth machte es sich vorn bequem.
Ich stieg ein und drehte den Schlüssel im Zündschloss. Wir mussten beide grinsen, als der 6-Zylinder Einspritzer kehlig zum Leben erwachte.
Achtundachtzig Minuten später war ich am Tatort.
2
Nur ein weiterer toter Dealer
Vor dem Haus Nummer 15 Mountbatten Terrace in Sunnylands Estate hatte sich eine kleine Menschenmenge eingefunden. Wenn es trocken gewesen wäre und kein Montag, dann wären es wohl mehr Menschen gewesen. Aber montags war nun mal der Meldetag beim Sozialamt, und in dieser Straße hier war mehr oder weniger jeder entweder arbeitslos oder arbeitsunfähig und musste sich daher auf dem Amt melden. Das war nicht immer der Fall gewesen. Als die Sozialsiedlung Sunnylands Estate Anfang der Sechziger errichtet worden war, hatte es in Carrickfergus drei große Textilfabriken gegeben, und in den Werften in Belfast nebenan hatten 20 000 Leute gearbeitet. Die Fabriken waren alle geschlossen worden, bei Harland and Wolff auf den Werften sorgten nur noch dreihundert Personen für Ordnung, und alle Versuche der Regierung, Arbeit nach Nordirland zu bringen, waren jämmerlich gescheitert. Die einzigen legalen Möglichkeiten zu der Zeit bestanden darin auszuwandern, zur Polizei zu gehen oder Arbeit beim Staat zu finden. Illegale Möglichkeiten fanden sich zuhauf, wenn man sich den Paras anschloss und Schutzgelder erpresste, oder man war ganz mutig und versuchte es mit Drogenhandel.
Unabhängige Dealer gab es nur wenige, denn ab und zu statuierten die protestantischen und katholischen Paras gern ein Exempel an ihnen, um der Bevölkerung zu beweisen, dass sie – und nicht die Polizei – diejenigen waren, die »die Straßen für unsere Kinder sauber hielten«. Natürlich begriff jeder östlich von Boston, Massachusetts, dass dies nur Heuchelei war. Mitte der Achtziger hatten die Paras von beiden Seiten in einer Reihe von Übereinkommen auf höchster Ebene Belfast unter sich aufgeteilt, wenn es um das Dealen mit Haschisch, Heroin, Speed und den beiden neuesten (und lukrativsten) Drogen in Irland ging: Ecstasy und Crack.
Die paar unabhängigen Dealer, die es noch gab, mussten äußerst diskret sein oder satte Schutzgelder zahlen, wenn sie nicht umgebracht werden wollten. Offenbar war dieser hier nicht diskret gewesen, oder er hatte dem örtlichen Para-Stammesfürsten seinen Anteil nicht gegeben. Ich hatte schon im Auto über die Geschichte mit dem Armbrustbolzen nachgedacht. Bei den Paras gab es reichlich Schusswaffen, jedoch war es für Privatbürger schwierig, an eine Waffe zu kommen, also ging es vielleicht auch um irgendein Kind mit einer Überdosis Heroin und einen Vater, der Rache üben wollte. Er kriegt keine Schusswaffe, aber er besorgt sich in einem Sportgeschäft eine Armbrust – so in etwa?
Ich stellte den BMW ab und stieg aus. Es handelte sich um eine trostlose kleine Straße; im Sommer musste es die reinste Hölle sein, wenn die einzigen Ablenkungen darin bestanden, alleinstehende Frauen an der Bushaltestelle zu belästigen und große Feuer aufzuschichten. Aus einem offenen Wohnzimmerfenster drang Frank Sinatras aufmunterndes »Come Fly with Me«, doch die etwa zwanzig Personen wirkten mürrisch und böswillig. Fast roch ich den Gestank aus billigen Fluppen, ungewaschenen Achselhöhlen, Lösungsmitteln, Feuerzeugbenzin und Carlsberg Special Brew. Es handelte sich um meist arbeitslose junge Männer, die sich durch einen Mord vor ihrer Haustür davon hatten abbringen lassen, sich zur Seite Drei einen von der Palme zu schütteln. Ich hasste es, meinen nagelneuen BMW 535i auf einer solchen Straße abzustellen, aber welche Wahl hatte ich denn?
Ein paar kleine Hosenscheißer tauchten auf und betatschten den Lack.
»Finger weg«, sagte ich.
»Sind Sie Polizist?«, fragte ein ganz kleines Mädchen.
»Ja!«
»Und wo ist Ihre Waffe?«
Ich klopfte auf mein Schulterholster.
»Und was für eine?«
»Eine Glock. Ein Mann namens Tschechow hat sie mir verkauft. Schätze, die werde ich irgendwann brauchen.« Perlen vor die Säue, aber es sind nun mal die kleinen Dinge, die einen durchs Leben bringen. Ich versuchte es bei dem Mädchen noch mal anders: »Warum springen Blinde nicht Fallschirm?«
»Keine Ahnung, Mister.«
»Weil sich sonst die Blindenhunde zu Tode erschrecken.«
Kein Mundwinkel zuckte. Bei diesem Haufen musste ich wohl eine ganze Slapsticknummer abziehen, aber für meinen Buster Keaton war es einfach noch zu früh am Morgen.
»Ist das Ihr Wagen, Mister, oder haben Sie den geklaut?«, fragte ein großes, besonders bedrohlich wirkendes Kind mit einem beunruhigenden Lispeln.
»Warum bist du denn nicht in der Schule, Jungchen?«
»Ich hab ein Attest. Ich krieg so fürchterliche Kopfschmerzen. Ich gehe nur zur Schule, wenn ich will«, erklärte er.
»Wie heißt du denn?«
»Stevie, Stevie Unwin«, antwortete er, und ich speicherte den Namen für später ab, wenn das Ding in seinem Hirn, das ihm die Kopfschmerzen verursachte, ihn mit einem Gewehr einen Turm hinauftreiben sollte.
»Pass auf den Wagen auf, Stevie, und lass niemanden mit Dreckpfoten dran«, sagte ich, drückte ihm den üblichen Fünfer in die Hand und ging auf die Menge zu. »Platz machen da vorn, Platz machen«, sagte ich. Die Menge teilte sich unwillig und feindselig, und manche murmelten solch höchst originelle Dinge wie »verfluchter Bulle« und »Scheißpolente«.
Wie Jules Maigret traf ich emotional völlig abgestumpft an der scène du crime ein. Nur dass der gute alte Jules solch einen Tatort nie gesehen hatte. Der tote Dealer lag mit dem Gesicht nach unten im Vorgarten, auf halber Strecke zur Haustür. Er hatte orangefarbene Haare und trug eine ärmellose Jeansjacke, auf der mit Nieten gesetzt »Slayer« stand. Unter der Jeansjacke trug er eine hellblaue Motorradjacke. Um das Ganze abzurunden, hatte er noch eine gebleichte Jeans und Cowboystiefel an. Der Bolzen steckte hinten in der linken Schulter.
Ich war überrascht, dass der Tatort noch nicht abgesperrt war und sich keinerlei Anzeichen von Kriminaltechnikern oder ihrer Tätigkeit fanden. Stattdessen stand die Menge so nah bei der Leiche, dass Zigarettenasche auf den Verblichenen fiel und den Tatort verunreinigte.
Mir kochte das Blut in den Adern. Bei jeder anderen Polizeitruppe hätte man das Chaos genannt. Bei den Jungs des Carrickfergus Criminal Investigation Department nahm man solche Worte wie »Chaos« oder »Fiasko« natürlich nicht in den Mund, zumindest nicht in meiner Gegenwart, aber wenn das hier kein Chaos war, dann konnte es gut dessen Stelle einnehmen, bis das wahre Chaos in Form der Ballyclare Royal Ulster Constabulary, der Larne RUC oder gar dieser Arschlöcher von jenseits des Wassers hereinbrach.
»Alle zurücktreten!«, befahl ich und schob ein paar der Gaffer mit beiden Händen von der Leiche fort. »Zurück auf den Bürgersteig, und macht eure Kippen aus!«
Wo waren die Kriminaltechniker? Und warum waren hier keine Uniformierten abgestellt, um die Leute auf Abstand zu halten?
Was zum Teufel war hier los?
Ein Hinterhalt? Nein, die Gaffer wären erheblich vorsichtiger, wenn es hier einen Angriff geben sollte. Machten die Techniker gerade Teepause? Durchaus möglich, wenn man an ihr auch ansonsten merkwürdiges Gebaren dachte, aber sie wären niemals verschwunden und hätten einen Haufen Idioten hier stehen lassen und ihnen erlaubt, die Leiche mit Zigarettenasche zu bestreuen.
Die Menge hinter mir drängte nach. »Zurück, habe ich gesagt. Hier gibt es nichts zu sehen, der wird keine Tricks mehr aus dem Hut zaubern, er ist doch nicht Lazarus, verflucht.«
Ich schaute mir die Leiche an, während die Menge mich neugierig beobachtete und Sinatra »Chicago« sang, also handelte es sich um die britische Plattenfassung, nicht die amerikanische. Sinatra konnte ich mir anhören oder auch nicht, meistens auch nicht, und so langsam ging mir die Platte auf die Nerven. »Und mach doch mal jemand diese beschissene Musik aus!«, brüllte ich, und augenblicklich hörte man die Nadel über die Scheibe kratzen.
Jetzt herrschte Stille, bis auf den Wind, der durch die Chipstüten und Einkaufsbeutel fuhr, und das Meckern einer Ziege, die an einem Ziegelstein im überwucherten Nachbargrundstück festgemacht war und versuchte, über den Zaun zu klettern und die Schnürsenkel des Opfers zu fressen. Sie kam nicht heran, sabberte aber ebenfalls auf den Tatort.
»Und schaff jemand diese Ziege fort!«, sagte ich.
»Und wie kommen Sie darauf, uns rumzuscheuchen?«, fragte eine Frau mit einem East Belfaster Akzent, der sich anhörte wie Glasscherben unter einem Springerstiefel.
Ich griff in die Tasche nach meinem Dienstausweis, doch der steckte noch in einer meiner Taschen in der Coronation Road.
»Detective Inspector Duffy, Carrickfergus CID«, sagte ich und zückte stattdessen meine Videoclub-Mitgliedskarte.
Die Menge wirkte beeindruckt und wich ein paar Schritte zurück.
Ich zeigte auf einen mir dafür geeigneten Burschen, dessen Liverpool-FC-Schal Anzeichen für eine überdurchschnittliche Intelligenz war.
»Sonnyboy, tu mir den Gefallen und schaff die Ziege von dem Zaun weg«, forderte ich ihn auf.
»Und was soll ich mit dem Vieh machen?«
»Siehst du den Einkaufswagen mit den Steinen da drüben? Binde sie da fest. Hier hast du ein Pfund für deine Mühe«, sagte ich.
Er schnappte das Seil, ging nach nebenan und zerrte die Ziege von der Leiche fort.
»Also gut! Was ist hier los? Wo sind die anderen Polizisten hin?«, fragte ich die Menge, doch jetzt starrten sich alle auf die Schuhe und sagten keinen Ton. Das stets präsente, ewig nervende Belfaster Gesetz trat in Kraft: Was immer du sagst, sag nichts