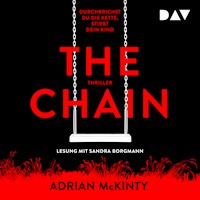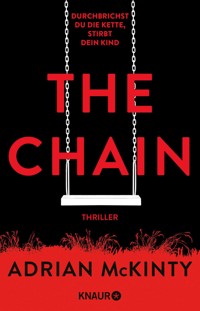
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Ein Thriller, der mit unseren schlimmsten Ängsten spielt, bis zum letzten Atemzug: Stell dir vor, sie kidnappen dein Kind, um es zurückzubekommen, musst auch du ein Kind entführen … Was als ganz normaler Tag begann, wird zum Albtraum für die alleinerziehende Rachel, als ihre 13-jährige Tochter auf dem Weg zur Schule verschwindet. Die einzige Spur: Das Handy des Mädchens wird an der Bushaltestelle gefunden. Tatsächlich erhält Rachel kurz darauf einen Anruf von der Entführerin. Die Frau am Hörer – ebenfalls Mutter eines entführten Kindes –, gibt sich als Kylies Kidnapperin zu erkennen. Sie ist Teil des perfiden Netzwerks »The Chain«. Und sie hat Rachel auserwählt, die Kette der Kindes-Entführungen weiterzuführen: Wenn Rachel ihr Kind lebend wiedersehen will, muss sie nicht nur binnen weniger Stunden das Lösegeld auftreiben – sie muss ihrerseits ein Kind entführen und dessen Eltern dazu bringen, dasselbe zu tun. Die Kette muss weitergehen … Höllischer Nervenkitzel aus den USA vom preisgekrönten Autor Adrian McKinty. »›The Chain‹ gehört in die Liga der Weltklasse-Thriller à la ›Gone Girl‹ und ›Das Schweigen der Lämmer‹.« Don Winslow
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 464
Ähnliche
Adrian McKinty
THE CHAIN
DURCHBRICHST DU DIE KETTE, STIRBT DEIN KINDThriller
Aus dem Englischen von Anke und Eberhard Kreutzer
Knaur e-books
Über dieses Buch
Ein Thriller, der mit unseren schlimmsten Ängsten spielt, bis zum letzten Atemzug: Stell dir vor, sie kidnappen dein Kind, um es zurückzubekommen, musst auch du ein Kind entführen …
Was als ganz normaler Tag begann, wird zum Albtraum für die alleinerziehende Rachel, als ihre 13-jährige Tochter auf dem Weg zur Schule verschwindet. Die einzige Spur: Das Handy des Mädchens wird an der Bushaltestelle gefunden. Tatsächlich erhält Rachel kurz darauf einen Anruf. Die Frau am Hörer – ebenfalls Mutter eines entführten Kindes –, gibt sich als Kylies Kidnapperin zu erkennen. Sie ist Teil des perfiden Netzwerks »The Chain«. Und sie hat Rachel auserwählt, die Kette der Kindes-Entführungen weiterzuführen: Wenn Rachel ihr Kind lebend wiedersehen will, muss sie nicht nur binnen weniger Stunden das Lösegeld auftreiben – sie muss ihrerseits ein Kind entführen und dessen Eltern dazu bringen, dasselbe zu tun. Die Kette muss weitergehen …
Inhaltsübersicht
Viel weniger irrt, wer, mit zu finsterm Blicke, diese Welt als eine Art Hölle ansieht …
Arthur Schopenhauer,
Parerga und Paralipomena, 1851
We must never break the chain.
Stevie Nicks, »The Chain« (Original-Demo), 1976
TEIL EINS
ALL DIE VERSCHWUNDENEN MÄDCHEN
1
Sie sitzt an der Bushaltestelle und überprüft in ihrem Instagram-Profil die Likes, deshalb bemerkt sie den Mann mit der Waffe erst, als er fast bei ihr ist.
Sie hätte ihre Schultasche fallen lassen und wegrennen können, quer über das Marschland. Sie ist dreizehn, eine schnelle Läuferin und mit allen Sümpfen und mit dem Treibsand auf Plum Island vertraut. Vom Meer zieht ein wenig Morgennebel auf, und der Mann ist groß und schwerfällig. Eine Verfolgung würde ihn verunsichern, möglicherweise würde er aufgeben, bevor um acht der Schulbus kommt.
Das alles geht ihr in einer einzigen Sekunde durch den Kopf.
Jetzt steht der Mann direkt vor ihr. Er trägt eine schwarze Skimaske und richtet die Waffe direkt auf ihre Brust. Sie schnappt nach Luft und lässt ihr Handy fallen. Das Ganze ist eindeutig kein Scherz oder dummer Streich. Es ist November. Halloween war vor einer Woche.
»Weißt du, was das ist?«, fragt der Mann.
»Eine Pistole«, sagt Kylie.
»Es ist eine Pistole, die auf dein Herz zielt. Wenn du schreist oder dich wehrst oder versuchst wegzulaufen, erschieße ich dich. Verstehst du?«
Sie nickt.
»Gut. Bleib ruhig. Leg dir diese Augenbinde um. Was deine Mutter in den nächsten vierundzwanzig Stunden tut, entscheidet darüber, ob du am Leben bleibst oder stirbst. Und wenn … falls wir dich gehen lassen, möchten wir nicht, dass du uns wiedererkennen kannst.«
Mit zitternden Händen legt sich Kylie die elastische Augenbinde um.
Neben ihr hält ein Wagen. Die Tür wird geöffnet.
»Steig ein. Stoß dir nicht den Kopf«, sagt der Mann. Sie tastet sich in den Wagen vor. Hinter ihr geht die Tür zu.
Kylies Gedanken rasen. Sie weiß, sie hätte nicht in den Wagen steigen dürfen. Genau so verschwinden Mädchen. So verschwinden tagtäglich Mädchen. Sobald du eingestiegen bist, war’s das. Sobald du eingestiegen bist, tauchst du nie wieder auf. Man steigt nicht in ein Auto, man macht kehrt und rennt, rennt, rennt.
Zu spät.
»Schnall sie an«, sagt eine Frau vom Vordersitz aus.
Kylie kommen hinter der Augenbinde die Tränen.
Der Mann rutscht neben sie auf den Rücksitz und legt ihr den Gurt an. »Bitte, Kylie, versuch, ruhig zu bleiben. Wir wollen dir wirklich nichts tun«, sagt er.
»Das muss ein Irrtum sein«, bringt sie heraus. »Meine Mom hat kein Geld. In dem neuen Job fängt sie erst –«
»Sag ihr, sie soll aufhören zu reden!«, faucht die Frau vom Vordersitz.
»Es geht nicht ums Geld, Kylie«, sagt der Mann. »Hör mal, halt einfach den Mund, okay?«
Der Wagen fährt los, und hinter ihm scheint Schotter aufzustieben. Er beschleunigt stark, wird von einem Gang in den nächsten geschaltet.
Kylie horcht, wie sie über die Plum-Island-Brücke fahren, und sie zuckt zusammen, als sie das röhrende Brummen des Schulbusses hört, der in entgegengesetzter Richtung an ihnen vorbeikommt.
»Fahr langsamer«, sagt der Mann.
Die Zentralverriegelung schnappt zu, und Kylie verflucht sich innerlich dafür, dass sie die Chance verpasst hat. Sie hätte den Gurt lösen, die Tür aufstoßen und sich hinausrollen können. Eine Woge blinder Panik erfasst sie. »Wieso tun Sie das?«, schluchzt sie.
»Was soll ich ihr sagen?«, fragt der Mann.
»Sag gar nichts. Sag ihr, sie soll verdammt noch mal die Klappe halten«, erwidert die Frau.
»Du darfst nicht reden, Kylie«, sagt der Mann.
Sie fahren schnell, wahrscheinlich auf der Water Street, nicht weit von Newburyport. Kylie zwingt sich, ruhig zu atmen. Ein und aus, ein und aus, so wie es ihnen die Schulpsychologin im Meditationskurs beigebracht hat. Sie weiß, dass sie wachsam und geduldig sein muss, wenn sie am Leben bleiben will. Sie ist im Leistungskurs der achten Klasse. Alle sagen, sie sei schlau. Sie muss die Ruhe bewahren und auf alles achten und ihre Chance nutzen, wenn sie kommt.
Dieses Mädchen damals in Österreich hat überlebt, genau wie die in Cleveland. Und sie hat auf Good Morning America das Interview mit der jungen Mormonin gesehen, die mit vierzehn entführt wurde. All diese Mädchen haben überlebt. Sie hatten Glück, aber vielleicht war es auch mehr als nur Glück.
Sie schluckt ein weiteres Aufwallen ihrer Panik herunter, an dem sie fast erstickt.
Kylie hört, wie sie in Newburyport auf die Brücke zur Route 1 fahren. Demnach wollen sie über den Merrimack Richtung New Hampshire.
»Nicht so schnell«, murmelt der Mann, und einige Minuten geht es langsamer weiter, doch dann gibt die Frau vorn wieder Gas.
Kylie denkt an ihre Mom. Heute Morgen fährt sie nach Boston zu ihrer Onkologin. Arme Mom, das hier wird –
»Oh, mein Gott«, sagt die Frau am Steuer erschrocken.
»Was ist los?«, fragt der Mann.
»Wir sind an der Bundesstaatengrenze gerade an einem Polizeiwagen vorbeigekommen.«
»Egal, ich glaube, du bist im … nein, o Gott, sein Blinklicht geht an«, sagt der Mann. »Er winkt dich raus. Du bist zu schnell gefahren! Du musst anhalten.«
»Ich weiß«, antwortet die Frau.
»Wird schon gut gehen. Das Auto wurde bestimmt noch nicht als gestohlen gemeldet.«
»Der Wagen ist nicht das Problem. Sie ist das Problem. Gib mir die Pistole.«
»Was hast du vor?«
»Was sollen wir bloß tun?«
»Wir können uns sicher rausreden«, beharrt der Mann.
»Mit einem entführten Mädchen auf dem Rücksitz, das eine Augenbinde trägt?«
»Sie wird nichts sagen, oder, Kylie?«
»Nein, bestimmt nicht«, wimmert Kylie.
»Sag ihr, sie soll den Mund halten. Sag ihr, sie soll das Ding abnehmen und den Kopf gesenkt halten«, schnauzt die Frau.
»Mach die Augen zu. Und keinen Mucks«, sagt der Mann, nimmt Kylie die Augenbinde ab und drückt ihren Kopf nach unten.
Die Frau fährt auf den Seitenstreifen, und vermutlich hält der Polizeiwagen hinter ihnen. Offenbar beobachtet die Frau den Polizisten im Rückspiegel. »Er schreibt sich das Kennzeichen auf. Hat es wahrscheinlich auch schon per Funk durchgegeben«, sagt sie.
»Nur die Ruhe. Du wirst mit ihm reden, alles wird gut.«
»Bei der Grenzpolizei haben alle Wagen Dashcams, oder?«
»Keine Ahnung.«
»Sie werden nach diesem Fahrzeug suchen. Nach drei Personen. Wir werden den Wagen in der Scheune verstecken müssen. Vielleicht jahrelang.«
»Übertreibe mal nicht. Er stellt dir vermutlich nur einen Strafzettel aus, weil du zu schnell warst.«
Kylie hört Schritte auf dem Schotter knirschen, als der Polizist aus seinem Fahrzeug steigt und herüberkommt. Sie hört, wie die Frau auf der Fahrerseite die Scheibe hinunterlässt. »O Gott«, flüstert sie, als der Mann den Wagen erreicht.
Die Schritte verharren am geöffneten Fenster.
»Gibt es ein Problem, Officer?«, fragt die Frau.
»Ma’am, wissen Sie, wie schnell Sie gefahren sind?«, fragt der Polizist.
»Nein«, erwidert die Frau.
»Ich hab Sie mit zweiundfünfzig Meilen gemessen. Das hier ist eine Fünfundzwanzigerzone, Schuleinzugsgebiet. Wahrscheinlich haben Sie die Schilder übersehen.«
»Oh, ich wusste nicht, dass hier in der Gegend eine Schule ist.«
»Es stehen aber überall Schilder, Ma’am.«
»Tut mir leid, hab ich wirklich nicht gesehen.«
»Darf ich mal Ihren …«, beginnt der Polizist, hält dann aber inne. Kylie weiß, dass er sie entdeckt hat. Sie zittert am ganzen Leib.
»Sir, ist das da neben Ihnen Ihre Tochter?«, fragt der Polizist.
»Ja«, antwortet der Mann.
»Miss, kannst du mich bitte kurz ansehen?«
Kylie hebt den Kopf, lässt die Augen aber weiterhin geschlossen. Sie zittert immer noch. Der Polizist hat sicher gesehen, dass etwas nicht stimmt. Eine Sekunde vergeht, in der sie alle – der Polizist, Kylie, die Frau und der Mann – fieberhaft überlegen, was sie tun sollen.
Die Frau stöhnt auf, dann ist ein Schuss zu hören.
2
Es ist eine Routineuntersuchung bei der Onkologin, alle sechs Monate, um sicherzugehen, dass alles in Ordnung und der Brustkrebs weiterhin in Remission ist. Rachel hat Kylie gesagt, sie solle sich keine Sorgen machen, sie fühle sich großartig, und bestimmt sei alles gut.
Insgeheim weiß sie natürlich, dass doch etwas sein könnte. Ursprünglich war der Termin erst für den Dienstag vor Thanksgiving vereinbart, doch letzte Woche hat sie im Labor ein Blutbild machen lassen, und nachdem die Ergebnisse vorlagen, hat sie Dr. Reed schon für heute zu sich bestellt. Früh am Morgen. Und Dr. Reed aus Nova Scotia ist eine nüchterne, unaufgeregte Frau, die sich zu keiner Überreaktion hinreißen lässt.
Während der Fahrt auf der I-95 Richtung Süden versucht Rachel, sich abzulenken.
Wozu sich verrückt machen? Schließlich weiß sie noch nichts. Vielleicht will Dr. Reed ja auch nur über Thanksgiving nach Hause und hat alle ihre Termine vorverlegt.
Rachel fühlt sich nicht krank. In Wahrheit ist es ihr seit Jahren nicht mehr so gut gegangen. Eine Zeit lang hatte sie geglaubt, dass sie das Unglück regelrecht anzieht, doch das ist vorbei. Die Scheidung liegt hinter ihr. Für die neue Stelle, die sie im Januar antritt, schreibt sie an ihren Philosophie-Vorlesungen. Ihr Haar ist seit der Chemo schon deutlich nachgewachsen, sie ist bei Kräften und legt an Gewicht zu. Der psychische Tribut für das vergangene Jahr ist gezahlt. Sie ist wieder die gut organisierte Frau, die alles im Griff hat, die Frau, die damals zwei Jobs gestemmt hat, um Marty durchs Jurastudium zu bekommen und das Haus auf Plum Island kaufen zu können.
Sie ist erst fünfunddreißig. Sie hat das Leben noch vor sich.
Klopf auf Holz, denkt sie und pocht auf das Armaturenbrett, das hoffentlich aus Holz, vermutlich aber eher aus Kunststoff ist. In dem Durcheinander, das im Laderaum des Volvo 240 herrscht, müsste sich noch ein alter Spazierstock aus Eiche befinden, aber jetzt besser nicht nach hinten greifen und dabei Kopf und Kragen riskieren.
Auf dem Handy ist es 8:36 Uhr. Kylie steigt jetzt sicher gerade aus dem Bus und schlendert mit Stuart über den Schulhof. Sie schreibt ihr den dämlichen Witz, der ihr schon den ganzen Morgen durch den Kopf geht.
Descartes geht in eine Bar und setzt sich an den Tresen. Fragt ihn der Barkeeper: »Wissen Sie schon, was Sie trinken möchten?« »Ich denke nicht …«, sagt Descartes und fällt tot vom Hocker.
Als Kylie nach einer Minute noch nicht geantwortet hat, schreibt Rachel erneut.
Komm schon, habt ihr doch gerade in Philosophie durchgenommen. Ich denke …
Immer noch keine Antwort.
Fällt der Groschen?,
schreibt Rachel.
Kylie ignoriert sie offenbar mit Absicht. Aber, denkt Rachel grinsend, Stuart muss bestimmt darüber lachen. Er lacht immer über ihre albernen Witze.
Es ist jetzt 8:38 Uhr, und inzwischen herrscht dichter Verkehr.
Sie will nicht zu spät kommen. Sie kommt nie zu spät. Vielleicht sollte sie die Autobahn verlassen und auf der Route 1 weiterfahren?
In Kanada feiert man Thanksgiving an einem anderen Tag, fällt ihr gerade ein. Demnach will Dr. Reed sie wohl doch früher sehen, weil die Laborwerte nicht so rosig sind. »Nein«, sagt sie laut und schüttelt den Kopf. Sie wird nicht wieder in diese alte Spirale negativen Denkens gleiten. Sie wird nach vorn blicken. Und obwohl sie immer noch die »Staatsbürgerschaft im Reich der Kranken« besitzt, wie es Susan Sontag in ihrem Buch über den Krebs formuliert, ist er nicht das, was sie ausmacht. Das hat sie hinter sich, genauso wie das Kellnern und das Chauffieren bei Uber und auf Martys Süßholzraspeln hereinzufallen.
Endlich schöpft sie aus, was in ihr steckt. Sie ist jetzt Dozentin. Sie denkt an ihre Einführungsvorlesung. Vielleicht ist Schopenhauer für manche etwas zu schwere Kost. Vielleicht sollte sie den Kurs mit diesem Witz über Sartre und die Kellnerin im Deux –
Ihr Handy klingelt und schreckt sie aus ihren Gedanken auf. Unbekannter Anrufer, liest sie.
Sie meldet sich über die Freisprecheinrichtung. »Hallo?«
»Zwei Dinge müssen Sie sich einprägen«, sagt eine mechanisch verzerrte Stimme. »Zum einen: Sie sind nicht die Erste und Sie werden ganz bestimmt nicht die Letzte sein. Zum anderen: Denken Sie dran, es geht nicht ums Geld – es geht um die KETTE.«
Das muss irgendein blöder Scherz sein, meldet sich ein Areal ihres Gehirns. Doch andere, tiefere, urtümlichere Strukturen ihres Kleinhirns reagieren auf eine Weise, die man nur als blanke, animalische Angst beschreiben kann.
»Ich glaube, Sie haben sich verwählt«, erwidert sie.
Die Stimme fährt unbeirrt fort: »In fünf Minuten werden Sie den wichtigsten Anruf Ihres Lebens bekommen, Rachel. Sie müssen auf die Standspur fahren und anhalten. Sie müssen einen klaren Kopf bewahren. Sie werden detaillierte Anweisungen erhalten. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Handy voll aufgeladen ist, und halten Sie Stift und Papier bereit, um mitzuschreiben. Ich will nicht behaupten, dass die Sache leicht für Sie wird. Stellen Sie sich auf ein paar sehr schwierige Tage ein, doch die KETTE bringt Sie da durch.«
Ihr wird eiskalt. Sie hat einen metallischen Geschmack im Mund und nur noch Watte im Kopf. »Ich rufe die Polizei oder –«
»Keine Polizei. Keine Strafverfolgung, welcher Art auch immer. Sie schaffen das schon, Rachel. Die Wahl wäre nicht auf Sie gefallen, wenn wir Sie für jemanden halten würden, der unter der Sache zusammenbricht. Was von Ihnen verlangt wird, mag Ihnen jetzt unmöglich erscheinen, doch es liegt ganz und gar im Rahmen Ihrer Fähigkeiten.«
Ein Eissplitter rutscht an ihrer Wirbelsäule hinunter. Ein Hinweis aus der Zukunft in die Gegenwart. Eine furchterregende Zukunft offenbar, die in wenigen Minuten Wirklichkeit werden soll.
»Wer sind Sie?«, fragt sie.
»Beten Sie, dass Sie nie herausfinden, wer wir sind und wozu wir imstande sind.«
Die Verbindung wird unterbrochen.
Sie überprüft erneut die Anruferkennung, doch die Nummer erscheint immer noch nicht. Aber diese Stimme ist noch da, bis zur Unkenntlichkeit verzerrt, die Ansprache wohldurchdacht: selbstsicher, eiskalt, arrogant. Was soll das heißen, dass sie den wichtigsten Anruf ihres Lebens bekommt? Rachel blickt in den Rückspiegel und wechselt von der Überholspur auf die Mittelspur, nur für den Fall, dass tatsächlich ein zweiter Anruf folgt.
Sie zupft gerade nervös an einem Fädchen, das sich an ihrem roten Pullover löst, als das Smartphone klingelt.
Unbekannter Anrufer.
Ihr Finger tippt auf den grünen Hörer. »Hallo?«
»Ist da Rachel O’Neill?«, fragt jemand, eine andere Stimme. Eine Frau. Eine Frau, die sehr aufgeregt klingt.
Am liebsten würde Rachel verneinen, das drohende Unheil abwenden, indem sie erklärt, sie habe wieder ihren Mädchennamen angenommen – Rachel Klein –, aber sie weiß, dass ihr das nichts bringt. Nichts, was sie sagen oder tun kann, wird diese Frau davon abhalten, ihr gleich mitzuteilen, dass das Schlimmste passiert ist.
»Ja«, sagt sie.
»Es tut mir leid, Rachel, ich habe eine schlimme Nachricht für Sie. Haben Sie Stift und Papier zur Hand? Sie müssen sich einige Anweisungen notieren.«
»Was ist passiert?«, fragt sie, nunmehr in heller Panik.
»Ich habe Ihre Tochter entführt.«
3
Der Himmel stürzt herab. Wie Blei stürzt er herab. Sie kann nicht atmen. Sie will gar nicht atmen. Ihr kleines Mädchen. Nein. Das ist nicht wahr. Niemand hat Kylie entführt. Diese Frau hört sich nicht an wie eine Entführerin. Es ist eine Lüge.
»Kylie ist in der Schule«, sagt Rachel.
»Nein. Ich habe sie. Ich habe sie entführt.«
»Sie sind nicht … das ist ein böser Scherz.«
»Die Sache ist mir todernst. Wir haben uns Kylie an der Bushaltestelle geschnappt. Ich schicke Ihnen ein Foto von ihr.«
In der nächsten Sekunde kommt ein Foto von einem Mädchen, das eine Augenbinde trägt und im Fond eines Wagens sitzt. Das Mädchen trägt denselben schwarzen Pullover und beigefarbenen Wollmantel wie Kylie heute Morgen, als sie das Haus verließ. Das Mädchen hat Kylies sommersprossige Stupsnase und ihr braunes Haar mit den roten Strähnchen. Sie ist es, keine Frage.
Rachel wird speiübel. Sie sieht plötzlich alles verschwommen. Sie lässt das Lenkrad los. Als der Volvo aus der Spur gerät, erhebt sich ein Hupkonzert.
Die Frau redet immer noch. »Sie müssen ruhig bleiben, zuhören und verstehen, was ich Ihnen sage. Sie müssen es genauso machen, wie ich es gemacht habe. Sie müssen alle Anweisungen aufschreiben und sie dann genau befolgen. Wenn Sie gegen die Anweisungen verstoßen oder die Polizei einschalten, wird das Ihnen zur Last gelegt und auch mir. Das bezahlt Ihre Tochter mit dem Leben – und mein Sohn ebenfalls. Schreiben Sie sich also alles auf, was ich Ihnen jetzt sage.«
Rachel reibt sich die Augen. Sie hat ein Dröhnen im Kopf, es rauscht wie eine gigantische Woge heran und droht jeden Moment über ihr zusammenzubrechen. Das Allerschlimmste, was es auf der Welt gibt, geschieht offenbar gerade. Ist sogar schon geschehen.
»Ich will mit Kylie reden, Sie Miststück!«, schreit sie, packt das Lenkrad, reißt den Volvo herum, wobei sie nur knapp einem tonnenschweren Lkw ausweichen kann. Sie überquert die rechte Fahrspur und schwenkt auf den Seitenstreifen. Schlitternd kommt sie zum Stehen, während mehrere Fahrer auf die Hupe drücken und Obszönitäten brüllen.
»Bis jetzt geht es Kylie gut.«
»Ich rufe die Polizei!«, wimmert Rachel.
»Nein, das tun Sie nicht. Sie müssen sich beruhigen, Rachel. Ich wäre nicht auf Sie gekommen, hätte ich befürchten müssen, dass Sie die Nerven verlieren. Ich habe über Sie recherchiert. Ich weiß von Harvard und von Ihrem Krebs. Und von Ihrer neuen Stelle. Sie sind gut organisiert, und ich bin mir sicher, Sie werden das hier nicht vermasseln. Denn wenn es doch passiert, ist die Folge ganz einfach: Ihre Tochter und mein Sohn werden sterben. Jetzt schnappen Sie sich ein Blatt Papier und schreiben mit.«
Rachel holt tief Luft und zieht ihren Terminkalender aus der Handtasche. »Okay«, sagt sie.
»Sie sind jetzt in der KETTE, Rachel. Wie ich auch. Und die KETTE weiß sich zu schützen. Die erste Regel lautet also: keine Polizei. Sollten Sie doch auch nur ein einziges Mal mit einem Polizisten reden, werden die Leute, die hinter der KETTE stehen, davon erfahren und mir befehlen, Kylie umzubringen und mir eine andere Zielperson zu suchen, und genau das werde ich dann tun. Sie und Ihre Familie sind denen völlig egal; es geht ihnen einzig und allein um die Sicherheit der KETTE. Verstanden?«
»Keine Polizei«, sagt Rachel wie betäubt.
»Zweitens: Prepaid-Handys. Sie müssen sich anonyme Prepaid-Handys kaufen, die Sie jeweils nur für ein einziges Telefonat benutzen, so wie ich jetzt. Alles klar?«
»Ja.«
»Drittens müssen Sie sich die Suchmaschine für das Tor-Netzwerk herunterladen, um ins Darknet zu gelangen. Es ist knifflig, aber Sie schaffen das schon. Suchen Sie auf Tor nach InfinityProjects. Schreiben Sie mit?«
»Ja.«
»Der Name InfinityProjects bedeutet nichts weiter, aber auf der Website finden Sie ein Bitcoin-Konto. Auf Tor können Sie bei einem halben Dutzend Anbietern per Kreditkarte oder telegrafischer Überweisung Bitcoins kaufen. Die TAN-Nummer für InfinityProjects ist zwei-zwei-acht-neun-sieben-vier-vier. Schreiben Sie sich das auf. Sobald das Geld überwiesen ist, lässt es sich nicht mehr zurückverfolgen. Die KETTE verlangt fünfundzwanzigtausend Dollar von Ihnen.«
»Fünfundzwanzigtausend Dollar? Wie soll ich –«
»Ist mir egal, Rachel. Kredithai, zweite Hypothek, Auftragsmord, was weiß ich. Egal. Hauptsache, Sie besorgen das Geld. Sie zahlen es ein, und Teil eins ist geschafft. Teil zwei ist schwerer.«
»Was ist Teil zwei?«, fragt Rachel alarmiert.
»Ich soll Ihnen sagen, dass Sie nicht die Erste sind und nicht die Letzte sein werden. Sie sind in der KETTE, und die reicht schon sehr weit zurück. Ich habe Ihre Tochter entführt, damit mein Junge freikommt. Er wird von einem Mann und einer Frau gefangen gehalten, die ich nicht kenne. Sie müssen sich jetzt eine Zielperson aussuchen und jemanden entführen, den diese Person liebt, damit die KETTE weitergeht.«
»Was? Sind Sie verrü–«
»Hören Sie mir zu. Das ist wichtig. Sie werden jemanden entführen, der in der KETTE Ihre Tochter ersetzt.«
»Was reden Sie da?«
»Sie müssen eine Zielperson finden und einen Menschen, den er oder sie liebt, entführen und gefangen halten, bis die Zielperson das Lösegeld zahlt und ihrerseits jemanden entführt. Dann müssen Sie denjenigen, den Sie sich ausgesucht haben, anrufen und ihm oder ihr haargenau dasselbe erklären wie ich jetzt Ihnen. Was ich Ihnen gerade antue, das werden Sie Ihrer Zielperson antun. Sobald Sie jemanden entführt und das Geld eingezahlt haben, kommt mein Sohn frei. Sobald Ihre Zielperson jemanden entführt und das Lösegeld bezahlt hat, kommt Ihre Tochter frei. So einfach ist das. So funktioniert die KETTE, und so geht sie endlos weiter.«
»Was? Wen soll ich denn aussuchen?«, fragt Rachel in blankem Entsetzen.
»Jemanden, der die Regeln nicht brechen wird. Keine Polizisten, keine Politiker, keine Journalisten – das sind potenzielle Regelbrecher. Finden Sie jemanden, der jemand anderen entführt und das Geld überweist und den Mund hält und die KETTE aufrechterhält.«
»Wie können Sie sicher sein, dass ich das alles tun werde?«
»Falls nicht, töte ich Kylie und suche mir eine neue Zielperson. Denn falls ich es vermassle, töten sie meinen Sohn und danach mich. Wir haben nichts zu verlieren. Lassen Sie mich eins klarstellen, Rachel: Ich werde Kylie töten. Ich weiß jetzt, dass ich dazu fähig bin.«
»Bitte tun Sie das nicht! Lassen Sie Kylie gehen, bitte, ich flehe Sie an! Von Mutter zu Mutter, bitte. Sie ist ein wundervolles Kind. Sie ist alles, was ich habe. Ich liebe sie so sehr.«
»Darauf zähle ich. Haben Sie verstanden, was ich Ihnen erklärt habe?«
»Ja.«
»Auf Wiederhören, Rachel.«
»Nein! Warten Sie!«, schluchzt Rachel, doch die Frau hat bereits aufgelegt.
4
Rachel zittert heftig. Ihr wird übel, speiübel. So wie an den Behandlungstagen, als sie sich vergiften und versengen ließ, in der Hoffnung, dadurch am Ende wieder gesund zu werden.
Links von ihr tost unablässig der Verkehr, während sie wie zu Eis gefroren dasitzt, gleich einem toten Polarforscher, der einst in eine vollkommen fremde Welt aufgebrochen und nie zurückgekommen ist. Seit die Frau die Verbindung unterbrochen hat, sind fünfundvierzig Sekunden verstrichen. Es fühlt sich an wie fünfundvierzig Jahre.
Das Handy klingelt, sie erschrickt. »Hallo?«
»Rachel?«
»Ja.«
»Hier spricht Dr. Reed. Wir haben Sie um neun erwartet, aber Sie haben sich noch nicht am Empfang gemeldet.«
»Ich bin leider noch unterwegs. Der Verkehr«, sagt sie.
»Kein Problem. Um die Zeit ist immer die Hölle los. Wann können wir mit Ihnen rechnen?«
»Was? Oh … ich komme heute nicht. Ich kann nicht.«
»Wirklich nicht? Na gut, Rachel, würde es Ihnen morgen besser passen?«
»Nein, diese Woche gar nicht.«
»Rachel, ich muss dringend mit Ihnen über Ihre Blutwerte sprechen.«
»Das passt jetzt nicht«, sagt Rachel.
»Hören Sie, ich rede über diese Dinge nicht gern am Telefon, aber Ihr letztes Blutbild weist hohe CA-15-3-Werte auf. Wir müssen dringend besprechen –«
»Ich kann nicht kommen. Auf Wiederhören, Dr. Reed«, sagt Rachel und legt genau in dem Moment auf, als sie in ihrem Rückspiegel sieht, dass sich ein Blinklicht nähert. Ein kräftiger, dunkelhaariger Officer der Staatspolizei von Massachusetts steigt aus und kommt zu ihrem Volvo.
Vollkommen verloren sitzt sie da, während die Tränen auf ihren Wangen trocknen.
Der Polizist klopft ans Fenster, und nach kurzem Zögern lässt sie die Scheibe herunter. »Ma’am«, fängt er an und sieht dann, dass sie geweint hat. »Ähm, Ma’am, haben Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug?«
»Nein. Tut mir leid.«
»Also, Ma’am, Sie wissen doch, dass diese Standspur nur für Rettungsfahrzeuge ist.«
Sag’s ihm, denkt sie. Erzähl ihm alles. Nein, das geht nicht, sie werden sie umbringen. Diese Frau wird sie umbringen. »Ich weiß, dass ich hier nicht halten darf. Ich habe gerade mit meiner Onkologin telefoniert. Wie – wie’s aussieht, habe ich einen Rückfall bei meiner Krebserkrankung.«
Der Polizist begreift. Er nickt langsam. »Ma’am, glauben Sie, dass Sie unter diesen Umständen überhaupt weiterfahren können?«
»Ja.«
»Ich schreibe Ihnen jetzt keinen Strafzettel, aber ich muss Sie bitten, weiterzufahren, Ma’am. Ich halte den Verkehr an, bis Sie wieder auf der Fahrspur sind.«
»Danke, Officer.«
Sie startet den Motor, und der alte Volvo setzt sich brummend in Bewegung. Wie versprochen hält der Polizist den Verkehr auf der rechten Spur an, und so kann sie sich problemlos wieder einfädeln. Sie fährt eine Meile und nimmt dann die nächste Ausfahrt. Richtung Süden liegt das Krankenhaus, in dem man sie vielleicht wieder gesund machen kann, doch das ist ihr in diesem Moment egal. Das ist vollkommen nebensächlich. Jetzt dreht sich alles, das ganze Universum, nur darum, Kylie zurückzubekommen.
Sie wechselt auf die Interstate 95 in nördlicher Richtung und fährt mit dem alten Wagen so schnell wie nie zuvor. Fährt erst auf der langsamen Spur, dann auf der mittleren und schließlich auf der Überholspur, mit sechzig Meilen, fünfundsechzig, siebzig, fünfundsiebzig, achtundsiebzig, achtzig. Der Motor empört sich, doch Rachel hat nur einen Gedanken im Kopf: schnell, schnell, schnell.
Was sie zu erledigen hat, führt sie nach Norden: einen Kredit an Land ziehen; Prepaid-Handys besorgen; eine Schusswaffe kaufen und was sonst noch getan werden muss, um Kylie zu befreien.
5
Es war alles so schnell gegangen. Ein Schuss, und schon waren sie weitergefahren. Wie lange? Kylie konnte es nicht mehr ganz rekonstruieren. Vielleicht sieben oder acht Minuten, bevor sie in eine kleinere Straße abgebogen sind und am Ende eines langen Feldwegs angehalten haben. Die Frau hat ein Foto von ihr gemacht und ist ausgestiegen, um zu telefonieren. Wahrscheinlich mit ihrer Mom oder ihrem Dad.
Kylie ist neben dem Mann auf dem Rücksitz. Er atmet schwer, flucht leise und gibt dazwischen wimmernde Laute von sich, wie ein Tier.
Den Polizisten zu erschießen, war offensichtlich nicht Teil des Plans, und er kommt damit nicht klar.
Kylie hört, wie die Frau zum Wagen zurückkehrt.
»Gut, das ist erledigt. Sie hat alles verstanden und weiß, was sie zu tun hat«, sagt die Frau. »Bring die Kleine in den Keller runter, und ich verstecke den Wagen.«
»Okay«, erwidert der Mann ergeben. »Du musst aussteigen, Kylie.«
»Wohin gehen wir?«, fragt Kylie.
»Wir haben einen kleinen Raum für dich vorbereitet. Hab keine Angst«, sagt der Mann. »Bisher warst du sehr tapfer.«
Sie spürt, wie der Mann ihren Gurt öffnet. Sein Atem stinkt nach Galle. Neben ihr öffnet sich die Tür.
»Lass die Augenbinde aufgesetzt, ich habe eine Waffe auf dich gerichtet«, sagt die Frau.
Kylie nickt.
»Na los, worauf wartest du? Mach voran!«, befiehlt die Frau in einem schrillen, hysterischen Tonfall.
Kylie schwingt die Beine aus dem Wagen und macht Anstalten, auszusteigen.
»Stoß dir nicht den Kopf«, murmelt der Mann.
Langsam und vorsichtig stellt sie sich hin. Sie horcht, ob Verkehr von der Interstate oder irgendwelche anderen Geräusche zu hören sind, doch nichts. Keine Autos, keine Vögel, nicht das vertraute Rauschen des Atlantiks. Sie müssen folglich ein gutes Stück landeinwärts gefahren sein.
»Hier lang«, sagt der Mann. »Ich nehme jetzt deinen Arm und führe dich hinunter. Bitte keine Tricks. Du kannst hier nirgendwohin, und wir sind beide bereit, auf dich zu schießen, okay?«
Sie nickt.
»Antworte ihm«, drängt die Frau.
»Ich versuche nicht, abzuhauen«, antwortet sie.
Dann hört sie, wie ein Riegel zurückgeschoben und eine Tür geöffnet wird.
»Achtung, die Treppe ist alt und ein bisschen steil«, warnt sie der Mann.
Kylie steigt langsam eine Holztreppe hinunter, der Mann lässt ihren Ellbogen dabei nicht los. Als sie unten ankommt, fühlt sie, dass sie auf einem Betonboden steht. Ihr sinkt das Herz. Wäre es ein Kriechkeller gewesen, so wie bei ihrem eigenen Haus, dann hätte sie Sand und Erde unter den Füßen. Durch Sand und Erde kann man sich hindurchgraben. Aber nicht durch Beton.
»Hier entlang«, sagt der Mann und führt sie durch den Raum. Es ist eindeutig ein Keller. Der Keller eines Hauses ein beträchtliches Stück landeinwärts, mitten in der Pampa.
Kylie muss an ihre Mutter denken, und ein Kloß bildet sich in ihrem Hals. Ihre arme Mom! Sie tritt doch bald ihre neue Stelle an. Sie ist doch gerade erst dabei, nach dem Krebs und der Scheidung wieder Fuß zu fassen. Das ist nicht fair.
»Setz dich hierhin«, sagt der Mann. »Auf dem Boden liegt eine Matratze.«
Kylie lässt sich auf die Matratze nieder, es fühlt sich so an, als sei sie mit einem Laken bezogen. Auch einen Schlafsack ertastet sie.
Sie hört ein Klicken, offenbar macht die Frau ein weiteres Foto. »Okay, ich gehe jetzt ins Haus, schicke ihr das hier und sehe nach, ob die Überwachung funktioniert. Ich kann nur hoffen, dass die nicht sauer auf uns sind«, sagt die Frau.
»Sag ihnen einfach gar nicht, dass was schiefgegangen ist. Sag ihnen, alles lief nach Plan«, rät der Mann.
»Das weiß ich selbst!«, schnauzt sie zurück.
»Es wird schon alles gut«, sagt der Mann mit wenig Überzeugungskraft.
Kylie hört, wie die Frau eilig die Holztreppe hochläuft und die Kellertür schließt. Jetzt ist sie mit dem Mann allein, und das macht ihr Angst. Er könnte ihr sonst was antun.
»Alles klar«, sagt er. »Du kannst jetzt die Binde abnehmen.«
»Ich will Ihr Gesicht nicht sehen«, entgegnet Kylie.
»Schon gut, ich habe die Skimaske wieder auf.«
Sie streift sich die Augenbinde ab. Er steht dicht vor ihr und hält immer noch die Waffe in der Hand. Er hat seine Jacke ausgezogen. Er trägt Jeans, einen schwarzen Pullover und schlammverkrustete Halbschuhe. Ein korpulenter Mann, zwischen vierzig und fünfzig.
Der Keller ist rechtwinklig, ungefähr neun mal sechs Meter. Es gibt zwei kleine quadratische Fenster, von außen mit Laub zugeweht. Der Betonboden, die Matratze und daneben eine Lampe. Sie haben ihr einen Schlafsack, ein Kissen, einen Eimer, Toilettenpapier, einen Karton und zwei große Flaschen Wasser hingestellt. Der Rest des Raumes ist leer, mit Ausnahme eines gusseisernen Herds an einer Wand und eines Boilers in der hinteren Ecke.
»Hier bleibst du für die nächsten Tage. Bis deine Mutter das Lösegeld gezahlt und noch andere Dinge erledigt hat. Wir machen es dir so bequem wie möglich. Du musst ja entsetzliche Angst haben. Ich möchte mir gar nicht vorstellen …«, sagt er und schluckt. »Das ist auch für uns neu, Kylie. Wir sind in Wahrheit nicht so. Wir wurden zu alldem gezwungen. Das musst du verstehen.«
»Wieso haben Sie mich entführt?«
»Deine Mutter wird dir alles erklären, sobald du wieder bei ihr bist. Meine Frau will nicht, dass ich mit dir darüber rede.«
»Sie sind freundlicher als Ihre Frau. Können Sie mich denn nicht einfach –«
»Nein. Wir werden dich … nun, wir werden dich umbringen, wenn du versuchst abzuhauen. Ich meine es ernst. Du weißt, wozu wir f… fähig sind. Du warst dabei. Du hast es gehört. Der arme Mann … O mein Gott. Hier, mach dir das ans linke Handgelenk«, sagt er und reicht ihr eine Handschelle. »Eng genug, damit du die Hand nicht herausbekommst, aber nicht so eng, dass es scheuert … ungefähr so. Noch ein kleines bisschen enger. Lass mal sehen.«
Er nimmt ihr Handgelenk und lässt die Handschelle einen Tick enger einrasten. Die zweite befestigt er an einer schweren Metallkette und das andere Ende der Kette schließlich mit einem Vorhängeschloss an dem Eisenherd.
»Die Kette ist knapp drei Meter lang, du kannst dich also ein wenig bewegen. Siehst du das da drüben, da an der Treppe? Das ist eine Kamera. Wir behalten dich auch dann im Auge, wenn wir nicht hier unten sind. Und das Neonlicht bleibt immer an, damit wir wissen, was du tust. Du wirst also keine Dummheiten machen, okay?«
»Okay.«
»Schlafsack und Kissen hast du ja schon gesehen. In dem Karton da sind Toilettenartikel, noch mehr Klopapier, Kekse und Bücher. Magst du Harry Potter?«
»Ja.«
»Da sind sämtliche Bände drin. Und noch ein paar ältere Bücher. Das Richtige für Mädchen in deinem Alter. Ich kenne mich aus, ich bin Eng… gute Bücher«, sagt er.
»Ich bin Englischlehrer« – hätte er das beinahe gesagt?, denkt Kylie. »Danke«, sagt sie. Sei höflich, Kylie, schärft sie sich ein. Sei das brave, verängstigte Mädchen, von dem sie annehmen können, dass es ihnen keine Probleme bereiten wird.
Der Mann hockt sich vor sie hin, die Waffe weiterhin auf sie gerichtet.
»Wir sind hier mitten im Wald. Am Ende unseres privaten Feldwegs. Wenn du schreist, hört dich niemand. Es ist ein riesiges Grundstück, auf allen Seiten von Wald umgeben. Wenn du trotzdem schreist, sehe und höre ich dich über die Kamera. Dann komme ich und werde dich knebeln müssen. Und damit du den Knebel nicht rausreißen kannst, müssen wir dir die Hände hinter dem Rücken fesseln. Hast du verstanden?«
Kylie nickt.
»Und jetzt mach deine Taschen leer und gib mir deine Schuhe.«
Sie gehorcht. Sie hat sowieso nur etwas Geld in der Manteltasche. Kein Klappmesser oder Handy. Das Handy liegt auf Plum Island am Straßenrand.
Als der Mann sich erhebt, schwankt er ein wenig. »Himmel«, murmelt er und schluckt. Während er die Treppe hinaufgeht, schüttelt er den Kopf, als sei er fassungslos über das, was er angerichtet hat.
Als sich die Tür oben schließt, lehnt sich Kylie auf der Matratze zurück und atmet aus.
Doch im nächsten Moment schluchzt sie wieder los, weint so lange, bis keine Tränen mehr kommen. Danach richtet sie sich auf und betrachtet die beiden Flaschen Wasser. Ob der Mann und die Frau sie vergiften wollten? Doch an den Flaschen sind die Verschlüsse noch versiegelt, und es ist Poland Spring. Gierig trinkt sie ein paar Schlucke und setzt die Flasche dann ab.
Wenn er nun nicht wiederkommt? Wenn sie mehrere Tage oder sogar Wochen mit dem Wasser auskommen muss?
Ihr Blick fällt auf den großen Karton. Zwei Packungen Graham-Cracker, ein Snickers-Riegel und eine Dose Pringles. Zahnbürste und Zahnpasta, Klopapier, Feuchttücher und etliche Bücher. Außerdem ein Zeichenblock, zwei Bleistifte und ein Kartenspiel. Den Rücken zur Kamera, stochert sie mit dem Bleistift im Schloss der Handschelle herum, gibt es jedoch nach zehn Sekunden auf. Dazu bräuchte sie eine Büroklammer oder so. Sie nimmt die Bücher zur Hand. Harry Potter, J. D. Salinger, Harper Lee, Herman Melville, Jane Austen. Tatsächlich, offenbar ein Englischlehrer. Sie nimmt noch einen Schluck Wasser, wickelt etwas Klopapier ab und trocknet sich damit die neuen Tränen.
Dann legt sie sich auf die Matratze. Sie ist kalt. Kylie schlüpft in den Schlafsack und rutscht so tief hinein, dass die Kamera sie nicht sehen kann. So fühlt sie sich sicherer.
Wenn die sie nicht sehen können, ist das schon mal was. Das ist ein Daffy-Duck-Zaubertrick. Wenn ich dich nicht sehen kann, dann gibt es dich auch nicht.
Ob es stimmt, dass sie ihr nichts antun wollen? Man glaubt Menschen ja gern so lange, bis sich zeigt, wie schlecht sie in Wahrheit sind.
Aber das haben sie ja schon gezeigt, oder?
Dieser Polizist … Der ist wahrscheinlich tot oder liegt im Sterben. Lieber Gott!
Bei dem Gedanken an den Schuss ist ihr wirklich nach Schreien zumute. Auch, damit jemand kommt und ihr hilft.
Hilfe, Hilfe, Hilfe!, formt sie stumm mit den Lippen.
Himmel, Kylie, wie konnte das nur passieren? Das, wovor du immer gewarnt worden bist: Steig nie bei einem Fremden ins Auto ein. Niemals. Andauernd werden Mädchen vermisst, und ganz viele tauchen nie wieder auf.
Aber manche eben doch. Manche kommen wieder nach Hause.
Elizabeth Smart – so hieß das Mädchen von den Mormonen. In dem Interview wirkte sie ruhig und gefasst. Sie sagte, selbst in solchen Situationen gebe es immer Hoffnung. Ihr hat der Glaube Hoffnung gegeben. Aber Kylie glaubt nicht an Gott, woran offensichtlich ihre blöden Eltern schuld sind.
Furchtbar eng hier drinnen.
Sie kriecht aus dem Schlafsack und atmet gegen die Panik ein paar Mal tief durch. Dann sieht sie sich erneut im Keller um.
Ob die sie wirklich beobachten?
Am Anfang bestimmt. Aber um drei Uhr morgens? Vielleicht kann sie ja diesen Herd bewegen. Vielleicht findet sie einen alten Nagel und bekommt damit das Schloss auf. Sie muss abwarten. Sie muss die Nerven behalten und warten. Sie späht in den Karton und nimmt einen Stift und den Block heraus.
Hilfe, ich werde in diesem Keller gefangen gehalten, schreibt sie, doch wem sollte sie den Zettel geben?
Sie reißt die Seite ab und knüllt sie zusammen.
Dann fängt sie an zu zeichnen. Sie zeichnet die Decke der Grabkammer von Senenmut aus ihrem Buch über Ägypten. Das beruhigt sie ein wenig. Sie zeichnet Mond und Sterne. Die Ägypter glaubten an ein Leben nach dem Tod, in den Sternen. Aber es gibt kein Leben nach dem Tod, oder? Ihre Grandma glaubt daran, sonst keiner aus der Familie. Es ergibt ja auch keinen Sinn, oder? Wenn sie dich umbringen, bist du einfach tot, und das war’s. Und dann findet man vielleicht in hundert Jahren deine Leiche im Wald, und niemand kann sich auch nur an dich erinnern, geschweige denn daran, dass du verschwunden warst.
Du wirst aus der Geschichte gelöscht, ausradiert wie die Zeichnungen auf einer Zaubertafel.
»Mommy«, flüstert sie. »Hilf mir! Bitte hilf mir. Mommy!«
Aber sie weiß, dass keine Hilfe kommen wird.
6
Als Rachel wieder in ihrem Haus auf Plum Island angekommen ist, geht sie in die Küche und sinkt dort auf den Boden. Sie fällt nicht in Ohnmacht, sie kann sich nur nicht länger aufrecht halten. Wie ein schiefes Fragezeichen liegt sie da. Ihr Puls jagt, ihre Kehle ist wie zugeschnürt. Vielleicht fühlt es sich so an, wenn man einen Herzinfarkt bekommt.
Aber sie kann sich keinen Herzinfarkt leisten. Sie muss ihre Tochter retten.
Sie setzt sich auf, versucht, durchzuatmen und klar zu denken.
Sie haben mir verboten, die Polizei zu rufen. Sie haben Angst vor der Polizei.
Aber die Polizei würde wissen, was zu tun ist, nicht wahr?
Sie greift nach dem Handy, hält jedoch wieder inne. Nein. Das kann sie nicht riskieren.
Lass die Polizei aus dem Spiel. Auf keinen Fall die Polizei rufen. Wenn sie das rausbekommen, bringen sie Kylie sofort um. Es klang etwas im Tonfall dieser Frau mit. Verzweiflung. Entschlossenheit. Sie würde es tun und sich dann ein anderes Opfer suchen. Die ganze Sache mit dieser Kette ist unfassbar und vollkommen irre und doch … Der Tonfall der Frau – es klang echt. Die Frau hat eindeutig riesige Angst vor der KETTE und ihrer Macht und glaubte daran.
Genau wie ich, denkt Rachel.
Aber deshalb muss sie das noch lange nicht allein durchstehen. Sie braucht Hilfe.
Marty. Er wird wissen, was zu tun ist. Sie drückt die Kurzwahltaste für Martys Nummer, doch sofort meldet sich die Mailbox. Sie versucht es erneut – das Gleiche. Sie geht ihre Kontaktliste durch und ruft in seinem neuen Haus in Brookline an.
»Halloho!«, meldet sich Tammy in ihrem übertriebenen Singsang.
»Tammy?«, fragt Rachel.
»Ja, wer ist da?«
»Rachel. Ich hab versucht, Marty zu erreichen.«
»Er ist verreist.«
»Oh … Wohin denn?«
»Er ist in, ähm, ach, wie hieß das noch gleich …«
»Geschäftlich?«
»Nein. Sag schon … da, wo sie Golf spielen.«
»Scotland?«
»Nein! Da, wo alle hingehen. Er hat sich total darauf gefreut.«
»Golfen, seit wann … egal. Hör zu, Tammy, es ist ein Notfall, und auf seinem Handy meldet er sich nicht.«
»Er ist mit allen aus der Kanzlei dort. Sie sind in so einem Retreat und mussten ihre Handys abgeben.«
»Aber wo, Tammy? Bitte überleg noch mal.«
»Augusta! Er ist in Augusta. Ich glaube, ich habe irgendwo eine Nummer, falls du die brauchst.«
»Ja, bitte!«
»Okay, bleib am Apparat, mal sehen … ah, da ist sie.« Sie liest die Nummer vor.
»Danke, Tammy. Dann rufe ich gleich dort an.«
»Warte, was denn für ein Notfall?«
»Ach, ein Problem mit dem Dach, es ist undicht, keine große Sache. Danke«, sagt Rachel, legt auf und tippt sofort die Nummer ein, die Tammy ihr genannt hat.
»Gleneagle Augusta Hotel«, meldet sich die Rezeptionistin.
»Ich hätte gern Marty O’Neill gesprochen. Ich bin seine, ähm, Frau und habe leider die Zimmernummer vergessen.«
»Warten Sie, ich schau mal nach … vierundsiebzig. Ich stelle Sie durch.«
Sie leitet das Gespräch weiter in Martys Zimmer, doch er geht nicht ran. Rachel ruft wieder beim Empfang an und bittet die Rezeptionistin, Marty auszurichten, dass er sie zurückrufen soll, sobald er wieder da ist.
Sie legt auf und setzt sich wieder auf den Boden. Sie ist wie betäubt, sprachlos vor Entsetzen.
Es gibt so viele schlechte Menschen auf der Welt, mit jeder Menge Schulden auf dem Karma-Konto. Warum musste jetzt ausgerechnet ihr so etwas passieren, nach allem, was sie in den letzten Jahren ohnehin schon durchgemacht hat?
Es ist nicht fair. Und die arme Kylie ist doch noch ein kleines Mädchen, sie –
Neben ihr klingelt das Handy. Sie hebt es auf und wirft einen Blick auf die Anruferkennung: wieder unbekannter Anrufer.
O nein.
»Sie rufen Ihren Ex-Mann an?«, sagt die unheimliche, verzerrte Stimme. »Halten Sie das wirklich für eine gute Idee? Können Sie ihm vertrauen? Können Sie ihm Ihr Leben und das Leben Ihres Kindes anvertrauen? Das müssten Sie nämlich, denn falls er irgendjemandem irgendetwas erzählt, ist Kylie tot, und Sie werden wir dann wohl auch liquidieren müssen. Die KETTE weiß sich zu schützen. Vielleicht denken Sie vor Ihrem nächsten Anruf noch mal gut darüber nach.«
»Tut mir leid. Ich … ich konnte ihn sowieso nicht erreichen. Ich habe eine Nachricht hinterlassen. Es ist nur … ich weiß nicht, ob ich das allein schaffe, ich –«
»Möglicherweise erlauben wir Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt, sich Hilfe zu suchen. Wir werden Ihnen eine Nachricht zukommen lassen, wie Sie mit uns in Kontakt treten können, und dann dürfen Sie uns um Erlaubnis bitten. Aber vorerst sollten Sie mit niemandem reden, das ist sicher das Beste für Sie. Besorgen Sie das Geld und machen Sie sich danach Gedanken über ein geeignetes Entführungsopfer. Sie können das, Rachel. Sie haben sich gut geschlagen, als Sie auf dem Highway diesen Polizisten abgewimmelt haben. Ja, ganz richtig – wir haben es verfolgt. Und bis die ganze Sache vorbei ist, behalten wir Sie im Auge. Und jetzt sehen Sie zu, dass es vorangeht«, sagt die Stimme.
»Ich kann das nicht«, protestiert Rachel verzagt.
Die Stimme seufzt. »Wir wählen keine Personen aus, bei denen wir ahnen, dass wir ihnen ständig gut zureden müssen. Das wäre viel zu anstrengend für uns. Wir nehmen Macher, Leute, die sich zu helfen wissen. So jemanden wie Sie, Rachel. Jetzt stehen Sie schon von diesem verdammten Küchenboden auf und legen Sie los!«
Die Leitung ist tot.
In ungläubigem Entsetzen starrt Rachel auf das Handy. Sie beobachten sie also tatsächlich. Sie wissen, wen sie anruft, sehen alles, was sie tut.
Sie stößt das Handy weg, rappelt sich auf und wankt mit weichen Knien ins Bad.
Sie dreht den Hahn auf und spritzt sich Wasser ins Gesicht. Weder hier noch irgendwo sonst im Haus außer in Kylies Zimmer gibt es einen Spiegel. Um sich den furchtbaren Anblick ihrer ausfallenden Haare zu ersparen, hat sie sämtliche Spiegel entfernt. Natürlich hat ihr niemand aus der Familie erlaubt, auch nur an die Möglichkeit zu denken, dass sie am Krebs sterben könnte. Von Anfang an hat ihre Mutter, die immerhin mal Krankenschwester gewesen ist, sie immer wieder darauf hingewiesen, dass es sich um einen behandelbaren Brustkrebs im zweiten Stadium handelt, der gut auf einen lokalen, operativen Eingriff anspricht, mit anschließender Bestrahlung und Chemotherapie. Doch in jenen ersten Wochen sah sie in jedem Spiegel, wie sie immer magerer und schwächer wurde.
Sämtliche Spiegel zu verbannen war ein wichtiger Schritt auf ihrem Weg zur Genesung gewesen. Sie musste sich den Anblick dieses bleichen, abgemagerten Wesens in den düsteren Tagen der Chemo nicht antun. Ihre Heilung war nicht wirklich ein Wunder – angesichts des zweiten Stadiums lag die fünfjährige Überlebenschance bei neunzig Prozent –, trotzdem konnte man immer zu den zehn Prozent gehören.
Sie dreht den Hahn zu.
Gut, dass es keinen gottverdammten Spiegel gibt, denn die Spiegel-Rachel würde ihr mit vorwurfsvollen Augen entgegenblicken. Ein dreizehnjähriges Mädchen allein an der Bushaltestelle warten lassen? Glaubst du, das wäre passiert, wenn Kylie bei Marty leben würde?
Nein. Nicht in seiner Obhut. In deiner, Rachel. Denn mal unter uns, du bist eine Versagerin. Die schätzen dich völlig falsch ein. Die liegen unglückseligerweise völlig daneben. Fünfunddreißig, und du trittst deine erste richtige Stelle an? Was hast du die ganze Zeit davor gemacht? Deine ganzen Talente brachliegen lassen. Das Friedenskorps? Wer geht denn heutzutage noch zum Friedenscorps, und dann auch noch nach Guatemala! Und dann all die Jahre danach, in denen du dich mit Marty hast treiben lassen. In denen du gejobbt hast, nachdem er sich endlich entschieden hatte, dass er Jura studieren will.
Du hast allen was vorgemacht. In Wirklichkeit bist du eine Versagerin, und jetzt hast du deine arme Tochter in deine Versagerwelt mit reingezogen.
Rachel stößt den spitzen Finger an die Stelle, wo früher der Spiegel war. Du dämliche Kuh. Ich wünschte, du wärst krepiert. Wärst du doch krepiert! Hättest du doch zu den zehn Prozent gehört!
Sie schließt die Augen, atmet, zählt von zehn herunter, öffnet die Augen wieder. Sie läuft ins Schlafzimmer, schlüpft in den schwarzen Rock und die weiße Bluse, die sie sich für die Uni gekauft hat. Sie zieht ihre teuer aussehende Lederjacke an, findet ein passendes Paar hochhackige Schuhe, ordnet sich mit der Hand die Haare und holt ihre Schultertasche. Sie rafft ihre Finanzunterlagen, ihren Laptop sowie den Anstellungsvertrag des Newburyport Community College zusammen. Zuletzt holt sie eine Packung Zigaretten aus Martys Geheimvorrat aus der Zeit vor seinem Jura-Examen sowie das wasserdicht versiegelte Bündel Bargeld – der Notgroschen für den Fall einer Überschwemmung. Sie rennt wieder in die Küche, stolpert in den hohen Schuhen und schlägt beinahe mit dem Gesicht gegen die Dunstabzugshaube. Sie findet ihr Gleichgewicht, ergreift das Handy und hastet dann zum Wagen.
7
Die First National Bank in der State Street im Zentrum von Newburyport öffnet um 9:30 Uhr. Rachel läuft, so schnell sie kann, zum Eingang der Bank und zieht dabei an ihrer Marlboro.
Die State Street ist menschenleer, bis auf einen sehr bleichen, nervösen älteren Mann in einem schweren Mantel und einer Red-Sox-Kappe, der auf sie zukommt.
Ihre Blicke kreuzen sich, und er bleibt vor ihr stehen.
»Sind Sie Rachel O’Neill?«, fragt er.
»Ja«, antwortet sie.
Der Mann schluckt hart und zieht sich die Kappe tiefer ins Gesicht. »Ich soll Ihnen sagen, dass ich jetzt seit einem Jahr aus der KETTE raus bin. Dass meine Familie in Sicherheit ist, weil ich getan habe, was mir aufgetragen wurde. Und ich soll Ihnen auch sagen, dass es Hunderte Menschen gibt wie mich, auf die die KETTE zurückgreifen kann, um eine Botschaft zu überbringen, wenn sie glaubt, Sie oder jemand anders aus Ihrer Familie habe eine Botschaft nötig.«
»Verstanden.«
»Sie – Sie sind nicht schwanger, oder?«, fragt der Mann zögerlich, es scheint, als weiche er für einen Moment vom Skript ab.
»Nein«, erwidert Rachel.
»Dann ist das Ihre Botschaft«, sagt er und versetzt ihr ohne Vorwarnung einen harten Schlag in den Magen.
Ihr bleibt die Luft weg, und sie sackt zu Boden. Der Mann ist überraschend stark und der Schmerz kaum erträglich. Sie braucht etliche Sekunden, um wieder zu Atem zu kommen. Fassungslos und in heller Angst blickt sie zu dem Mann auf.
»Ich soll Ihnen sagen, falls Sie noch mehr Beweise für unseren langen Arm brauchen, sollten Sie die Familie Williams in Dover, New Hampshire, googeln. Sie werden mich nicht wiedersehen, aber es laufen viele andere wie ich da draußen herum. Versuchen Sie nicht, mir zu folgen«, sagt der Mann, und während ihm vor Scham die Tränen über die Wangen laufen, wendet er sich ab und geht weiter.
Im selben Augenblick öffnet die Bank, und ein Mann vom Sicherheitsdienst sieht Rachel auf dem Bürgersteig liegen. Er blickt dem davoneilenden Mann hinterher und ballt die Fäuste – offensichtlich erkennt er, was da gerade passiert sein muss.
»Kann ich Ihnen helfen, Ma’am?«, fragt er. Rachel hustet und reißt sich zusammen. »Alles in Ordnung, danke. Also, ich … nun, ich bin gestürzt.«
Der Wachmann hält ihr die Hand hin und hilft ihr auf.
»Danke«, sagt sie und zuckt vor Schmerzen zusammen.
»Fehlt Ihnen auch wirklich nichts, Ma’am?«, fragt er.
»Nein, nein, alles bestens.« Der Wachmann blickt von ihr zu dem Mann mit der roten Kappe, der jetzt schon ein ganzes Stück entfernt ist. Nicht schwer zu erraten, dass er sich fragt, ob sie vielleicht eine Art Lockvogel bei einem versuchten Banküberfall ist. Seine Hand wandert zu seiner Waffe.
»Vielen herzlichen Dank«, sagt sie und senkt die Stimme. »Ich bin diese hochhackigen Folterinstrumente nicht gewohnt. So viel dazu, bei der Bank Eindruck zu schinden!«
Der Wachmann entspannt sich. »Außer mir hat Sie ja niemand gesehen«, erwidert er. »Ist mir schleierhaft, wie man in den Dingern laufen kann.«
»Meiner Tochter hab ich diesen Witz erzählt: ›Wie heißt ein Dinosaurier in hochhackigen Schuhen?‹«
»Wie denn?«
»›Die-Füße-sind-sauer‹. Sie lacht nie. Sie lacht nie über meine dämlichen Witze.«
Der Wachmann lächelt. »Also, ich find’s lustig.«
»Nochmals tausend Dank«, sagt Rachel. Sie richtet sich die Frisur, betritt die Bank und fragt nach Colin Temple, dem Direktor.
Temple ist ein älterer Mann, der früher draußen auf der Insel gelebt hat, bevor er in die Stadt zog. Er und Rachel haben sich gegenseitig zu ihren Grillabenden eingeladen, und Marty ist mit ihm in seinem Boot zum Angeln rausgefahren. Als sie nach ihrer Scheidung ein paar Mal die Zahlungsrate der Hypothek schuldig blieb, hat er ihr nicht gleich den finanziellen Hahn abgedreht.
»Wenn das nicht Rachel O’Neill ist«, sagt er grinsend. »Rachel, welch Glanz in unserer Hütte!«
Es ist nicht alles Gold, was glänzt, denkt sie, spricht es aber nicht aus. »Guten Morgen, Colin, wie geht’s?«
»Danke, gut. Wie kann ich dir helfen, Rachel?«
Sie verdrängt die Schmerzen von dem Schlag in den Magen und setzt mühsam ein Lächeln auf. »Ich stecke ein bisschen in der Klemme und dachte, ich rede am besten mit dir.«
Sie begeben sich ins Büro des Direktors, das mit Fotos von Jachten dekoriert ist und mit winzigen detailgetreuen Modellbooten, die Colin selbst gebastelt hat. Rachels Blick fällt auf mehrere Bilder von einem stupsnasigen King Charles Spaniel, an dessen Namen sie sich dummerweise nicht erinnern kann. Colin lässt die Tür einen Spaltbreit offen und setzt sich hinter seinen Schreibtisch. Rachel nimmt ihm gegenüber Platz und bemüht sich um einen einnehmenden Gesichtsausdruck.
»Was kann ich für dich tun?«, fragt Colin in beschwingtem Ton, doch sein Blick verrät, dass er wachsam ist.
»Also, es geht um das Haus, Colin. Das Dach ist über der Küche undicht. Ich hatte gestern einen Handwerker da, und der meint, vor dem nächsten Schnee müsste rasch noch alles neu eingedeckt werden, wenn ich nicht will, dass es uns auf den Kopf fällt.«
»Tatsächlich? Als ich das letzte Mal bei euch war, sah es eigentlich ganz okay aus.«
»Ich weiß. Aber es ist noch das ursprüngliche Dach aus den 1930er-Jahren. Und es leckt jeden Winter. Mittlerweile ist es offenbar eine Gefahr. Ich meine, für uns. Für mich und Kylie. Und natürlich für das Haus. Und … und ihr seid die Gläubiger, wenn das Haus zusammenkracht, ist es nichts mehr wert«, sagt sie und bringt sogar ein kleines Lachen zustande.
»Und wie hoch veranschlagt dein Handwerker die Kosten?«
Rachel hat mit sich gekämpft, ob sie um die gesamten fünfundzwanzigtausend Dollar bitten soll, doch für die Instandsetzung eines Dachs wäre das mehr als übertrieben. Sie hat nichts gespart, kann jedoch ihre Visa-Karte mit zehntausend belasten. Darüber, wie sie das Geld zurückzahlt, wird sie sich Gedanken machen, wenn Kylie wieder wohlbehalten zu Hause ist.
»Fünfzehntausend. Aber das ist kein Problem, Colin, ich kann das stemmen. Ich trete im Januar eine neue Stelle an«, sagt sie.
»Ach, tatsächlich?«
»Ich gebe Kurse am Newburyport Community College. Einführung in die moderne Philosophie. Existenzialismus, Schopenhauer, Wittgenstein und so.«
»Dann kannst du endlich einen Nutzen aus deinem Abschluss ziehen, wie?«
»Allerdings. Hier, ich hab den Anstellungsvertrag mitgebracht und den Gehaltsnachweis. Ist nicht überwältigend, aber immerhin ein geregeltes monatliches Einkommen und mehr, als ich bei Uber verdient habe. Es läuft gerade wirklich alles gut bei uns – bis auf, wie gesagt, das Problem mit dem Dach«, sagt sie, während sie ihm die Unterlagen überreicht.
Colin sieht sich die Papiere an und blickt dann zu ihr auf. Sie liest ihm vom Gesicht ab, dass er misstrauisch ist. Er merkt, dass etwas nicht stimmt. Wahrscheinlich sieht sie schrecklich aus. Bleich und verängstigt wie eine Frau, deren Brustkrebs zurückgekehrt ist, oder wie jemand in der Todesspirale einer Drogensucht.
Er kneift die Augen zusammen. Seine Stimmung kippt. Er schüttelt den Kopf. »Ich fürchte, wir können dir keinen Zahlungsaufschub mehr gewähren und auch die Hypothek nicht aufstocken. Das bekäme ich nicht durch. Mein Ermessensspielraum ist da ziemlich eng.«
»Dann eben eine neue Hypothek im zweiten Rang«, schlägt sie vor.
Wieder schüttelt er den Kopf. »Tut mir leid, Rachel, aber das gibt dein Haus nicht her. Um ganz ehrlich zu sein, ist es doch nur eine bessere Strandhütte. Und die liegt streng genommen nicht einmal am Strand.«
»Aber im Tidebecken. Das Haus liegt am Wasser, Colin.«
»Tut mir wirklich leid. Ich weiß, dass du und Marty jahrelang davon gesprochen habt zu renovieren, aber ihr habt es nun mal nicht getan. Das Haus ist nicht winterfest, noch dazu ohne zentrale Klimaanlage.«
»Dann eben auf den Grund und Boden. Die Grundstückspreise sind doch in der Gegend ziemlich gestiegen.«
»Aber ihr liegt eben im wenig angesagten Westen von Plum Island und nicht am Atlantik. Ihr seid dicht am Marschland und in der Überschwemmungszone. Tut mir leid, Rach, ich kann wirklich nichts für dich tun.«
»Aber, aber … ich habe doch die neue Stelle.«
»Das ist ein Zeitvertrag, Rachel, nur für ein Semester. Für die Bank stellst du ein hohes Risiko dar – das siehst du doch selbst, oder?«
»Du weißt, dass auf mich Verlass ist«, beharrt sie. »Du kennst mich, Colin. Ich zahle fast immer pünktlich. Ich bediene meine Schulden. Ich arbeite hart.«
»Ja. Aber darum geht es nicht.«
»Und was ist mit Marty? Er ist in der Kanzlei jetzt Junior-Partner. Wegen Tammys Konkurs habe ich zwar ein Auge zugedrückt, als er vorübergehend keinen Unterhalt gezahlt hat, aber –«
»Tammy?«
»Seine neue Freundin.«
»Sie ist in Konkurs gegangen?«
Mist, denkt Rachel. Sie weiß, dass diese Information nicht gerade eine positive Wirkung in Bezug auf ihr Anliegen hat, und so versucht sie, es herunterzuspielen.
»Ach, das war nichts Besonderes. Sie hatte einen Süßwarenladen am Harvard Square und ist damit pleitegegangen. Sie ist keine Geschäftsfrau. Ich glaube, sie ist erst fünfundzwanzig oder –«
»Wie kann man pleitegehen, wenn man doch in der Hauptstadt der Leckermäuler von ganz New England Schokolade verkauft?«