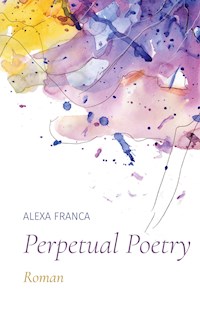Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Urlaub beginnt im Kopf, denkt sich Tom Zahner, entnervter Lehrer, und träumt sich während einer langweiligen Klausuraufsicht vom Klassenzimmer nach Italien in ein amouröses und gaunerhaftes Abenteuer. Unter dem Einfluss von Sonne, Wein und der schönen Eleonora nimmt sein sonst unspektakuläres Leben an freudiger Fahrt auf - bis es eine Leiche gibt, dann wendet sich das Blatt ... Italienflair trifft schwarzen Humor - perfekt für urlaubsreife Schreibtischtäter und alle mit der Sehnsucht nach mehr Dramatik und Dolce Vita im Alltag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alexa Francaist das Pseudonym einer passionierten Philologin. Alexa Franca hat Germanistik und Latinistik studiert, unter anderem in Rom. Sie kennt die liebenswerten Eigenheiten Italiens und seiner Bewohner ebenso gut wie die listigen Tücken des Schulalltags, denn sie unterrichtet heute nach ihrem Quereinstieg aus der Wirtschaft Deutsch und Latein an einem Gymnasium.
Inhalt
Arbeitsauftrag
Buongiorno Blütenträume
Ciao cinghiale
Drama Dolce
Eifer
Furie
Geladene Gäste
Hereinspaziert
Irreführen
Luna
Minenfeld
Nässe
Obskures Örtchen
Plätschern
Quellversiegen
Resteentsorgung
Sonderbare Sendung
Totenbotschaft
Umverzeihungbitten
Versöhnung
Zum Zug
Klausuranhang
A ARBEITSAUFTRAG
»Na, Tom, machst du Bildungsurlaub in Deutschland?« Sein süffisantes Grinsen war nicht zu übersehen. Ich versuchte über Sven Wittens schlechten Scherz zu grinsen, schnitt aber wohl eher eine dämliche Grimasse. Der hatte leicht reden, der würde wenigstens in ein paar Stunden Ferien haben – ohne Korrektur. Der Arsch. Wenigstens hielt mir der Dauerstrahlemann die Tür auf, so viel Anstand hatte er also doch, der Depp.
»Danke.«
Auf ein weiteres Gespräch hatte ich keine Lust. Ich bugsierte einen beträchtlich schwankenden Stapel Duden durch den Türspalt und steuerte auf meinen Platz im Lehrerzimmer zu, wo ich die geballte Ladung deutschen Wortguts geräuschvoll abstellte. Uff – ich tat es den Wörterbüchern gleich in puncto Lautmalerei.
Bildungsurlaub! Von Urlaub mochte er was verstehen, dieser Sportbälle-Jongleur, aber von Bildung? Geschweige denn von Wortbildungsregeln. Ich jedenfalls würde die ganzen Ferien Zeit dafür haben, die nicht-Duden-konformen Ausdrücke meiner lieben Schülerchen zu korrigieren. Seitenweise. Na, wenigstens würde ich dabei nicht abgelenkt werden, jetzt wo Diana gerade bei mir ausgezogen war. Da hatte ich Zeit und Platz und Ruhe. Scheißferien.
Noch schnell einen Kaffee, bevor der Wahnsinn weiterging. An der Kaffeemaschine herrschte reger Andrang, und ich musste mich anstellen. Na toll! Heute war nicht mein Tag. Während jeder seinen cremigen Kaffee-Latte-extra-lungo aus dem Vollautomaten rinnen ließ, kam ich leider nicht umhin, die hochfliegenden Ferienpläne meiner Kolleginnen und Kollegen mitzuverfolgen.
»Wir fahren noch heute Nacht nach Frankreich«, trällerte eine junge, dynamische Geografielehrerin. »Das Auto ist bereits voll bepackt. Und morgen bin ich schon in den Pyrenäen!«
»Wow!«, bestaunte sie eine ebenso junge, ebenso dynamische Kollegin in wortgewandtem Deutsch. Dann fügte sie hinzu, offensichtlich um mitzuhalten: »Ich fliege erst morgen früh. Nach Island. Diesmal ist der Hvannadalshnúkur dran. Die Vulkane in Italien und Spanien habe ich alle schon durch.«
Den unaussprechlichen Namen des isländischen Berges sprach sie dabei überzeugend flüssig wie fließende Lava aus. Wahrscheinlich bereitete sie sich schon seit Ostern auf den anstehenden Pfingsturlaub vor. Dafür eigneten sich die leidigen Schulwochen zwischen den wohlverdienten Ferien bestens.
Wenn doch der Kaffee auch so schnell wie heiße Lava aus dem Vollpfostenautomaten fließen würde! Wie lange dauerte das denn noch? Die Pause war gleich rum. Endlich! Ich drückte auf ›Espresso doppelt‹ und wartete auf meine schwarze Brühe. Der belebende Duft stieg mir bereits in die Nase und stimmte mich versöhnlicher. Das war auch fast wie Urlaub.
Kaum wollte ich mich mit meinem dampfenden Tässchen (ich würde nie verstehen, wie die Kollegen ihren Kaffee aus bestoßenen Pötten mit verblichenen Werbeaufdrucken schlürfen konnten) wieder in Richtung meines Platzes schlängeln, als ich erst einen Schlag auf meiner Schulter, dann einen heißen Guss auf meinem Handgelenk spürte.
Aua! Verdammt! Welcher Idiot …? Ich wurde in meinen Gedanken abgewürgt, bevor ich überhaupt laut schimpfen konnte.
»Hey, Tom!«, tönte es hinter mir und ich drehte mich unwillkürlich mit entsprechend missmutiger Miene um. »Mein Guter, wir müssen unbedingt mal wieder karteln in den Ferien! Bist du da? Ich bin nur in der ersten Woche weg, Wellness in Südtirol mit ein wenig Kultur, Museum, Ötzi-Leiche anschauen und so, du weißt schon, mein Guter, aber dann bin ich fast die ganze zweite Woche hier, also bis auf ein, zwei Tage oder so, wo ich mal mit Anne zu ihren Eltern fahre, du weißt schon, Pflichtbesuch und so …«
Ralf plapperte ohne Unterlass und schien sein für mich folgenschweres Malheur gar nicht bemerkt zu haben. Es würde gleich noch eine Leiche geben, und zwar im Wellnesspool! Mein schöner Espresso! Ganz abgesehen von der Sauerei und meinem brennenden Arm musste ich jetzt ohne Aufputschmittel die nächsten Stunden überleben. Hatten sich heute alle gegen mich verschworen? Am besten ich würde gleich die ganze verdammte Schule in einem Pool versenken. Dann könnte ich wenigstens oben gelassen auf der Luftmatratze liegen.
Während mein Kollege munter weitersprach, schüttelte ich mir demonstrativ den Kaffee vom Handgelenk und krempelte umständlich mit meiner freien Hand den besudelten Hemdärmel hoch. Wenigstens war der jetzt frisch gestärkt. Den Schmerz unterdrückte ich mannhaft.
»Oh, was hast du denn da angestellt, mein Guter?«, unterbrach Ralf seinen Wortschwall, worauf ich nur etwas Unverständliches brummte. »Das war doch hoffentlich nicht ich?« Wieder knurrte ich vor mich hin, schlürfte den Restbodensatz aus dem Tässchen und stellte es in die Spüle.
»Also, mein Guter«, fuhr Ralf unbeirrt fort, »ich muss dann, und falls wir uns nicht mehr sehen nachher, schon mal guten Start in die Ferien, wir trinken mal was, also, wie gesagt, in der zweiten Woche, weil ich bin erstmal weg, du weißt schon, aber nach dem Wellnesstrip rufen wir uns zusammen und gehen was trinken, mach’s gut, mein Guter!« Es folgte noch ein kumpelhafter Schlag auf meine Schulter.
Bevor ich etwas erwidern oder gar zurückhauen konnte (ein Kinnhaken wäre angebracht gewesen), war Ralf schon in dem bunten Vorferientreiben verschwunden. Wellness. Mit Freundin. Du Hund! Eigentlich war er ein lieber Kerl, der Ralf, und die Kartabende mit ihm waren immer unterhaltsam, das hieß: Er unterhielt die Runde stets prächtig. Dann musste ich wenigstens nicht so viel reden und konnte stattdessen die Trümpfe mitzählen. Das zahlte sich am Ende in barer Münze aus. Aber manchmal war er einfach nur schwer zu ertragen. Wie eben.
Es gongte bereits das erste Mal zum Einläuten des Pausenendes. Na prima. Wenigstens noch mal schnell für kleine Jungs, dann ging’s schon weiter.
Zwar standen mir in den nächsten drei Stunden keine quasselnden Fünftklässler und keine zickigen Mittelstufenschülerinnen bevor. Aber die Aussicht auf langweilige hundertachtzig Minuten Aufsicht bei der Oberstufenklausur motivierte mich auch nicht gerade und stimmte mich schon gar nicht auf Ferien ein, in denen ich mich die gesamten zwei Wochen den geistigen Ergüssen meiner Schützlinge widmen würde, anstatt auf Bergen herumzukraxeln oder mich in Whirlpools zu aalen.
Ich hängte mir meine abgewetzte Ledertasche quer über die Schulter und packte wieder meinen Duden-Stapel, den ich vorhin noch schnell der Schulbücherei in weiser Voraussicht entnommen hatte, weil bestimmt wieder ein paar Pappenheimer ihre Wörterbücher vergessen hatten. Und bevor ich mir die miserable Rechtschreibung in den Ferien antat, schleppte ich lieber vorher Bücherberge – vorausgesetzt die lieben Kinder würden auch mal reinschauen in die erhellenden Untiefen der deutschen Sprache.
Einmal fragte mich eine Schülerin, wie sie denn ein Wort finden solle, wenn sie nicht wüsste, wie es geschrieben werde. Berechtigte Frage. Ich faselte damals wohl etwas von Ableitungen von ähnlichen, ihr geläufigen Wörtern und Querverweisen und so, um mich rauszureden, weil ich auch keine passable Antwort wusste. Jedenfalls gab ich die Hoffnung nicht auf, dass der ein oder die andere das Standardwerk der deutschen Sprache in den nächsten Stunden zur Hand nehmen, den eigenen Horizont erweitern und meinen Korrekturaufwand verringern würde. Träumen sei ja noch erlaubt!
»Hallo, Herr Zahner!«, tönte es schrill durch die Aula. Eine Horde Mädchen flitzte vom Pausenhof kommend auf mich zu. Es waren die kleinen Fünftklässlerinnen, mit denen ich vor der Pause noch Erlebniserzählungen über Ferienabenteuer geschrieben hatte. Welch Enthusiasmus, einfach erfrischend!
»Hier«, quietschte Lina und hielt mir ein Gänseblümchen entgegen. »Für Sie.« Sie strahlte mich mit ihrer Zahnspange an, sodass ich zurückstrahlen musste. Das passierte einem auch nur in der Unterstufe.
Weil ich das Blümchen nicht als Bestechungsversuch für bessere Zensuren einstufte, ging ich vorsichtig ein wenig in die Knie, damit sie es auf meinen Bücherstapel legen konnte. »Danke dir, Lina«, rief ich noch, denn das Mädchen war flugs wieder zu ihren kichernden Kameradinnen gerannt. Wie einem so eine kleine Begegnung den Alltag aufheitern konnte!
Doch der beschwingte Zustand hielt nicht lange. Genauer gesagt, keine Minute.
»Herr Zahner!«
Bei dieser vordergründig zwar säuselnden, aber im Kern doch bestimmten Stimme, untermalt vom metallenen Klacken ihrer Absätze, schwante mir nichts Gutes: Die Vollstreckerin. Höflich blieb ich stehen und setzte eine freundliche Miene auf, bevor ich mich zu meiner Chefin umdrehte und sie über meinen blühenden Bücherturm hinweg ansah.
»Frau Doktor Strecker?«, fragte ich mit gespielt interessierter Tonlage. Vollstreckerin nannten wir sie im Kollegium selbstverständlich nur hinter vorgehaltener Hand und in Gedanken.
»Wir bräuchten noch dringend ein weiteres Projekt für das Schulfest.«
Sie machte eine Pause, in der sie wohl erwartete, dass ich gleich Juhu! schreien würde. Aber ich schwieg vorsichtshalber. Als meine Reaktion auf sich warten ließ, sprach sie weiter:
»Da Sie immer so gute Ideen haben, dachte ich mir, Sie könnten sicherlich noch etwas Tolles auf die Beine stellen«. Dabei überkreuzte sie ihre langen Beine wie zur Untermauerung ihrer Aussage.
Ich habe tolle Ideen? Ich musste ziemlich dämlich geguckt haben, weil sie gleich eine Erklärung hinterherschob.
»Sie wissen schon – ein kreatives Mitmach-Spiel mit Bezug zum Schulalltag – etwas mit Deutsch. Da kann jeder mitmachen, von Klein bis Groß. Deutsch kann ja jeder.«
Aha. Klar. Wozu musste ich dann noch eine Klausur schreiben lassen? Dass mir unter der Last der schwerwiegenden Dudenbände fast der Arm abfiel, schien die Chefin nicht zu interessieren. Ich nickte ergeben.
»Ich weiß, dass ich auf Sie zählen kann!« Dabei lächelte sie so gekonnt aufgesetzt, wie sie es nur bei einem ihrer zahlreichen Führungskräfteseminare gelernt haben konnte. Sie wandte sich bereits zum Gehen, als sie noch kurz hinzufügte: »Der Ministerialbeauftragte will übrigens auch am Schulfest vorbeischauen.«
Daher wehte also der Wind. Frau Doktor Strecker mochte wieder einmal mit einem Vorzeigeprogramm glänzen. Ganz im Sinne der Außenwirkung der Schule. Bestbewertungen für unser Gymnasium als Leuchtturmschule. Mit ihr als Repräsentantin.
Während ich mich wieder in Bewegung Richtung Klassenzimmer setzte, lauschte ich dem Nachhall ihrer waffenscheinpflichtigen Stilettos.
Wahrscheinlich hatte sie beim Umbau des Gebäudes extra auf einen harten Steinboden bestanden, damit man ihre Präsenz besser wahrnahm. Wie konnte sie auf diesen schwindelerregenden Absätzen überhaupt das Gleichgewicht halten? Ich drehte mich kurz um. In dem Moment verlor der Stapel Duden den Halt und purzelte einer nach dem anderen zu Boden. Das Gänseblümchen war vorerst begraben. Umständlich bückte ich mich, um die wertvollen Werke wieder einzusammeln und das Pflänzchen zu retten. Während ich auf den kalten Steinplatten kniete, überlegte ich, ob man darunter eventuell auch eine Leiche verschwinden lassen könnte. Wäre es nicht sogar für eine Direktorin der passende Platz? Eine dezente, unauffällige Grabplatte inmitten der Schule? Auf immer verbunden mit der heiligen Halle der Bildungsanstalt. Das hatte fast etwas Sakrales. Der passende Blumenschmuck war auch schon da. Ich hob das ramponierte Gänseblümchen auf.
»Da nehm ich gleich einen mit!«, trällerte es neben mir.
Meine Gedankenblase zerplatzte. Ich blickte auf lange, unbedeckte und – wie ich zugeben musste – wohlgeformte Beine. Amelie bückte sich neben mich und griff zu einem Duden, wobei ihr Ausschnitt nach vorne fiel. Das machte die doch mit Absicht. Die wusste schon genau, wie sie auf Männer wirkte. Ganz schön ausgefuchst. Aber nicht mit mir! Ich kannte meine Grenzen.
Zwei weitere frisch gestylte Mädchen folgten aus der Toilette (es wäre auch ein Wunder gewesen, wenn Amelie dort allein hingegangen wäre) und halfen mir beim Aufheben. Wie höflich. So konnten sich die letzten Jahre Unterricht und Erziehung doch sehen lassen. Das wurde also im Laufe der Zeit aus den unschuldigen kleinen Mädchen mit Zahnspange und Gänseblümchen.
»Ich danke Euch!«, sagte ich, versuchte meinen Blick weiter konzentriert auf die Bücher zu richten und folgte den miniberockten und minibeshorteten Mädchen ins Klassenzimmer. Ritterlich ließ ich ihnen den Vortritt.
Aber wie sich herausstellte, resultierte ihre Höflichkeit eher aus ihrer Vergesslichkeit, weil jede den von ihr aufgehobenen Duden gleich an ihren Platz trug. Nach eigenen Aussagen handelte es sich bei dem Trio von Amelie, Anita und Annika um die sogenannten Asse. Das hatte ich einmal bei meiner Pausenaufsicht vernommen beziehungsweise vernehmen müssen. Denn die drei Asse hatten damals in der Aula auch lautstark ihr Motto verkündet: Auffallen auf alle Fälle. Jedenfalls blieben sie ihren selbstgewählten Zielen treu.
»So, guten Morgen!«, tönte ich in den Geräuschpegel und wuchtete die restlichen Bücher aufs Pult.
»Morgen«, echote es aus mancher Richtung.
»Wir schieben die Tische auseinander. Ich muss Euch ja nicht mehr erklären, dass jede Form von Unterschleif und so … Ihr wisst Bescheid.«
Die umgänglichere Du-Anrede hatte sich an unserer Schule auch für die Oberstufe durchgesetzt. Es folgte ein Raunen, was ich als Zustimmung interpretierte, und ein quietschendes Rumpeln der gequälten Möbel. Ging das nicht leiser? Na, bald würde es ruhig hier sein, wenn alle fleißig schrieben.
Dann teilte ich die Bögen und Angaben aus: ein Gedichtvergleich von Goethe und Eichendorff.
»Viel Erfolg! Ihr macht das schon«, munterte ich die Truppe auf. »Wir haben die Klassik und Romantik ausführlich besprochen, und jetzt könnt Ihr zeigen, was Ihr draufhabt.« Dann fügte ich noch hinzu: »Und außerdem: Deutsch kann ja jeder!« Das Zitat konnte ich mir nicht verkneifen.
Es gongte pünktlich zum Beginn der dritten Stunde: 9.45 Uhr. »So, los geht’s! In drei Stunden sind Ferien.«
»Wie?«, fragte es von irgendwo aus den Reihen, und ich blickte nach links, wo sich ein Schüler meldete.
»Was meinst du, Jonas?«
»Ich dachte, wir haben vier Stunden lang Zeit.« Hektik schwang in seiner zittrigen Stimme mit.
Ich überlegte, was ich gerade gesagt hatte, und konkretisierte meine Aussage: »Abgabe ist um 12.45 Uhr.« Zur Sicherheit schrieb ich die Uhrzeit an die Tafel. »Also in vier Schulstunden und drei Zeitstunden.«
Jonas atmete erleichtert auf, aber allgemein setzte ein Stöhnen und Seufzen ein, als die lieben Kinder (das waren sie in meinen Augen jedenfalls immer noch) ihre Angabenblätter umdrehten. Sie mussten wohl derartige Laute äußern, wahrscheinlich um bereits im Vorfeld eine milde Korrektur zu erflehen. Schwer war die gut vorbereitete Aufgabe nämlich nicht. Angemessen eben.
Ich setzte mich ans Pult, legte die kleine, leicht zerfledderte Blume vor mich hin (wie süß!) und packte eine Wasserflasche, eine Tüte mit marktfrischen Kirschen, ein Wurstbrot und eine Ausgabe mit antiken Liebesgedichten zum Schmökern aus.
Drei Zeitstunden. Wie das schon klang! Aber in der Schule gingen die Uhren anders. Hier tickte alles im Sechsersystem – sechs Schulstunden am Vormittag, sechs Stufen bei der Notengebung. Wer sich das ausgedacht hatte, wusste ich auch nicht. Jedenfalls kam ich immer wieder durcheinander, wenn mich meine Physiotherapeutin bei der Behandlung meiner korrekturgeschädigten Haltung nach der Schmerzskala von eins bis zehn fragte, weil bei mir die Schmerzgrenze schon bei sechs erreicht war.
Und jetzt hatte ich also vier Schulstunden (oder eben drei Zeitstunden) Zeit. Zeit … Ich lauschte dem leisen Ticken der Wanduhr. Jedenfalls so lange, bis draußen wieder der Presslufthammer der braungebrannten Straßenarbeiter einsetzte, die dort seit einigen Tagen irgendwelche Rohre verlegten. Prompt stöhnte es durch die Bank, sodass ich mich genötigt fühlte, die Fenster zu schließen. Sehnsüchtig ließ ich meinen Blick schweifen. Selbst die hart arbeitenden Männer da draußen kamen mir im Moment beneidenswert vor, denn sie waren eben da draußen und nicht hier drinnen. Drei Stunden lang! Wenn ich doch schon in dieser Zeit das korrigieren könnte, was die lieben Kleinen, also die angehenden Abiturientinnen und Abiturienten, gerade auf ihre Bögen kritzelten. Aber nein! Dafür waren dann meine Ferien da, während alle anderen nach Südtirol, nach Island, nach Tuvalu oder sonst wohin fuhren oder flogen.
Selbst Goethe reiste einst ins sonnige Italien. Und ich? Riss mir wieder mal allein (und diesmal wirklich ganz allein) zu Hause am Schreibtisch den Arsch auf. Nicht mal Balkonien war drin, weil da der Tisch zum Korrigieren zu klein war.
Einmal hatte ich das versucht und beim Griff zum Duden gleich die Kaffeetasse umgehauen, sodass sich die braune Brühe auf die Arbeit ergossen hatte. Im Nachhinein betrachtet, war der Kaffee dann auch das Beste an dem Aufsatz.
Nur Eichendorff war selbst nie in Italien, obwohl er so romantische Landschaften beschrieben hatte. Ich musste schmunzeln. Der alte Gauner! Alles ausgedacht. Als Romantiker hatte er eben eine blühende Fantasie und konnte leichthändig zarte Verse von schwindelerregenden Felsen, von rauschenden Wäldern, von sich herabstürzenden Quellen, von verwilderten Gärten, von Lauben und von Palästen im Mondlicht dichten. Nicht zu vergessen die ansehnlichen Marmorstatuen und Mädchen.
Was würde ich dichten, wenn ich den Anblick hier in Verse fassen wollte? Ich schaute mich im Klassenzimmer um. Der frühsommerlichen Hitze geschuldet, trugen die meisten Mädchen nur knappe Kleidung. Diente der mangelnde Stoff wirklich einzig dem Temperaturausgleich? Besser ich behielt – im Gegensatz zu Goethe – meine Gedanken für mich. Man wurde hier zum Gucken förmlich gezwungen! Wo sollte ich denn hinsehen? Bei dieser geballten Fülle im engen Raum müsste ich die Augen schließen, wodurch ich meine Aufsichtspflicht verletzen würde.
Bis vor Kurzem hatte meine Muse Diana ihren wohl proportionierten Körper noch an meinen geschmiegt. Leider war meine Schulter nicht die einzige, an die sie sich gelehnt hatte, wie ich kürzlich schmerzlich erfahren musste. Und jetzt beglückte sie mit ihrer göttinnengleichen Gestalt nur noch diesen – diesen – wie hieß das Juristenarschloch gleich? Na, egal.
Goethe war auch Jurist, fiel mir bei dieser Gelegenheit ein. Ach, Goethe … Eichendorff … Italien! Marmor – Amor. Da könnte ich mich in einer perfekten Mischung aus Klassik und Romantik austoben! Bildungsreise und dolce far niente. Klassische Museen und mondhelle Nächte. Ach!
Einfach den Zug besteigen und gen Italien reisen, ins Land, in dem die Zitronen blühen …
B BUONGIORNO BLÜTENTRÄUME
Das gleichmäßige Vibrieren des Presslufthammers war mir eine Metapher für das stete Rattern des Zuges. Die aufgegrabene Straße für die Erde der vor dem Fenster vorbeiziehenden blühenden Landschaften. Die braungebrannten Bauarbeiter für die Trauben pflückenden Winzer auf ihren Feldern. Das Abwasser pumpende Rohr für die rauschenden Bächlein.
Je weiter der Zug südwärts rollte, desto wohliger wurde mir ums Herz und desto mehr durchglühte es meine Brust. Ich hatte klassischen Boden erreicht und empfand Begeisterung für das Bevorstehende, alles, was ich mir nur träumen würde: Abenteuer, Amore …
Sol hatte seinen Sonnenwagen schon tief herabgezogen und goss warmes Gold über die sanften Hügel, und am Horizont glitzerten bereits Neptuns Wogen. Luna grüßte auf der anderen Seite in ihrer ganzen Fülle zart den scheidenden Tag und machte sich bereit für ihren glänzenden Auftritt. Leider funkte just in diesem romantischen Augenblick Diana, die nachtstrahlende Jagdgöttin, dazwischen, die mich daran erinnerte, dass auch sie mit dem Schein des Mondes in Verbindung stand. Musste sie sich immer vordrängen? Zum Glück konnte ich den Gedanken an sie mit dem fortlaufenden Rattern des Zuges wieder zermalmen.
Ich betrachtete mein durchsichtiges Spiegelbild in der Fensterscheibe vor der verblassenden Landschaft, als stünde ich inmitten des Idylls.
Mit hereinbrechender Nacht wurde das Licht des Abteils gedimmt und ich war froh, mich allein ausbreiten zu können, nachdem auch der letzte signore das Coupé verlassen hatte. Nur der Vollmond begleitete mich weiter durch die Dunkelheit. Sein silberner Schein veränderte die Natur und verlieh ihr etwas Zauberhaftes. Ich durchblätterte meinen Gedichtband mit den Werken der Alten, der alten römischen Liebeslyriker. Ihre amourösen Verse hatten mir schon so manche Wartezeit versüßt und stimmten mich jetzt auf prächtige Sommernächte ein. Es machte mir nichts aus, in dem schummrigen Licht kaum mehr lesen zu können, kannte ich die Gedichte doch fast auswendig. Ich fiel in eine Art sehnsüchtige Trance. Amor würde auch mich bedenken im sonnigen Süden. Ach!
Im Rhythmus der Verse (ich skandierte in Gedanken gerade Catull) ließ ich mich sanft hin- und herschaukeln, als meine klassisch-romantisch dahinholpernde Spazierfahrt jäh endete. Mit einem ohrenbetäubenden Quietschen, einem heftigen Gepolter, Rattern und Knacken und einem letzten unsanften Ruck blieb der Zug stehen. Mich beugte es unfreiwillig vornüber, dann schleuderte es mich grob gegen die Lehne. Ich rieb mir den Hinterkopf. Mein Büchlein und meine ausgepackte Brotzeit lagen jetzt auf dem Boden. Ich schaute aus dem Fenster, blickte aber nur in ein fragendes Augenpaar. Meine Augen. Dann machte ich mich daran, meine Sachen zusammenzuklauben. Inzwischen hörte ich draußen auf dem Gang lautes, aufgebrachtes Stimmengewirr.
Als ich meine Siebensachen beisammen und verstaut hatte, öffnete ich die Schiebetür, um mich zu erkundigen, was los sei. Denn allem Anschein nach war das kein planmäßiger Halt. Doch trotz meiner passablen Italienischkenntnisse verstand ich in dem Durcheinander nur Bahnhof, was wohl das Unpassendste in dieser Situation war, da wir uns gefühlt irgendwo im Nirgendwo befanden und weit entfernt von jeder Haltestelle.
Ich versuchte mich zumindest freundlich bemerkbar zu machen: »Scusa! Scusa!«, und erhaschte mittels Gesten endlich auch die Aufmerksamkeit einer kompetent aussehenden signora. Aber trotz ihrer gepflegten Erscheinung wusste sie auch nichts. Ich ließ mich wohl allzu sehr von Äußerlichkeiten blenden. Dennoch bedankte ich mich höflich: »Grazie mille, signora«, und zog mich wieder in mein Abteil zurück, weil mir das unverständliche Geschrei und Gedränge auf dem Gang mit der Zeit zu sehr auf die Nerven ging. Ergeben fügte ich mich in mein Schicksal und starrte vor mich hin. Früher, zur Zeit von Goethe und Eichendorff, gab es auch unvorhergesehene Zwischenfälle beim Reisen, tröstete ich mich.
Als ich gerade dabei war, mich wieder in meinen Träumereien zu verlieren, wurde die Tür unsanft aufgerissen und ein italienischer Wortschwall prasselte auf mich ein, dass ich mich wie ein begossener Pudel fühlte und wohl auch so guckte, eben weit entfernt von des Pudels Kern, was Sache sei. Mein Gegenüber erfasste, dass ich ein ausländischer Fahrgast war, und sprach (leider) auf Englisch weiter, anstatt das Gesagte noch einmal langsam und verständlich auf Italienisch zu wiederholen. So konnte ich aus dem gebrochenen Italo-Englisch nur erraten, dass die Fahrt hier zu Ende sei. »Grazie per l’informazione, signore!« Wenigstens wollte ich ihn wissen lassen, dass ich durchaus seiner Landessprache mächtig und kein Banause war.
Wie dem auch war, mir blieb nichts anderes übrig, als es den anderen Fahrgästen gleichzutun und auszusteigen. Ich schulterte meine abgewetzte Umhängetasche und griff nach meinem antiquarischen Lederkoffer und bereute gleichzeitig, dass ich aus Nostalgiegründen das schwere unhandliche Teil anstatt meines leichten, rollbaren Alukoffers ausgewählt hatte.
Nachdem sich die meisten schon mit Sack und Pack durch die aufgestemmte Tür nach draußen gezwängt hatten, wagte auch ich mich auf die eiserne Ausstiegstreppe ins Niemandsland. Da stand ich nun. Pampa statt Campagna. Aber was sollte es: auch ich in Arkadien!
Wenn ich mir die planlose Hektik der auf- und abrennenden Leute sowie ihr überflüssiges Geschrei in die Handys wegdachte, war es richtig romantisch: ein einsam gestrandeter Zug inmitten einer silbermondbeschienenen Landschaft bei milden Temperaturen. Leider gelang mir das Ausblenden meiner Mitmenschen nur für ein paar Sekunden.
»Dove siamo?«, fragte ich eine signora und erhielt – wenigstens auf Italienisch – zur Antwort, dass wir etwas südlich von Livorno seien. Aha. Livorno. »Grazie.« Na, Dankeschön. Nicht gerade antike Tempel und römische Brunnen, sondern Erdölraffinerie und Containerhafen. Deshalb war ich hier bei meinen früheren Reisen noch nie ausgestiegen. Ich lief ohne Ziel am Gleis neben dem Zug entlang. Warum, wusste ich auch nicht. Mir erschien aber Bewegung aus unerklärlichen Gründen sinnvoller als statisches Warten. Damit reihte ich mich in den Trupp der Massen ein.
Unterwegs trafen wir Gestrandete endlich auch auf einen überforderten Zugbegleiter, der uns hektisch erklärte, es habe einen tragischen Zwischenfall gegeben. Was er damit meinte, war klar, zumal er seine Ausführungen mit eindeutigen Gesten untermalte: Er wedelte mit seiner Handfläche vor seinem Hals hin und her. Ich erinnerte mich an das Rattern und Knacken vorhin. Der Zug werde hier die nächsten Stunden festsitzen, wahrscheinlich sogar bis in die Morgenstunden, bis die polizia den Tatort freigegeben habe. Eigentlich müssten die Passagiere an Bord bleiben … Er zog schulterzuckend von dannen. Verständlich. Wie sollte hier ein Schaffner allein Herr der Lage werden?
Der vordere, von der Lok und von der bereits eingetroffenen polizia taghell erleuchtete Bereich war bereits weiträumig abgesperrt, sodass ich es vorzog, die andere Richtung einzuschlagen. Die Reise ging ja gut los. Gleich eine zerstückelte Leiche als Wegbegleitung. Hatte der arme Tropf, der da jetzt in seinen Einzelteilen verstreut lag, keinen anderen Ausweg gesehen? War es Liebeskummer? Kurz blitzte in dem gleißenden Scheinwerferlicht das Antlitz der strahlenden Diana vor meinen Augen auf. Sie schien gerade einen ihrer Jagdpfeile in mein Herz bohren zu wollen. Ich verfluchte sie. Es gab immer eine bessere Lösung!
Ich folgte den meisten Leuten, in der blinden Annahme, sie wüssten, wohin sie gingen. Schwarmintelligenz, dachte ich mir wohl dabei. Doch eigentlich dachte ich gar nichts. Viele stiefelten nämlich querfeldein von den Gleisen weg und hinterließen mit ihren Rolltrolleys beträchtliche Furchen in der ach so lieblichen Landschaft. Als sich meine vom Scheinwerferlicht noch geblendeten Augen wieder an die Dunkelheit gewöhnt hatten, erkannte ich auch den Sinn des Marsches. Weiter hinten war eine Straße. Kleine Lichtkegel zogen vorbei oder blieben kurz stehen. Es hielten immer wieder Autos und transportierten nach und nach die wild gestikulierenden und aufgebrachten Reisenden ab. Die meisten nach Süden, schließlich waren wir alle irgendwie auf dem Weg nach Rom. Rom …
Seufzend ließ ich mich an einer Bucht am Straßenrand neben meinem schweren Lederkoffer im stoppeligen Gras nieder. Einer nach dem anderen wurde abgeholt, mit baci begrüßt, umarmt und eingeladen. Jeder schien jemanden zu kennen, den er anrufen konnte und der ihn dann nachts mitten auf einer Landstraße aufgabelte. Beneidenswert.
Ich saß da. Wen sollte ich auch anrufen? Oder sollte ich einfach irgendjemanden ansprechen, dass er mich mitnahm? Aber wohin überhaupt? Bis nach Rom?
»Signore!« Im ersten Moment reagierte ich gar nicht, weil ich nicht damit gerechnet hatte, dass die Ansprache inmitten des Wortgewimmels ausgerechnet mir gelten sollte. Doch dann wiederholte die liebliche Stimme: »Signore?«
Ich sah hoch und in das freundliche Gesicht einer – wie sollte ich sagen? In dem Moment fehlten mir die Worte. Ihr Lächeln war umwerfend. Zähne wie milchige Perlen zwischen den sinnlichen Lippen … Ich musste mich erst berappeln, sammeln, sortieren. Dann stammelte ich: »Io? Sì?«
»Vuole accompagnarci?« Sie hatte sich etwas zu mir hinuntergebeugt, damit ich sie besser verstehen konnte. Dabei war ihr seidiges, schokoladenfarbenes Haar nach vorne geflossen und hatte sanft meine Wange gestreift. Es duftete nach – nach … Irgendwie machte mich diese Frau sprachlos. Dabei begriff ich, dass sie auf eine Antwort wartete. Also was? Accompagnare – begleiten? Wen? Wer? Ich? Durfte das wahr sein? Oder hatte ich gerade meinen Kopf verloren? Nein, das war ja der andere, der unter und um den Zug herum lag.
»Na klar!«, beeilte ich mich zu sagen. »Äh, also, ich meine: volentieri, gern!« Wohin, war mir gerade egal.
Sie wies mit einer Handbewegung in Richtung eines klapprigen Transporters, in dem ein Mann am Steuer saß. Scheiß auf den Typen! Ich rappelte mich auf und folgte ihrer Einladung zum Wagen. Sie stellte mir Francesco als ihren Bruder vor. »Ciao!« Bruder also, sehr angenehm.
Nachdem wir uns ein wenig ausgetauscht hatten, wurde mein Italienisch immer flüssiger, und es stellte sich heraus, dass die beiden auch Deutsch sprachen, weil ihre Großmutter einst mit einem Deutschen, (einem gewissen Heinrich), verheiratet war. So verstanden wir uns gut in einem zweisprachigen Mix. Und zu dieser Oma sollte es auch gehen. Nach dem gegenseitigen Beschnuppern und Kennenlernen verstauten wir meinen Koffer hinten, und Eleonora – so hieß die bezaubernde junge Frau – und ich kletterten neben Francesco auf die Sitzbank. Ich musste mich notgedrungen nah an Eleonora drängen, damit ich noch Platz hatte. Ihre Beine steckten zwar in langen Hosen, aber was ich unter dem Stoff ahnen konnte, ließ meine Hose zunehmend mehr spannen im Bereich unter dem Gürtel. Ich gab vor, zu frösteln und zog meine Jacke vorne weiter zusammen. Zum Glück fuhr Francesco gleich los, sodass alle nach vorne auf die Straße schauten.
»Wir waren gerade auf dem Weg zu unserer nonna, da haben wir im Radio von dem Unglück gehört«, erklärte Eleonora. »Das heißt, so direkt sagen sie das ja nicht in den Medien. Aber man kann sich denken, was passiert ist.«
»Und dann die vielen Menschen hier,« fügte Francesco knapp hinzu. Er untermalte seine Aussage dafür aber mit einer ausladenden Geste, während er durch die Nacht brauste, sodass ich mir wünschte, der Bus hätte einen Autopiloten. Sah er eigentlich, wo er hinfuhr? Die kurvenreiche Straße war kaum beleuchtet.
»Sì