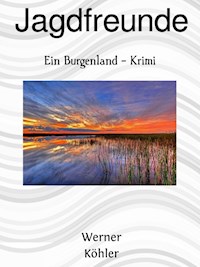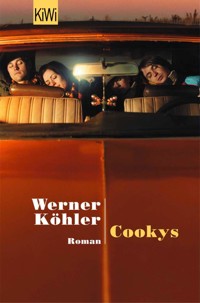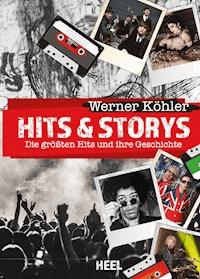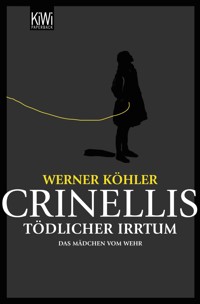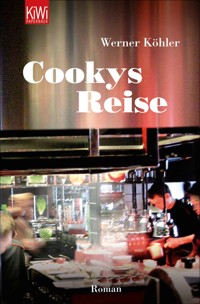15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Verwirrung, eine Entscheidung, schließlich das Paradies Santiago de Chile. Ein Gewitter entlädt sich über der Millionenstadt. Trinidad Faber, Fotograf, hockt auf der Kante seines Hotelbetts, einen Brief von dem Mann in Händen, den er seit 40 Jahren für tot hält. Einen Brief seines Vaters, der ihn wiedersehen will.Verwirrt und zutiefst verunsichert flieht Faber vor den aufbrechenden Erinnerungen in den Süden des Landes. Patagonien mit seinen weiten Steppen, der Magellanstraße und dem einzigartigen Torres del Paine Nationalpark. In der Landschaft spiegelt sich sein bisheriges Leben ebenso wie in den wenigen Menschen, denen er dort begegnet. Er weiß, dass er eine Entscheidung treffen muss.Endlich bereit sich seiner Vergangenheit zu stellen, reist Faber nach Griechenland und begibt sich auf die Suche nach dem Vater. Was er dort findet, ist die lange verdrängte Geschichte seiner Kindheit. Aber hat er damit auch die Wahrheit gefunden?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
» Buch lesen
» Das Buch
» Der Autor
» Impressum
[Menü]
There is a crack, a crack in everythingThat’s how the light gets in.
Leonard Cohen »Anthem«
[Menü]
FABERS IRRITATION
I.
Der nächtliche Anruf brachte Unordnung in Fabers Leben. Ein Brief für ihn? So ungewöhnlich, dass Sandra es für nötig befunden hatte, ihn trotz des Zeitunterschieds ohne Aufschub darüber zu informieren. Konstantin Karamanolis stand als Absender auf der Rückseite des Couverts. Ein Mann, auf dessen Existenz in Fabers Leben nur noch der Geburtsname in seinen Ausweispapieren hinwies. Für einen Scherz war die Sache eindeutig zu makaber.
Ein Brief seines Vaters mit dem handgeschriebenen Zusatz: persönlich. Vor zwei Tagen in Griechenland aufgegeben, überbracht von einem FedEx-Boten. Eine Eilzustellung von einem Mann, den Faber im Alter von fünf Jahren zum letzten Mal gesehen hatte und an dessen Aussehen er sich nicht mehr erinnern konnte. Von einem Mann, den er seit beinahe einem halben Jahrhundert für tot hielt.
Vor den Scheiben des Hotelfensters zuckten erste Blitze, tauchten den Nachthimmel über Santiago für Momente in ein bedrohliches Violett. Seit Tagen schon war die Luft mit heißem Wasserdampf gesättigt. Nach wenigen Metern im Freien überzog ein klebriger Schweißfilm die Haut. Die hohe Luftfeuchtigkeit raubte der Stadt und ihren Bewohnern die Lebensenergie. Der aufkommende Wind würde das Hochdruckgebiet in Richtung Anden verschieben, das Gewitter eine kurze Erleichterung bringen.
Doch weder die vom Hotelfenster bei Nacht besonders gut erkennbare Struktur der Innenstadt, noch die Naturgewalten, die sich über dem weitläufigen Hochplateau entluden, vermochten Faber vom Schock der Nachricht abzulenken. Eine Nachricht, für die es keinen schlechteren Zeitpunkt hätte geben können.
Faber wickelte ein Glas aus der sterilen Verpackung und goss es halb voll mit dem schottischen Quellwasser, das bei Buchungen stets für ihn geordert wurde. Er verschloss die Flasche sorgfältig, bevor er trank. Die Kühle im Mund schenkte ihm einen kurzen Moment der Entspannung. Mit dem letzten Schluck nahm er eine Tablette. Er legte den Kopf in beide Hände und rieb sich mit den Handballen die Augenhöhlen. Wenigstens der dumpfe, pulsierende Schmerz hinter seinen Augen könnte doch endlich nachlassen.
Sandras Anruf hatte ihn nicht aufgeweckt, das Schrillen des Telefons ihn nicht wirklich erschreckt. Er war am vergangenen Abend erst spät zu Bett gegangen, nachdem er rastlos die Straßen durchstreift hatte, auf der Suche nach nichts, außer dem Ende der Nacht. Vollständig bekleidet hatte er sich aufs Bett gelegt und eine kleine Ewigkeit regungslos auf den rötlich-braunen Fleck an der Zimmerdecke der eleganten Suite gestarrt. Erst nachdem seine Augen zu brennen anfingen, hatte er sich ausgezogen und auf die Seite gerollt. Eingeschlafen war er nicht.
Jetzt musste Faber dem Impuls widerstehen, diesem Ort, der ihm von Minute zu Minute unerträglicher wurde, auf dem schnellsten Wege zu entfliehen. Unsichtbar werden war ihm zur zweiten Natur geworden. Und hatte ihm mehr als einmal das Leben gerettet. Er konnte Länder und Städte, aber auch Menschen ohne jede Gefühlsregung verlassen. Darin war er manchem seiner Kollegen ähnlich. Das Heer der Kriegsnomaden teilte sich in zwei Lager auf: in diejenigen, die einen starken Familienzusammenhalt brauchten, um ein Leben, wie sie es führten, überhaupt durchstehen zu können. Und in die weitaus größere Gruppe derjenigen, die sich fast schon spielerisch der Gefahr hingaben.
Die Nachricht vom Brief seines Vaters hätte ihn auch an jedem anderen Ort der Welt erreichen können. Was ihn aufschreckte, war die zeitliche Parallelität. Er begleitete Inkas Sterben jetzt schon etwas länger als eine Woche. Direkt nachdem ihn in Europa der Anruf ihrer Familie erreicht hatte, war er nach Chile geflogen. Dabei hatte er geschworen, niemals wieder hierher zurückzukehren.
Lange konnte es nun nicht mehr dauern. Die einstmals so schöne Frau verfiel von Tag zu Tag mehr. Wenn die Ärzte recht behielten, würde sie die nächsten vierundzwanzig Stunden nicht überleben. Fabers Tasche stand jedenfalls schon zur Abreise fertig gepackt an der Hotelzimmertür.
Bei Sonnenaufgang checkte er aus. Sein Weiterflug nach Punta Arenas, wo er zu fest vereinbarten Werbeaufnahmen erwartet wurde, war erst für den nächsten Tag gebucht, aber in diesem Hotel, das stand für ihn fest, würde er keinesfalls bleiben.
Auf dem roten Teppich, direkt hinter der Drehtür, verharrte er kurz und schaute zum Himmel, wo die Sonne den Frühdunst zu vertreiben suchte. Er schob sich die Sonnenbrille vor die Augen und überquerte die Straße. Gegenüber lag eine für südamerikanische Verhältnisse prachtvolle Parkanlage. Wege und Pflanzen überzogen einen aufgeschütteten Hügel, von dessen höchstem Punkt man mit etwas Glück am Horizont die Kette der Anden sehen konnte.
Er spazierte die Avenida Bellavista entlang, überquerte den Río Mapocho und bog auf Höhe der Avenida Recoleta schließlich in die Straßen des historischen Zentrums ein. Faber schlenderte über breite Gehwege und betrachtete die Auslagen eines Haushaltwarengeschäfts mit dem gleichen entrückten Gesichtsausdruck wie die Perückensammlung des daneben gelegenen Friseursalons. Er fotografierte einen Mann undefinierbaren Alters, der sich mit einem Mitarbeiter der städtischen Müllabfuhr um den Inhalt einer Tonne stritt, und bestaunte nicht zum ersten Mal die Ähnlichkeit der Metropole mit dem europäischen Paris.
Etliche Boulevards, Litfaßsäulen und Pissoirs weiter erreichte Faber das Herz der Stadt, die Plaza de Armas. Zwischen Bürotürmen, Rathaus, Kathedrale und Hauptpost war der von Bäumen umsäumte Platz eine Bühne für Flaneure, Straßenhändler, Gaukler und Taschendiebe. Belebt bis tief in die Nacht, wenn die Stadt sich schon wieder für den neuen Tag herausputzte, boten sich hier Männer und Frauen in dunklen Ecken für jeden Dienst an, den sie für verkäuflich hielten. So früh am Morgen empfand Faber die Luft über der Plaza noch als frisch und klar. In wenigen Stunden, wenn die Sonne ihren Zenit erreichte, würde die Schwüle zurückkehren und mit ihr die Abgase von Hunderttausenden Autos den Menschen das Atmen fast unmöglich machen.
Eine Brise strich vom hundert Kilometer entfernten Pazifik über das Land. Die ersten Sonnenstrahlen lugten über die Bebauung und spiegelten sich in den Pfützen. Die Grünanlagen, die den Platz nach allen vier Himmelsrichtungen begrenzten, waren gepflegt. Es roch nach feuchter Erde, vermischt mit dem süßlich schweren Duft von Rosen.
Faber zog die D-Lux4 aus der Hosentasche. Die kleine Kamera war eine Sonderedition und die einstellige Seriennummer auf dem Metallplättchen Ausdruck für seinen Stellenwert unter den Gegenwartsfotografen.
Bei der Arbeit trat Faber den Menschen ohne jede Scheu entgegen. Für Porträtaufnahmen ein Teleobjektiv einzusetzen, wäre ihm niemals in den Sinn gekommen. Es hätte ihn des intimsten Moments seiner Arbeit beraubt. Niemals durfte sein Auftritt die Menschen stören, da sie sonst ihr Verhalten ihm und der Kamera gegenüber grundlegend verändern würden. Der Ausdruck auf ihren Gesichtern sollte wahrhaftig sein. Faber wollte die großen und kleinen Dramen hinter ihrer Stirn sichtbar machen. Falten, die das Leben in ihr Gesicht gegraben hatte. Nur einen Gesichtsausdruck, ein Starren vielleicht, ein verrutschtes Lächeln, ein Schielen, das Aufblitzen eines Gedankens brauchte er, um sich für sie zu interessieren.
Wenn er eine Situation als heikel einstufte, dann deutete er kurz auf seine Kamera und sah dabei seinem Gegenüber fest in die Augen. Meistens erhielt er ein zustimmendes Nicken, und von dieser Sekunde an wurde der Fotograf für seine Modelle unsichtbar. Ein Vorgang, der ihn nach all den Jahren als Fotograf immer noch faszinierte. Wenn der geringste Widerwille gegen die Aufnahmen spürbar wurde, akzeptierte er den Wunsch nach Privatsphäre und verschwand, ohne auch nur den Versuch unternommen zu haben, sein Gegenüber umzustimmen.
An diesem Morgen stieß er auf keinerlei Ablehnung.
Als die Sonne begann, die Konturen aufzuweichen, verzog sich Faber in einen alten Eissalon. Im hinteren Teil des Ladens quetschte er sich in eine Sitzecke, ehemals rotes Leder, im Rücken brüchig, auf dem Sitz abgewetzt-speckig. Er wartete auf den Kellner und bestellte einen starken Kaffee, einen, der einem Espresso am ähnlichsten und vom meist ausgeschenkten Nescafé am weitesten entfernt war.
Die Arbeit hatte Faber Klarheit verschafft. Er hatte sich entschieden, vorerst keinen weiteren Gedanken an den mysteriösen Brief zu verschwenden. Er hatte sich nur noch nicht aufraffen können, dies auch Sandra mitzuteilen.
Sandra war seine persönliche Agentin, sein Büro und auch sein Zuhause. Sie besaß fast unbegrenzte Vollmacht und hatte Anweisung, ihn mit bürokratischen Dingen nur zu behelligen, wenn es absolut unumgänglich war. Für diesen Service zahlte er ihr eine Menge Geld. Die restlichen Transaktionen steuerte er von seinem Laptop. Ihm war schleierhaft, warum nicht mehr Menschen die Freiheit wählten, sich jederzeit an jedem Ort der Welt aufhalten zu können.
Sandra hatte von ihm klare Anweisungen verlangt, was mit dem Brief zu geschehen habe. Sie war wie immer neugierig gewesen, schien aber auch ein wenig um ihn besorgt. Wahrscheinlich wollte sie weitere Irritationen von ihm fernhalten, die einer termingerechten Ablieferung seiner Arbeiten im Wege stehen könnten. Er verstand schon, dass ihr inzwischen die Argumente ausgingen, mit denen sie seine immer zahlreicher werdenden Ausfälle den Auftraggebern gegenüber begründen konnte. Doch das war es nicht allein: Sie hatte sich vor Monaten in ihn verliebt und hoffte nun, ihn mit ihrer Fürsorge für sich gewinnen zu können. Zumindest sah Faber das so. Dabei hatte er nur eine einzige Nacht mit ihr verbracht. Nicht mehr Zeit also, wie mit jeder anderen Frau vor und nach Sandra auch. Obwohl sie ihm am nächsten Morgen versichert hatte, dass das kleine Abenteuer keinesfalls ihre Zusammenarbeit belasten müsse, wusste es Faber besser.
Sandra war eine kluge Frau. Sie hatte ein interessantes Gesicht mit einer markanten Nase und einen ganz eigenen Humor. Manchmal vergaß Faber in ihrer Gegenwart die Zeit. Eine junge Frau, die wusste, was sie wollte, die sehr selbstständig war, und bereit, Freiräume zuzulassen. Er hätte Sandra ebenfalls lieben können, wenn er Interesse an einer Beziehung gehabt hätte. Die gemeinsame Nacht war ein Fehler gewesen.
Endlich zog Faber das Handy aus der Innentasche seiner Reisejacke und schickte ihr eine Kurznachricht: Leg den verdammten Brief, schrieb er, und setzte verdammt in Anführungszeichen, wofür er ewig brauchte, weil er sich mit den Sonderzeichen auf der Handytastatur schwertat, einfach in mein Fach. Gruß Trini.
Trini Faber war sein Künstlername. Er bestand aus der Kurzform seines tatsächlichen Vornamens Trinidad (angeblich der Ort seiner Zeugung) und seinem Rufnamen aus Jugendtagen, als er ständig einen weichen Faber-Castell 2B-Bleistift hinter dem Ohr trug und alles aufzuschreiben oder zu zeichnen versuchte, was ihn faszinierte. Ein Faber-Castell steckte auch heute immer noch in seiner Jackentasche.
Faber nahm ihn zur Hand, um die Bildnummern der morgendlichen Serie in sein schwarzes Notizbuch einzutragen, während er mit der freien Hand den schlechten, aber heißen Kaffee schlürfte. Das Wasserglas hatte er dem Kellner gleich wieder zurück auf das Serviertablett gestellt und dabei den Kopf geschüttelt. »Kein Wasser«, hatte er auf Spanisch geflüstert und sich, ohne eine Antwort abzuwarten, gleich wieder über das Display der Leica gebeugt.
Bürokräfte eilten zur Arbeit. Schuhputzer bezogen ihren Platz vor dem Thron aus dunklem, fast schwarzem Holz. In den vergoldeten Scharnieren brach sich das frühe Licht der Sonne. Limonadenverkäufer brachten ihre Läden in Position und die fliegenden Händler hielten Ausschau nach den ersten Touristen, die sich von den Uhren- und Schmuckkollektionen im Futteral ihrer Jacketts blenden ließen. Bettler mit tatsächlichen Gebrechen stritten sich mit solchen, die nur für eine begrenzte Zeit erblindet waren, um die besten Plätze. Die unvermeidlichen Straßenmusiker vertrieben sich die Zeit vor dem ersten Einsatz, indem sie jungen Mädchen in Schuluniform eindeutige Blicke zu- und anzügliche Bemerkungen hinterherwarfen. Nonnen verließen den Schutz der Klostermauern und strebten zwischen Büschen und Bänken hindurch der Kathedrale auf der Westseite des Platzes entgegen. Eine Horde Schulkinder jagte dem Ball so ausgelassen hinterher, als läge allein in diesem Spiel der Sinn des Lebens.
Faber nahm nicht aktiv am Leben teil. Seine Position befand sich außerhalb des Schachbretts. Er war der stille Beobachter, keine der handelnden Figuren. Er hatte aus der Not eine Tugend gemacht, aus einem Defekt seinen Beruf.
Normalerweise entlud Faber seine Kamerachips jeden Abend. Er sortierte die Bilder im Laptop mithilfe seiner Notizen, bearbeitete und speicherte sie anschließend auf externen Platten und formatierte die Speicherkarten für den nächsten Einsatz. Dieser Angewohnheit war er in der vergangenen Nacht nicht gefolgt. Deshalb zeigte das Display nach den letzten, den soeben erst entstandenen Aufnahmen, das Bild einer ausgemergelten Frau. Sie lag auf einem Krankenbett, den Kopf auf einem dünnen Kissen. Man konnte immer noch ihre einstige Schönheit erahnen. Schläuche steckten in ihrem Hals, in der Nase und ihren Armen. Das an den Schläfen bereits ergraute Haar klebte ihr auf der Stirn. Bei den Aufnahmen hatte sich Fabers Kamera nie weiter als fünfzig Zentimeter vom Gesicht der Frau entfernt befunden. Die Augen geschlossen, den Mund geöffnet, röchelnd, Speichelbläschen in den Mundwinkeln. Ihre Kieferknochen traten deutlich unter der pergamentfarbenen Haut hervor. Der Todeskampf hielt die Frau bereits umfangen.
Faber schaltete die Kamera aus und schob sie zurück in die Seitentasche seiner Cargohose. Unsicher strich er mit der Hand über seine unrasierten Wangen, über das Kinn, den Hals. Mechanisch wiederholte er die Bewegung, während er an seiner Wasserflasche nippte. Sein Blick glitt in die Ferne, verließ das Café, überquerte die Plaza de Armas und die Kathedrale Intendencia, flog über die Slums der Vorstädte hinaus auf das fruchtbare Plateau mit seinen kilometerlangen Reihen von Rebstöcken, die langen Kehren hinab zum sechshundert Meter tiefer gelegenen Valparaiso, wo er schließlich auf den Pazifik und seine eigene Vergangenheit traf.
Faber stöhnte leise auf. Sein Atem kam jetzt stoßweise und er benötigte drei konzentrierte, tiefe Züge der abgestandenen Barluft, um sich wieder zu beruhigen. Entschlossen stand er auf, schulterte seinen Kamerasack, bezahlte den Kellner mit einem ordentlichen Trinkgeld und beeilte sich, dem Flug seiner Gedanken zu folgen.
[Menü]
II.
Das Krankenhaus von Valparaiso lag in entgegengesetzter Richtung zum Strand. Faber widerstand der Verlockung, ans Meer auszuweichen oder doch zumindest mit einem der zahlreichen Ascensores, den Standseilbahnen, in die höher gelegenen Stadtteile hinaufzufahren und von den Aussichtsplattformen die unendliche Weite auf sich wirken zu lassen.
Ein langer, dunkler Korridor öffnete sich ihm, als er mit trockener Kehle im dritten Stockwerk des Hospitals aus dem Aufzug trat. Das Linoleum des Fußbodens war an unzähligen Stellen bis auf den Estrich abgeschabt. Putz rieselte von den feuchten Wänden wie schmutziger Schnee. Im fiebrigen Halbdunkel der Notausgang-Schilder die langen Reihen der Betten beiderseits des Ganges. Ein Wartesaal des Todes.
Faber zog seine Kamera und machte ein paar Aufnahmen. An Krankenhäuser war er ebenso gewöhnt wie an das Antlitz des Todes, und doch hatte jedes Haus seine eigene Poesie. Er hatte wohl mehr Menschen sterben sehen als jede dieser Schwestern hier. Sogar mehr, als ein Mensch überhaupt sehen sollte. Aber diese Tode hatten nichts mit dem zu tun, weshalb er hier war. Kriege waren bis zu einem gewissen Punkt abstrakt. Niemand, der es nicht am eigenen Leib erlebt hatte, konnte sich vorstellen, wie es war, mitten in einem überhitzten Inferno aus Waffengebell, Rotorenlärm und brennenden Hütten zu stecken. Gebrüllte Befehle in unvertrauten Sprachen, das trockene Husten der Maschinengewehre, Schreie, explodierende Jeeps, Granaten. Und dazwischen die Sanitäter und Fotografen mit ihren blauen UN -Leibchen.
Eine Oase des Grauens in einer Wüste der Langeweile war eins von Fabers Lieblingszitaten, an das er sich vor allem dann erinnert hatte, wenn er in Kriegszeiten abends noch mit seinen Kollegen an der Bar saß. Es stammte aus Baudelaires Die Blumen des Bösen. Er hatte es von einem alten Hasen übernommen, kannte aber im Gegensatz zu diesem auch den Zusammenhang, aus dem es stammte:
Bitteres Wissen, das man von der Reise mitbringt! Die Welt eintönig, eng und klein, heut, gestern, morgen, immer zeigt sie uns unser Bild: Eine Oase des Grauens in einer Wüste der Langeweile!
Niemand kann sich ein solches Chaos für sein Leben vorstellen, und wenn es dann hereinbricht, ist es genau der Albtraum, den man nie erleben wollte, und er wird doch schnell zur alles überlagernden Normalität.
Soll man fortgehen? Bleiben? Bleib, wenn du bleiben kannst; geh, wenn du gehen musst. Der eine rennt, der andere hockt sich in den Winkel, um den wachsamen, verhängnisvollen Feind zu täuschen: die Zeit!
Faber kannte sich mit derlei schwer verdaulichen Kriegssituationen aus. Morgens noch saß er auf dem friedlichen Münchner Flughafen, abends die Salven der Kalaschnikows, die die Luft erfüllten, die Kampfpanzer, verbranntes Land, umherirrende Menschen. Tote ohne Kopf, Sterbende ohne Beine, Landminen, überforderte Blauhelme, das Grauen.
Ständig weiter fotografierend, betrat Faber durch eine Schleuse den Bereich, den kaum ein Patient lebend wieder verließ. In diesem Krieg trugen die Blauhelme Schwesterntracht. Einer dieser neutralen Geister des Krankenhauses verpasste ihm einen Kittel und einen Mundschutz, gerade so, als könnten irgendwelche Erreger oder Viren Inka jetzt noch schaden.
An der Wand des Schwesternzimmers hing ein hoher Spiegel. So kurz vor der Begegnung mit dem Tod erschien Faber die Person, die ihn daraus anschaute, seltsam fremd. Wer war dieser Mann mit den zwei schweren Kameragehäusen um den Hals? Nur mittelgroß, aber immer noch ein bis zwei Köpfe größer als alle Schwestern auf der Station. Schlank und einigermaßen stolz darauf, mit neunundvierzig noch eine derart durchtrainierte Figur zu besitzen. Aber das schwarze Haar ergraute bereits und die Geheimratsecken wurden von Jahr zu Jahr ausgeprägter. Er trug ein Kapuzenshirt mit der Aufschrift Ich werde nicht in diesem Flugzeug sein, das viele für eine Anspielung auf 9/11 hielten. In Wirklichkeit war es ein Filmzitat aus Casablanca.
Faber betrachtete sich genauer. Schwarze Augen, dunkler Teint, eher ein südländischer Typ. Augenbrauen, um deren Wuchs er sich nicht kümmerte, schmale Lippen, die Mundwinkel weder nach oben zeigend noch nach unten hängend und so etwas wie einen Dreitagebart, obwohl er sich erst vor Tagesanbruch glatt rasiert hatte. Eine Sonnenbrille baumelte, von einem elastischen Band gehalten, auf seiner Brust. Aus einer der Brusttaschen seiner beigen Funktionsjacke ragte der Schirm einer Kappe heraus. Er trug einen Rucksack.
Die Schwester sah zu Faber auf. Anstatt etwas zu sagen, machte er schnell einige Aufnahmen von ihr. Wie alt mochte sie sein? Faber betrachtete sie in dem großen Display der Nikon – eigentlich hatte sie ein hübsches Gesicht. Etwas grob vielleicht und die Augen standen zu nah beieinander, dafür hatte sie ein warmes Lächeln, das nie von ihrem Gesicht zu verschwinden schien, selbst wenn sie, wie in diesem Augenblick, auf das Fotografiertwerden ärgerlich reagierte.
»Don’t«, sagte sie knapp. »No photo!«
Er blickte über den Rand der Kamera, der Schwester direkt in die Augen. Etwas unbeholfen aber freundlich nickte er ihr zu.
Zögerlich nahm er die letzten Meter in Angriff. Eine Ecke, ein kurzes Stück den Flur hinunter, nochmals eine Linkskehre, und da hockte sie, in stiller Trauer vereint, die Familie der Sterbenden. Drei Erwachsene und fünf Kinder. Die Älteren saßen gedankenverloren auf harten, einfachen Stühlen. Inkas Schwiegervater schien zu beten, während die Kinder Karten spielten und dabei ganz vergnügt wirkten. Liebend gern hätte Faber sich jetzt zu ihnen gesetzt und einen Kartentrick vorgeführt, den einzigen, den er beherrschte – ein russischer Soldat hatte ihn ihm während des Kriegs in Tschetschenien beigebracht. Er war sich sicher, dass die Kinder den Trick lieben würden, und er könnte in ihre erstaunten Gesichter blicken, mit ihnen lachen und dann zum Höhepunkt der Vorstellung sich selbst aus diesem Gebäude wegzaubern. Aus der Stadt, aus dem Land, weit weg, dorthin, wo niemand ihn finden würde und niemand etwas von ihm erwartete.
Riella, Inkas Schwiegermutter, erkannte ihn trotz des grünen Kittels und des albernen Mundschutzes sofort. Sie sprang schneller auf, als es ihre Figur erwarten ließ, und kam mit trippelnden Schritten auf ihn zu. Eine füllige Frau, mit stiftkurzem Haar und Lachfalten um die Augen. Faber schätzte sie auf Anfang sechzig. Fast rannte sie in ihn hinein, ignorierte die Kamera vor Fabers Auge und presste ihren Körper so fest an den seinen, als sei ausgerechnet er die verheißene Rettung. In diesem Augenblick war er froh, mindestens zwei Köpfe größer zu sein. Steif blieb er stehen und versuchte gar nicht erst, sich ihrer Herzlichkeit zu entziehen, sah sich aber auch nicht in der Lage, sie zu erwidern. Sein unbeholfenes Lächeln blieb wegen des Mundschutzes unentdeckt.
So wie Faber sich bislang der Familie gegenüber verhalten hatte, musste sie sicher sein, dass er kein Wort Spanisch verstand. Wohl deshalb hatten sie den Versuch, ihn in ein Gespräch zu verwickeln, längst eingestellt. Riella war auf seiner Seite, ganz im Gegensatz zu den beiden Männern mit den grauen Gesichtern, die jetzt aufgestanden waren, um ihm wenigstens die Hand zu schütteln. Er wusste es aus den Gesprächen der Chilenen untereinander, die er bei seinem ersten Besuch belauscht hatte. Es waren wenige Sätze gewesen, die er damals aufgeschnappt hatte, aber sie hatten genügt, um ihm die Ablehnung der kleinwüchsigen Männer unmissverständlich deutlich zu machen. Faber wusste nicht, was sie gegen ihn hatten, aber sie ließen ihn in Ruhe, und mehr wollte er nicht. Sie begrüßten ihn kurz und setzten sich wieder hin.
Riella zog ihn an der Sitzgruppe vorbei und öffnete die Tür zu Inkas Zimmer. Auf dem Linoleum davor standen einige Vasen mit spärlichen Blumensträußen, einer davon stammte von Faber. Er hatte ihn am ersten Tag mitgebracht. Jetzt ließen die Blumen ihre Köpfe hängen.
Faber verschaffte sich noch einen letzten Aufschub, indem er den Kindern freundlich zuwinkte, zögerte noch einmal und trat dann ein, während die Tür hinter ihm leise ins Schloss fiel. Starr vor Angst drückte er sich mit dem Rücken an die Wand und schoss ein paar Bilder.
In Isla Negra, südlich von Valparaiso, waren Faber und Inka sich das erste Mal wieder begegnet. In einem der vier Häuser von Chiles berühmtestem Dichter Pablo Neruda, in dem heute ein Museum untergebracht war. Faber hätte den Auftrag der Zeitschrift normalerweise abgelehnt. Tausende äußerst seltener Bücher ins Bild zu setzen, die Pablo Neruda im Laufe eines Lebens als leidenschaftlicher Sammler zusammengetragen hatte. Wenn es nicht die zeitliche Überschneidung mit Inkas Anruf gegeben hätte.
Er hatte nicht einmal geahnt, wer am Apparat war. In einem Eisenbahnwaggon hatte er gehockt, daran erinnerte er sich immerhin noch. Aber ob in Thailand, Kerala, auf dem Weg nach Lhasa oder irgendwo sonst in Asien, das wusste er nicht mehr. Er war so bestürzt gewesen, dass er den Hörer weit von sich gehalten hatte, als könne er damit das Schicksal noch einmal abwenden. Stammelnd suchte er das Gespräch zu beenden, um die Kontaktaufnahme gleich im Keim zu ersticken, während sie ihm vom Ausbruch ihrer Krankheit erzählte. So war sie schon immer gewesen: direkt, klar, gradlinig, ohne Umwege auf ihr Ziel zusteuernd.
»Anfangs glaubte ich noch, mich hätte eine schwere Grippe erwischt. Ich fühlte mich total schlapp, alle Knochen im Leib taten mir weh. Eines Morgens wachte ich mit Nasenbluten auf, was mich furchtbar erschreckt hat. Ich ging zum Arzt, zunächst noch zu meinem Hausarzt. Der schickte mich sofort in eine Klinik. Das erste Mal überhaupt nach der Geburt meiner Kinder«, fügte sie hinzu.
»Warum rufst du mich an? Was willst du von mir nach so vielen Jahren?«, stöhnte Faber.
»Weil ich keine Zeit mehr habe, weil ich sterben werde, Trini. Leukämie. Ich habe eine monatelange Chemotherapie hinter mir. Zuerst fielen mir die Haare in der Nackengegend aus, dann hatte ich Blut im Stuhl. Überhaupt sah meine Scheiße aus wie frischer Teer, pechschwarz glänzend. Beim Zähneputzen fand ich schwarze Flecken auf meiner Zunge. Als ich genauer hinsah, war der gesamte Rachenraum schwarz. Irgendwann begann ich Blut zu spucken. Meine Mundschleimhaut löste sich auf. Ich habe mir die Haut in Fetzen aus dem Mundraum gezogen.« Sie legte eine kurze Pause ein. Faber hörte sie schwer atmen. »Ich will dich ein letztes Mal sehen. Ich muss dringend mit dir reden.«
Lange zögerte Faber. Immer wieder kamen im letzten Moment irgendwelche Jobs dazwischen. Er erkrankte an einer Mittelohrentzündung, die es unmöglich machte, ein Flugzeug zu betreten, oder seine Flüge nach Chile wurden urplötzlich vom Flugplan gestrichen. Insgeheim hoffte er, Inka würde aufgeben, würde seinen Widerwillen, sich mit Vergangenem zu beschäftigen, bemerken und ihn in Ruhe lassen. Aber dann hatte er den Pablo-Neruda-Auftrag angenommen und ehe er sich versah, stand er in Nerudas Haus in Isla Negra. Nach Abschluss der Arbeit traf er Inka in einer Wohnung außerhalb von Valparaiso.
Er blieb nur einen Nachmittag lang, länger ertrug er den durchdringenden Blick ihrer dunklen Augen nicht. Keine halbe Stunde nachdem sie im Garten des winzigen Holzhauses zum ersten Mal nach all den Jahren wieder allein waren, kam die Erinnerung mit voller Wucht zurück. Dabei hatte das Gespräch zunächst noch harmlos begonnen. Sie hatten der alten Zeiten gedacht, unsicher zwar, aber gerade deshalb mit einer angenehmen Distanz. Urplötzlich hielt Inka inne, sah ihn an und sagte dann:
»Meine Zeit ist um. Die ganzen Jahre über wollte ich mit dir über diese eine Sache sprechen, die mein ganzes Leben beeinflusst hat und wahrscheinlich auch deins. Deshalb habe ich dich gebeten, zu kommen.«
Faber war kurz darauf aufgesprungen und Hals über Kopf auf die Straße gestürzt. War zum Busbahnhof gehetzt und, sobald er zurück in der Hauptstadt war, zum nächsten Flieger, der ihn wegbringen konnte, nur weg aus dieser Bedrohung.
Nach seiner panischen Flucht hatte er noch versucht, alles von sich abzuschütteln, wie er es gewöhnlich tat, wenn er einer emotionalen Situation entkommen wollte. Aber dieses Mal gelang es ihm nicht. Nachdem die Krankheit bei Inka erneut ausgebrochen war, hatte sie sich entschieden, keine weitere Therapie mehr über sich ergehen zu lassen. Sie lehnte alle lebensverlängernden Maßnahmen ab. Sie hatte mit ihrem Leben abgeschlossen und wollte nur noch in Würde sterben.
Faber sah sich in dem Zimmer um. Steckdosen überzogen die Wand hinter dem Bett. Sauerstoffanschlüsse, Hämoperfusionsgeräte, gleich sechs davon in einem Rack. Ein Defibrillator, Ernährungspumpen, Medikamentenpumpen, unter der Decke ein Intensivüberwachungsmonitor. Ein Schlauch, der in ihre Vene ging. Morphium, um die schlimmsten Schmerzen zu lindern. Er trat an das Bett, fotografierte die Verdickung der Haut, durch die Nadel verursacht. Auf dem Nachttisch standen Bilder ihrer Familie. Daneben lag eine goldene Halskette mit einem Kreuz. Zwei Briefe und eine weitere Fotografie, die er nicht ansehen wollte. Faber wich entsetzt zur stützenden Wand zurück.
Plötzlich entrang sich ihrer Brust ein Stöhnen. Er näherte sich wieder, die Kamera schützend zwischen sich und die Sterbende haltend. Durch den Sucher glaubte er ein Zucken ihrer Augenlider wahrzunehmen. Er täuschte sich nicht. Inka öffnete die Augen. Er wollte laut aufschreien, aber seine Stimme blockierte. Sie blickte ihn fragend an. Faber versuchte die Kamera sinken zu lassen, seine Arme verweigerten den Dienst. Seine Augen wanderten von den Elektroden auf ihrer Brust zu dem Transportmonitor, der Herz- und Atemfrequenz anzeigte, Sauerstoffgehalt des Blutes, Blutdruck, Körpertemperatur. Zahlen und Kurven. Er fixierte das Beatmungsgerät, das Inka über einen dünnen Schlauch, der durch ihre Nase in die Lunge führte, mit Sauerstoff versorgte. Dann fiel sein Blick auf ihre Hand. Schweiß trat ihm auf die Stirn. Dabei war ihm eigentlich eiskalt. Er beobachtete die Hand durch den Sucher der Kamera. Eindeutig, die Finger bewegten sich. Er ließ die Nikon sinken und legte behutsam, fast zärtlich einen Zeigefinger auf ihren Handteller. Als Inka ihre Hand abrupt schloss, riss er erschrocken die Augen auf. Die Umklammerung wurde fester. Ihr Gesicht war schmerzverzerrt. Ein gewaltiger Ruck ging durch ihren Körper. Faber starrte sie so gebannt an, dass er nicht bemerkte, dass sie seinen Finger in der Zwischenzeit wieder freigegeben hatte. Inkas Körper schien sich aufzubäumen. Dann, einen winzigen Moment später, sank der abgemagerte Leib zurück auf die Laken. Ihre Züge entspannten sich und wirkten mit einem Mal ganz weich.
Für Sekunden überdeckte das Bild der jungen Inka das der Gestorbenen. Seine Schwester, die so wütend sein konnte und immer so aufrecht stand – Schultern