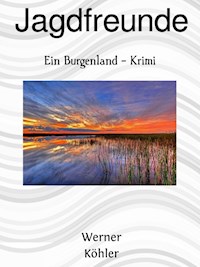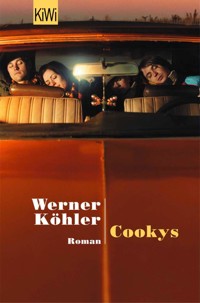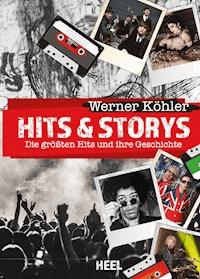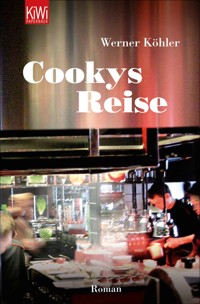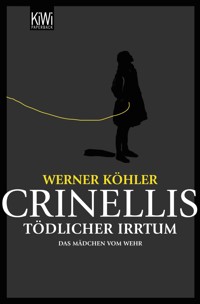
9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Eine Reise in die Dunkelheit Nach dem großen Erfolg seines ersten Romans Cookys zeigt uns Werner Köhler eine neue Seite seines literarischen Könnens: ein düsterer Krimi der Sonderklasse. Der grausame Fund einer Mädchenleiche erschüttert ein kleines Dorf. Für Hauptkommissar Crinelli führen die wenigen Spuren aus dem Ort heraus. Doch ein Blick hinter die Fassaden der scheinbar heilen Welt lässt ihn sehr bald Schreckliches ahnen ... Ein Dorf am Ende der Straße. Für Hauptkommissar Jerry Crinelli und seine schwangere Frau Maria soll hier ein neues Leben beginnen. Freundlich werden sie von der Gemeinde aufgenommen, doch dann geschieht ein Mord an einem unbekannten Mädchen, der alles verändert. Crinelli nimmt sich des Falls an. Je näher er dem grausamen Mörder zu kommen glaubt, desto tiefer gerät er in einen Strudel aus Korruption, Selbstherrlichkeit und Intrige. Bald hat Crinelli nicht nur das ganze Dorf gegen sich, er selbst verliert mehr und mehr die Distanz zu dem Fall.Crinelli glaubt nicht, dass die Leiche nur zufällig in seiner unmittelbaren Nachbarschaft gefunden wurde. Ein entscheidendes Detail muss ihm entgangen sein. Als eine zweite Leiche auftaucht, ist Crinelli sich sicher. Der Mörder ist ganz in seiner Nähe. Ihm bleibt nur wenig Zeit, will er ein weiteres grausames Verbrechen verhindern. Ein Wettlauf gegen die Uhr beginnt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 605
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
» Buch lesen
» Über das Buch
» Der Autor
» Informationen zum Autor (Klappentext)
» Lieferbare Titel / Lesetipps
» Impressum
Inhalt
Samstag
Dienstag
Februar bis Mai des gleichen Jahres
Dienstag
Nordwestdeutschland 1963
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Mittwoch
Nordwestdeutschland 1972
Donnerstag
Samstag
Niederkirchen
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Niederkirchen
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Sonntag
Montag
Dienstag
Niederkirchen
Mittwoch
Donnerstag/Freitag
Samstag
Sonntag
Danksagung
Über das Buch
Der Autor
Informationen zum Autor (Klappentext)
Lieferbare Titel / Lesetipps
Impressum
[Menü]
Samstag
»Maria? Maariiaa!«
»Ja, ich bin ja gleich so weit, schrei doch nicht so.«
Crinelli saß fertig angezogen in Marias Lesesessel am Kamin und blätterte in einem Buch der Blinker Bibliothek, einem der wenigen Bücher, das er besaß. Er musste feststellen, dass keinerlei Literatur über die Fische und Gewässer der Region im Regal stand, und beschloss, beim nächsten Mal, wenn er in der Innenstadt zu tun haben würde, in einer der großen Buchhandlungen zu stöbern. Ein wenig war ihm die Gegend vertraut, aber vielleicht gab es ja doch noch irgendwo einen Schatz zu heben.
»Da bin ich.« Maria lehnte im Türrahmen und Crinelli verschlug es für einen Moment die Sprache. In den letzten Wochen hatte er seine Frau häufiger in einem Arbeitsoverall als in normaler Kleidung gesehen, und er musste lange zurückdenken, wann sie sich zum letzten Mal so in Schale geschmissen hatte. Ganz offensichtlich sollten die neuen Nachbarn heute Nacht schwer beeindruckt werden, Crinelli war es jedenfalls schon einmal. Maria hatte sich betont weiblich gekleidet und wirkte fast schon ein wenig zu elegant für den Anlass. Die langen Haare trug sie hochgesteckt, und nur wenigen auserwählten Strähnen war es erlaubt, sich sanft auf die Schulter zu legen. Maria war, für ihre Verhältnisse, auffällig geschminkt. Ihre vollen Lippen verschwanden hinter tiefrotem Lippenstift.
»Na Crinelli, gefall ich dir?«
»Äh, wir müssen ja nicht unbedingt ausgehen.«
Sie lachte amüsiert auf. »Ich nehme das mal als Kompliment. Können wir dann, oder bist du noch nicht fertig?«
Crinelli erhob sich schnaufend und schüttelte wortlos den Kopf.
»Nimm in jedem Fall einen warmen Mantel mit. Ich hab keine Ahnung, wie es da zugeht, ob die Feier drinnen oder draußen stattfindet.«
»Du glaubst doch nicht, dass ich mir die ganze Mühe gemacht habe, um das alles hier unter einer dicken Pelle zu verstecken?«
Dennoch griff sie sich ihren warmen Wintermantel, legte ihn sich jedoch nur lässig über den Arm.
»Spürst du eigentlich schon etwas?«, fragte Crinelli und deutete auf Marias Bauch, während sie langsam mit dem Volvo durch die Nacht glitten.
»Nein, nur manchmal ist mir so, als ob sich etwas bewegt, aber ich glaube, das ist bloße Einbildung. Laut gängiger Schwangerschaftsliteratur soll man erst im fünften Monat überhaupt Bewegungen spüren können.«
»Du immer mit deinen Buchtheorien. Und was ist mit den Symptomen, von denen alle immer erzählen? Frauen würden sich übergeben, Gurken essen, immer müde sein und all so was?«
»Gott sei Dank scheint das bei mir nicht so zu sein. Vermutlich bekommen wir einen ziemlich stillen Jungen.«
»Mädchen!«
»Wieso glaubst du das?«
»Mädchen! Ist so ein Gefühl.«
»Aber ist doch auch egal. Ich bin jetzt im vierten Monat, da sollte ohnehin das Schlimmste überstanden sein. Ich hatte wohl Glück, und außerdem weißt du ja, dass ich Gurken nicht sehr mag. Na ja. Freust du dich immer noch auf das Kind, Jerry?«
Jerry lenkte den Wagen an den Straßenrand und hielt an. Natürlich freute er sich immer noch, warum fragte Maria?
»Komm her, meine Süße.«
Sie trafen sich über der Mittelkonsole.
»Küss mich, ich liebe dich.«
Ihre Lippen berührten sich und verharrten für einen langen Moment aufeinander. Ihre Zungen begannen miteinander zu spielen, normalerweise ein sicheres Indiz für bevorstehenden Sex.
»Stopp, Sir!«, sagte Maria und schob Crinelli von sich weg. »Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Wir sind schließlich in gesellschaftlicher Mission unterwegs, oder etwa nicht?«
Sie legte ihrem verdutzten Ehemann die Hand wie aus Versehen in den Schritt, durfte feststellen, dass Jérôme Crinelli ziemlich erregt war, und schaute ihn fragend an.
»Das zahl ich dir heim, du Biest«, erwiderte Crinelli.
»Moment noch.«
Maria klappte die Sichtblende an der Frontscheibe des Wagens herunter und öffnete die Klappe des Leuchtspiegels. Um ihre Lippen in dem kleinen Rechteck genau betrachten zu können, drückte sie ihren Rücken durch und begann sich die Lippen nachzuschminken. Crinellis Kehle entrang sich ein gedämpftes Stöhnen, er atmete hörbar tief ein und aus.
»Jetzt können wir wieder, Schatz«, hauchte Maria mit einem weiteren schelmischen Seitenblick.
»Katze!«, zischte Crinelli.
Nach diesem kurzen Stopp war Crinelli nach allem zumute, nur nicht nach Smalltalk mit den Dorfbewohnern. Aber sie waren nun einmal neu im Ort, und ein solches Fest war die ideale Gelegenheit, sich mit weiteren Menschen aus der Nachbarschaft bekannt zu machen.
Schon von weitem konnte man den Feuerschein über dem Neumann'schen Hof sehen. Der Bauer hatte ein riesiges Holzfeuer entzündet. Um die hoch lodernden Flammen herum standen an die hundert Personen. Der Geräuschpegel deutete daraufhin, dass man sich amüsierte und dass es die übliche zähe Anfangsphase einer Feier hier nicht gab. Neben den Erwachsenen rannten noch etwa ein Dutzend Kinder zwischen den Ställen und dem Herrenhaus hin und her. Am hinteren Ausgang des Hofes brannte ein weiteres, etwas kleineres Feuer. Darüber drehten sich zwei ganze Schweine an einem Spieß. Fett tropfte in das offene Feuer, und es roch verlockend. Gleich neben dem Grill war ein Stand aufgebaut. Die beiden kellnernden Mädchen hatten alle Hände voll zu tun. Sie zapften Kölsch vom Fass, was Crinelli freute. Er mochte kein Pils, es schmeckte ihm zu bitter, und Kölsch erinnerte ihn an zu Hause.
Sie waren noch keine zehn Schritte über den Hof gelaufen, als ihnen auch schon der Gastgeber entgegenkam. Neumann sah aus, als müsse er sich erst noch für das Fest zurechtmachen. Sein gedrungener Körper steckte in schäbiger Arbeitskleidung, und der Geruch, den er verströmte, untermauerte den ersten Eindruck noch. Hinter ihm tauchte eine kleine, ziemlich kräftig gebaute Frau auf.
»Herzlich willkommen, das ist aber schön, dass Sie kommen konnten. Und Ihre Frau ist ja auch dabei, sehr gut. Musste sie also nicht zu ihrer Mutter?«
Maria schaute den Bauern verdutzt an, aber bevor sie etwas sagen konnte, antwortete Crinelli für sie.
»Nein, das Treffen ist verschoben worden. Danke für die nette Einladung, ist ja ein großes Fest. Und Glück mit dem Wetter haben Sie auch.«
»Ja, kühl, aber klar. Guten Abend, ich bin Ännchen Neumann«, stellte sich die Bäuerin selbst vor, »aber Sie können Ännchen zu mir sagen, ohnehin duzen sich die meisten hier. Hier auf dem Land nehmen wir es nicht so genau mit den Förmlichkeiten, wissen Sie, und wenn Sie wollen ...«
»Gern«, erwiderte Maria, die, wie üblich, jede Gelegenheit zum schnellen Übergang vom Sie zum Du ergriff, »ich bin also Maria.«
»Und ich bin Jerry«, stimmte Crinelli zu.
»Jerry? Wofür ist das die Abkürzung?«, fragte Ännchen Neumann.
»Jérôme, ein französischer Name.«
»Aber dein Nachname hört sich eher italienisch an.«
»Gut bemerkt, ist er auch. Meine Familie stammte ursprünglich aus dem Grenzgebiet zwischen Norditalien und Südfrankreich.«
»Dann bist du also Italiener?«
»Nein, ich bin Deutscher. Ich war in meinem gesamten Leben noch nicht in Italien und spreche auch kein Wort Italienisch. Mein Großvater ist von Kalabrien aus direkt nach Köln gezogen. Schon mein Vater ist hier geboren und hat dann eine Urkölnerin geheiratet. Bei uns zu Hause sprach niemand Italienisch.«
»Frido, also eigentlich Fridolin, aber alle nennen mich Frido«, unterbrach der Bauer seine wissbegierige Frau. »Also, dann hätten wir ja schon mal das Wichtigste. Was haltet ihr davon, wenn ich euch mal einigen Leuten vorstelle, die ihr noch nicht kennt?«
»Nun lass die Beiden doch erst einmal ankommen, Fridolin, bevor du mit der Tür ins Haus fällst«, versuchte Ännchen wiederum ihren müffelnden Mann zu unterbrechen. »Nehmt euch ein Bier und mischt euch dann unters Volk, und wenn ihr wollt, können wir euch immer noch mit dem ein oder anderen bekannt machen. Die Spanferkel sind auch gleich fertig. Esst ordentlich, dann habt ihr eine gute Grundlage für den Alkohol.«
»Ännchen hat Recht, Jerry. Ich habe mächtigen Hunger«, dabei strich sich Maria über den Bauch, »und außerdem musst du jetzt erst mal abschalten.«
Neumann lachte, schnappte sich seine Frau und ging Arm in Arm mit ihr wieder zum Feuer. Für die Augen des Städters Crinelli bot das Paar, das sich so gar nicht für ein Fest herausgeputzt hatte, sondern vielmehr wirkte, als sei es gerade von der Feldarbeit nach Hause gekommen, einen ungewohnten Anblick. Aber die beiden waren ihm auf Anhieb sympathisch.
»Du erzählst ja schöne Geschichten, mein Lieber. Was sollte denn bei meiner Mutter gefeiert werden?«
»Ach, nur so eine Notlüge. Ich wollte nicht sofort zusagen und wusste ja auch nicht, ob du überhaupt Lust hast auf so ein Fest.«
»Und warum sagst du es dann nicht genau so?«
»Komm, Maria, Friede. Ich brauch ein Kölsch.«
Das erste Glas leerte Crinelli mit einem Zug gleich am Fass und ließ es sofort wieder nachfüllen. Gerade wurde auch das Schwein angeschnitten. Jeder holte sich eine dicke Scheibe knusprigen Schweinsbraten auf einem ebenso knusprigen runden Brötchen. Zusätzlich wurde noch Krautsalat aufgelegt, und zwei riesige Töpfe Senf standen zum Würzen bereit.
Es lag eine schöne Stimmung über dem Hof, und Crinelli entspannte sich zusehends. Noch eine zweite Portion, sowie einige weitere Stangen Kölsch, und allmählich fühlte sich alles richtig an. Schließlich gingen sie auf das zentrale Feuer zu. Als sie sich nach bekannten Gesichtern in der Menge umsahen, bemerkten sie eine Hand, die ihnen zuwinkte. Die Hand gehörte Sybille Zimmermann, der Inhaberin der örtlichen Bäckerei. Maria winkte zurück.
»Hallo«, rief die Zimmermann erfreut in die Runde, »darf ich vorstellen, das sind unsere neuen Dörfler, Familie Crinelli aus Köln. Herr Crinelli ist bei der Mordkommission, und seine Frau schreibt Bücher.«
Maria hatte sich gleich am ersten Tag, beim morgendlichen Brötchenholen mit der Frau des Bäckers unterhalten. Dabei hatte sich die hoch gewachsene, schlanke Frau als mitteilsam, aber auch sehr interessiert an den Crinellis gezeigt. Sie hatten sich über die Ladentheke hinweg ein wenig ausgetauscht.
»Hallo«, grüßten die Crinellis artig in die Runde.
»Ich stell euch gleich mal die anderen vor. Ich darf euch doch duzen, wir duzen uns hier alle?« Maria lächelte, doch Jerry war einigermaßen peinlich berührt von dem vereinnahmenden Wesen der Bäckersfrau. Als sie aber dennoch nickten, fuhr die Zimmermann fort: »Also, ich bin Sybille, und der hier ...«, sie packte den Mann, der ihr gegenüberstand, am Ärmel,»... ist Josef, mein Mann und gleichzeitig auch unser Bürgermeister. Und gleich neben ihm Traugott und Marlis Keppeler, kennt ihr ja wahrscheinlich auch schon, unsere Metzger hier im Ort. Sie haben besseres Fleisch, als ihr jemals in der Stadt kaufen könnt. Meist stammt es direkt von Frido oder einem der anderen Höfe in der Umgebung. Fritz Maasen kennt ihr ja schon?« Sie deutete auf den Wirt der Kupferkanne, der an diesem Abend ausnahmsweise sein Lokal geschlossen hielt, um an diesem Fest teilnehmen zu können. »Und dann haben wir hier noch die Hansens. Niklas und Jenny. Niki ist Schulleiter der Hauptschule in Taufheim. Jetzt kennt ihr alle. Schön, dass ihr da seid. Aber nun erzählt ihr doch mal, was Städter dazu bringt, in unser schönes Niederkirchen zu ziehen.«
»Ja, danke«, begann Crinelli, »also, ich weiß nicht, ob ich mir alle eure Namen direkt merken kann, aber danke für den netten Empfang, ich heiße jedenfalls Jerry und meine Frau Maria. Es hat sich ja vielleicht schon rumgesprochen, dass Maria schwanger ist, und deshalb sind wir auch in erster Linie hierher gezogen. Wir möchten nicht, dass unser Kind in der Großstadt aufwächst. Zu gefährlich.«
»Das stimmt nur zum Teil«, fiel ihm Maria ins Wort, »ich brauche einfach in den nächsten Jahren etwas Ruhe, nicht allein wegen des Kindes. Ich habe begonnen, einen Roman zu schreiben ...«
»Sie ist eine richtige Schriftstellerin«, unterbrach Sybille mit verzückter Stimme.
»... Na ja, eigentlich bin ich Lektorin, und zwar für Kochbücher. Das heißt, ich bearbeite Manuskripte von anderen, setze Texte, baue Bilder ein und all den Kram, den man ohne Computer nicht mehr machen könnte. Früher habe ich Filme fürs Fernsehen gedreht, Reportagen, ebenfalls zum Thema Essen und Trinken. Und jetzt will ich einmal versuchen, ob da noch mehr in mir ist, ob ich auch etwas Eigenes zu Papier bringen kann, aber dafür benötige ich Ruhe, und die habt ihr hier ja nun wirklich ausreichend. Aber richtig ist auch, dass Jerry nicht möchte, dass unser Kind in der Stadt aufwächst, obwohl ich persönlich ja finde, Köln ist nicht New York und der Grüngürtel nicht der Central Park.« Crinelli versuchte Maria durch seinen Blick darauf aufmerksam zu machen, dass er nicht gedachte, dieses Thema vor den immerhin noch fremden Leuten auszubreiten, was Maria aber nicht davon abhielt fortzufahren. »Jerry will, dass die Kinder auf dem Land aufwachsen und die Familie dann später, wenn der Nachwuchs größer ist, wieder zurück in die Stadt zieht. Und wenn mein Jerry sich was in den Kopf gesetzt hat, dann kommt man da nur sehr schwer gegen an.«
»Ich versteh das sehr gut. Bei meinem letzten Besuch in Köln, auf dem Weihnachtsmarkt, haben sie mir mein Handy und mein Portemonnaie aus der Handtasche geklaut«, verriet Jenny ihren Kummer mit der Großstadt.
»Ihr immer mit eurem Hass auf Köln. Ich weiß gar nicht, was das soll? Ich für meinen Teil bin froh, dass wir eine so tolle Stadt in der Nähe haben«, entgegnete Traugott Keppeler. Nichts an ihm erinnerte an einen Metzger, er trug einen gut geschnittenen Anzug, nur die futuristische Designerbrille wirkte etwas aufgesetzt. »Ich, das heißt wir, gehen regelmäßig ins Theater und gerne auch mal schön essen. Ich liebe das Nachtleben in großen Städten.«
»Da bringen mich keine zehn Pferde freiwillig hin«, fühlte sich jetzt auch Fritz Maasen genötigt, seine Meinung zum Besten zu geben.
»Sag mal Jerry, wie kommt man eigentlich als Italiener zur Mordkommission?« Die Frage kam von Josef Zimmermann.
»Ich bin Deutscher.« Crinelli erklärte seine Herkunft zum zweiten Mal an diesem Abend, aber darin hatte er seit Jahrzehnten reichlich Übung. »Aber woher wisst ihr eigentlich alle, dass ich bei der Mordkommission arbeite?«
»Na, das spricht sich schnell rum. Das ist ja das Gute an einer kleinen Gemeinde, die Menschen kennen sich untereinander und sprechen miteinander. Kruminga, unser Polizist, hatte natürlich nichts Eiligeres zu tun, als dich anzukündigen. Ist doch klar, dass ein solcher Zuzug für einen einfachen Dorfpolizisten, wie soll ich sagen, ein gewisses Ereignis darstellt und vielleicht auch eine potenzielle Bedrohung«, sagte Zimmermann.
»Eine Bedrohung? Ich verstehe nicht so ganz.«
»Ihr seid doch so was wie die Meister eures Fachs, und vielleicht befürchtet er, dass du so eine Art Kontrollinstanz sein wirst.«
»Das kann ich mir nicht vorstellen. Kruminga kennt doch den Polizeiapparat in- und auswendig, mit all seinen Berufsjahren, er weiß, dass ich hier nicht zuständig bin, und außerdem, was passiert hier schon?«
»Da hast du allerdings Recht«, mischte sich Keppeler in das Gespräch ein, »hier ist ein Polizist eher überflüssig, dafür haben wir wohl gleich zwei.«
»Ach was«, entgegnete Zimmermann, »Keller ist doch eher so was wie Krumingas Wachablösung. Er hat es doch nicht mehr weit bis zur Rente. Aber Verbrechen gibt es wirklich keine, wenn man von den gelegentlichen Geschichten mit den Zigeunern absieht.«
»Was?«, entfuhr es Crinelli.
»Na ja, was die halt immer so machen. Klauen, einbrechen, sich auf fremden Grundstücken rumtreiben. Wenn's dieses Pack nicht gäbe, könnten wir die Polizeistation in der Tat schließen.«
Maria verdrehte die Augen. Zimmermann zögerte und bemühte sich, keinen falschen Eindruck zu erwecken.
»Versteht mich nicht falsch, hier wohnen Jugos, Türken und Polaken. In meiner Backstube arbeitet sogar ein Moslem. Nein, wenn die Leute anständig und sauber sind, dann habe ich persönlich mit denen kein Problem, niemand von uns. Schau mal da rüber, der Frantisek zum Beispiel ist schon seit vier Jahren Knecht beim alten Neumann. Der wird gut behandelt, alles kein Problem, obwohl er immer noch kein vernünftiges Deutsch spricht.«
Crinelli schaute sich den großen, hageren Kerl an, auf den Zimmermann zeigte. Er stand mit einer Frau direkt neben der Stalltüre. Die Frau war Crinelli schon am Bierstand aufgefallen. Sie war hübsch, wirkte noch sehr jung und passte mit ihrer freizügigen Garderobe irgendwie nicht hierher.
»Will jemand Bier?«, Crinelli legte keinen gesteigerten Wert auf eine Fortführung einer ernsten Auseinandersetzung. Alle nickten, und Crinelli war froh, der Runde für einen Augenblick entkommen zu können. Zu seiner Freude stellte er bei der Rückkehr fest, dass sich die Gruppe etwas aufgelöst hatte. In den nächsten Stunden unterhielt er sich lange mit Niklas Hansen, der genau wie er selbst ein begeisterter Angler war. Mit Josef Zimmermann und Traugott Keppeler sprach er über die Jagd, von der er keine Ahnung hatte. Sie luden ihn ein, sie einmal in die Wälder zu begleiten. Maria stand derweil mit Sybille und Marlis zusammen und aufgrund ihrer Gesten war unschwer zu erraten, dass sich ihr Gespräch um Marias Schwangerschaft drehte.
»Jerry? Kommt, ich will euch noch den Liebermanns vorstellen, die müsst ihr unbedingt kennen lernen.« Das war Ännchen, die Maria bereits untergehakt hielt und sich jetzt auch Jerrys freien Arm schnappte, um beide zielstrebig in die gegenüberliegende Ecke des Hofes zu führen. Hier erinnerte wenig an das übrige Hoffest. Eine kleine Gruppe von Menschen stand lässig mit einem Glas Wein in der Hand da, wippte auf den Füßen hin und her, und statt konservativem Sonntagsornat trug man Jeans und Polo-Shirt. Es waren Städter. Auf zwei von ihnen steuerte die Bauersfrau zu.
»Hier, das sind die beiden, von denen ich euch erzählt habe. Ihr passt zusammen, da bin ich ganz sicher. Jerry und Maria Crinelli, und das sind die Liebermanns. Ophelia und Franz.«
»Aber Ännchen«, begann der kräftige Mann, »nur weil wir auch aus einer größeren Stadt kommen, musst du uns doch nicht gleich verkuppeln.« Seine Frau lachte laut auf.
»Unser gutes Ännchen, Sie müssen schon entschuldigen, aber sie ist immer sehr direkt, und wenn sie glaubt, dass ein Mensch einen anderen kennen sollte, dann packt sie das Thema sofort an. Wenn Sie wüssten, wen sie uns schon alles vorgestellt hat...«
»Und wurde aus allem Freundschaft?«, fragte Maria.
»Das kann man nun wirklich nicht behaupten.« Die Frau lachte wieder herzhaft und sah dabei ihren Mann an. »Wir haben nicht allzu viele Kontakte. Nicht aus Ablehnung. Wir kümmern uns hier um unser Haus, unseren Garten und haben unsere Berufe, da bleibt wenig Zeit. Die Dorfbewohner interpretieren das gerne schon mal ein wenig falsch.«
»Dummes Zeug«, erwiderte Ännchen Neumann, »das bildet ihr euch immer ein. Ihr könntet allerdings ein bisschen offener sein, etwas mehr auf die Leute zugehen, das ist nun einmal so, wenn man auf dem Dorf lebt, da kann man nicht mehr so für sich alleine sein, das ist eben eine richtige Gemeinschaft.« Ophelia Liebermann lächelte Maria an und legte Ännchen versöhnlich den Arm um die Schultern. »Das brauchen wir ja jetzt nicht zu vertiefen. Ich wollte euch nur miteinander bekannt machen, der Rest ist eure Sache.« Ännchen machte eine rasche Drehung und verschwand in eines der Gebäude.
»Sie ist schon ein spezieller Fall«, sagte Franz Liebermann, »aber ein mehr als liebenswürdiger, glauben Sie mir. Ich denke, ich stelle uns einmal vor, wo wir nun schon einmal zueinander geführt wurden. Also, mein Name ist wie erwähnt Franz Liebermann. Ich bin Journalist, arbeite inzwischen aber lieber als freier Bildhauer und Maler, zumindest solange das Geld dazu reicht. Ophelia ist Kunstlehrerin am Gymnasium in Taufheim. Dann wohnen mit uns noch Andreas Simon und Friedrich-Karl Schuler, beides Reisefotografen. Außerdem eine Landschaftsgärtnerin, Sabine von Leek, sowie Clara Feyerabend, eine Architektin.« Bei der Vorstellung der Namen deutete Liebermann mit seiner freien Hand auf die Betreffenden, die zusammen in der Gruppe nebenan standen, aber keinerlei Anstalten machten, ihr angeregtes Gespräch für die Crinellis zu unterbrechen. »Sie sehen, wir haben alles zusammen, um ein Haus zu bauen, und das haben wir auch getan. Wir stammen aus Düsseldorf und wollten einfach aufs Land, allerdings nicht unbedingt als vollwertige Mitglieder einer verschworenen Dorfgemeinschaft.«
»Das kann ich gut nachvollziehen«, sagte Maria, »bei mir ist es ähnlich. Die Ruhe kann ich gut gebrauchen, aber ansonsten fällt es mir schwerer als gedacht, mich hier einzugewöhnen.«
»Ich denke, das ist wirklich alles Gewohnheitssache. Man muss ja nicht mit jedem intensiven Kontakt pflegen«, sagte Crinelli.
»Mmh, nicht ganz richtig. Unserer Erfahrung nach ist es so, dass man sich seine Bekannten hier nur schwerlich aussuchen kann. Irgendwie hängen immer alle zusammen, was bedeutet, dass sich zu dem ein oder anderen, den man gerne etwas näher kennen lernen möchte, immer noch einer gesellt, auf dessen Anwesenheit man auch verzichten könnte.«
»Aber so schlimm werden sie doch wohl nicht sein, oder?«
»Da haben Sie natürlich Recht. Und es stimmt wohl auch, dass wir nicht sehr kontaktfreudig sind, wir haben einfach genug mit uns und unserer Arbeit zu tun.«
Während der nächsten Stunde unterhielten sich die beiden Paare über die Gründe, aufs Land zu ziehen, über ihre jeweiligen Berufe und über Marias Buch, das Ophelia sehr interessierte, und verabredeten sich schließlich zu einem gemeinsamen Abendessen an einem der nächsten Wochenenden. Genau genommen waren die Liebermanns die Ersten im Ort, für die Maria so etwas wie echte Sympathie empfand. Für Crinelli war es ein Anfang, sie hatten die Entscheidung getroffen, die Stadt zu verlassen, hier war es friedlich, und darüber hinaus hatte er nicht viel erwartet. Er selbst mochte Franz Liebermann. Der Mann hatte zwar eine dominante Art im Auftreten, was auch an seinem austrainiert wirkenden Körper liegen konnte, aber er hörte zu, wirkte ruhig und gelassen und hatte sanfte braune Augen.
Es war schon weit nach Mitternacht. Crinelli ging leicht wankend auf die nächste Häuserecke zu. Er hatte viel getrunken, andauernd war einer auf dem Weg zum Fass, immer wieder stießen sie mit jemandem an, der sich vorstellte oder einfach nur vorüberging. Die Nacht war inzwischen empfindlich kalt geworden. Am Feuer, das von Neumann und seinem Knecht am Brennen gehalten wurde, war die Kälte nicht spürbar, aber keine zehn Meter von der wärmenden Glut entfernt, spürte man die frühe Jahreszeit deutlich. Crinelli tauchte hinter dem Gebäude in den Schatten der Bäume und genoss das befreiende Gefühl beim Pinkeln. Der Hof war auf dieser Seite unbeleuchtet. Nur durch eine offene Stalltür am Ende des Gebäudes drang Licht. Im Stall stand der Knecht Frantisek. Er hatte den Kopf zum Lachen in den Nacken gelegt und war offensichtlich nicht allein. Frantiseks mächtige Hand hielt den Hals eines lebenden Huhns fest umschlossen. Das Tier schlug in Todesangst wild mit den Flügeln, als könnte es so Hilfe herbeiholen. In dem Moment, in dem sich Crinelli abwenden wollte, blitzte plötzlich eine Messerklinge im Schein der Stalllaterne auf. Mit einem einzigen schnellen Schnitt trennte der Hüne den Kopf des Huhns ab. Jetzt spritze das Blut im Takt des sterbenden Herzens aus dem Körper. Der Knecht schmiss den Kopf des Tieres vor sich in den Staub. Und was dann folgte, war ein Ritual aus einer längst vergangenen Zeit. Der Mann trank das heiße Blut des toten Tieres.
Benommen ging Crinelli zurück auf den Hof. Er konnte Maria nirgends entdecken, wurde aber auf dem Weg zum Feuer von einer kompakten Mittsechzigerin mit Namen Vroni Meyer gestoppt. Sie war Haushälterin bei Pfarrer Vandermeulen.
»Na, Frau Meyer, ist der Herr Pfarrer auch da?«, grüßte Crinelli, obwohl ihm in diesem Moment nicht der Sinn nach einer belanglosen Unterhaltung stand.
»Ach wo, der geht doch immer schon so früh zu Bett. Aber er hätte sicher einmal vorbeigeschaut, wenn er nicht nach Köln zum Bischof gemusst hätte.«
»Oh je, zum Rapport beim Chef sozusagen?«
»Kann man so sehen, aber wer es in der Kirche zu etwas bringen will, der muss auch etwas dafür tun. Nur mit Beten geht das heute auch nicht mehr«, entgegnete die resolute Frau und lachte dabei herzhaft. Offenbar hatte auch sie schon ein paar Bierchen getrunken, denn bei Crinellis Antrittsbesuch im Pfarramt hatte sie noch ausgesprochen sachlich und abweisend gewirkt.
»Sagen Sie, Frau Meyer, kennen Sie den Knecht hier vom Hof?«
»Franta?«
»Ja, so heißt er wohl. Was ist das für ein Typ?«
»Ein bisschen grob vielleicht, aber ein herzensguter Kerl.«
Da war Crinelli entschieden anderer Ansicht.
»Sonntags kommt der sogar zweimal zur Messe. In der Früh und spät am Abend noch einmal. So sind sie halt, die Kinder vom Woijtila, fromm und dennoch lebenslustig.«
»Stammt also aus Polen?«
»Was dachten Sie denn?«
»Na, Frantisek hört sich eher tschechisch an, oder?«
»Keine Ahnung. Mit Nachnamen heißt er Lubanski, Frantisek Lubanski. Jedenfalls ist der Franta in der Nähe von Breslau geboren und auch aufgewachsen und somit wohl eindeutig Pole. Aber warum interessiert Sie der Bursche so sehr?«
»Hat keinen besonderen Grund. Ich war nur überrascht, dass ein so einfacher Kerl mit so einer hübschen Frau flirtet«, versuchte sich Crinelli aus der Situation zu stehlen.
»Das Fräulein ist ja wohl auch eher einfach, Herr Crinelli«, antwortete die Meyer spitz. »Und jetzt wünsche ich eine gute Nacht, für mich wird es langsam Zeit.«
»Gute Nacht, Frau Meyer, und grüßen Sie den Pfarrer bitte recht freundlich von mir.«
Crinelli mochte den groß gewachsenen Randolph Vandermeulen. Er hatte sich lange mit ihm im Pfarrhaus unterhalten, und der sensible Mann war ihm von Beginn an sympathisch gewesen. Crinelli war nicht besonders fromm, doch Vandermeulen schien das wenig zu stören. Das offene und gewinnende Wesen des Pfarrers hatte den Kriminalkommissar, auch bei ihrem zweiten Treffen in der Kupferkanne, angenehm überrascht. So wie Vandermeulen seinen Beruf begriff, schien es, bei allen Unterschieden, doch auch eine Menge Gemeinsamkeiten zwischen einem Polizisten und einem Seelsorger zu geben.
Er ging zurück zum Feuer, wo sich die Anzahl der Gäste inzwischen deutlich verringert hatte. Als er an Maria vorbeikam, hielt sie ihn am Arm fest und zog sein Ohr dicht an ihren Mund.
»Ich muss dir gleich was Tolles erzählen.«
Crinelli nahm sich vor, sich bei Maria nicht mit seiner eigenen Neuigkeit zu revanchieren. Die grausige Beobachtung wollte er seiner Frau lieber vorenthalten. Er trank noch ein letztes Bier mit Fridolin Neumann, und dann verabschiedeten sie sich in die feuchte Nacht.
»Das glaubst du nicht«, konnte Maria sich nicht einmal gedulden, bis der Wagen gestartet war, »rate, wen ich beim Seitensprung erwischt habe?«
»Keine Ahnung«, erwiderte Crinelli nicht sehr interessiert an dem üblichen Klatsch. »Na sag schon.«
»Traugott Keppeler treibt es mit Sybille Zimmermann. Was sagst du jetzt?«
»Würstchen sucht Brötchen. Klingt doch logisch, oder?«
»Crinelli, sei ernst! Ist das nicht schockierend?«
»Überraschend, nicht schockierend. Aber eigentlich nicht einmal überraschend. Wenn ich es genau bedenke, finde ich es einfach relativ uninteressant. Wir kennen die Leute doch überhaupt nicht näher. Und was hast du eigentlich genau gesehen? In flagranti heißt doch wohl im Bett, oder? Darf ich daraus schließen, dass du dich durch ein fremdes Haus geschlichen hast?«
»Quatsch! Ich war auf der Toilette.«
»Die treiben es auf dem Klo? Ist ja scharf!«
»Jerry, bitte. Als ich von der Toilette zurückkam, sah ich sie durch einen Türspalt in der Küche stehen. Küssend!«
»Komm, Maria, das wird ein Freundschaftskuss gewesen sein.«
»Ach ja? Und bei einem Freundschaftskuss hat die Frau ein Bein um die Hüfte des Mannes geschlungen und dieser seine Hand unter ihren Rock geschoben?«
»Welche Farbe hatte ihr Slip? Warte! Ich wette, rot.«
»Schwarz, du Ferkel. Kannst du mal bitte ernst sein. Ich finde das skandalös. Ihre jeweiligen Ehepartner stehen keine hundert Meter entfernt am Feuer, und die beiden treiben es in der bäuerlichen Küche. Und, mein lieber Mann, wir befinden uns nicht im sündigen Köln, sondern im reinen Niederkirchen.«
»Nein, Maria, Gnade, nicht schon wieder einen Minuspunkt für unsere neue Gemeinde«, lachte Crinelli. »Sag mal, Schatz, hat dich die Szene zwischen den beiden erregt?«
Maria näherte sich seinem Ohr, biss zärtlich hinein und antwortete:
[Menü]
Dienstag
Crinelli hatte noch die Zahnbürste im Mund, als das Schrillen des Telefons die morgendliche Ruhe störte.
»Verdammt, wer ruft um halb sieben in der Früh an?«, knurrte er zwischen Bürste und Schaum.
Er spuckte kurz ins Becken und lief, so schnell er konnte, die Treppe hinab zum Telefon. Maria schlief noch. Ein nochmaliges Klingeln würde sie aufwecken. Das tat einer werdenden Mutter im vierten Monat sicher nicht gut. Crinelli musste lächeln, als ihm dieser Gedanke durch den Kopf schoss. Eigentlich lächelte er unentwegt, seit sie schwanger waren. Ein schönes, ein beglückendes und ein sehr ungewohntes Gefühl.
»Ja? Crinelli.«
»Hi Jerry, hier ist Julia.«
»Was willst du denn schon so früh?«
Julia Hammerschmidt hatte Nachtdienst. Es war ihre Aufgabe, die Kollegen herbeizurufen, falls im Laufe der Nacht etwas Ernstes geschah. In aller Regel erwischte es die Kollegen, die am schnellsten am Tatort oder im Präsidium sein konnten. Crinelli kannte dieses Vorgehen aus leidvoller Erfahrung, schließlich hatte er während der ersten Jahre bei der Mordkommission noch in unmittelbarer Nähe des alten Polizeipräsidiums gewohnt und war somit gerne und häufig »erste Wahl« für Notfälle gewesen. Dieses Problem hatte er durch seinen Umzug ins Bergische Land, immerhin fast eine Stunde von Köln entfernt, für sich als erledigt betrachtet.
»Sind euch in Köln die Beamten ausgegangen?«
»Hier ist alles ruhig, Jerry, aber du wohnst doch jetzt in Niederkirchen, oder liege ich da falsch?«
»Klar, du hast mich doch hier angerufen.«
»Dann hab ich was für dich. Irgendwo da in eurer Nähe befindet sich ein altes Wehr, irgendwo am Waldrand.«
»Ja, kenn ich, und was ist damit?«
»Ein Jäger hat dort vor einer halben Stunde eine Mädchenleiche entdeckt und den Fund per Handy bei uns gemeldet. Ich dachte, wo du nun schon mal da unten wohnst, kommst du besser erst gar nicht aufs Präsidium, sondern fährst gleich zum Tatort. Die Kollegen vor Ort, Keller und Kruminga heißen sie, sind schon informiert. Sie haben den Ersten Angriff gefahren und erwarten dich am Tatort. Aber beeile dich, bevor die Dörfler alle brauchbaren Spuren zertrampelt haben.«
Stille!
»Jerry, bist du noch dran?«
»Ja. Scheiße! Ein Mord hier in Niederkirchen? Das darf doch wohl nicht wahr sein.«
»Wer spricht von Mord, Jerry? Schau dir die Sache doch erst mal an! Allerdings, der Jäger hat ausgesagt, das Mädchen klemme nackt und irgendwie unnatürlich verrenkt an der Stautüre, das zumindest spricht gegen einen Unfall. Aber was soll all das Spekulieren? Fahr hin und gib Nachricht, sobald du dir ein Bild von der Lage verschafft hast.«
»O. K., ich fahr direkt los.«
»Und, Jerry?«
»Was noch?«
»Nimm dein Handy mit und achte auf einen vollen Akku.«
»Blöde Kuh! Du machst wohl nie einen Fehler?«
Crinelli legte den Hörer auf. Er hatte keine Beziehung zu seinem Handy, auch wenn er wusste, dass es für seinen Beruf einen Segen darstellte. Das eigentlich Bösartige an Hammerschmidts Bemerkung war der darin unverhohlen mitschwingende Vorwurf. Bei einem seiner letzten Fälle hätte er im Laufe der Ermittlungen dringend Verstärkung rufen müssen, hatte aber vergessen, morgens den Akku seines Mobiltelefons aufzuladen. Diese Nachlässigkeit hatte ihn nicht nur persönlich in arge Bedrängnis gebracht, sondern auch die Auflösung des Falles in erheblichem Maße erschwert. Außerdem hatte ihm seine Unachtsamkeit einen unangenehmen Termin beim Chef beschert.
Ein Blick auf das kleine Ding, das direkt neben dem großen Telefonapparat auf der Ablage im Flur lag, zeigte ihm, dass zumindest von dieser Front heute keine Gefahr drohte. Er zog das Ladekabel aus dem Handy und steckte das eingeschaltete Gerät schon einmal vorsorglich in die Tasche seines Jacketts.
Crinelli schlich sich die Treppe hoch zurück ins Bad. Als er gerade in die Hose steigen wollte, hörte er aus dem Schlafzimmer Maria rufen.
»Liebling, wer war dran?«
»Schlaf weiter, war nur Hammerschmidt.«
»Hast du einen Einsatz?«
»Ja, aber nur Routine.«
Er betrat das Schlafzimmer und schaute liebevoll auf seine Frau hinab. Maria war wunderschön, und seit sie schwanger war und ihre Formen von Tag zu Tag weicher und rundlicher wurden, erschien sie ihm noch begehrenswerter. Er beugte sich zu ihr hinab und küsste sie zärtlich, so wie er es immer zum Abschied tat, einen Kuss auf die Stirn, den nächsten auf die Nasenspitze, und schließlich küsste er ihre weichen, vollen Lippen.
»Tschüs, mein Liebling, ich muss mich beeilen.«
»Schade«, hauchte sie mit einem sehr verheißungsvollen Unterton in ihrer dunklen Stimme.
»Ich komme ja wieder«, sagte Crinelli lächelnd, »hab einen schönen Tag.«
Sie kuschelte sich zurück in ihre noch schlafwarme Bettwäsche und war bereits wieder eingeschlafen, als Crinelli das Haus verließ.
Draußen schlug ihm kalte, feuchte Luft entgegen. Daran hatte er sich noch nicht gewöhnt. Die Temperatur in Niederkirchen lag beständig mehrere Striche auf dem Thermometer unter der Kölns. In der Stadt brauchte man Anfang Mai morgens nur noch selten einen Mantel. Für Crinelli kein unwichtiger Faktor, weil er ihn ständig irgendwo liegen ließ. An diesem typisch Bergischen Morgen ging er noch einmal ins Haus zurück, tauschte Jackett gegen Daunenjacke und nahm vorsorglich einen dicken Wollschal von der Garderobe.
Der Volvo schnurrte nahezu geräuschlos aus dem Neubaugebiet hinaus auf die Kreuzung am Ortseingang zu. Aus den sechs Boxen erklangen die Peer-Gynt-Suiten, und Jérôme Crinelli genoss den typischen Ledergeruch seiner Sonderausstattung. Er nahm die erste Ausfahrt aus dem Kreisel heraus und beschleunigte leicht. Die Ausfallstraße war der einzige asphaltierte Weg, der Niederkirchen mit der Außenwelt verband. Das Dorf lag in einem natürlichen Talkessel, umgeben von hohen bewaldeten Hügeln. Gerade diese abgeschiedene und geschützte Lage hatte Crinelli bei seiner Suche nach einem geeigneten Heim für die werdende Familie angezogen. Das Tal bildete den natürlichen Rahmen für seinen frisch aufgekommenen Wunsch nach Geborgenheit. Keine Durchfahrtsstraße, keine Umgehung, kein Tunnel, keine nahe gelegene Autobahn oder Schnellbahntrasse. Ausnahmslos Natur, Bäche voller Fische und nette, einfache Bewohner. Wer nach Niederkirchen wollte, musste sich am Ortseingang von Taufheim, dem zwölf Kilometer entfernt liegenden Touristenstädtchen, entschließen, die Fernstraße von Köln kommend zu verlassen. Über fünf Kilometer stieg die Straße langsam, in immer spitzer werdenden Kehren an, bis man schließlich den Pass, wie die Bewohner des Tales die höchstgelegene Stelle des Berges nannten, erreichte. Immer durch dichten Laubwald führend, schlängelte sich die schmale Straße den Berg auf der anderen Seite wieder hinab. Auf gleichem Niveau mit der kleinen Gemeinde verließ die Straße schließlich den Wald und gab den Blick auf das vollständig geschlossene Tal frei, auf schiefergedeckte Fachwerkhäuser und den alles überragenden Kirchturm. Hochhäuser oder Industriebauten suchte man hier vergebens. Die einzige gravierende Veränderung im Ortsbild der letzten Jahrzehnte stellte das Neubaugebiet dar, in dem auch die Crinellis wohnten. Es lag gleich zu Beginn des Ortes auf der Südseite des Tales, war aber auch schon in den 70er Jahren entstanden.
Von der Hauptstraße zweigte noch in der Ebene ein tief ausgefahrener Feldweg in nördlicher Richtung zur alten Mühle ab. Unweit von dem verfallenen Gemäuer befand sich das Wehr, das den hier oftmals schnell fließenden Fluss bei Bedarf so staute, dass das Dorf vor etwaigem Hochwasser sicher war. Obwohl der Bach nördlich am Ort vorbeifloss, waren dessen letzte Häuser direkt an das unbefestigte Ufer gebaut.
Die Digitalanzeige der Wagenuhr zeigte 7:10 Uhr, als Crinelli seinen Volvo neben dem Streifenwagen der Dorfpolizisten und einem modernen Jeep abstellte.
Crinelli zog seine Jacke fest zu. Sein Atem formte in der kalten Morgenluft dünne Rauchwölkchen. Vor seinen Augen breitete sich eine unwirkliche Szenerie aus. Durch den Schleier des Morgennebels hindurch erkannte er schemenhaft unterhalb des Weges am Bach zwei Personen. Er öffnete die Heckklappe seines Kombis und griff sich eine große Stabtaschenlampe. Vermeintlich optimal ausgerüstet, begann er den kurzen Abstieg hinab zur Flussaue. Kaum hatte er abschüssiges Gelände unter den Füßen, zog es ihm auch schon die Beine weg, und er landete mit lautem Fluchen auf seinem Hintern. »Verdammte Scheiße«, stieß er aus, als er beim Abstützen mit der linken Hand bemerkte, dass er im Matsch saß. Er schlitterte den restlichen Hang hinab und kam neben Peter Keller, dem jüngeren der beiden Schutzpolizisten, und dem Jäger zum Stehen.
»Morgen«, grüßte er den Ersten Angriff schlecht gelaunt. Der Ausdruck entstammte dem Militärjargon und hielt sich schon verdächtig lange im Polizeialltag. Erster Angriff war eine feststehende Redewendung. Welcher Polizist, welche Dienststelle befand sich am nächsten zum Tatort? Sie fuhren den Ersten Angriff, sicherten den Tatort so lange ab, bis die restlichen Polizisten zum Einsatz kamen.
»Guten Morgen, Herr Crinelli.«
Obwohl das Zwielicht täuschen konnte, fand Crinelli, dass der jüngere Kollege blass und erschüttert wirkte.
»Die Kollegen von der Kölner Mordkommission haben mich angerufen. Wo ist die Leiche?«
Keller deutete mit dem Kopf ein Stück den Fluss hinauf. Crinelli schaltete seine starke Lampe ein und ließ den Lichtkegel die angegebene Richtung absuchen. Im Kreis seiner Leuchte bot sich ihm ein schauriges Bild. Zwanzig Meter flussaufwärts staute das alte Holzwehr den Fluss. Seine Tore standen leicht geöffnet. Im so entstandenen Spalt hatte sich die Leiche verfangen. Von seinem Standort aus konnte Crinelli lediglich einen kleinen nackten Arm, einen Fuß, der durch den Spalt hindurchgerutscht war, und nasse, dunkle Haare erkennen. Der Leichnam sah aus, als sei er über den linken Flügel des Wehrs geworfen worden. Was er darüber hinaus sah, bestätigte Hammerschmidts Befürchtungen.
»Hans Kruminga, bleib stehen! Keinen Schritt weiter«, rief Crinelli.
Er lief los, trotz aller Eile jetzt sehr darauf bedacht, nicht noch einmal in Ganzkörperkontakt mit der schlammigen Erde zu geraten.
»Komm aus dem Wasser raus, Hans, bitte. Wir dürfen nichts anrühren, bis die Kollegen von der Spurensicherung da sind.«
Kruminga, der 59-jährige Dorfpolizist sah fragend zu ihm herüber.
»Ich muss doch nachsehen, ob noch etwas zu machen ist.«
Crinelli musste trotz der traurigen Situation über so viel Unbedarftheit lächeln.
»Da ist wohl nichts mehr zu machen. Komm wieder ans Ufer und erzähl mir lieber, was ihr vorgefunden habt.«
»Gar nichts haben wir gefunden«, rief der Alte und stakste vorsichtig zurück. »Zunächst einmal hab ich meine Gummistiefel aus dem Wagen geholt, und dann warst du ja auch schon da. Man sieht doch vor lauter Nebel die eigene Hand nicht vor Augen, wie soll ich da was gefunden haben. Ich bin jetzt 40 Jahre hier im Ort, aber so etwas wie das hier habe ich noch nie sehen müssen. Armes Mädchen.«
»Ich ruf jetzt die Kollegen in Köln an. Wir können hier sowieso nichts machen, außer dafür sorgen, dass keine Spuren zerstört werden.«
Crinelli fasste in seine linke, dann hektisch in seine rechte Tasche. Mist, er hatte beim Jackenwechsel sein Handy vergessen.
»Hast du ein Telefon, Hans?«
»Nur den Funk im Wagen.«
»Nein, ich brauch ein Handy. Muss direkt mit einigen Kollegen im Präsidium sprechen.«
Keller hielt ihm ein Mobiltelefon hin.
»Danke, muss meines wohl in der Eile vergessen haben.«
Er wählte die Durchwahl der Kölner Mordkommission.
»Kripo Köln, Hammerschmidt«, meldete sich die Kollegin.
»Hallo Julia, hier ist Jerry.«
»Hi Jerry! Und? Wie sieht's aus bei dir?«
»Prima, schick mal die Kavallerie.«
»Das ganze Programm?«
»Ohne Ausnahme. Das Mädchen liegt oder besser hängt im Wasser, und es ist zwar noch sehr neblig, aber nach einem Badeunfall sieht das hier nicht aus. Und sag allen Leuten, besonders dem Doc, er braucht hohe Gummistiefel, am besten Anglermontur.«
»Kannst ihm ja deine leihen.«
»So weit kommt das noch, ein fremder Kollege in meiner Hose. Ernsthaft, Julia, wir brauchen den ganzen Apparat. Wir müssen das Ufer nach Spuren absuchen. Der Fluss fließt hier oben ziemlich schnell. Ich glaube nicht, dass das Mädchen hier am Fundort ins Wasser geschmissen worden ist.«
»Unfall ausgeschlossen?«
»Hundert Prozent! Wenn ich nicht völlig danebenliege, ist dem Kind vor seinem feuchten Tod noch Schlimmeres passiert.«
Der Arm des Mädchens und der Teil des Rückens, den Crinelli vom Wehr aus sehen konnte, wiesen sichtbar massive Verfärbungen auf, die nicht auf das Aufschlagen des Körpers auf Steine im Flussbett zurückzuführen sein konnten. Außerdem hatte das Mädchen etwas um den Hals, was verdammt nach einer Drahtschlinge aussah.
Zwei Stunden später wimmelte es von Beamten, Spurensicherung und Medizinern. Das Mädchen war inzwischen geborgen und lag auf einer dicken schwarzen Plastikplane an Land. Der Vierer ohne, ausnahmsweise einmal dem Rudervokabular und nicht dem Militärjargon entnommen, wartete darauf, die Leiche abzutransportieren.
Der linke Unterarm des Mädchens war fast abgerissen, sicher ein später Unfall im Wasser. Auch die Füße standen unnatürlich von den Gelenken ab. Das Kind war höchstens acht Jahre alt und von sehr feingliedriger Statur. Die Rippen seines Brustkorbs drückten sich durch die grün und blau gefärbte Haut hindurch. Das Kind sah aus, als ob es vor seinem gewaltsamen Tod lange Zeit Hunger gelitten hätte. Der Todeskampf hatte seine Gesichtszüge verzerrt.
Das Einzige, was die Kleine noch am Körper trug, war ein zartes goldenes Kettchen mit einem einfachen Kreuz. Die Kette hatte sich in der Drahtschlinge verfangen und dadurch sicherlich auch noch unfreiwillig bei der Strangulation geholfen.
»Hans, hast du die Kleine schon einmal hier im Ort gesehen?«
Kruminga verneinte. Er war ebenso blass geworden wie sein jüngerer Kollege. Damit konnte man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausschließen, dass es sich bei dem Mädchen um ein Mitglied der Gemeinde handelte. Wen Kruminga nicht kannte, der war in diesem Tal nicht existent.
Auch die schnelle Befragung des Jägers, der das Mädchen gefunden hatte, hatte nichts ergeben. Sein Jagdrevier lag in der hinteren, dem Tal abgewandten Seite des Waldes. Er war gegen fünf Uhr von der Mühle aus losgezogen. Erst das Gebell seines Hundes machte ihn bei seiner Rückkehr auf die Leiche aufmerksam. Crinelli ließ Keller die Personalien des Mannes aufnehmen, bat ihn für den nächsten Tag aufs Revier und schickte ihn dann mit einem Dank für sein vorbildliches Verhalten nach Hause.
Also blieben nur die üblichen Maßnahmen: Fundort absuchen, Fotos erstellen und verteilen, Zeitungen informieren und nach den Angehörigen suchen. Anschließend dann das Gespräch mit den Hinterbliebenen, Crinelli mochte gar nicht daran denken, Kindermorde brachten selbst hart gesottene Beamte aus der Fassung.
»Hallo Jerry.«
»Guten Morgen, Chef«, antwortete Crinelli überrascht.
»Wollte mir einen eigenen Überblick hier verschaffen, jetzt, wo Kleinert für eine Zeit ausfällt. Wie stellt sich die Situation dar?«
Kleinert war als Leiter der Kriminalgruppe 1 – Gewaltdelikte und gemeingefährliche Straftaten – Crinellis direkter Vorgesetzter. Aus seinem jährlichen Skiurlaub war er mit einem doppelten Oberschenkelhalsbruch zurückgekehrt und fiel jetzt auf unbestimmte Zeit aus. Das allein war allerdings nicht Grund genug, dass nun dessen Vorgesetzter Böker selbst am Tatort erschien. Aber bei einem Ex-Juristen musste man auf alles gefasst sein.
»Leider ziemlich übel. Sie sehen ja selbst, wie das Opfer aussieht. Die Leiche muss schnellstmöglich in die Rechtsmedizin gebracht werden. Wir brauchen Klarheit darüber, ob die äußeren Verletzungen alles sind, was dem Kind zugefügt wurde, oder ob noch Schlimmeres geschehen ist. Können Sie bitte für die richterliche Zustimmung zu der Obduktion sorgen? Dann sollten wir den Fundort sowie die nächsten ein bis zwei Kilometer flussaufwärts beide Uferseiten weiträumig absperren und nach verwertbaren Spuren absuchen lassen. Irgendwo muss der Täter das Mädchen ja in den Fluss geworfen haben. Die Frage wird sein, finden wir dort Kampfspuren, oder war das Kind bereits tot und wurde nur weggeschafft. In jedem Falle könnten wir dort Fußspuren und Abdrücke von Wagenrädern finden. Der Boden ist tief. Hat viel geregnet in den letzten Tagen.«
»Das mit den Richtern geht klar, kenn die ja alle noch. Hört sich nach einer Menge Arbeit an, Jerry. Eigentlich brauche ich Sie in Köln. Wir haben einen furchtbaren Krankenstand und nicht eben wenig zu tun.«
Böker machte eine Pause und dachte nach.
»Allerdings ist es ziemlich unsinnig, Sie nach Köln zu holen und einen anderen Kollegen hier mit den Ermittlungen zu betrauen. Verdammter Mist! Wie beurteilen Sie die Kollegen vor Ort?«
»Nett.«
»Verstehe. Sie brauchen also auch noch weitere Unterstützung. Verdammter Mist.«
»Verdammter Mist« war der Lieblingsfluch des leitenden Kriminaldirektors René Böker, des Chefs der Zentralen Kriminalitätsbekämpfung, kurz ZKB genannt. Ein echter Brüller auf dem Präsidium. Ein distinguiert auftretender Mensch wie Böker schimpfte nicht, jedenfalls nicht öffentlich. Ehemalige Juristen wie er waren schließlich gut erzogen. Zudem galt im Hause Böker jegliche Art von Kraftausdrücken als verpönt. »Verdammter Mist« schien seine Art zu sein, seine Zugehörigkeit zur Truppe unter Beweis zu stellen. Aber immerhin, wenn Böker »Verdammter Mist« sagte, konnte man relativ sicher sein, dass er den Ernst der Lage erkannt hatte und für Hilfe sorgte.
»Ich will sehen, was ich tun kann, Jerry. Ich melde mich bei Ihnen. Ihre Handynummer liegt vor?«
»Äh, sicher, Julia hat alle unsere Nummern, natürlich.«
»Hammerschmidt, ja? Gut, gut! Vielleicht haben wir ja Glück, und der Fall löst sich schnell und einfach. Soll die Hoffnung ja nie aufgeben, was, Jerry?«
Beim letzten Satz legte er ihm die Hand auf die Schulter, drückte einmal fest zu und machte sich ohne ein weiteres Wort auf den Rückweg.
»Hans, wir haben viel Arbeit. Ich bin jetzt offiziell auf den Fall angesetzt und auf deine und Kellers Mitarbeit angewiesen. Wir installieren unser Hauptquartier auf eurer Wache. Ein weiterer Kollege kommt noch zu unserer Unterstützung. Zunächst einmal möchte ich euch bitten, beide Flussufer abzusperren. Die Spurensicherung darf nicht von Gaffern behindert werden. Und die wird's geben, wenn sich die Sache erst einmal rumgesprochen hat.«
Auf beiden Seiten des Flusses befanden sich die Beamten bereits bei der Arbeit. Hunde kamen nicht zum Einsatz. Es gab keine Kleidung, und das Mädchen hatte zu lange im Wasser gelegen, um noch eine brauchbare Witterung abzugeben.
»Ich muss noch mal los, bin aber in spätestens einer Stunde wieder hier.«
»Äh, Jerry, meine Frau erwartet mich zum Mittag.«
»Das geht leider heute nicht, Hans, bitte hab dafür Verständnis.«
Er ließ die beiden stehen und ging auf seinen Wagen zu. Der Tag hatte sich gemausert. Jetzt um kurz vor zwölf war es angenehm warm. Die Luft war klar, und die Sonne schien von einem wolkenlosen Himmel. Das Tal zeigte sich von seiner schönsten Seite. Nur ein kleines Mädchen hatte davon nichts mehr.
Bevor Jerry weiter nach Köln fuhr, wollte er schnell noch zu Hause vorbei. Was hatte dies alles zu bedeuten? Welcher Mistkerl brachte ein so junges Mädchen um, noch dazu in dieser friedlichen Umgebung? Zwei Monate hatte er intensiv gesucht, um für seine Tochter ein schönes und vor allem friedliches, geschütztes Zuhause zu beschaffen. Sie sollte nicht im Dreck der Großstadt aufwachsen, umgeben von Kleinkriminellen und Drogensüchtigen. Und jetzt holte ihn hier in dieser ländlichen Idylle die raue Wirklichkeit bereits nach sechs Wochen wieder ein. Wie sollte er das Maria erklären?
[Menü]
Februar bis Mai des gleichen Jahres
Jérôme Crinelli stieg die 72 Stufen zu seiner Wohnung im vierten Stock empor. Ab Stufe 34, unmittelbar vor Etage zwei, erreichte seine Atmung die höchste Frequenz. Er hielt für einen tiefen Atemzug inne und setzte dann seinen Aufstieg fort. Nach einem langen Arbeitstag wie diesem machte sich seine unsportliche und ungesunde Lebensweise bemerkbar. Dabei war er erst 39 Jahre alt, aber 60 Zigaretten pro Tag und das bewegungsarme Rumhängen im Präsidium hinterließen ihre Spuren.
Beim Betreten der Wohnung wich seine Kurzatmigkeit mit einem Schlag einer gespannten Aufmerksamkeit. Das Licht war gedimmt, und überall brannten Kerzen. Seine Frau Maria erwartete ihn an der Tür zur großen Wohnküche.
»Wau! Hallo, Schatz. Sieht ganz nach einem gemütlichen Abend aus?«
»Tja, komm erst mal in die Küche.«
Crinelli hängte den Mantel an die Garderobe, zog seine vom Schneematsch feuchten Schuhe aus und schlich auf dicken Wollsocken gespannt zur Küchentür. Was er sah, gefiel ihm. Blütenweiße Tischdecke, das gute Porzellan – Erbstücke seiner Mutter – die neuen Gläser und eine Flasche Champagner. In der Mitte der Tafel, eingerahmt von zwei Kerzenleuchtern, stand eine riesige Platte mit frischen Meeresfrüchten. Verschiedene Muschelsorten, große Belon-Austern, ganze Garnelen und ein leuchtend roter Hummer.
Crinelli sah seine Frau fragend an. Nach einem kaum wahrnehmbaren Augenblick des Nachdenkens machte sich ein schelmisches Grinsen auf seinem Gesicht breit.
»Nein!«, schrie er.
»Doch«, hauchte Maria.
Er schloss Maria in die Arme, hob sie hoch, wollte zur Drehung ansetzten, hielt aber mitten in der Bewegung inne und stellte sie vorsichtig wieder auf die Füße.
»Entschuldige. Jetzt muss ich wohl vorsichtiger mit dir umgehen?«
»Du Blödmann«, sagte Maria und nahm ihn ihrerseits in den Arm, »ich dachte, das sollten wir feiern, oder?«
»Verdammt richtig! – Schatz«, er schaute seiner Frau tief in die Augen, »ich liebe dich und bin sehr, sehr glücklich.«
»Ich auch, Jerry. Wenn man bedenkt, dass wir uns gerade erst entschieden haben, schwanger zu werden. Viele Paare brauchen ewig, manche schaffen es nie.«
»Tja, wir passen eben gut zusammen.«
Sie küssten sich lange. Die nächsten Stunden vergingen wie im Flug. Sie aßen die Schalentiere und tranken den Champagner. Die Stimmung war aufgekratzt, aber Crinelli war entspannt. Als sie sich schließlich entschlossen, ins Bett zu gehen, hatten sie erste Namensideen ausgetauscht, sich über Kindergärten, Erziehungsmethoden, ihre zu kleine Wohnung und den öffentlichen Umgang mit der Neuigkeit unterhalten.
Am nächsten Morgen packte Crinelli seine Angelsachen zusammen. Maria hatte ihm – in weiser Voraussicht – schon ein paar Leckereien aus dem Kühlschrank eingepackt, als er, noch reichlich verschlafen, in der Küche erschien. Sie kannte ihren Jerry. Im Grunde ein unverbesserlicher Einzelgänger, verschlossen, auch wenn sie ihm Tag für Tag näher kam. Aber wenn die Ereignisse zu intensiv, zu emotional für ihn wurden, konnte man ihn immer am großen Fluss antreffen. Die vielfältigen Eindrücke eines Tages, eine schwere Ermittlung, ein Schicksalsschlag oder anstehende Entscheidungen konnte Crinelli nur alleine verarbeiten, und er benötigte Zeit dazu. Sein Hobby verschaffte ihm genau diese Zeit, denn er betrachtete das Fischen nicht als Sport und schon gar nicht als Herausforderung, sondern als kontemplative Beschäftigung. Die Fänge, die er dabei machte, interessierten ihn nicht.
Beim Angeln hatte sich das ungleiche Paar überhaupt erst kennen gelernt. Maria arbeitete damals für einen privaten Sender an einer Reportage über die neuerdings wieder steigende Zahl der Rheinfischer. Das Thema interessierte zunehmend auch eine breitere Öffentlichkeit, denn auch die Wasserqualität des Stromes verbesserte sich von Jahr zu Jahr. Sogar die Lachse waren zurückgekehrt.
An jenem Tag hockte Crinelli an seiner Lieblingsstelle, in der Nähe der alten Eisenbahnbrücke. Hinter ihm ging die Sonne langsam unter und zeichnete die Rheinaue und das am Horizont sichtbare Siebengebirge in einem letzten, weichen Licht. Als die Autorin und ihr Fernsehteam das Bild des einsamen Anglers im Abendlicht aus dem Wagen heraus entdeckten, parkten sie den Geländewagen und schleppten die Kamera und das restliche Equipment die Wiesen hinab. Crinelli gab sich zunächst sehr abweisend. Er duldete keine Störungen beim Fischen und war außerdem gerade tief in Gedanken versunken. Dem Charme der jungen, schönen Fernsehdame konnte er allerdings nicht lange widerstehen und gab in der Folge sogar ein Interview – das erste seines Lebens. Im Job taten das andere für ihn, und das war gut so. Als die Journalistin ihr Mikrofon abschaltete, war die Nacht angebrochen, und Jerry und Maria verabredeten sich noch zu einem Drink auf einem der Restaurantboote. Aus dieser ersten Begegnung war, schneller als beide erwartet hatten, Liebe geworden, und im Spätsommer hatten sie beschlossen zu heiraten. Crinelli zog bereits nach zwei Monaten in Marias Wohnung.
Aber es war nicht nur das Körperliche, das Crinelli in den ersten Monaten den Schlaf raubte, er hatte in Maria erstmals in seinem Leben einen Menschen gefunden, dem er sich anvertrauen konnte und wollte. Es war, als würden lange gehütete Geheimnisse plötzlich an die Oberfläche gespült. Das Reden, für das er nicht geschaffen war, tat ihm gut. In seinen Erinnerungen hatte er immer gesprochen, viel, sehr viel sogar, über alles und jeden, mit seiner geliebten Mutter nämlich. Doch als sie viel zu früh starb, zog er sich in sich selbst zurück. Nach ihrer Beerdigung hatte Crinelli nichts mehr zu sagen und wurde zunehmend ängstlich. Sie fehlte ihm wahnsinnig, diese warmherzige Frau, und sich in das Unwiederbringliche zu fügen verlangte ihm alle Kräfte ab, die er besaß. Dann hatte er sich entschlossen, Polizist zu werden, und irgendwie war es ihm damit gelungen, wieder stark zu werden. Nicht wie die Bullen in schlechten Filmen, nicht Rambo, nein, in der Gemeinschaft fühlte er sich aufgehoben, wenn er auch auf seine Kollegen den gegenteiligen Eindruck machte, und nach einer Weile war die Angst vollständig aus seinem Leben gewichen – was hingegen blieb, war seine Sprachlosigkeit. Er hatte selten Freundinnen und machte auch wenig Anstalten, eine zu bekommen. Tief in sich drin wusste er, dass sie eines Tages kommen würde, die Frau, die die Lücke ausfüllen konnte, die der Tod seiner Mutter gerissen hatte. Natürlich in einem ganz anderen Sinne, er suchte keinen Mutterersatz, er wünschte sich Nähe und Vertrautheit. Maria war genau diese Frau, das hatte er sogleich gespürt. Mit ihr würde es möglich sein, den Traum zu verwirklichen, der sich zunächst nur in seinem Kopf entwickelt hatte, dann aber, mehr und mehr, auch seine Gefühle bestimmt hatte. Eine Familie gründen, auf dem Land in Frieden leben und all seine bösen Erinnerungen für immer loswerden.
In Crinellis und Marias Gesprächen nahm der Kinderwunsch von Beginn an einen zentralen Platz ein. Und obwohl beide ihren jeweiligen Beruf nicht aufgeben wollten, konnten sie auch diese Klippe schnell umschiffen. Maria arbeitete ohnehin frei. Ein Wechsel vom Fernsehen hin zur eher journalistischen Reportage war lange geplant und auch mit Kindern durchaus zu realisieren. Außerdem lektorierte sie für diverse Verlage seit über zwei Jahren Kochbücher, und das war ohnehin Heimarbeit. Als sie ihm dann noch ihren sehnlichsten Wunsch verriet, sich als Romanautorin zu versuchen, ergab sich ein gangbarer Weg.
Crinelli, seine Angelsachen auf dem Rücken tragend, radelte durch die glasklare Winterluft zu einer Stelle am Rhein, wo er sicher um diese Zeit des Jahres nicht gestört werden würde. Er setzte sich auf einen großen Stein. Direkt am Fluss wehte immer ein leichter Wind, aber an diesem Morgen war er besonders eisig. Er zog die Kapuze seines Alaskajacketts noch über den von einer Wollmütze geschützten Kopf.
Crinelli war in seinem Beruf äußerst erfolgreich. Er sah gewissenhaft hin, verhielt sich taktisch klug und hatte im rechten Moment die richtigen Ideen, um die vielen, zumeist grausamen Fälle zu lösen. Seine Statistik konnte sich sehen lassen. Er war ein eingefleischter Einzelgänger, liebte es, nur seiner eigenen Nase nachzugehen, und hegte keinerlei Ambitionen auf eine leitende Stelle, was ihn bei den Kollegen recht beliebt machte, sah man einmal von seinen legendären Wutausbrüchen ab. So gerne Crinelli seinen Job erledigte, er setzte ihm auch mächtig zu. Er war täglich von Leichen umgeben, die meisten von ihnen waren schlimm zugerichtet. Es gab Gewaltverbrechen in Familien oder unter scheinbaren Freunden. Verbrechen aus Leidenschaft, Habgier, Drogensucht oder Hass. Und alle hinterließen deutlich sichtbare Spuren bei den Opfern. Crinelli hatte damit noch die geringsten Probleme. Sein größtes Problem wurde zunehmend er selbst. Es gelang ihm immer weniger, bei seinen Ermittlungen unemotional und analytisch zu bleiben. Als ihm diese Veränderung an sich selbst auffiel, hatte er begonnen, sich seine Kollegen näher anzusehen. Viele von ihnen waren Zyniker, Alkoholiker und zu steinerner Kälte verhärtet. So wollte er nicht werden, aber seinen Weg, mit all dem Elend umzugehen, hatte er noch nicht gefunden. An manchen Tagen war ihm einfach nur nach Kündigung, nach Abhauen. Einfacher Streifenpolizist – der Horror der frühen Jahre – erschien ihm plötzlich wieder ein erstrebenswertes Ziel zu sein. Gewaltverbrechen waren wie Riesenkraken, die ihre mächtigen Fangarme nach deiner Seele ausstrecken.
Es war für ihn undenkbar, dass sein Kind in der Großstadt, diesem Moloch aus Stein, Gestank und Gewalt, aufwachsen sollte. Nicht dass er Erfahrungen mit dem Landleben gehabt hätte, aber ihn verfolgten einmal mehr diese Bilder. Crinelli malte sich Urlaubsorte ebenso im Vorhinein aus wie bevorstehende Gespräche, und wehe, die Realität blieb hinter seinen eingemauerten Vorstellungen zurück. Und so sah er sich vor seinem geistigen Auge bereits mit einer Familie auf dem Land.
Crinelli hatte auch schon eine Vorstellung, in welche Gegend sie ziehen könnten. Am Südrand des Bergischen, keine 60 Kilometer von der Stadt entfernt. Gut mit Zug und Auto zu erreichen. Die tägliche An- und Abfahrt würde er liebend gerne in Kauf nehmen. Die Gegend war ihm durch zahlreiche Angeltouren an die Sieg und ihre kleinen Nebenflüsse etwas bekannt. Es gab für ihn keine Alternative, nur Maria musste er es noch beibringen. Sie war überzeugte Städterin, aber sie sah auch nicht, was er gezwungen war täglich zu sehen.
Erstmals in seiner langen Angelkarriere hatte er nichts gefangen. Was nicht weiter verwunderlich war, bedachte man, dass er die Rute nicht einmal ausgeworfen hatte. Aber das war an diesem frostigen Tag wirklich nicht wichtig.
[Menü]
Dienstag
Crinelli stieg aus dem Wagen und sah seine Frau im Garten mit einem Spaten hantieren. Er bog um die Ecke des zweigeschossigen Hauses. Als Maria ihn wahrnahm, erschien ein fragender Ausdruck auf ihrem Gesicht. Sie rammte den Spaten in die aufgelockerte Erde und kam auf ihn zu.
»Was ist los, ist etwas passiert?«
»Nichts, Maria, alles in Ordnung – zumindest mit mir.«
»Und wieso kommst du schon mittags wieder nach Hause?«
»Ich war eigentlich gar nicht weg«, sagte Crinelli, etwas verlegen vor sich auf die feuchte Erde starrend. »Ich hatte hier im Ort..., ich meine, mein neuer Fall ..., ach, scheiße, Maria, ein Mädchen ist ermordet worden, hier bei uns. Zumindest haben wir sie hier gefunden.«
Maria starrte ihn entsetzt an.
»Nun schau mich nicht so an, als ob ich der Mörder wäre. Mir gefällt das noch weniger wie dir. Ich bin nur gekommen, um mein Handy zu holen. Ich hab's in der Eile heute Morgen in die falsche Jacke gesteckt. Muss mich beeilen, Böker hat mir die Ermittlungen übertragen.«
Er wandte sich ab und ging auf die Terrassentür zu.
»Jérôme?« Marias Unterton war schneidend.
»Was?« Er drehte sich um. Wenn seine Frau seinen vollständigen Vornamen benutzte, gab es keine Spielräume, für nichts. Halb scherzhaft rief sie ihn schon mal bei seinem Nachnamen, aber Jérôme sagte sie nur, wenn es wirklich ernst wurde. Sie kam langsam auf ihn zu. Als sie ihn erreicht hatte, streckte sie beide Arme nach ihm aus. Ihre Hände waren kalt. Sie zog ihn sehr nah zu sich heran und sah ihm fest in die Augen.
»Das kann doch nicht wahr sein. Du sagst mir gerade, dass in dieser Idylle ein Mörder frei herumläuft und gehst da so einfach drüber hinweg.«
»Das ist doch gar nicht gesagt, dass der Mörder hier noch herumläuft. Kruminga kennt das ermordete Mädchen nicht, was bedeutet, dass sie nicht von hier ist. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass der Mörder sie hier nur entsorgt hat, das Verbrechen aber irgendwo anders verübt wurde. Es ist noch zu früh, um irgendetwas Genaues sagen zu können.«
»Entsorgt?«, fragte Maria entsetzt. »Nennt man das bei euch so, entsorgt? Das ist ja schrecklich.«
»Entschuldige, aber mir ist gerade kein besseres Wort eingefallen. Liebling, ich stehe selbst noch zu sehr unter dem Eindruck des Leichenfundes. Und so, wie wir das Mädchen gefunden haben, ist der Ausdruck gar nicht so falsch gewählt.«
»War sie so schlimm zugerichtet?« Crinelli nickte. »Du meinst, da ist noch mehr, außer Mord, meine ich?«
»Ich fürchte, ja. Aber ich kann tatsächlich noch nichts Genaueres sagen. Ich habe bloß ein schlechtes Gefühl. Ein beschissenes Gefühl sogar, wenn ich ehrlich sein soll. Aber jetzt muss ich wirklich gehen, Maria.«
»Du musst zunächst einmal deiner Frau die Angst nehmen, bevor du mich wieder allein lässt«, entgegnete Maria vorwurfsvoll.
Crinelli zog Maria zärtlich an seine Brust und streichelte mit seiner linken Hand sanft über ihren Kopf.
»Komm Süße, noch steht doch gar nichts fest. Vielleicht ist der Mörder ja schon über alle Berge.«
»Vielleicht aber auch nicht.«
Sie sah ihn von unten herauf an. Tränen standen in ihren Augen. Crinelli beugte seinen Kopf leicht und versuchte, die dicken, salzigen Tropfen, die sich ihren Weg durch den Staub des von der Gartenarbeit verschmutzten Gesichts bahnten, mit seinen Lippen aufzufangen.
Er befand sich wieder einmal in einer der beschissenen Situationen, die ihn regelmäßig besonders stark an seinem Job zweifeln ließen. Wie oft schon hatte er sich in der Vergangenheit solchen Sackgassen in einem Gespräch stellen müssen? All die peinigenden Fragen von Angehörigen, wenn er ihnen die Nachricht vom gewaltsamen Tod eines Familienmitglieds überbrachte. Die Fragen nach dem Wer, dem Warum und dem Weshalb. Fragen ohne Antworten. Jedes Mal mehr spürte er kaltes Metall um seinen Hals.
Bei seiner eigenen Frau war eine solche Situation noch einmal so schwer zu ertragen. Es stand der unausgesprochene Vorwurf im Raum, die Angst, der schwelende Konflikt. Die unauflösliche Situation machte Crinelli rasend, und nur seine Liebe verhinderte einen seiner gefürchteten Ausbrüche. Er musste den Fall schnellstmöglich klären, um seine Frau und auch sich selbst wieder beruhigen zu können.
»Hab keine Angst, Maria, dazu besteht kein Grund. Es gibt keine Bedrohung für dich. In Köln bin ich fast jeden Tag mit einem neuen Mord nach Hause gekommen, und das hatte doch auch keine Auswirkungen auf dein Sicherheitsempfinden. Also bitte, überbewerte das Ganze auch hier in Niederkirchen nicht. Ich fahre jetzt zurück zum Tatort. Je eher ich meine Ermittlungen aufnehmen kann, desto eher wird der Fall gelöst. Arbeite noch etwas hier im Garten, das wird dich ablenken und entspannen. Oder geh ins Dorf, begib dich unter Menschen. Du bist doch hier nicht allein.«
»Doch, Jerry, das ist es ja gerade. Ich bin hier allein.«