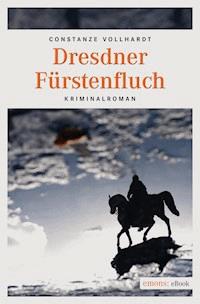
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein grausiger Leichenfund, der zunächst wie die unerklärliche Tat eines Verrückten aussieht, entpuppt sich als der Beginn einer mysteriösen Mordserie im Zeichen der einstigen Sächsischen Fürsten des Hauses Wettin. Kommissar Färber, der die Soko »Fürstenzug« leitet, taucht tief in die sächsische Historie ein - doch die Ereignisse laufen aus dem Ruder und werden beinahe zur tödlichen Falle.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 547
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Constanze Vollhardt lebt in Sachsen, wo sie auch aufgewachsen ist. Nach ihrem Pädagogik-, Germanistik-, Anglistik- und Amerikanistik-Studium an der Humboldt-Universität zu Berlin lebte und arbeitete sie für einige Zeit in den USA. Mehrere Jahre war sie als Gästeführerin im Schloss Rochlitz in Sachsen tätig. Heute arbeitet sie als freie Autorin und im Tourismus-Bereich, unter anderem führt sie als Reiseleiterin Gästegruppen durch Europa und begleitet Reisen auf andere Kontinente.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind, bis auf die historisch belegten Ereignisse und Persönlichkeiten, frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2015 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: photocase.com/united lenses Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Lektorat: Christine Derrer eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-767-3 Originalausgabe
Für Juliane und Johanna, Irmgard und Christian, in Liebe und Dankbarkeit
EIN
FÜRSTENSTAMM,
DESS HELDENLAUF
REICHT BIS
ZU UNSERN TAGEN,
IN GRAUER VORZEIT
GING ER AUF
MIT UNSRES VOLKES
SAGEN.
Motto am Anfang des Dresdner Fürstenzuges
Sonntag, 19.April, Nacht
Zwickauer Mulde, Wechselburg
Wenige Stunden zuvor
Kneipe, Dresden-Neustadt
Die Eingangstür fiel ins Schloss. Stickige Luft kroch mir in die Nase, und ich fand mich in einer schummrigen Kneipe wieder, deren Deckenlampen kaum den Tresen erhellten. Der Wirt des Lokals, ein hagerer Typ mit Halbglatze, beugte sich nach vorn und wischte mit einem Geschirrtuch die Holzplatte vor sich ab. Hierhinein war mein Darsteller vor einer halben Stunde gewankt, ein wunderbar fetter Kerl. Ich kniff die Augen zusammen. Anscheinend hatte seit Tagen niemand ein Fenster geöffnet. Doch für mich schmeckte die verbrauchte Luft nach Verheißung. Allmählich lösten sich zwei Gestalten aus dem Grau. Die beiden Männer trugen Jeans, hingen am Tresen und starrten in ihre Biergläser.
Ich ging an ihnen vorbei, beachtete sie kaum. Ganz hinten, in der dunkelsten Ecke, hockte er. Endlich. Sein schwerer Bauch wölbte sich und füllte das karierte Hemd zum Zerreißen aus. Die Wampe ruhte auf den Oberschenkeln. Zwischen seinen Ellenbogen, die auf dem Tresen lagen und den schweren Körper in der Aufrechten hielten, hingen schmutzige Haarsträhnen. Seine Augen hielt er geschlossen. Der Geruch von Schweiß und altem Bier kroch mir in die Nase. Ich schluckte. Mein Plan war verrückt, aber das machte nichts. Alle großen Künstler waren verrückt. Ich schwang mich auf den Barhocker neben ihm.
Der Wirt hatte uns den Rücken zugekehrt und polierte jetzt Gläser. Ich beobachtete ihn eine Weile, seine türkis schimmernde Weste zuckte im Takt der Musik.
»Zwei Bier«, rief ich schließlich hinüber. Als die Getränke vor mir standen, schob ich ein Glas zu dem karierten Hemd hinüber. »Hier, für dich.«
Der dicke Kerl hob langsam den Kopf. Sein halb geöffneter Mund entblößte ein paar gelbe Zähne, die beiden vorderen fehlten ganz. »Lass mich in Ruhe«, spuckte er mir die Worte ins Gesicht. Ein Speicheltropfen flutschte durch die Zahnlücke und klatschte mir an den Hals. Ich zuckte, wischte den Tropfen mit meinem Ärmel ab.
Dann klopfte ich ihm auf die Schulter. »He, es gibt was zu feiern«, strahlte ich übers ganze Gesicht.
Der Fettwanst reagierte nicht.
»Ich hab heute eine Prüfung bestanden«, log ich. »Los, wir trinken einen drauf. Du bist eingeladen.«
»Hau ab«, knurrte er, schielte aber schon nach dem frischen Bier.
»Sei doch kein Spielverderber.« Lächelnd schob ich das Glas noch ein Stück weiter in seine Richtung.
Endlich griff er nach dem Bier, balancierte es ein paar Zentimeter nach oben und prostete mir zu. Seine Augen tränten, und hinter den halb geschlossenen Lidern erahnte ich den leblosen schwarzen Abgrund seines vergammelten Daseins.
»Klar«, nuschelte er, »das muss begossen werden.« Er krümmte sich noch weiter zusammen, spitzte die Lippen und schlürfte am saftigen Schaum des Getränks. Dann neigte er das Glas und spülte einen großen Schluck hinunter.
Sonntag, 19.April, Nacht
Zwickauer Mulde, Wechselburg
Nur ein paar Stunden später lag der Fettwanst in Wechselburg am Ufer der Zwickauer Mulde. Sein letzter Atemzug entwich als schwerer Seufzer. Ich beugte mich über den Sterbenden und horchte. Der Kerl gab keinen Mucks mehr von sich, nur das gurgelnde Platschen und Schäumen des Flusses war jetzt noch zu hören.
Beim Aufknöpfen des zu knapp sitzenden Hemdes flogen sämtliche Knöpfe ab, die wegen der Spannung einfach nicht mehr halten wollten. Den Anblick seiner entblößten Brust konnte ich kaum ertragen. Die Haut schimmerte bleich unter einem Gewirr krauser Haare hervor. Ekelhaft. Ich wandte mich ab.
»Es muss sein«, flüsterte ich, während meine Hand nach dem Skalpell tastete, das in der Seitentasche meines Rucksacks steckte. Zitternd suchte die Spitze der Klinge eine geeignete Stelle am Bauch des Toten. Ich sah nach oben und erkannte den Großen Wagen am nächtlichen Himmel, als die Schneide ihr zerstörerisches Werk begann. Ich war ein Unbeteiligter, während das Skalpell scheinbar zufällig in meiner klammen Hand verharrte und sich eine Schneise durch das Bauchfett grub. Das Geräusch, das die Klinge dabei verursachte, erinnerte mich an das Zerteilen von Koteletts. Blut ergoss sich entlang der Linie, die das Messer schon zurückgelegt hatte, ein schwarzes glänzendes Rinnsal, das abwärts rann und unter dem Dicken verschwand.
Erst als die Klinge ihre Arbeit getan hatte, kehrte mein Bewusstsein zurück. Das Fett lag in Stücken neben der Leiche im Gras, blutverschmierte gelbe Klumpen. Mir wurde übel, und augenblicklich begann ich zu würgen. Wie hatte ich nur annehmen können, dass das alles Spaß machen würde?
»Jetzt bloß nicht kotzen«, betete ich.
Ich überwand meinen Ekel und hob die abgetrennten Hautlappen auf, trug sie hinüber zur Brücke. Die Masse in meinen Händen zitterte bei jedem Schritt. Über dem Fluss lehnte ich mich gegen das Geländer der Brücke und spürte seine stählerne Kälte an meinem Bauch. Ich beugte mich weit nach vorn, hielt die Luft an, schloss die Augen und öffnete meine Hände. Unter mir klatschte und spritzte es. Unmittelbar fühlte ich tiefe Erleichterung. Die Fische würden ihre Arbeit tun.
Am liebsten wäre ich sofort in meinen Wagen gesprungen und davongefahren. Aber dafür war es zu früh. Ich wollte mein Werk jetzt vollenden. Nein. Ich musste es vollenden. Nur deswegen war ich überhaupt hierhergefahren und hatte all diese widerlichen Vorbereitungen getroffen.
Ich lauschte in die Dunkelheit. Das Wasser im Fluss plätscherte, hin und wieder schrie ein Nachtvogel. Die Stille war tröstlich im Angesicht meiner nächsten Aufgaben.
Ich ging zum Wagen und nahm den Karton mit den Kleidungsstücken des Herolds heraus. Dann zog ich an den Armen meines Darstellers, um ihm das bordeauxfarbene Unterkleid überzustreifen. Immer wieder glitt er mir aus den Händen, der Kerl war schwerer als zehn Säcke Kartoffeln. Mein Rücken schmerzte. Schnaufend und schwitzend ließ ich nach einer Weile von ihm ab. So kam ich nicht weiter.
Um meine Generalprobe nicht abbrechen zu müssen, verzichtete ich schließlich auf das Ankleiden, breitete stattdessen nur sorgfältig das Unterkleid über meinem Darsteller aus. Darüber warf ich den Umhang, den Spitzhut stülpte ich auf seinen Kopf. In die linke Hand bekam er einen Stab und den Schild eines Bannerträgers, darunter schob ich ein Schwert. Als ich fertig war, zierte ein Bildband der Wechselburger Basilika seine Brust.
Ich zögerte. Sollten seine Augen offen bleiben, oder musste ich sie zudrücken? Darüber hatte ich nie nachgedacht.
Schließlich ließ ich meinen Herold weiter in den Himmel starren, der Große Wagen spiegelte sich in seinen leeren Pupillen.
Montag, 20.April, früher Morgen
Zwickauer Mulde, Wechselburg
Über den Baumkronen lag noch der Dunst des sehr frühen Morgens. Verschlafen, aber mächtig ragte das Wechselburger Schloss in die Höhe und herrschte über das Ostufer des Flusses, so wie einst das Grafengeschlecht zu Schönburg über seine Ländereien.
Annerose Lange stand am anderen Ufer. Ihr rostroter Anorak mit den abgewetzten Ärmeln passte zum faden Grau dieses Morgens. Vor ihr lag ein dicker Mann, ausgestreckt auf dem Rasen unter einem seltsam verzierten Umhang. Er starrte teilnahmslos in den Himmel, auf dem Kopf saß ein spitzer Hut. Sein Blut hatte das Gras schmutzig braun verfärbt.
Sie war um diese Zeit noch allein unterwegs. Als sie kurz vor Altzschillen die Muldenbrücke überquert hatte, war ihr etwas Buntes hinter dem Ratsherrendenkmal aufgefallen. Und jetzt stand sie hier, mutterseelenallein. Sie befürchtete, den Halt zu verlieren. Annerose Lange eilte den kleinen Abhang hinunter zu ihrem Wagen. Der Rasen war noch feucht vom Tau. Kurz verlor sie den Halt, rutschte aus und stürzte fast, sie ruderte mit den Armen und konnte damit Schlimmeres verhindern. Am Auto angekommen, öffnete sie die unverschlossene Beifahrertür und tastete nach dem Handy, das irgendwo im Handschuhfach liegen musste.
»Guten Morgen, Annerose. Wie immer früh auf den Beinen.«
Erschrocken riss sie den Kopf nach oben und stieß sich am Türrahmen, das Handy fiel unter den Beifahrersitz. Sie rieb sich die schmerzende Stelle und schaute in die Richtung, aus der die Stimme gekommen war.
»Ach, Helmut.«
»Du bist ja ganz außer Atem. Was ist denn los?«
»Mein Handy. Verdammt, wo ist es denn jetzt wieder?« Sie bückte sich tief in ihren Wagen hinein und tastete den Fußbereich vor dem Sitz ab.
»Ist etwas passiert?«, fragte der grauhaarige alte Herr. Er trug einen beigefarbenen Mantel, und seinen Kopf bedeckte ein etwas aus der Mode gekommener Hut mit schmaler Krempe.
Annerose Lange richtete sich stöhnend auf und deutete auf das Ratsherrendenkmal. »Da liegt einer, ich wollte einen Arzt rufen.«
»Was, ein Betrunkener?«
»Ich glaube, der ist verletzt.«
»Ach was, der ist bloß besoffen.« Helmut Wagner kannte das schon. Am anderen Ufer der Mulde stand die Brückenschänke. Nicht jeder Gast fand den Weg ins eigene Bett. Helmut Wagner ging beherzt hinüber zum Denkmal. Unvermittelt blieb er stehen. Weil ihm schwindlig wurde, musste er sich am Oberschenkel eines der Ratsherren abstützen. »Annerose, da ist ja überall Blut«, keuchte er.
Annerose Lange nickte nur. »Ja, ich habe dir doch gesagt, dass der verletzt ist, vielleicht ein Unfall.«
Helmut Wagner hatte den Krieg noch erlebt und schon einige Leichen in seinem Leben gesehen, und das war eindeutig eine weitere. Er zögerte nicht und beugte sich schnaufend nach unten, so weit es die Arthritis in seinen Gelenken zuließ. Vorsichtig hob er die Kleidungsstücke an, die den Mann bedeckten. Als der Stoff den Blick auf den Leichnam freigab, richtete er sich schnell auf, wobei ihm schon wieder schwindlig wurde. Er taumelte ein paar Schritte zurück und schüttelte den Kopf.
»Da ist ja alles weg«, presste er hervor.
»Was ist weg?«, rief Annerose Lange aus sicherer Entfernung.
»Ach, nichts, wir müssen die Polizei rufen.«
»Warum die Polizei? Ein Arzt muss her, der muss die Blutung stoppen.«
Helmut Wagner war blass um die Nase. »Dafür ist es zu spät. Der Mann ist tot.«
»Wirklich? Woher weißt du das?«
»Das sieht man doch«, sagte Helmut Wagner.
Annerose Lange bückte sich erneut in ihren Wagen und fand endlich das Handy.
Wenig später fuhren zwei Rochlitzer Polizisten in einem Streifenwagen vor und sperrten den Bereich mit rot-weißen Kunststoffbändern ab. Sie nahmen die Personalien von Annerose Lange und Helmut Wagner auf und baten sie, auf die Ankunft der Kollegen aus Chemnitz zu warten.
Eine Stunde lang geschah nichts. Dann aber ging alles sehr schnell. Mehrere Fahrzeuge stoppten in der Nähe des Denkmals. Ein Trupp weiß gekleideter Männer sprang aus einem Kleinbus. Die Beamten sicherten Spuren, rammten Schildchen in den Boden und machten unzählige Fotos. Ein Rechtsmediziner untersuchte das Opfer.
Als Carola Mertens am Tatort ankam, sah sie sich zuerst den Toten an, dann stöckelte sie in Pfennigabsatzschuhen auf die beiden Einheimischen zu. Dabei knickte sie mehrfach um, weil ihr Schuhwerk im weichen Boden versank. Carola trug eine rote Jacke und enge Jeans, ihr rehbraunes Haar war zu einem Pferdeschwanz gebunden.
»Carola Mertens, Kriminalpolizei«, stellte sie sich vor. »Haben Sie die Leiche entdeckt?«
Helmut Wagner nickte und hob seinen Hut ein Stück nach oben, sodass für kurze Zeit sein kahler Kopf über dem grauen Haarkranz zum Vorschein kam. »Eigentlich Frau Lange«, antwortete er und blickte dabei seine Nachbarin an.
»Um wie viel Uhr war das denn?«
»Es muss kurz nach vier gewesen sein«, erklärte Annerose Lange, »ich bin immer um diese Zeit in Wechselburg fertig und fahre dann weiter nach Altzschillen.«
»Womit sind Sie in Wechselburg fertig?«
»Ich trage Zeitungen aus.«
»Aha, und wann waren Sie hier?«, fragte Carola Helmut Wagner.
Er räusperte sich. »Nur Minuten später, denke ich?« Fragend schaute er wieder zu Annerose Lange hinüber.
»Ist Ihnen denn irgendetwas aufgefallen heute Morgen, etwas, das anders war als sonst?«
»Nein, alles war wie immer.«
Annerose Lange ergänzte leise: »Bis auf den Mann da drüben.«
»Natürlich. Warum sind Sie eigentlich schon so früh hier draußen?«, wandte sich Carola erneut an Helmut Wagner.
»Meine Frau schläft gern länger, jetzt als Rentner können wir das ja«, er schmunzelte, »aber ich bin immer schon sehr früh wach, dann wälze ich mich nicht mehr im Bett herum, sondern gehe spazieren, genieße die Stille am Morgen und trainiere meine widerspenstigen Gelenke.«
»Kennen Sie den Toten?«, fragte Carola.
Beide Zeugen schüttelten entschieden den Kopf.
Helmut Wagner antwortete: »Nein, der wohnt nicht in unserer Gegend, wir kennen uns hier alle.«
Carola hob die Augenbrauen. »Ist das so?« Jetzt sah sie Annerose Lange an.
Die Angesprochene hob die Arme und bestätigte: »Ja, ja. Der ist nicht von hier. Fremde fallen sofort auf, und der dort«, sie zeigte Richtung Ratsherrendenkmal, »ist eindeutig fremd hier.« Annerose Lange trat unruhig von einem Bein aufs andere, ihre rechte Hand steckte in der Seitentasche des rostroten Anoraks und tastete nach dem Autoschlüssel.
»Haben die Kollegen schon Ihre Personalien aufgenommen?«, fragte Carola.
»Ja, ja, Adresse, Telefonnummer und alles.« Sie nickte eifrig.
»Gut, dann sehen wir uns später.«
Dankbar verabschiedete sich Annerose Lange und eilte zu ihrem Wagen.
Carola wollte sich schon abwenden, als Helmut Wagner sich räusperte und sagte: »Vielleicht hat es ja nichts zu bedeuten, aber mir ist da etwas aufgefallen.«
Sie blieb stehen. »Ja, was denn?«
»So, wie der Mann da liegt, erinnert er mich an Dedo in der Basilika.«
»Wie bitte?«
»Na Dedo, der Graf von Groitzsch und Rochlitz.«
Carola stützte ihre linke Hand in die Hüfte und wippte mit einem Fuß, der dünne Absatz steckte im weichen Rasen. Sie überlegte. »Kenne ich nicht. Wer soll das sein?«
»Hier im Ort gibt es die berühmte Basilika, eine romanische Kirche. Der Stifter war Graf Dedo, und der liegt mit seiner Frau da drin.«
»Aha?«
»Es gibt eine Grabplatte aus Rochlitzer Porphyr, eine Tumba, auf der die Eheleute in Stein gehauen ruhen. Der Graf jedenfalls liegt genauso da wie der da drüben.«
»Was meinen Sie genau?«
»Also, in der einen Hand hat Dedo Zepter, Schwert und Schild, in der anderen hält er ein kleines Modell der Basilika, als Symbol sozusagen.«
»Sie sagten aus Porphyr, ist das ein spezieller Stein?«
»Er wird auch der Sächsische Marmor genannt.« Helmut Wagner streckte den Arm aus und deutete auf einen dunkelgrün bewaldeten Hügel. »Dort drüben wird er abgebaut. Er ist rot und nur hier zu finden. Das war mal ein Vulkan, und die Asche ist erkaltet, daraus wurde der Porphyr. Sie können den Stein überall in unserer Gegend finden. Hier zum Beispiel, die Ratsherren enthalten auch Rochlitzer Porphyr.« Helmut Wagner zeigte auf das Denkmal, neben dem die Leiche lag.
Carola betrachtete die sitzenden Figuren, die ihr etwas unförmig vorkamen. »Wissen Sie vielleicht auch, was diese beiden hier bedeuten?«
»Die haben aber nichts mit Dedo zu tun«, sagte Helmut Wagner. »Früher hieß der Ort Zschillen, die Ländereien gehörten den Wettiner Fürsten. Moritz von Sachsen tauschte die Gebiete und die Stadt gegen andere in der Sächsischen Schweiz. Die neuen Eigentümer waren die Grafen zu Schönburg. Daher der Name Wechselburg, Sie verstehen? Die beiden Ratsherren tragen jeder eine symbolische Burg auf dem Schoß, die sie miteinander tauschen.«
Carola musste sich eingestehen, dass sie absolut keinen Schimmer von sächsischer Geschichte hatte. Sie kannte weder diesen Dedo noch einen Moritz von Sachsen. Das konnte ja heiter werden. Wenn ihr Mörder ein Geschichtsfanatiker war, dann musste sie sich in diese ganzen Dinge einarbeiten. Sie atmete tief ein.
»Ach, Herr Wagner, haben Sie vielleicht noch etwas Zeit?«
»Na ja, ich hatte noch kein Frühstück, aber wenn ich helfen kann.«
»Ja, das können Sie sicher. Zeigen Sie mir bitte diesen Dedo in der Kirche?«
»Wie, jetzt gleich?«
Carola nickte.
»Gut, wir müssen über die Brücke in die Stadt gehen.«
»Nein, wir fahren.« Sie bat Helmut Wagner um einen Moment Geduld und ging zu zwei uniformierten Beamten. »Ich muss kurz mit einem Zeugen weg, bitte klappern Sie inzwischen die umliegenden Häuser ab, vielleicht hat jemand heute Nacht etwas bemerkt.«
Der jüngere der angesprochenen Polizisten grüßte zackig. »Geht klar, machen wir sofort.«
Carola dankte mit einem Lächeln.
Sie fuhren in Carolas dunkelblauem Kombi in die Stadt und passierten den verschlafenen Marktplatz, hinter dem der Klosterhof lag. Helmut Wagner öffnete die schwere Eingangstür der Basilika, ein kühler Lufthauch strömte ihnen entgegen. Er nahm seinen Hut ab und führte Carola zur Grabplatte Dedos. Ihre Absätze hallten in dem hohen Gemäuer wider, dessen Kreuzgewölbe von mächtigen Porphyrpfeilern getragen wurde. Ein Mönch in schwarzer Kutte, der im Gestühl saß, schaute auf und bedachte sie mit einem finsteren Blick. Offenbar fühlte er sich in seiner Morgenandacht gestört.
Der alte Herr hat recht, dachte Carola, während sie staunend die Tumba umrundete. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen. Vor ihr lag, neben seiner Gemahlin, das steinerne Abbild des Toten vom Muldeufer, nur um einiges schlanker. Der steinerne Dedo hielt in der rechten Hand das Symbol einer Kirche, ihr Toter von heute Morgen einen Bildband mit der Wechselburger Basilika auf dem Buchdeckel. Die linke Körperhälfte des Steinernen verdeckten ein Schwert, ein Schild und ein langer Stab. Ihrem Toten hatte jemand einen ähnlichen Stab und einen Schild unter den linken Arm geklemmt, darunter ein Schwert geschoben.
»Tatsächlich«, sagte sie und wandte sich an Helmut Wagner, »können Sie mir vielleicht auch sagen, wann dieser Dedo gelebt hat?«
Er zog die Mundwinkel nach unten. »So genau weiß ich das nicht, aber mehr als achthundert Jahre wird es schon her sein.«
»Wer könnte denn diesen Dedo heute noch so abgrundtief hassen, dass er dafür einen Mord begeht?«, überlegte sie laut.
Helmut Wagner schaute sie nachdenklich an.
»Kennen Sie jemanden, der mit Graf Dedo oder seinen Nachfahren noch ein Hühnchen zu rupfen hat?«, fragte Carola.
Er kratzte sich am Kopf. »Nachfahren gibt es keine mehr, soweit ich weiß. Möglicherweise hat es mit dem Kloster und den Mönchen zu tun.«
»Inwiefern?«, fragte Carola.
»Keine Ahnung, war nur so ein Gedanke.« Helmut Wagner räusperte sich. »Entschuldigen Sie, aber meine Frau wartet mit dem Kaffee.«
»Na dann, vielen Dank.« Carola drückte ihm ihre Visitenkarte in die Hand. »Wenn Ihnen noch etwas einfällt.«
Er steckte die Karte in seine Manteltasche, nickte zum Abschied und huschte durch die schwere Pforte der Kirche nach draußen.
Carola trat ebenfalls ins Freie, rief ihre Kollegen an und bat sie, später noch ein paar Fotos von der Grabplatte zu machen. Sie ging zurück ins Kirchenschiff und näherte sich dem Mönch, der immer noch an seinem Platz saß. Sie hüstelte, der Geistliche sah sie an, jetzt lächelte er.
»Darf ich Sie etwas fragen?«, flüsterte Carola im Angesicht der Heiligenstatuen, die auf sie herabschauten.
Der Mönch rutschte auf der Holzbank näher zu ihr heran und nickte freundlich. Er war nur wenig älter als dreißig Jahre, doch sein Haar begann sich über der Stirn schon zu lichten.
Carola nahm Platz und zeigte ihm ihren Dienstausweis.
»Kriminalpolizei?«, fragte der Geistliche, er schien nicht wirklich erstaunt über ihren Besuch zu sein.
Sie nickte.
»Ich bin Pater Michael, was wollen Sie wissen?«
»Wir haben einen unnatürlichen Todesfall, deshalb bin ich hier.«
Der Mönch musterte die Rückenlehne der Kirchenbank vor sich. Schließlich sah er Carola an und fragte leise: »Wer ist tot?« Seine Augen wirkten matt, als wenn sich eine feine Eisschicht über das einstmals strahlende Blau gezogen hätte.
»Das wissen wir noch nicht. Es gibt Hinweise auf eine Verbindung zum Stifterpaar dieser Kirche.« Carola hob den Kopf und nickte in Richtung des prachtvollen Lettners, hinter dem sich die Tumba befand.
»Zu Dedo und seiner Frau?« Pater Michael zog die Augenbrauen nach oben.
»Ja. Deshalb bin ich hier. Können Sie sich vorstellen, dass jemand etwas gegen das Kloster oder gegen Sie als Mönche hat?«
Pater Michael zog die Luft hörbar ein. »Wir sind beliebt hier.«
»Wirklich bei allen?«
»Ich denke schon.« Er starrte auf seine Schuhspitzen, die auf einem schmalen Fußbrett ruhten.
»Ihr Kloster ist katholisch?«
»Ja. Wir sind Benediktiner, übrigens heute der älteste Orden in der katholischen Kirche.«
»Die meisten Menschen hier in der Gegend sind aber evangelisch«, sagte Carola, »vielleicht gibt es da ja Unstimmigkeiten, so in Glaubensfragen, meine ich.«
Pater Michael dachte nach. »Wir haben regelmäßig Kinderfeste und auch andere Veranstaltungen mit Einheimischen hier bei uns. Niemals ist mir dabei etwas aufgefallen, das Ihre Vermutung bestätigen würde. Niemals.« Er schlug mit der flachen Hand auf ein Buch, das er schon die ganze Zeit auf dem Schoß liegen hatte.
»Ja, ja«, beeilte sich Carola zu sagen, »vielleicht können Sie mir zu Dedo und seiner Frau mehr erzählen. Gibt es da etwas, das Ihnen merkwürdig oder ungewöhnlich vorkommt?«
Pater Michael schwieg eine Weile, dann sagte er: »Ich habe mich immer schon gefragt, warum unser Dedo dort hinten so schlank ist. In den Überlieferungen wird er als fettleibig beschrieben, er trug sogar den Beinamen der Feiste.«
»Und? Haben Sie eine Antwort auf diese Frage gefunden?«
»Nicht wirklich. Ich vermute, der Steinmetz wollte unseren Dedo in einem besseren Licht für die Nachwelt erscheinen lassen.«
Carola erhob sich und reichte Pater Michael die Hand. Der nickte zum Abschied, dann öffnete er das Buch auf seinem Schoß, um darin zu lesen.
Carola fuhr zurück zum Fundort, wo gerade ein Blechsarg in ein graues Fahrzeug geschoben wurde. Thomas Scholz war also fertig. Sie ging zu ihm hinüber. Er saß auf dem Fahrersitz seines Wagens, die Tür stand offen. Auf den Knien hielt Scholz ein Klemmbrett, auf dem er etwas notierte. Der Rechtsmediziner war etwa vierzig Jahre alt, trug sein dunkles Haar kurz geschnitten, an den Schläfen zeigten sich graue Stellen. Thomas Scholz schrieb schnell und kritzelte neben die Wörter kleine Skizzen.
»Und, kannst du mir schon etwas sagen?«, fragte sie ihn.
Thomas Scholz schaute Carola über den Rand seiner Lesebrille an und zog die Stirn in Falten. »Du weißt ja. Genaues wissen wir erst nach der Obduktion. Nur so viel, der Mann hat eine große Menge Blut verloren, ob das auch die Todesursache war, kann ich noch nicht sagen.«
»Aber den Todeszeitpunkt kannst du mir schon verraten?«
Thomas Scholz kratzte sich am Kopf. »Ich schätze, irgendwann zwischen Mitternacht und heute Morgen.« Er nickte kurz und konzentrierte sich wieder auf seine Aufzeichnungen.
Carola wurde hier nicht mehr gebraucht. Sie ging über die Wiese zurück zum Wagen und blieb mit ihren Absätzen mehrfach stecken. Am Auto angekommen, bückte sie sich. »Dieses blöde Kraut«, schimpfte sie und zog mehrere saftige Löwenzahnblätter von ihren Absätzen herunter, die sie unterwegs aufgespießt hatte.
Dienstag, 21.April, früher Nachmittag
Kommissariat, Chemnitz
Carola saß an ihrem Schreibtisch und studierte die Wechselburger Tatortfotos. Seit gestern forschten sie nach der Herkunft der altertümlichen Verkleidung des Toten. Bisher hatten sie nicht die kleinste Spur.
Alle Kostümverleiher und jedes Theater im Regierungsbezirk Chemnitz waren gefragt worden. Nichts. Niemand schien den burgunderfarbenen Umhang mit Borte, den dazu passenden spitzen Hut mit weißer Krempe und das bordeauxrote Unterkleid mit dem Wappen auf der Brust, das einen schwarzen Löwen zeigte, zu vermissen.
Carola griff zum Telefon. In der Kantine hatte eine Bereitschaftskollegin über historische Kostüme auf Schloss Rochsburg berichtet und dass dieses schöne alte Schloss ganz in der Nähe des Städtchens Wechselburg liege. Also wählte Carola die Nummer und erfuhr, dass Schloss Rochsburg eine Ausstellung mit zahlreichen historischen Kostümen beherbergte. Nein, glücklicherweise werde keines vermisst, und ein solches, wie Carola es beschrieben habe, besäßen sie überhaupt nicht.
Mit einem Seufzer legte sie auf und rief stattdessen in der Rechtsmedizin an.
Thomas Scholz war selbst am Apparat. »Grüß dich, Carola. Wir sind fast fertig, den Bericht bekommt ihr heute noch.«
»Und, was kannst du schon sagen?«
»Dass der Täter eine ziemliche Schweinerei angerichtet hat.«
»Aha?«
»Der hat dem Opfer das Fettgewebe an Bauch und Hüften großflächig abgeschnitten.«
»Warum denn das?«
»Woher soll ich das wissen? Jedenfalls hat er eine sehr scharfe Klinge benutzt, wahrscheinlich ein Skalpell. Aber Ahnung hatte der keine. Die Schnitte sind sehr unsauber und dilettantisch ausgeführt worden.«
»Heißt das, der Täter ist vermutlich kein Chirurg oder Fleischer?«
»Das könnte das heißen, ja. Aber Genaues weiß ich auch nicht. Ich sage dir bloß, was wir bisher festgestellt haben.«
»Ist er daran gestorben, weil ihm das Fett rausgeschnitten wurde?«
»Nein, der Mann war vorher schon tot. Wir haben im Blut ein starkes Schlafmittel gefunden, er hat ziemlich schnell nach der Einnahme das Bewusstsein verloren und ist nicht wieder aufgewacht, so wie wenn einer Schlaftabletten schluckt, um sich umzubringen.«
»Meinst du, er hat das Zeug freiwillig genommen?«
»Möglich. Er hatte außerdem eine extrem hohe Alkoholkonzentration im Blut. Trotzdem muss ja mindestens eine weitere Person ihre Hand im Spiel gehabt haben, sonst wäre ihm sein Bauchfett nicht abhandengekommen.«
»Du bist geschmacklos, Thomas.«
»Nicht mehr als du«, lachte er.
Carola hatte jetzt keine Lust auf diese Scherze. »Wir haben ihn noch nicht identifiziert und brauchen ein gutes Foto von seinem Gesicht«, sagte sie.
»Na ja, er ist nicht gerade eine gepflegte Erscheinung, er wirkt geradezu verwahrlost.«
»Hm«, brummte Carola, »vermutlich lebte er allein, wenn er überhaupt eine Bleibe hatte.«
Thomas Scholz erwiderte nichts darauf.
»Also gut«, beendete Carola das Schweigen in der Leitung. »Hattest du schon einmal so einen Fall, ich meine das mit dem abgeschnittenen Fett?«
»Noch nie.«
»Vielleicht hasst unser Täter dicke oder fette Menschen?«
»Ja, oder er selbst hat ein Gewichtsproblem und wollte probieren, ob man es überleben kann, wenn man sich das lästige Fett einfach abschneidet«, meinte Thomas Scholz sarkastisch.
»Also weißt du …« Carola bedankte sich und legte auf.
Sie dachte über den Toten nach. Er war stark übergewichtig, sein Haar wirkte ungepflegt, rasiert hatte er sich schon ein paar Tage nicht mehr. Hände und Fingernägel zeigten schwarze Ränder, einige Zähne waren ihm ausgefallen. Im Blut hatten sie eine hohe Konzentration Alkohol festgestellt, vielleicht war er Alkoholiker. Der Mann tat Carola leid, so ein Ende wünschte man keinem.
Sonntag, 3.Mai, Abend
Nowa Karczma, Polen
Das Dorf kam in Sicht. Ein rot-weiß gestreifter Sendemast grüßte schon von Weitem. An einer verlassenen Bushaltestelle bog ich links ab und verließ die Fernstraße, die in südöstlicher Richtung weiter ins Landesinnere führte.
Der Transporter holperte die unbefestigte Fahrspur entlang, die gesäumt war von saftigen Wiesen und Buschwerk. Nach einigen hundert Metern musste ich anhalten, weil ein blau gestrichenes Tor den Weg versperrte. Dahinter lag die Bodenstation des Sendemastes in sonntäglicher Ruhe, von deren Dach aus mehrere Satellitenschüsseln den Himmel abhorchten. Der Bereich vor dem Tor war durch Gebüsch vor neugierigen Blicken geschützt.
Eigentlich ein ideales Plätzchen, um einen Organspender zu finden, dachte ich, während ich aus meinem Fahrzeug stieg. Ratlos blickte ich mich um, kein Mensch weit und breit. Wahrscheinlich musste ich weiterfahren, weitersuchen. Zuvor wollte ich mir die Füße vertreten und stieg eine kleine Böschung hinab. Ein surrender Elektrodraht versperrte mir den Weg. In der Nähe graste eine Kuh. Ich roch das frische Gras und blieb für eine Weile stehen.
Vielleicht spielt es gar keine Rolle, wenn das Herz nicht von einem Menschen stammt, überlegte ich.
Dann stieg ich über den Elektrozaun, ohne ihn zu berühren, und stapfte durchs hohe Gras. Als das Gebüsch hinter mir lag, konnte ich zwei weitere Kühe ausmachen. Sie glotzten mich an, standen reglos im dichten Grün. Ein Speichelfaden am Maul der einen zog sich glitzernd in der Sonne nach unten. Die Kuh schien es nicht zu kümmern.
Unter meinem Arbeitsanzug trug ich einen Maleroverall aus Folie, die Sonne brannte auf meinem Rücken. Ich wischte mir den Schweiß von der Stirn. Vorsichtig tastete ich nach dem scharfen Messer, das sich in der Seitentasche meines Hosenbeins verbarg.
Erst jetzt bemerkte ich den Bauern, der die Stäbe des Elektrozauns weiter steckte. Glück muss man haben, jubelte ich. Ich drehte mich einmal im Kreis und musterte die Umgebung, wir schienen allein zu sein. Also kämpfte ich mich weiter durch das hohe Gras auf den polnischen Bauern zu. Als er mich bemerkte, hob er den Kopf und stapfte mir entgegen. Wir trafen uns etwa in der Mitte der Wiese.
»Guten Tag, sprechen Sie Deutsch?«, fragte ich höflich.
Der Bauer nickte eifrig. »Ja, kann ich etwas.« Er war ein schmächtiger Mann mit einer braunen Cordhose, deren Knie sich nach vorn wölbten. Sie wurde gehalten von einem Paar dunkler Hosenträger. Darunter flatterte ein zerschlissenes Hemd. Auf dem Kopf klemmte eine Schiebermütze, die seine Augen fast verdeckte. Die Haut in seinem Gesicht war von der Sonne gegerbt. Die Nase stand schief über einem schmalen Mund, um das Kinn drängten sich graue Stoppeln.
Wir lächelten uns an.
»Ich interessiere mich für den Sendemast«, gab ich vor und deutete mit dem Zeigefinger in den Himmel.
»Ah ja. Das ist großer Turm, was?« Der Bauer lachte.
»Hm, sehr beeindruckend.«
Er lachte wieder. Dann führte er mich von der Weide und auf das Tor zu, vor dem mein Kleinbus stand. Wir stützten uns auf dem Zaun ab und betrachteten die Sendeanlage.
»Sind hier viele Fernsehstationen. Auch deutsche dabei«, erklärte mir der Pole und nickte mehrmals.
Unbekümmert sprach er über die Attraktion seines Heimatdorfes. Kurz drehte ich meinen Kopf nach hinten, überblickte den Zufahrtsweg und ertastete das Messer in meiner Hose.
Dann spürte der Bauer wohl einen heftigen Schmerz im Rücken, denn er schaute mich mit aufgerissenen Augen an. Tapfer hielt meine Hand den Messergriff umklammert und drehte die Klinge in seinem Körper hin und her, was schnell zu großem Blutverlust führte. Sein Lebenssaft rann ungehindert auf den Boden und versickerte im trockenen Kies. Mit einem tiefen Seufzer wurde er ohnmächtig und sackte in sich zusammen.
Beim Atmen pfiff etwas so laut in meiner Brust, dass ich Angst hatte, wegen des Lärms entdeckt zu werden. Für einen kurzen Moment wurde mir schwarz vor Augen, und ich hockte mich auf den Boden direkt neben das dunkelrote Rinnsal. Es vergingen Minuten, in denen ich mich nahezu ohnmächtig fühlte. Eine der Kühe muhte laut, ich erschrak.
Jetzt aber schnell, ermahnte ich mich. Gleich würde es dunkel werden, und die schlimmste Aufgabe stand mir noch bevor. Angewidert betrachtete ich das Blut an meiner Hand. Ich wischte es ins Taschentuch und kämpfte schon wieder gegen die Übelkeit. Meine von Blut und Schweiß verklebten Finger zwängte ich mit Mühe in ein Paar Latexhandschuhe.
Dann schleifte ich den leblosen Bauern hinter ein Gebüsch gleich neben dem Tor. Ich knöpfte ihm das Hemd auf und kauerte mich neben ihn, atmete ein paarmal tief durch. Aus meiner Jackentasche zog ich ein Skalpell und setzte zögernd die Spitze des scharfen Werkzeugs in Höhe des Brustbeins an, Bilder aus Wechselburg kamen mir in den Sinn. Ich schluckte und schloss meine Augen, als ich die Klinge nach unten drückte. Das Skalpell durchbrach mit schmatzendem Geräusch Haut und Knorpel, die Rippen waren im Weg. Schweiß rann mir von der Stirn hinunter in die Augen. Mit dem Ärmel wischte ich die lästigen Tropfen ab. Die Rippen mussten weg, also erhob ich mich stöhnend und schlich zum Wagen. Im Laderaum stand meine Werkzeugkiste bereit. Zurück beim Toten, setzte ich meine Eisensäge an und lauschte auf das Ratschen der stumpfen Zähne, die sich durch die knorpelige Masse arbeiteten. Hin und wieder blieb das Blatt stecken und verkeilte sich. Als die Säge endlich durch war, bog ich die Knochen auseinander und umfasste das noch warme Herz, das gerade erst aufgehört hatte zu schlagen. Geschickt schnitt ich die großen Blutgefäße durch und hob das Organ vorsichtig aus der Brust.
Ich umfasste das Herz wie einen Schatz und trug es zum Wagen, steckte es behutsam in einen leeren Plastikbeutel. Im Laderaum lag eine grüne Pferdedecke mit goldenen Verzierungen. Die trug ich zum toten Bauern, über dem bald die ersten Fliegen kreisen würden, und deckte ihn damit zu. Die Werkzeuge warf ich achtlos in den Laderaum zurück. Bevor ich ging, drehte ich mich noch einmal um und stellte erleichtert fest, dass die grüne Decke kaum vom Buschwerk zu unterscheiden war, ein perfektes Versteck. Ich verließ ohne weitere Verzögerung das Dörfchen Nowa Karczma in westlicher Richtung und begegnete dabei keinem Menschen.
Montag, 4.Mai, Nacht
Elbufer, Altstadtseite, Dresden
Unter der Carolabrücke gleich neben der Brühlschen Terrasse parkte ich meinen Wagen. Ich zog neue Handschuhe über und hob meine schwere Reisetasche aus dem Laderaum, auch den Beutel, in dem sich die gelockte Langhaarperücke und das Herz befanden. Die Nachtluft lastete schwer und dunkel auf der Großstadt und dämpfte jedes Geräusch. Die Elbe wand sich als zäher Strom durch die Wiesen wie Asphalt an einem heißen Sommertag. Es roch nach abgestandenem Wasser.
Ich schleppte meine Fracht den Berg vor der neuen Synagoge hinauf, rechts befanden sich die Gewölbe des Bärenzwingers. Vor dem Albertinum bog ich ab und stieg die Treppe hinauf, die auf die Terrasse führte. In der Dunkelheit fand ich mich ohne Probleme zurecht, denn in den letzten Wochen war ich oft hier gewesen. Das stählerne Denkmal für den Maler Caspar David Friedrich erreichte ich nach wenigen Schritten. Meine schwere Tasche ließ ich auf den Boden fallen, direkt neben dem Stuhl, der zum Denkmal gehörte. Es schepperte laut. Ich zuckte zusammen, die Rüstung in der Tasche hatte ich glatt vergessen. Eine geschlagene Minute wartete ich und horchte in die Nacht. Ein Vogel schrie, und in der Ferne hörte ich das Rauschen einer Schnellstraße. Ansonsten passierte nichts. Lautlos öffnete ich die Reisetasche und packte den Beutel aus, legte die mitgebrachten Gegenstände auf dem Denkmal ab.
Im Gebüsch neben mir raschelte es. Wieder hielt ich inne und lauschte. In der Kehle spürte ich mein Herz schlagen, als wollte es meinen Körper an Ort und Stelle verlassen. Hatte doch jemand das Scheppern gehört und lauerte mir schon hinter dem Gebüsch auf? Ich hockte zitternd am Boden und wartete. Doch es geschah nichts. Mit flatternden Händen ging ich schließlich an die Arbeit und beeilte mich, mein Kunstwerk herzurichten. Es dauerte nicht lange, jeder Handgriff saß, denn ich hatte mein Vorgehen unzählige Male im Geiste ablaufen lassen. Erst als ich fertig war, spürte ich, dass mir der Schweiß auf der Stirn stand. Ich richtete mich auf und rieb mir die Hände.
Montag, 4.Mai, Vormittag
Kommissariat, Dresden
»Chef, ich hab da eine Meldung reinbekommen, die sollten Sie sich mal ansehen.« Gerlinde Strecker betrat das Büro von Kriminalkommissar Fred Färber und legte ihm einen Zettel auf den Schreibtisch. Sie trug eine gestärkte Blümchenbluse zum eleganten knielangen Rock. Gerlinde Strecker war die ordnende Hand im Büro der Mordkommission und Färbers zuverlässigste Mitarbeiterin.
Färber blickte kurz von seinen Akten auf und griff nach dem Stück Papier. Die wenigen Zeilen hatte er schnell überflogen. »Was, die haben das Herz eines Menschen auf der Brühlschen Terrasse gefunden, unter einem Hut?«
»Scheint so, Chef.«
»Das kann doch nur ein schlechter Scherz sein.« Er schüttelte den Kopf. Er las die Meldung ein zweites Mal. »Wer hat denn die Polizei informiert?«
»Steht da.« Dabei stippte Gerlinde Strecker mit dem Zeigefinger auf das Blatt.
»Walter Heuner, städtischer Angestellter, meldete um sieben Uhr achtunddreißig einen seltsamen Fund auf der Brühlschen Terrasse«, las er laut. »Na, so was. Ein seltsamer Fund. Woher wissen wir denn, dass es ein Herz ist und noch dazu ein menschliches?«
Gerlinde Strecker zog die Schultern nach oben. »Das weiß ich auch nicht. Vielleicht ist es das Beste, Sie fahren gleich mal hin. Dann werden wir ja sehen, ob an der Geschichte etwas dran ist.«
Seufzend erhob sich Färber und ging zum Kleiderständer, um seine Jacke zu holen. »Die frische Luft wird mir guttun. Die verstaubten Akten hier«, dabei deutete er auf einen Stapel Mappen auf dem Schreibtisch, »laufen mir ja nicht davon.« Er nickte Gerlinde Strecker zu und verließ das Büro. Im Gehen kramte er ein paar Stücke Lakritz aus seiner Jackentasche und steckte sie sich in den Mund.
Montag, 4.Mai, später Vormittag
Brühlsche Terrasse, Dresden
Endlich war die kahle Winterzeit vorbei. Die Bäume auf der Terrasse entlang der Elbe zeigten ihr zartes Grün. Da Färber nicht wusste, was ihn am anderen Ende der Flaniermeile erwartete, die bei Dresdnern und Besuchern gleichermaßen beliebt war, freute er sich lieber jetzt über die Natur, später hatte er vielleicht keinen Blick mehr dafür.
Er eilte zielsicher an den schwatzenden und lachenden Touristengruppen vorbei, die die Terrasse bevölkerten. Ein Liebespaar stand eng umschlungen am Geländer und schaute hinunter zur Elbe. Färbers Magen krampfte sich zusammen, er hielt inne und ging ein paar Schritte auf die beiden zu. Für einen Augenblick hatte er gedacht, es sei Marita, die sich in die Arme des Fremden schmiegte. Seit sie vor mehr als sechs Wochen aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen war, meinte er, sie überall zu sehen. Färber atmete tief aus, um den Schmerz zu unterdrücken, der ihn seit diesem Tag quälte und sich in seinen Eingeweiden festgesetzt zu haben schien.
Schnell ging er weiter. Die Vögel zwitscherten in den Zweigen, der Himmel strahlte blau und spiegelte sich im Wasser des Flusses. Ein perfekter Frühlingstag, wenn da nicht das rot-weiße Band der Polizeiabsperrung gewesen wäre, das in der Ferne flatterte. Die Jungs von der Spurensicherung waren schon vor Ort. Ein paar Beamte in Uniform hielten eine Gruppe Schaulustiger in Schach, die versuchten, hinter die Absperrbänder zu gelangen. Färber blieb vor einem der Polizisten stehen und zeigte seine Dienstmarke.
»Gut, dass endlich einer kommt«, sagte der Beamte. »Die Leute sind kaum zu bändigen. Wir müssen das Zeug hier wegschaffen.«
»Was für Zeug?«
»Na die Klamotten dort«, sorgenvoll schaute der Polizist zum Caspar-David-Friedrich-Denkmal, »und auf dem Boden liegt das Herz eines Menschen.« Dann nickte er, um die Bedeutung seiner Worte zu unterstreichen.
Färber bückte sich und kroch unter dem Band hindurch. Zwei Leute von der Spurensicherung arbeiteten innerhalb der Absperrung. Ein ihm unbekannter Mann stand unschlüssig neben den Kollegen. Färber wusste nicht, was er hier zu suchen hatte.
»Guten Morgen, Färber, Mordkommission. Darf ich fragen, was Sie hier machen?«
»Klein, Dr. Klein, ich bin Arzt.«
»Schön, aber Sie arbeiten doch nicht für die Rechtsmedizin, oder sind Sie neu?«
»Nein, nein.« Ein Lächeln stahl sich in das Gesicht des schlanken Mannes, der einen gepflegten Oberlippenbart trug. Seine Augen blinzelten hinter randlosen Brillengläsern. »Ich war auf dem Weg zur Arbeit, als ich zwei Straßenkehrer beobachtete, wie sie einen blutverschmierten Gegenstand auf ihre Schaufel schoben. Das wollte ich mir genauer ansehen. Als ich sie ansprach, beschwerten sie sich, was für eine Schweinerei wieder über Nacht angerichtet worden sei und dass an ihnen immer die Drecksarbeit hängen bliebe. Ich erkannte sofort, dass es sich um ein humanes Herz handelte, das sie gerade in den Müll werfen wollten. Ich bestand darauf, dass sie alles stehen und liegen ließen und umgehend die Polizei angerufen wurde.«
Färber betrachtete die seltsame Anordnung beziehungsweise das, was die Straßenkehrer davon noch übrig gelassen hatten. Das Denkmal bestand aus mehreren Objekten aus Edelstahl, die mit Stäben verbunden waren und sich in einem imaginären Zentrum in einer Kugel vereinigten. Es gab einen Stuhl, ein Fenster, eine Staffelei und eine Schrifttafel.
Auf dem Boden lagen zusammengeknüllte altertümlich wirkende Kleidungsstücke und Teile einer Rüstung, soweit Färber das erkennen konnte. Das Herz befand sich blut- und dreckverschmiert auf einer großen Kehrschaufel daneben. Auf der Sitzfläche des Stuhls begann eine Blutspur, die bis auf den Boden reichte, sich dort fortsetzte und an der Schaufel endete. Die Männer der Stadtreinigung hatten ganze Arbeit geleistet, dachte Färber resigniert. Wenn es je auswertbare Spuren gegeben hatte, dann waren sie erfolgreich zerstört worden. Färber las den Spruch auf der Tafel.
»Der Maler soll
nicht bloß malen,
was er vor sich sieht,
sondern auch,
was er in sich sieht.
Sieht er also nichts
in sich,
so unterlasse er
auch zu malen,
was er vor sich sieht.
C. D. F.«
Färber wandte sich wieder an den Arzt Dr. Klein: »Sind Sie sicher, dass das Organ nicht von einem Tier stammt, einem Schwein zum Beispiel?«
»Absolut. Ich bin Chirurg, glauben Sie mir, das Herz eines Menschen kann ich zweifelsfrei erkennen.«
Färber nickte, bat um die Personalien des Arztes und verabschiedete sich. Er kroch wieder unter dem Band hindurch und ging hinüber zu den beiden Straßenkehrern, die in grünen Arbeitsanzügen bewegungslos auf einer Bank saßen und warteten. Sie starrten auf den Fluss hinunter.
»Färber, Kriminalpolizei«, stellte er sich vor.
»Was wollen Sie denn wissen?«, fragte der eine. Er war von kräftiger Statur, hatte tiefe Falten im Gesicht, seine Haut war jetzt schon gebräunt. Er blinzelte mit wachen Augen gegen die Sonne, die hinter Färber strahlte, als hätte es die dunklen Wochen des Winters nie gegeben.
»Sind Sie Walter Heuner?«
»Nein, der da«, antwortete der Arbeiter und deutete auf seinen Banknachbarn. »Mein Name ist Franz Nagel.«
Färber wandte sich an Heuner, der ein schmächtiger kleiner Kerl war: »Sie haben also das da drüben gefunden.«
»Hm.«
»Warum waren Sie denn heute Morgen hier oben?«
»Arbeiten.«
»Was haben Sie hier oben denn zu arbeiten?«
Heuner schaute auf die Spitze seines rechten Schuhs, mit dem er kleine Kreise in den Kies vor der Bank malte. Färber wartete, Heuner schwieg. Färber atmete hörbar ein und wiederholte geduldig seine Frage.
Endlich räusperte sich Heuner. »Ich sollte Ordnung machen.«
»Was machen Sie denn so, wenn Sie Ordnung machen?«
»Na«, Heuner zögerte, als müsse er sehr gründlich überlegen, welche Arbeiten er am Morgen verrichtet hatte, »Abfall von den Grünflächen weglesen, die Wege harken und so was.«
»Was haben Sie denn getan, als Ihnen die Sachen auf dem Denkmal aufgefallen sind?«
Heuner überlegte eine Weile. »Ich hab mich erst einmal geärgert.«
»So, so«, brachte Färber mit einem Stöhnen hervor. »Und dann?«
Nagel meldete sich zu Wort. »Mensch, Walter, lass dir doch nicht jedes Wort aus der Nase ziehen. Erzähl dem Herrn Kommissar mal schön der Reihe nach, was heute früh los war.« Aufmunternd klopfte er seinem Kollegen auf die Schulter.
Heuner hustete und begann endlich flüssiger zu sprechen. »Ich kam um sieben hier an und sah gleich, dass auf dem Denkmal wieder Müll herumlag.«
»Was glauben Sie«, entrüstete sich Nagel und unterbrach damit Heuners ersten vollständigen Satz, »was die Leute hier immer abladen. Wenn es nur weggeworfenes Papier wäre, nein, manche entsorgen hier oben sogar ihren Hausmüll.«
»Tatsächlich?«, entfuhr es Färber, der seinen Ärger über die Einmischung schwer unterdrücken konnte.
»Klar, der Stuhl dort drüben lädt die Leute förmlich dazu ein, etwas darauf abzulegen.«
»Warum sind Sie denn hier?«, fragte Färber. »Arbeiten Sie zu zweit?«
»Nein. Ich bin dort hinten eingeteilt.« Nagel streckte seinen Arm aus und zeigte ans andere Ende der Terrasse. »Der Walter hat mich gerufen, um mir die Schweinerei hier zu zeigen.«
»Aha. Herr Heuner«, wandte Färber sich wieder an den anderen und hoffte, dass Nagel nicht weiter dazwischenreden würde, »was haben Sie denn gemacht mit den Sachen auf dem Denkmal«, er zögerte, »ich meine, nachdem Sie sich geärgert hatten.«
Heuner grübelte wieder eine halbe Ewigkeit, bevor er endlich weitersprach. »Ich habe die ganze Zeit geschimpft und das Blechding und den roten Stoff von der Platte mit der Schrift genommen, alles zusammengeknüllt erst mal auf die Erde geschmissen, ich hatte noch keinen Müllsack dabei. Dann habe ich den Faschingshut von der Sitzfläche des Stuhls genommen und den blutigen Klumpen Fleisch darunter gefunden. Ich habe mich furchtbar geekelt, obwohl ich einiges gewohnt bin, das können Sie mir glauben.« Er schaute Färber an. Dieser nickte aufmunternd und hoffte, dass Heuner weitersprach.
Stattdessen räusperte sich Nagel und sagte: »Sie glauben gar nicht, was wir schon alles gefunden haben.« Er winkte ab.
Färber räusperte sich. »Ach, Herr Nagel, lassen Sie doch bitte Ihren Kollegen aussprechen, ja?«
»Schon gut.« Beleidigt schaute Nagel zum Fluss, konzentrierte sich demonstrativ auf die Ausflugsschiffe, die unterhalb der Terrasse vor Anker lagen.
Heuner fuhr endlich fort: »Nur weil ich Handschuhe anhatte, habe ich nach dem Ding gegriffen, um es wegzuwerfen. Aber es ist mir aus der Hand gerutscht und von der Sitzfläche nach unten gefallen, dort habe ich es dann im Dreck liegen lassen. Blut kam auch noch heraus. Ich hatte die Nase gestrichen voll und rief nach meinem Kumpel«, er schaute kurz zu Nagel, »damit er sich die Sauerei ansieht. Franz kam auch gleich zu mir herüber.«
Nagel nutzte die Gelegenheit, doch wieder am Gespräch teilzunehmen. »Ja, ich war schockiert, müssen Sie wissen. So etwas hatte ich überhaupt noch nicht gesehen.«
»Wann kam denn Dr. Klein dazu?«
»Ist das der Arzt?«, fragte Nagel.
Färber nickte.
»Als wir gerade versuchten, das eklige Ding auf unsere Schaufel zu kehren. Er hat uns verboten, damit weiterzumachen«, berichtete Nagel.
»Und dann haben Sie die Polizei angerufen, Herr Heuner?«
»Ja.«
»Eigentlich wollte ich ja anrufen, aber ich dachte, weil Walter das Drecksding gefunden hat, muss er es auch melden«, sagte Nagel.
Färber wandte sich wieder an Heuner: »Wissen Sie noch, wie die Sachen dalagen, bevor Sie sie weggenommen und zusammengeknüllt haben?«
Heuner schien aus einer Art Trance zu erwachen und sprang von der Bank auf. »Ich kann es Ihnen zeigen, wenn Sie wollen.«
»Ja, das ist eine super Idee.« Auch Färber erhob sich.
»Aber«, gab Heuner zu bedenken, »das eklige Ding fasse ich nicht noch einmal an.«
Die beiden gingen zum Denkmal hinüber, Nagel folgte ihnen im Schlepptau.
Auf dem Rückweg durchdachte Färber mehrere Varianten, wie das Herz auf das Denkmal gekommen sein konnte. War es das Zeugnis eines grausamen Mordes oder etwa der schlechte Scherz eines Medizinstudenten, der das Organ aus der Pathologie entwendet hatte? Heutzutage schien alles möglich zu sein. Moralisch gesehen empfand er beides als verwerflich. Aber nur bei einem Tötungsdelikt konnte er etwas tun, der abartige Witz eines Studenten war zwar zu verurteilen, aber nicht durch die Mordkommission zu klären. Färber hoffte, dass sich die Sache als Letzteres herausstellen würde. Er wollte nicht an die Möglichkeit glauben, dass es jemanden da draußen gab, der einem Menschen das Herz aus dem Leibe schnitt, um es in einer makabren Inszenierung auszustellen.
Montag, 4.Mai, Nachmittag
Kommissariat, Dresden
Färber betrat das Vorzimmer seines Büros. Gerlinde Strecker lächelte ihm entgegen und legte verstohlen einen hellgrünen Plastiklöffel beiseite, mit dem sie gerade noch in einem halb leeren Joghurtbecher gerührt hatte.
»Essen Sie ruhig weiter. Es reicht, wenn Sie mir zuhören. Reden müssen Sie jetzt nicht, das tut mir auch mal ganz gut.« Färber grinste, während er die Tür hinter sich schloss.
»Na, Sie, als ob ich schwatzhaft wäre. Was war denn dran an der Geschichte?«
»Das Herz scheint tatsächlich von einem Menschen zu stammen. Es ist auf einem Denkmal oben auf der Brühlschen Terrasse abgelegt worden, zusammen mit altertümlichen Kleidern und Rüstungsteilen. Ich kann mir im Moment noch keinen Reim darauf machen. Wir müssen versuchen, die Herkunft des Organs zu klären. Es könnte sich alles als makabrer Scherz herausstellen oder auch als Mord.« Er kratzte sich am Kopf. »Wer könnte ein einzelnes Herz vermissen?«
»Bestatter, Krankenhäuser und das Krematorium«, schlug Gerlinde Strecker vor.
»Und die Friedhöfe.«
»Was sagt denn die Rechtsmedizin?«, fragte Gerlinde Strecker.
»Bisher noch gar nichts, das Herz müsste inzwischen aber dort sein. Es war ein Arzt vor Ort, der zufällig vorbeigekommen ist. Der hat eindeutig erklärt, dass das Organ menschlich ist.«
»Na dann. Ich kümmere mich sofort um alles.«
»Könnten Sie bitte auch der Herkunft der seltsamen Kleider nachgehen? Die Spurensicherung hat Fotos gemacht. Vielleicht werden sie in einem Theater oder Museum vermisst oder bei einem Kostümverleih.«
»Wird gemacht, Chef.« Gerlinde Strecker griff nach ihrem Telefon.
Färber ging in sein Büro. Er startete den Rechner, druckte die Fotos der Spurensicherung aus und brachte sie seiner Kollegin.
Dann widmete er sich wieder dem Aktenberg, den er zuvor überstürzt verlassen hatte. Sein Chef, Kriminaldirektor Kießling, hatte ihn beauftragt, sich einige unerledigte Fälle der letzten Jahre noch einmal vorzunehmen. Er sollte nach neuen Anhaltspunkten suchen und die modernen Möglichkeiten der Kriminaltechnik nutzen, möglicherweise konnten DNA-Vergleiche zur späten Aufklärung führen.
Als er den ersten Aktendeckel öffnete, lächelte ihm eine junge Frau von einem vergilbten Foto entgegen. Ohne dass er es wollte, schlich sich Marita in seine Gedanken. Sie waren glücklich gewesen, eine lange Zeit sogar. Doch die Jahre hatten ihre Liebe zerfressen wie hungrige Motten die Wollkleider in einem muffigen Schrank. Aber Färber war selbst schuld daran. Auf der Jagd nach Räubern, Erpressern und Mördern hatte er allzu oft vergessen, dass er eine kluge und schöne Frau hatte, die zu Hause saß und vergeblich auf ihn wartete. Ein anderer wusste es besser, und Marita verliebte sich in ihn, einen Sachbearbeiter bei der Abfallwirtschaft. Was wollte sie bloß von dem?
Färber vertiefte sich in die Akte, um den Schmerz unterhalb des Magens zu vertreiben, der sich gerade wieder breitgemacht hatte. Nach fast einer Stunde konzentrierter Arbeit klappte er den Ordner zu und überflog seine Notizen. In den Unterlagen war ihm aufgefallen, dass damals ein möglicher Zeuge wegen eines längeren Auslandsaufenthalts nicht vernommen werden konnte. Färber wollte das jetzt nachholen. Wenn sich der heutige Organfund allerdings als Mordfall entpuppen sollte, würden die alten Akten vorerst weiter ihren Dornröschenschlaf halten müssen. Er rollte seinen Stuhl vom Schreibtisch zurück und stand auf, dehnte seine verspannten Muskeln und öffnete die Tür zu Gerlinde Streckers Büro.
»Kaffee oder Tee?«, fragte er lächelnd.
»Moment noch, einen Anruf muss ich noch machen, das Städtische Krankenhaus«, erklärte Gerlinde Strecker, den Telefonhörer schon am Ohr. Als sie in die richtige Station verbunden worden war, fragte sie, ob seit dem gestrigen Tag oder der letzten Nacht ein menschliches Herz vermisst würde.
Färber drückte die Mithörtaste und vernahm eine dialektfreie Männerstimme.
»… hatten nur einen Organspender von gestern zu heute, einen verunglückten Motorradfahrer.«
»Haben Sie die Organe des Mannes schon transplantiert?«
»Wir haben … Moment, bitte, ich muss nachsehen«, sie hörten das Rascheln von Papier, »… eine Niere hier im Haus transplantiert.«
»Und das Herz?«
»Das ging nach Berlin an eine Spezialklinik. Ich habe das Protokoll hier, genau um ein Uhr dreißig wurde es mit dem Hubschrauber ausgeflogen.«
»Können Sie auch sehen, ob es dort angekommen ist?«
»Hier nicht, aber das sollte kein Problem sein. Ich schicke Ihnen ein Fax, wenn ich den Nachweis habe.«
»Wann können wir damit rechnen?«
»Das scheint ja wichtig zu sein. Ich werde gleich in Berlin anrufen und das Protokoll anfordern. Geben Sie mir Ihre Faxnummer.«
Gerlinde Strecker nannte die Nummer und beendete das Telefonat. Sie legte ihre Hände auf die Schreibtischkante und zog die Stirn in Falten. »Ich habe mit den Bestattungsfirmen und dem Krematorium gesprochen, die Krankenhäuser abtelefoniert und die Friedhöfe. Bisher ist niemandem etwas von einem verschwundenen Herzen zu Ohren gekommen. Ich habe allen unsere Büronummer gegeben und um Rückruf gebeten, wenn sich doch noch etwas herausstellen sollte.«
»Sehr gut. Kommen Sie, jetzt ist in der Kantine nicht viel los.«
Gerlinde Strecker deutete auf ein Glas Gemüsesaft auf ihrem Schreibtisch. »Danke, Chef, aber das ist gesünder.«
Färber hob die Hände. »Da kann man nichts machen. Kann ich Ihnen etwas mitbringen?«
»Nein, danke. Bin bestens versorgt.«
Eine Viertelstunde später empfing das Faxgerät ein Dokument. Die Klinik in der Hauptstadt hatte das Dresdner Herz schon am Morgen einem Patienten transplantiert. Die Operation war normal verlaufen.
Dienstag, 5.Mai, Nachmittag
Kommissariat, Dresden
»Ich hab was gefunden.« Gerlinde Strecker stürmte in Färbers Büro, in der rechten Hand hielt sie zwei Computerausdrucke, die sie über ihrem Kopf schwenkte, als habe sie eine Schlacht gewonnen. Sie legte die Papiere vor ihm auf den Schreibtisch.
»Ich habe im Polizeinetz ein wenig recherchiert und nach dem Begriff ›Herz‹ suchen lassen. Innerhalb Deutschlands gab es nichts Interessantes, dann habe ich europaweit gesucht, und was, glauben Sie, hat der Computer ausgespuckt?«
Färber hoffte, sie würde gleich zur Sache kommen, und versuchte, ein Stück Lakritz hinunterzuschlucken. »Ja, was?«
»Es gibt zwei Fälle, bei denen seit dem Wochenende ein Herz vermisst wird.«
»Wirklich?« Das kam ihm seltsam vor, weil er es in bald zwanzig Jahren bei der Polizei noch nie mit einem solchen Fall zu tun gehabt hatte.
»Also, in Portugal hat der Mitarbeiter eines Bestattungsunternehmens illegal Organe eines Verstorbenen verkauft. Das war am letzten Sonntag, am Montag darauf, also gestern, haben sie ihn schon überführt. Aus der Meldung geht hervor, dass sie zwar auch den Empfänger der Organe gefasst haben, aber weder Leber noch Herz oder Nieren gefunden worden sind.«
Färber schüttelte den Kopf. Die Welt war wohl aus den Fugen geraten, wenn selbst die Innereien eines Verstorbenen vor geldgierigen Händlern nicht sicher waren. Gleichzeitig fragte er sich, was man mit den Organen eines Toten eigentlich anfangen konnte, dass man das Risiko einging, sie sich illegal zu beschaffen. »Zu welchem Zweck wurden denn die Organe verkauft?«
Gerlinde Strecker zuckte mit den Schultern. »Das steht hier nicht, keine Ahnung.« Sie berichtete weiter: »Der andere Fall ereignete sich in Polen. In einem kleinen Dorf, den Namen spreche ich wahrscheinlich falsch aus«, Färber nickte ihr zu und sie fuhr fort, »in Nowa Karczma wurde ein Mann aufgefunden, erstochen. Und … ihm fehlte das Herz.« Sie machte eine demonstrative Pause und atmete tief ein.
»Wann wurde er ermordet?«
»Hier steht: Damian Pajak wurde am Montag, 4. Mai, in seinem Wohnort tot aufgefunden. Entdeckt wurde die Leiche gegen zehn Uhr dreißig durch zwei Streifenbeamte«, sie übersprang deren Namen und Dienstgrade, »vermisst wurde der Getötete seit dem Vorabend, 3. Mai, gegen einundzwanzig Uhr, eine Vermisstenmeldung erfolgte am frühen Morgen des 4. Mai durch die Ehefrau des Opfers.«
»Steht da noch mehr?«
»Ja. Pajak war neunundfünfzig Jahre alt, polnischer Staatsbürger, wohnhaft in Nowa Karczma, Woiwodschaft Niederschlesien, Republik Polen, Todesursache war Verbluten nach einem Messerstich in den Rücken, postmortal wurde dem Mann das Herz aus dem Körper entfernt.«
Färber überflog selbst die Meldungen. Den Bericht aus Portugal legte er beiseite, ein Zusammenhang mit ihrem Organfund schien ihm nicht wahrscheinlich. Aber der polnische Fall konnte passen. Der Zeitpunkt des Mordes stimmte. Außerdem begann Niederschlesien gleich hinter der deutsch-polnischen Grenze, von Dresden aus ein Katzensprung.
»Wir müssen sofort Kontakt mit den polnischen Kollegen aufnehmen, die DNA abgleichen lassen.«
»Moment, ich mache Ihnen eine Verbindung.« Gerlinde Strecker verschwand in ihrem Zimmer, ließ aber die Tür offen. Kurz darauf rief sie: »Ich habe die Nummer gefunden. Es ist ein Kommissar Jannek in Jelenia Góra.«
»Na, hoffen wir, dass er Deutsch oder Englisch spricht.« Er hörte, wie seine Mitarbeiterin im Nebenzimmer auf die Tasten ihres Telefons hämmerte, dann klingelte sein Apparat. Färber griff nach dem Hörer. Nach dem ersten Klingeln wurde abgenommen. Eine Männerstimme meldete sich auf Polnisch, Färber verstand kein Wort. Er räusperte sich: »Äh, verstehen Sie Deutsch, or do you speak English?«
»Yes, yes, English und Deutsch, beides ein wenig.«
»My name is Färber, I call from Germany, Dresden, police, Polizei«, brachte er zögerlich hervor. Gleichzeitig ärgerte er sich, wie schlecht sein Englisch geworden war.
»Hello, I am Lukasz Jannek. Sie können sprechen deutsch mit mir. Wie kann ich helfen?«
»Im Polizeinetz gibt es einen Eintrag. Sie haben am Montag einen Toten gefunden, dem das Herz fehlt.«
»Oh ja. Wir haben solche Fall.«
»Gut, es ist möglich, dass wir das Herz hier in Dresden gefunden haben.«
»Wirklich? Wo haben Sie Herz gefunden?«
Färber erklärte, was sich ereignet hatte und dass ihnen der Fall in Nowa Karczma aufgefallen war. Sie vereinbarten, die DNA aus beiden Fällen vergleichen zu lassen. Sollte sich herausstellen, dass das Herz vom Toten aus Polen stammte, würden sie sich umgehend am Fundort der Leiche treffen.
Färber beendete das Gespräch und lehnte sich zurück. Wenn die Puzzleteile zusammenpassten, würden sich seine schlimmsten Ahnungen bewahrheiten. Er fragte sich, in welchem Morast er die Lösung dieses Falles wohl finden würde, und fürchtete schon jetzt die möglichen Antworten.
Färber verließ das Büro am frühen Abend. Er hoffte, dass die Ergebnisse der DNA-Analysen bald vorliegen würden. Zu Hause angekommen, ging er ins Wohnzimmer und goss seine Kräuterpflanzen, die er in Blumenkästen auf den Fensterbänken zog. Sie tauchten die Räume in ein entspannendes grünes Licht und verströmten die feinsten Düfte. Manchmal zerrieb er vorsichtig eines der Blätter zwischen Daumen und Zeigefinger und schnüffelte. Wenn er Majoran erwischt hatte, dachte er an seine Großmutter, sah, wie sie vor ihrem uralten Küchenofen stand und gebratene Klöße zubereitete. Erst der Majoran verlieh diesem Gericht die besondere Note. Jedes Jahr wuchsen in Färbers hohen Fenstern, die nach Süden zeigten, Petersilie, Basilikum, Pfefferminz und einige andere wohlriechende grüne Gesellen. Die ersten Samen steckte er im März, ein bisschen später setzte er kleine Pflänzchen in die dunkelbraune Erde. Die letzten Kräuter schnitt er im Oktober ab, trocknete sie und brühte manchmal Tee daraus.
Gegenüber der Fensterwand stand eine Hollywoodschaukel in seinem Wohnzimmer. Die Sitzfläche und das Dach waren mit orange und grün kariertem Stoff bespannt, das Gestell glänzte matt. Hier konnte Färber herrlich nachdenken oder auch entspannen. Er lebte den Traum eines Gärtners ohne Garten.
Als Kind hatte er mit seinen Eltern in einer Mietwohnung in der Neustadt gelebt, aber nur in der kalten Jahreszeit. Im Frühjahr war die Familie hinaus in ihren Schrebergarten gezogen und bis zum Spätherbst geblieben. Seine Eltern hatten Obst und Gemüse angebaut, Blumen und Kräuter. Färber war schon damals der stolze Besitzer eines kleinen Gewächshauses gewesen, in dem er züchten durfte, was er wollte.
Wenn sich Färber heute um seine Pflanzen kümmerte, konnte er in die friedliche Welt seiner Kindheit eintauchen. Er vergaß Raub und Mord und Niedertracht, zwischen denen er manchmal zu versinken glaubte.
Marita hatte immer mit den Augen gerollt, wenn es um die Hollywoodschaukel ging. Sie träumte von einer Couch und einem Fernseher, stellte sich gemütliche Abende zu zweit bei Kerzenschein vor. Damit hatte Färber nie etwas anfangen können, und so blieben Couch und Fernseher im kleinsten Zimmer der Wohnung stehen. Eigentlich hätte es ein Kinderzimmer sein sollen, dachte er heute.





























