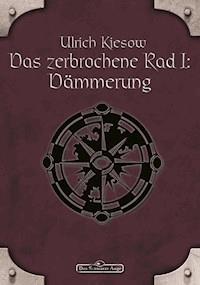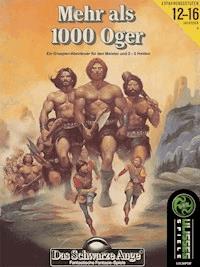Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ulisses Medien und Spiel Distribution GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Schwarze Auge
- Sprache: Deutsch
Als Selissa, die beste in der Eliteeinheit der Ferdoker Lanzenreiterinnen, des Verrats und des Mordes bezichtigt wird, wenden sich selbst ihre Freunde und Kampfgefährtinnen von ihr ab. Einzig ein Junker aus dem Bornland und ihre Stallmagd halten noch zu ihr - und der Scharlatan, ein alter Jahrmarktzauberer, den das Leben verbittert hat. Mit Schwert und Magie zieht die seltsame Schar tapfer in den ungleichen Kampf um Selissas Ehre und Erbe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titel
Ulrich Kiesow
Der Scharlatan
Erster Roman in der Welt von Das Schwarze Auge©
Originalausgabe
Impressum
Ulisses SpieleBand 1
E-Book-Gestaltung: Michael Mingers
Copyright ©2025 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems. DAS SCHWARZE AUGE, AVENTURIEN, DERE, MYRANOR, RIESLAND, THARUN und UTHURIA sind eingetragene Marken der Significant GbR.Alle Rechte von Ulisses Spiele GmbH vorbehalten.
Titel und Inhalte dieses Werkes sind urheberrechtlich geschützt. Der Nachdruck, auch auszugsweise, die Bearbeitung, Verarbeitung, Verbreitung und Vervielfältigung des Werkes in jedweder Form, insbesondere die Vervielfältigung auf photomechanischem, elektronischem oder ähnlichem Weg, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Ulisses Spiele GmbH, Waldems, gestattet.
Print-ISBN: 3-453-08676-7 (vergriffen)E-Book-ISBN: 978-3-86889-843-9
1. Kapitel
Der Gong im Tempel des Sonnengottes schlug zwölfmal, um den Ferdokern zu verkünden, daß die Mittagsstunde angebrochen sei, die hellste Stunde des Tages, aber in den Straßen herrschte so trübes Dämmerlicht, als ob der Abend bereits nahte. Dichte graue Wolken hingen schwer über den Dächern, Wasser troff daraus wie aus einem nassen Wollgespinst. Es wehte kein Wind, die Wolken zu vertreiben, und so fielen die schweren Tropfen schnurgerade dem Boden entgegen. Sie zeichneten lange wäßrige Striche in die Luft, zerplatzten auf den glänzenden Pflastersteinen, liefen zusammen zu stetig wachsenden Pfützen, kleinen Seen, auf denen Wellenringe sich zerschnitten und große Blasen trieben. ›Du kannst es an den Blasen seh‘n: Efferd will nicht weitergeh‘n...‹
Auch die Tauben auf dem Giebel des Praiostempels hatten die Hoffnung auf eine Ende des Regens aufgegeben. Mit aufgeplustertem Gefieder und eingezogenen Köpfen hockten sie auf der Kante des steinernen Dreiecks, unbewegt und in so regelmäßigen Abständen, als wenn sie vorgeben wollten, zum gemeißelten Zierrat des Gotteshauses zu gehören. An anderen Tagen holte sich schon einmal ein Ferdoker Gassenjunge mit geschicktem Schleuderschuß eine Taube vom Tempeldach – die Vögel vom Praiosplatz galten zwar als elendig zäh, doch wenn man sie nur lange genug kochte, erbrachten sie allemal eine kräftige Suppe , aber heute ließ sich von den kleinen Jägern niemand blicken, heute war kein Tag für eine Pirsch. An einem Tag wie diesem blieb der Ferdoker, wenn er es nur irgendwie einrichten konnte, daheim und dankte den Zwölfen, daß sie ihm ein festes Dach über dem Kopf geschenkt hatten. Diese Erkenntnis hatte sich voller Bitterkeit auch bei den Markthändlern eingestellt, die auf dem weiten Geviert des Praiosplatzes verloren hinter ihren Ständen ausharrten und wider besseres Wissen auf eine Ende des Regens und die Ankunft der Kundschaft hofften. Ganz ähnlich den Tauben hatten sie die Köpfe zwischen die Schultern gezogen und waren sorgsam bedacht, sich möglichst wenig zu bewegen, um ein Verrutschen der tropfnassen Kleider auf der Haut zu vermeiden. So standen sie stocksteif und mit leicht abgespreizten Armen da und sahen zu, während ihnen das Wasser von Hutkrempen und Hauben tropfte, wie ihnen der Regen die zarten Blumen zerschlug und die frisch gepflückten Beeren verdarb, wie er durch die Tuchbahnen der Baldachine sickerte, um auf die am Morgen voller Sorgfalt ausgebreiteten Stoffballen, Strohpuppen und Lederwaren zu tropfen.
Der Regen trommelte auf die Fässer der Fischhändler und füllte spritzend die Teller und Schalen der Töpfer, er tränkte die Felle der Zugtiere, die mit hängenden Köpfen am Rande des Platzes standen und lustlos an nassen Heuballen rupften. Hier und da rann er zu kleinen Bächen zusammen, die quer über den Marktplatz strömten, dunkle Schwaden von Tierdung, Heuhalme und Blütenblätter mit sich führend, um sich glucksend in der breiten Gosse vor der Goldenen Lanze an der Stirnseite des Platzes zu vereinigen.
»Mach die Luke zu, Alter! Hier zieht es, daß einem der Arsch gefriert!«
Gerion zuckte die Achseln, löste den Blick von Marktständen und Regenfäden und schloß sorgfältig die kleine hölzerne Lüftungsklappe unterhalb der hohen Butzenscheiben, durch die zwar ein mildes bernsteinfarbenes Licht in die Schenke fiel, die aber so trüb waren, daß man nicht hindurchschauen konnte. Er wandte sich um, um zu erkunden, wer ihn da so barsch angefahren hatte. Vom Tisch, wo die drei Gardistinnen saßen, schaute eine stämmige Frau zu ihm herüber. Sie mochte gut vierzig Jahre zählen; eine breite Narbe verunzierte ihre Stirn und setzte sich in ihrem roten Haar als fingerbreiter kahler Streifen fort. »Geh raus auf die Straße, wenn du neugierig bist, aber halt die heidnische Frischluft aus diesen heiligen Hallen fern!« Sie hob versöhnlich grinsend den Bierhumpen zum Gruß.
Gerion nickte knapp. Soso, dachte er, so weit sind wir schon, daß eine Vierzigerin uns ›Alter‹ schimpft. Unwillkürlich fuhr er sich mit der Linken durch das krause graue Haar. »Was lernt man eigentlich bei den berühmten Ferdoker Lanzerinnen«, knurrte er zornig, »außer Saufen, Hauen und das Ausmisten von Ställen...? Gutes Benehmen wohl nicht?« Er biß sich auf die Lippe. Wie alt mußte er eigentlich werden, um endlich schneller zu denken als zu sprechen?
Die Gardistin stellte ihren Krug so heftig auf der Tischplatte ab, daß es knallte und das Bier einen guten Schritt in die Höhe spritzte. »Sei froh, daß ich mich nicht an Krüppeln und Greisen vergreife, du Zausel, sonst würde ich dir gutes Benehmen lernen!«
Jetzt schweig still! mahnte eine kluge Stimme in Gerions Innerem, aber laut sagte er: »Es heißt nicht ›dir lernen‹, sondern ›dich lehren‹, du Cella unter den Reiterinnen!« Dabei hob er schulmeisterlich streng und nicht ohne Hochmut den rechten Zeigefinger.
Ein Stuhl stürzte um, schlitterte polternd über die Dielen. Die Gardistin war aufgesprungen und bahnte sich, Tische und Stühle zur Seite stoßend, einen Weg quer durch die Schenke. Die wenigen Gäste hatten sich erhoben und – die Bierkrüge sorgsam umklammernd – zu den Wänden zurückgezogen. Als die Gardistin Gerions Platz beim Fenster erreichte, kroch mit schabenden Krallen ein grauschwarzes Etwas unter dem Tisch hervor und stellte sich der Frau knurrend in den Weg. Sie packte mit beiden Fäusten einen Stuhl, hob ihn hoch. »Ruf deinen Köter zurück, oder ich schlage ihn zu Mus!«
»Zisch ab, Gurvan!« sagte Gerion und stand nun ebenfalls auf.
Während der Hund – immer noch leise grummelnd und knurrend – auf seinen Platz unter dem Tisch zurückkehrte, schlenderten die Gefährtinnen der Gardistin heran. Zu dritt formierten sich die Lanzerinnen zu einem Halbkreis vor Gerion. Die jüngste von ihnen, die wegen ihrer langen schwarzen Locken und ihrer dunkelglänzenden Augen Gerion schon aufgefallen war, als sie die Schenke betreten hatte, rümpfte die Nase. »Was stinkt denn hier so götterlästerlich? Ist das dein Köter, oder hast du dich vor Angst in deine Beinkleider erleichtert, alter Schlaumeier?«
Gerion deutete eine Verbeugung an. »Gerion Eboreus Eberhelm von Tisal«, sagte er, »und mit wem habe ich das Vergnügen?«
»Selissa von Jergenquell«, erwiderte die hübsche Schwarzhaarige. »Fiona Dergelstein«, sagte die Stämmige, die immer noch den Stuhl vor dem schweren Busen erhoben hielt. »Tsaiane vom Weidenbruch«, fügte die dritte hinzu. Sie mochte dreißig Götterläufe zählen, hatte ebenfalls schwarze Haare und wies eine gewisse Ähnlichkeit mit ihrer jungen Gefährtin auf. Alle drei trugen die typischen kurzen ledernen Streifenröckchen und hohen Stiefel der Ferdoker Lanzerinnen, allerdings, da sie nicht im Dienst waren, weder Helm noch Kürasse, sondern hochgeschlossene Wämser aus dunkelblauem Samt mit dem Regimentswappen, dem löwenköpfigen roten Roß auf dem Rücken und kleine blaue, mit je einer Häherfeder geschmückte, Barette.
»Was soll das nun werden?« fragte Gerion, während er, um Raum zu gewinnen, langsam einen Schritt zur Seite wich. »Werden mir alle drei Damen gemeinsam die Ehre geben, oder halten wir eine gewisse Reihenfolge ein?«
»Bei Rondra! Der Gesell glaubt, daß ich Hilfe brauchte, um ihn zu zerquetschen!« Tiefe Empörung schwang in der Stimme der rothaarigen Veteranin. Sie stellte den Stuhl ab, warf ihr Barett zur Seite und hob die Fäuste.
»Hau zu, Dicke!« rief eine Stimme von der Schenkentür.
Fiona warf einen zornigen Blick zur Seite, und Gerion knallte ihr mit aller Macht die Faust ans Kinn. Er wußte, daß er die Gardistin schwer getroffen hatte. Darum setzte er nicht nach, sondern wartete darauf, während er sich die schmerzende Rechte rieb, daß Fiona zu Boden ging. Aber die Lanzerin stürzte nicht. Sie schüttelte den Kopf, bis die roten Locken flogen, und nahm wiederum Kampfstellung ein.
»Mach ihn fertig, Mopsendronning!« rief es von der Tür. Aber Fiona sah nicht hinüber. Sie fintete mit der Linken, einmal, zweimal, und stieß die rechte Faust vor. Ihre Handknöchel schrammten über Gerions Wange, der im allerletzten Augenblick den Kopf zur Seite gerissen hatte. Er versuchte es mit einem Tritt, traf aber nur das verstärkte Knie des Reiterstiefels, da die Gardistin blitzschnell das Bein angezogen hatte. Ein Geschoß aus massivem Felsgestein landete in Gerions Magengrube.
»Hast du gesehen: ein Widderkopf!« kommentierte die hübsche Gardistin sachkundig den beidhändig geführten Schlag.
Gerion rang nach Luft, tauchte mit knapper Not unter einer mörderischen rechten Geraden durch und wich ein paar Schritte zurück. Er mußte Zeit gewinnen.
Unter dem Tisch drang Gurvans Gebell hervor; höchste Aufregung verrieten die schrillen Töne. »Hast recht, alter Kämpe«, murmelte Gerion keuchend, »wir stecken in echten Schwierigkeiten!«
»Was soll das sein«, höhnte Fiona im Nachrücken, »ein Faustkampf oder ein Wettlauf?«
Gerion wich zurück, duckte sich, pendelte hin und her, gab sich Mühe, die Fäuste oben zu behalten, obwohl seine Arme nach mehreren Treffern dämonisch schmerzten. Eine kleine Pause, nur ein kurzer Augenblick zum Atemholen: Nicht der kleinste Zauber, nicht die schäbigste Illusion konnten ihm gelingen, wenn er ständig so übel bedrängt wurde! Außerdem würde sein Zauberwerk wahrscheinlich nutzlos abprallen – an diesem Kampfgolem! Der schöne Trick mit der Stimme von der Tür hatte nicht eben viel ausgerichtet. Gerion tat einen halben Schritt nach hinten, Fiona holte zu einem wüsten Haken aus, aber der Grauhaarige sprang plötzlich vor, umklammerte die massige Gardistin und hieb ihr mit aller Kraft die Stirn auf die Nasenwurzel. »Eine Honinger Kopfnuß!« erläuterte er mit einem Seitenblick auf die schwarzhaarige Gardistin. Er gab seine Gegnerin frei, trat auf Armeslänge zurück und streckte ihr die Hand entgegen. »Plum...«
Fiona hieb seinen Arm wütend zur Seite. Zwei Blutfäden rannen ihr aus der Nase über Mund und Kinn. »Halt das Maul und kämpfe!« stieß sie zornbebend hervor.
Gerions Fuß verhakte sich zwischen den Beinen eines umgestürzten Stuhls. Er trat nach dem Möbelstück, versuchte freizukommen. Eine Bärentatze prallte ihm gegen den Kopf, warf ihn zur Seite wie ein Herbstblatt, brachte alle Geräusche ringsumher zum Verstummen und löschte das Licht in der Schenke...
Gerion blickte auf zwei glänzende Stiefelspitzen. Eine kräftige Hand krallte sich in seinen Kragen, zog ihn hoch. Dann stand er inmitten eines Kreises von Gaffern, blinzelnd bemüht, sich in dem wild schwankenden Gastraum zurechtzufinden und nicht auf das schrille Pfeifen zu achten, das ihm im linken Ohr gellte.
»Du magst dich nun bei mir entschuldigen, alter Straßenköter!« hörte er eine großgewachsene rothaarige Frau sagen, die ihm irgendwie bekannt vorkam und auf Anhieb unsympathisch war.
Er hob die bleischweren Arme. »Ein von Tisal entschuldigt sich nicht«, murmelte er, »und bei einem Oger schon gar nicht!
Als Gerion wiederum erwachte, lag er auf knisterndem Stroh. Jemand wischte mit einem feuchten Lappen aufgeregt in seinem Gesicht herum und blies ihm gleicheitig einen üblen, fauligen Geruch in die Nase. »Gurvan, du stinkst wirklich duglummäßig!« murmelte der Zauberer und schlug die Augen auf. Er starrte in ein dunkles Hundegesicht. Warmer Atem hechelte zwischen blitzenden Reißzähnen hervor, trocknete die kalte Feuchtigkeit, die die lange rosige Zunge auf Gerions Wangen hinterließ. Der Zauberer seufzte und hob mühsam einen Arm, um den Hundekopf zurückzudrängen. Die Schulter schmerzte, der Oberarm schmerzte, die zerschundenen Handknöchel brannten, und als Gerion sich mit dem Jackenärmel über das Gesicht wischte, schmerzten auch sein Kiefer und seine Augenbraue.
Gerion deckte den Unterarm über die Augen und ließ sich ins Stroh zurücksinken. »Gurvan, Stinker, wie es scheint, hat es uns böse erwischt.« Der Hund winselte zur Antwort und versuchte, die kalte Nase zwischen Gerions Ärmel und Gesicht zu bohren. »Nun beruhige dich endlich! Alles in allem hätte es viel schlimmer kommen können: Ich könnte tot sein, und dann wärst auch du übel dran. Du bist nämlich einfach zu dumm, den Schlachter nach seinen Abfällen zu fragen.« Gurvan stieß ein fast menschliches Wimmern aus. »Nicht wahr, da kriegst du es mit der Angst zu tun?« fuhr Gerion hämisch fort. »Das weißt du schon, daß du nicht schön genug bist, damit ein anderer dich zu sich nimmt... Eine Prinzessin womöglich, die dir jeden Tag feinsten Pansen auf einem silbernen Tellerchen serviert... Kannst du vergessen, Stinker! Manche Leute haben Glück, und andere sitzen zeitlebens in der Muhrsape. Schau uns an! Ich warte jetzt schon seit fast sechzig Jahren darauf, daß die Götter auf mich aufmerksam werden, und du bist ein ausgesprochener Glückspilz... Warum...? Weil du mich hast, du blöder Hund, darum!
Mit geschlossenen Augen betastete Gerion seinen Kinnwinkel. »Gebrochen scheint er nicht zu sein. Hm... Bei Ingerimm, hatte dieses Weib einen Schlag... Ogermäßig!«
»Fiona ist die beste Faustkämpferin in unserem Banner«, sagte eine Stimme von der Seite.
Gerion fuhr hoch, sank aber sofort wieder mit einem Seufzer auf das Stroh. »Ach, Ihr seid es... äh... Tsaiane...«
»Ich heiße Selissa. Tsaiane ist meine Freundin. Wir sehen uns recht ähnlich, nicht wahr? Manchmal geben wir uns zum Spaß als Schwestern aus.«
»Ist ja hochinteressant!« murmelte Gerion mit matter Stimme und ohne die Augen zu öffnen. »Dennoch sollte ich nicht verwechseln – Ihr seid die hübschere von Euch beiden. Entschuldigt also den... äh... Fehlgriff meiner Zunge...«
»Da braucht Ihr Euch gar nicht zu entschuldigen! Was wißt denn Ihr? Es ehrt mich, mit Tsaiane verwechselt zu werden. Sie ist eine sehr gute Lanzerin. Ich fühle mich sicher, wenn ich im Feld an ihrer Seite reite...«
Gerion stieß einen erneuten Seufzer aus. »Das mag so sein, und es sei Euch unbenommen.« Er schnitt eine Grimasse. »Wißt Ihr, daß Ihr eine sehr kräftige Stimme habt? Aber nun sagt, was wollt Ihr eigentlich von mir? Habt Ihr darauf gewartet, daß ich erwache, damit Ihr mich wieder zusammenschlagen könnt?« Bei den letzten Worten hob er den Kopf und musterte mißmutig seine Umgebung. »Wo bin ich hier überhaupt, und wie komme ich hierher. Bin ich etwa in die Kriegsgefangenschaft der Lanzerinnen geraten?«
Selissa schüttelte lächelnd die schwarzen Locken. »Die Lanzerinnen machen keine Gefangenen. Wußtet Ihr das nicht? Unser Schlachtruf: ›Für Rondra, für den Fürsten – keine Gefangenen!‹ Nicht geläufig?« –
Gerion schnaufte und blickte zu den Deckenbalken hinauf. Neben ihm erhob sich eine Wand aus Stroh. Durch ein offenstehendes großes Tor fiel mattes Dämmerlicht auf sein Lager. Draußen plätscherte und gluckste der Regen. »Eine Scheune«, stellte er fest, »aber wo?«
Selissa, die im Scheunengang auf einer Kornkiste saß, wippte mit der Stiefelspitze. »Na, wo denn schon? Hier in Ferdok, natürlich. Die Scheune gehört Fobol, der auch die Schenke Hammer und Amboß betreibt: Fobol, Sohn des Farnim. Ihr solltet ihn eigentlich kennen.« Sie stand auf, kam zu Gerion herüber und betastete mit kühlen Fingerspitzen sein Gesicht. Während sie behutsam über den scharf gekrümmten Rücken der schmalen Nase fuhr, sagte sie: »Ihr habt eine hübsche Nase. Zum Glück ist sie heil geblieben... Überhaupt scheint Ihr recht glimpflich aus der Sache herausgekommen zu sein. Wenn Ihr Euch hättet sehen können, wie Ihr da auf den Dielen in der Lanze gelegen habt! Ich hatte schon gedacht, Ihr wäret tot.« Um Gerions aufgeplatzte Braue zu untersuchen, beugte sich Selissa so tief über sein Gesicht, daß ihm ihre Haare auf die Stirn fielen.
»Ihr duftet wie eine Rose«, sagte Gerion.
»Das hat übrigens auch der Lanzenwirt gedacht«, fuhr Selissa unbeirrt fort, »daß Ihr tot wäret. Tot oder kurz davor. Jedenfalls hat er uns dringend gebeten, Euch fortzuschaffen. ›Wenn der Bursche mir hier in der Lanze krepiert‹, hat er gesagt, ›dann bekomme ich nichts als Ärger. Also macht mir die Freude und bringt ihn zum Hammer und Amboß. Da wohnt er nämlich.‹ Also haben wir Euch auf einen Karren geladen und hierhergefahren, um Euch auf Euer Zimmer zu tragen. Allein, der hiesige Wirt...«
»Ein kleinlicher Angroschim«, warf Gerion ein.
»...bestand darauf, daß erst einmal Eure Zeche zu bezahlen sei. Sonst habe er kein Bett für Euch.«
»Kleinlich, wie ich schon bemerkte!«
»Da war dann nichts zu machen. Immerhin hat er uns gestattet, Euch hierher zu bringen, in die ›Fürstensuite‹, wie er sagte.«
»Wie lange liege ich schon hier?« fragte Gerion.
»Fünf Stunden mögen es wohl sein...«
»Und in der ganzen Zeit sitzt Ihr an meinem Lager und haltet Wache? Das ehrt mich!«
»Ach, Unsinn!« Selissa stand auf. »Ich bin eben erst gekommen, um kurz danach zu sehen, ob Ihr wieder unter den Lebenden weilt.« Sie trug eine große irdene Wasserschüssel heran und tupfte mit einem weichen Lappen das getrocknete Blut von Gerions Wange und Kinn. Der Zauberer verzog das Gesicht. Selissa ließ den Lappen sinken und zuckte die Achseln. »Wenn Euch meine Behandlung nicht gefällt, kann ich Euch ja wieder Eurem Köter überlassen. Der ist gewiß zärtlicher zu Euch.«
Gerions Versuch, freundlich zu lächeln, geriet zu einer jämmerlichen Grimasse. »In einem klugen Buch habe ich gelesen, der Speichel eines Hundes könne Wunden heilen, der eines Welpen sogar innere...«
Selissa setzte ihre Arbeit fort. »Kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn: Gilt das für alle Köter? Auch für solche, die so stinken wie der Eure?«
»Das ist wie bei den Arzneien«, erläuterte Gerion. »Je besser sie wirken, desto kräftiger riechen sie.« Er schob Selissas Hand zur Seite und richtete sich auf. »Wieso seid Ihr so nett zu mir?«
Selissa wischte ihm ein letztesmal energisch über die Stirn. »Man kann Euch doch nicht einfach verrecken lassen. Da ist nichts Nettes dabei. Nur ein Gebot der Göttin.«
Gerion erhob sich und klopfte sich Strohhalme und Häcksel von der Jacke. Sofort sprang Gurvan auf und lief zum Scheunentor, wieder zurück und noch einmal hinaus. Dabei wedelte und bellte er eifrig.
»Laß den Unsinn!« ermahnte ihn der Zauberer. »Was sollen wir draußen anfangen bei diesem heidnischen Wetter? Oder halt, wart einmal! Vielleicht hast du recht.
Er wandte sich Selissa zu: »Darf ich Euch zu einem Gläschen einladen? Schlagt es mir bitte nicht ab«
Sie lachte. »Wie wollt Ihr das anstellen? Euren letzten Taler haben wir dem Wirt in der Lanze geben müssen, und ansonsten hattet Ihr nicht einen Kreuzer in den Taschen...«
»Ihr habt meine Taschen durchwühlt? Das sind mir feine Sitten...«
Ein rötlicher Hauch huschte über Selissas Wangen. Trotzig warf sie den Lappen in die Schüssel, bis das Wasser nach allen Seiten spritzte. »Was hätten wir wohl anderes tun sollen? Wir wollten schließlich Euer Bett hier im Hammer und Amboß bezahlen.«
Gerion hob die Hand. »Schon gut, schon gut, erregt Euch nicht. Ihr werdet schon das Richtige getan haben. Aber ganz ohne Mittel bin ich, Phex sei Dank, noch nicht.« Bei diesen Worten klappte er den Umschlag seines linken Stiefels zweimal herauf, und zwei Goldstücke sowie mehrere Taler rollten auf den Scheunenboden.
»Schau an!« versetzte Selissa. »Da seid Ihr ja recht wohlhabend, und dennoch prellt Ihr den guten Fobol um seine Zeche... Nun, wie dem auch sei – wie käme ich dazu, mit Euch zu trinken? Ich habe nach Euch geschaut, mich vergewissert, daß es Euch wohl ergeht, und damit gewiß genug getan. Ihr habt meinen Weibel beleidigt und Eure angemessene Lektion erhalten, wir sind Euch nichts schuldig. Erlaubt also nun, daß ich mich verabschiede...«
»Nein.«
»Bitte?«
»Ich erlaube es nicht.«
Selissa stutzte für einen Augenblick. »Nun, so werde ich wohl ohne Eure Erlaubnis gehen müssen. Es ist ohnehin nur eine Redensart.«
»Beim feixenden Phex! Wie seid Ihr plötzlich ernst geworden! Hat Euch meine Einladung trübsinnig gemacht? Ich hingegen sehe der Unternehmung ausgesprochen frohgemut entgegen: Ihr seid eine sehr gutaussehende Frau und tragt eine schmucke Uniform. Die Gäste in der Schenke werden raunen, wenn ich Euch an meinen Tisch geleite.«
Ein Lächeln huschte über Selissas Züge. »Nun, das waren recht artige Worte, aber sie betrafen nur Euren Vorteil. Nennt mir einen guten Grund, warum ich gerade mit Euch, einem arg ramponierten Scheunenbewohner, ausgehen sollte.«
Gerion trat dicht an die Gardistin heran und blickte ihr in die Augen, die im Dämmerlicht schwarz wie Jettstein schimmerten. »Einen Grund, sagt Ihr? Nun, ich will es versuchen, indem ich Euch folgendes zu bedenken gebe...« Danach wurde seine Stimme immer leiser und erstarb schließlich ganz.
»Was habt Ihr eben gemurmelt?« fragte Selissa halblaut und wie in Gedanken versunken. »Eure allerletzten Worte habe ich nicht verstanden.«
»In der Lanze kehre ich nicht wieder ein«, erklärte Gerion, während er hinter Selissa an einer Hauswand entlangstapfte, von dem überkragenden niedrigen Dach einigermaßen vor dem stetig fallenden Regen geschützt. »Am Ende hockt da Eure gute Freundin Fiona und wartet auf mich.«
»Das wohl kaum«, erwiderte Selissa über die Schulter hinweg. »Weibel Dergelstein kommandiert in dieser Nacht die Wache. Ihr könnt unbesorgt sein. Aber wenn Ihr eine andere Schenke vorzieht – wie war‘s mit dem Bardenkrug, der liegt gleich hinter der nächsten Ecke?«
»Wenn Euer Köter naß ist, stinkt er noch selemitischer als sonst«, sagte Selissa, wobei sie sich den rechten Zeigefinger waagerecht unter die Nase hielt. Unter dem Tisch stieß Gurvan einen schier endlosen Gähnlaut aus, rollte sich zusammen und legte die Schnauze auf die Vorderpfoten. »Ihr solltet ihn an die Goblins verkaufen. Wie man sagt, schätzen die für ihre Fleischtöpfe gerade die alten Hunde, wahrscheinlich wegen des Aromas, wie ich nun weiß.«
»Ach, was soll‘s.« Gerion hob das Glas mit dem roten Yaquirtaler. »Hunde stinken, und Vögel singen. Wie verwirrend wär‘s umgekehrt. Riecht an dem Wein und trinkt. Wenn man genug getrunken hat, bemerkt man den ollen Gurvan gar nicht mehr. Erzählt mir lieber ein wenig von Euch. Wo kommt Ihr her, und was hat Euch ausgerechnet zu den Ferdoker Lanzerinnen verschlagen?«
Es bedurfte einiger Neckereien und eindringlicher Bitten, bis sich Selissa Gerions Wunsch fügte, dann aber berichtete sie recht freimütig von ihrer Kindheit und Jugend auf Burg Albumin. Die Burg lag nur ein paar Tagesritte entfernt und war seit etwa einhundertdreißig Jahren der Sitz derer von Jergenquell, seit die Fürstin Lorinai von Eberstamm Selissas Urururgroßmutter Jandelinde zur Baronin von Albumin ernannt hatte. Alles in allem hatten die Jergenquells eine glückliche Hand mit ihrer Baronie, und besonders jener Passus in der Schenkungsurkunde, in dem es hieß, ›mit allem, was im und auf dem Boden ist‹, sollte sich in späteren Jahren als ein wahrer Segen erweisen, denn seit etwa siebzig Jahren wurde in Jergenquell Erz abgebaut, und seit mehr als vierzig Jahren gab es die ›Albuminer Hütte‹, eine von Zwergen betriebene Gießerei, die der Baronie inzwischen zu beachtlichem Wohlstand verholfen hatte. Selissa war das mittlere von drei Kindern des Barons Lechdan und seiner Frau Elvine. Den jüngeren Bruder Ulfing, so erzählte Selissa, habe sie recht lieb, der ältere aber, Reto, sei ein rechter Fatzke, zumindest gebe er sich alle Mühe, so zu erscheinen. Doch dann warf sie ein, daß sie ihm möglicherweise Unrecht tue, denn eigentlich kenne sie ihn nicht sonderlich gut. Er sei eben mehr als zehn Jahre älter als sie, während sie Ulfing nur zwei Jahre voraus habe. Dieser knappe Vorsprung habe wiederum dazu geführt, daß sie während ihrer gesamten Kindheit mit dem jüngeren in einen Topf geworfen worden sei. Immer habe es geheißen, die ›beiden Kleinen‹ dürften dieses oder jenes nicht tun oder müßten nun ins Bett gehen, während sie, Selissa, eigentlich stets der Meinung gewesen war, es gebe nur einen wirklich ›Kleinen‹ auf Burg Albumin, nämlich den quengelnden und lästigen Ulfing.
»Als wir älter wurden«, fuhr sie fort, »habe ich ihn immer mehr liebgewonnen. Wir haben zusammen das Reiten und Fechten gelernt, haben unsere Falken gemeinsam gezähmt und unseren ersten Geliebten geteilt: einen Fechtlehrer aus Almada, einen hübschen Burschen, stark wie ein Arenakämpfer, fröhlich, mit blitzenden Zähnen. Leider hat ihn der Vater irgendwann fürchterlich geschunden und davongejagt, nachdem er uns drei im Weinkeller erwischt hatte.« Sie lachte, hob das Glas an die Lippen und tat einen tiefen Zug. »Meine Liebschaften finden selten Gnade vor meines Vaters Augen, will mir scheinen. Er mochte den Fuhrmann nicht, auf dessen Bock ich bis nach Elenvina reiste, und nicht einmal den jungen Wengenholm. Dabei ist der immerhin der Sohn von unserem Grafen... Aber warum erzähle ich Euch das eigentlich alles? Mir scheint, ich habe einen Schwips. Das Weintrinken bin ich nämlich nicht gewohnt. Wir Lanzerinnen ziehen das gute Ferdoker vor.«
»Ach, was redet Ihr da?« Gerion winkte ab. »Eine echte Lanzerin sollte in jedem Sattel zu Hause sein: ›Schenk Schnaps, schenk Wein, schenk Ferdoker ein!‹« summte er leise.
»Ihr kennt unser Lied?« Selissa war überrascht.
»Gewiß, es ist ein schönes Lied, wenn auch ein wenig traurig. Aber fahrt doch bitte in Eurer Geschichte fort. Ihr wart gerade an einem sehr interessanten Punkt angelangt. Von Liebschaften – glücklichen und unglücklichen – höre ich immer germ. Von den Wengenholms war die Rede: Was hatte Euer Vater am Sproß der Wengenholms auszusetzen? Familiäre Bande zur Grafenfamilie, das sollte doch jeder Baron zu schätzen wissen.«
»Der junge Graf – er heißt Erlan – ist ein seltsamer Zeitgenosse: undurchschaubar, womöglich ein wenig verschlagen, aber geistreich und über alle Maßen auf die Form bedacht; der geborene Höfling eigentlich und kein Mann, mit dem ich glücklich würde. Nun, das weiß ich heute. Aber Erlan ist recht gutaussehend und kann sehr charmant sein. Seinerzeit hat es mir geschmeichelt, daß er mir den Hof machte. Von Anfang an trafen wir uns heimlich, denn mein Vater ist auf die Wengenholms nicht gut zu sprechen. Seit langer Zeit liegen unsere Familien miteinander im Zwist, und immer geht es um die Erzminen, die die Wengenholms für sich beanspruchen. Zwei Prozesse hat es schon gegeben, einen hier in Ferdok und einen gar am Hofgericht zu Gareth, und beide Male haben die Wengenholms verloren, doch sind sie immer noch unsere Lehnsherren und kennen natürlich Mittel und Wege, um meinem Vater das Leben sauer zu machen. Aber nun mag hoffentlich alles anders werden, denn Graf Hakan, Erlans Vater, ist im letzten Winter gestorben, und Erlan und seine junge Stiefmutter Ilma streiten sich um das Erbe. Da haben sie natürlich keine Zeit, sich auch noch mit uns Jergenquells herumzuschlagen. Mein Vater will nun die Gelegenheit nutzen und am Fürstenhof vorstellig werden, damit unsere Baronie einer anderen Grafschaft zugeschlagen wird. Vielleicht gibt es dann endlich Frieden. Es bleibt natürlich die Frage, ob es ratsamer wäre, daß wir uns unter den Schutz von Graf Falkenhag stellen, oder ob wir uns in Richtung Schetzeneck orientieren. Für den Falkenhager spräche – immer vorausgesetzt, Fürst Blasius stimmte meines Vaters Wünschen überhaupt zu , für den Falkenhager also... Sagt, Ihr scheint mir nicht mehr recht zuzuhören?«
Gerion, der eben wieder einmal sein schmerzendes Kinn betastet hatte, sah auf. »Mache ich den Eindruck? Nun, ich habe mich nur gerade ge fragt, ob wohl alle Jergenquells so gut aussehen wie Ihr. Davon abgesehen aber bin ich Eurer Erzählung aufmerksam gefolgt, auch wenn Ihr leider das spannende Feld der Liebschaften verlassen hattet. Wie kam es zum Bruch mit Graf Erlan? Ihr habt Euch doch gewiß nicht einfach den Wünschen Eures Vaters gefügt – das sähe Euch nicht ähnlich.«
»Ach was, so gut glaubt Ihr mich schon zu kennen? Aber Ihr habt ja recht. Die wahre Liebe, so denke ich, wird sich niemals von elterlichen Verboten unterdrücken lassen.«
»Bei Rahja, so soll es sein!« warf Gerion schmunzelnd ein und hob das Glas. »Darauf laßt uns trinken!«
Selissa führte ihr Glas an die Lippen. Ihre Wangen hatten sich gerötet, die dunklen Augen blitzten fröhlich. »Nein, nein, mit Erlan und mir kam es, wie es meistens kommt, wenn eine Liebschaft endet: Eine neue Liebe trat dazwischen.«
»Aha, nun wird es interessant.« Gerion beugte sich nach vorn und verschränkte die Arme über der Brust.
Selissa schüttelte lächelnd den Kopf und strich die schwarzen Locken zur Seite, die ihr ins Gesicht gefallen waren. »Ihr seid ein merkwürdiger Mensch, neugierig wie ein Klatschweib... Aber mich beschleicht immer mehr das Gefühl, daß Ihr nur einen seltsamen Spott mit mir treiben wollt.«
»Wie kommt Ihr denn auf diesen Gedanken, um der Zwölfe Willen? Habt Ihr mich nicht heute mittag noch ›Alter‹ geschimpft? Euch ist also durchaus aufgefallen, daß ich nicht mehr allzuviel Lebenszeit zu Verschenken habe. Wenn dem aber nun einmal so ist, so möchte ich die verbleibende Zeit nutzen. Mit einer schönen Frau über Liebe und Leidenschaft zu plaudern, das heißt für mich, meine Zeit aufs trefflichste auszukosten. Als schiere Verschwendung erscheint mir hingegen jener Zeitvertreib, der allenthalben ›Konversation‹ genannt wird. Was hätten wir davon, wenn wir uns den ganzen Abend lang über Vinsalter Sänger, Garether Politik, Hühner und Pferderassen oder tulamidische Schmiedekunst unterhielten. Das wäre fürwahr ein echter ›Zeitvertreib‹. Es kommt jedoch nicht darauf an, die Zeit zu vertreiben, sondern sie zu genießen. Aber vielleicht seid Ihr noch zu jung, um das zu verstehen.«
Gerion winkte den Wirt herbei, um eine neue Weinkaraffe zu ordern. In den Bardenkrug hatten sich um diese frühe Abendstunde erst wenige Gäste eingefunden. Ein paar Stammkunden standen beim Wirt an der Theke und verspeisten gemeinsam weichen weißen Käse und dunkles Brot. An einem kleinen Tisch beim Fenster saß ein Liebespaar, das fortwährend die Köpfe zusammensteckte und kicherte, in ihrer Nähe zeigten zwei Musikanten einander Akkorde und Melodien auf der Laute: Zaghaft angesummte Liedchen und einzelne verlorene Töne schwebten bisweilen durch die Schenke, sprachen von Sehnsucht, von Reisen und fremden Ländern und schufen einen seltsamen Kontrast zu dem behaglich selbstbewußten Gelächter des Wirtes, zum Knacken und Knistern des Herdfeuers, zu der warmen Geborgenheit, die jeder der mächtigen Deckenbalken, die bauchigen Krüge auf dem Kaminsims und die vom Rauch dunkel gefärbten Wandbehänge zu verströmen schienen.
Gerion und Selissa – saßen an einem Tisch direkt neben einer kleinen, etwa einen halben Schritt hohen Bühne, auf der, wie Selissa berichtet hatte, später gewiß noch einige Barden und Gaukler auftreten würden.
Der Wirt brachte den Wein und trug Gerion einen kleinen Plausch über das Wetter an, das zu Kaiser Retos Zeiten eindeutig besser und unter Kaiser Hal eben noch zu ertragen gewesen sei, nun aber, unter der Ägide des jungen Prinzen sich noch einmal spürbar zum Schlechteren verändert habe. Tage wie heute habe es jedenfalls früher nicht gegeben, im fernen Havena vielleicht, aber niemals hier, im sonnigen Kosch. Gerion pflichtete höflich bei, verwies aber auf das bekanntlich traditionsgemäß noch unerträglichere Wetter in Tobrien und gab, vom Wirt nach der Ursache für die Schrammen in seinem Gesicht gefragt, aus dem Stegreif eine bissige Tirade auf die gewissenlosen Eilkutschenfahrer zum besten, vor denen heute niemand mehr sicher sei.
Während Gerion sprach, betrachtete Selissa ihn gedankenversunken über den Tisch hinweg und nahm sich vor, ihn so bald wie möglich nach seinen Jahren zu fragen. Gewiß, das krause eisgraue Haar, das dicht wie ein Schaffell seinen Kopf bedeckte und sich bis auf die Schultern ringelte, sprach für ein recht hohes Alter, und auch die scharfen Falten, die in den Augenwinkeln zusammenliefen und über den buschigen Brauen die kantige Stirn zerfurchten sprachen dafür. Der Mund hingegen mit den elegant geschwungenen und keineswegs blassen Lippen war der eines jungen Mannes, und erst recht jugendlich erschienen die aufmerksamen leuchtendblauen Augen, die unter den auffällig langen Wimpern stets in Bewegung waren. Der Körper konnte wenig Aufschlüsse geben, denn er war unter einer schweren hüftlangen Jacke verborgen, wie sie die Flußschiffer gern während der Winterzeit trugen. Unter der Jacke schauten die verknitterten Spitzen eines ehemals weissen Hemdes hervor und verliehen ihrem Träger einen Anstrich von Ärmlichkeit und zugleich von Geckentum: eine unmögliche Tracht!
Es war schon einigermaßen beruhigend, daß sie mit ihrem Begleiter im Bardenkrug saß und nicht etwa im Marschall oder in der Lanze, wo die Gardistinnen zu verkehren pflegten. Wenn ihre Kameradinnen sie mit diesem kauzigen Gesellen zusammen sähen – mindestens eine Woche lang hätte sie alle möglichen Hänseleien zu ertragen. Wieso war sie überhaupt mit ihm gegangen? So sehr sie auch ihr Gedächtnis anstrengte, sie konnte sich nicht mehr darauf besinnen, mit welchen Worten Gerion sie schließlich zu dem Umtrunk überredet hatte. Ein wattiger Schleier lag über der Begebenheit in der Scheune, klarer wurde die Erinnerung erst wieder, wenn Selissa sich auf den Augenblick besann, als sie den Bardenkrug betreten hatte. Das muß an diesem Yaquirtaler liegen, dachte sie. Ich sollte wirklich aufhören, soviel Wein zu trinken. Als sie diesmal das Glas hob, nippte sie nur daran.
Gerion strich mit der Fingerkuppe über die Innenseite ihrer rechten Hand. »Welch schöne, kleine, kräftige Hände«, stellte er fest, »und welch entzückende kleine Schwielen, hart und rund.«
Selissa zog ihre Hand zurück. »Die kommen vom Reiten«, entgegnete sie. »Wenn Ihr an jedem Tag ein paar Stunden...«
Gerion hob abwehrend die Linke. »Schon gut, schon gut. Mir gefallen sie ja. Sie geben Eurer schmalen Hand etwas – wie soll ich sagen – etwas Ernsthaftes, Energisches. Doch nun bitte ich Euch, in Eurer Geschichte fortzufahren. Wir waren bei der spannenden Stelle angelangt, in der eine Liebelei durch den Auftritt der echten Liebe beendet wurde.«
Selissa fragte sich wieder einmal, ob sie Gerions Lächeln als freundlich oder spöttisch bewerten sollte, aber in seinen Augen leuchtete eine so jungenhafte Wißbegier, daß sie nicht widerstehen konnte. »Eigentlich hing alles mit den Ferdoker Lanzenreiterinnen zusammen«, erklärte sie. »Wäre ich nicht zu den Lanzerinnen gestoßen... Also, hätte uns nicht Graf Growin, Sohn des Gorbosch, daheim auf Albumin besucht, und hätte der Vater Brüderchen Ulfing und mir nicht aufgetragen, dem Gast ein paar Attacken gegen den Haukerl vorzureiten, wer weiß, vielleicht säße ich heute noch zu Hause in unserer Burg... Nein, den jungen Wengenholm hätte ich dennoch nicht geheiratet«, warf sie ein. »Das war damals schon abzusehen. Nun, Graf Growin war von meinen Reitkünsten schier begeistert. Zumindest behauptete er das und versprach, gleich nach seiner Rückkehr nach Ferdok den Fürsten aufzusuchen und für meine Aufnahme bei den Gardereiterinnen zu sorgen. Ich weiß noch, wie der kleine Graf sagte: ›Da sucht Fürst Blasius in der ganzen Welt herum, um seine Garde zu schmücken, und hat kein Auge für die heimischen Gewächse‹. ›Gewächse‹ – na ja!« Selissa rümpfte die Nase. »Kaum vierzehn Tage später erhielt ich einen Brief aus Ferdok, geschrieben von Govena Glaidis von HirschingenBerg, unserer Frau Oberst. Ich sollte auf der Stelle nach Ferdok kommen, um mich dort
vorzustellen. Das ist nun drei Jahre her. Vor zwei Jahren bin ich mit meiner Kameradin Yasinde zur Wintersonnenwende ins Bornland gereist, denn dort ist Yasinde zu Hause, in Geestwindskoje, das liegt zwischen Festum und Vallusa, und dort habe ich ihren Bruder, den Grafen Arvid, kennengelernt.« Selissa blickte auf und lehnte sich im Stuhl zurück.
Gerion sah sie erwartungsvoll an und nickte. »Ach, ich verstehe. Das ist er nun, der Weltbeweger: Graf Arvid aus dem Borneland...«
»Graf Arvid von Geestwindskoje«, verbesserte Selissa.
»Groß, blond, grundgütig und weltgewandt, nehme ich an.« –
»So ist es. Woher wißt Ihr...?« Selissa lächelte versonnen. »Wie groß seid Ihr?«
»Na, gut einen Schritt und vierzig Finger. Er ist vermutlich doppelt so groß?«
»Das nicht gerade, aber knapp zwei Schritt mißt er schon. Und er kann wunderschön singen. Wenn er bornische Lieder singt, läuft das ganze Gesinde zusammen, und alle weinen... Man kann nicht anders! In zwei Jahren werde ich meinen Dienst quittieren, und wir werden heiraten, und dann werde ich nach Geestwindskoje gehen. Aber vorher wird er mich besuchen, vielleicht in einem Monat schon. Und dann werde ich ihn auch auf Albumin vorstellen.«
»Was sagt denn Euer Herr Vater zu Eurer Wahl. Ist er diesmal endlich zufrieden?«
Selissa schob zornig die Brauen zusammen. »Was soll er wohl sagen? Einen mitgiftjagenden Habenichts und Brückenfürst hat er ihn ge schimpft. Vater ist nämlich der Ansicht, alle bornischen Adligen seien so arm, daß sie nächtens unter einer Brücke kampieren müßten... Nun ja, Geestwindskoje ist nicht Albumin, aber ich werde im Bornland schon nicht verhungern. Außerdem ist der Dukat nicht alles, was zählt!«
»Fürwahr, ein beneidenswerter Mann, der Herr von Geestwindskoje!
Ach, blond müßte man sein und zwei Schritt groß. Das habe ich mir ein Leben lang gewünscht. Ich wußte nie so recht, warum ich einen so seltsamen Wunsch hegte, aber nun, da ich Euch begegnet bin, habe ich die Erklärung.« Gerion seufzte so tief, daß Gurvan erwachte, unter dem Tisch hervorkroch und dem Zauberer die Pfote aufs Bein legte. Gerion kraulte ihm den Kopf. »Ich weiß, du liebst mich so, wie ich bin, Kumpel, aber ich sage dir, es ist nicht das gleiche...«
Selissa wedelte mit der Hand unter ihrer Nase und murmelte: »Andererseits, wenn ich es recht bedenke, vielleicht stinkt er doch mehr, wenn er trocken ist.« –
Gurvan warf ihr einen langen Blick zu, dann zog er sich wieder unter den Tisch zurück, wo er noch eine Zeitlang damit beschäftigt war, seine Gliedmaßen zu ordnen, bis sie eine befriedigende Schlafstellung eingenommen hatten. Gerion rief den Wirt herbei und ließ ein Krüglein Meskinnes bringen; Selissa war gerührt: »Das ist sehr lieb von Euch. Gewiß wollt Ihr mich ans Bornland erinnern. Auf Geestwindskoje haben wir auch immer Meskinnes getrunken.« Sie leerte das kleine dickwandige Gläschen und schleckte die Reste des Honigschnapses mit der Zunge aus. »Gerion, Ihr seid ein merkwürdiger Mensch. Nun habt Ihr mir so lange zugehört und noch kein Wort über Euch erzählt, obwohl es da gewiß eine Menge zu berichten gibt. Macht mir nur nicht vor, daß Ihr zu schüchtern seid ... Und für sonderlich bescheiden halte ich Euch auch nicht. Also, was habt Ihr zu verbergen?«
»Nie verschwiege ich Euch etwas, schönste Gardistin. Fragt mich, was immer Ihr möchtet. Ihr könnt in mir lesen wie in einem offenen Buch.«
»Nun, wie alt seid Ihr?«
»Neunundfünfzig Jahre, aber im nächsten Hesinde werde ich sechzig.«
»Soso! Woher stammt Ihr?«
»Aus Tobrien, von der Insel Tisal.«
Selissa stutzte. »Gehört die Insel etwa Eurer Familie?«
»Nicht daß ich wüßte. Mein Vater war dort Mühlknecht. Ich denke, wir hätten bessere Tage gehabt, wenn er der Inselherr gewesen wäre. Später erbte er eine Mühle in der Nähe von Ilsur.«
»Aber Ihr heißt doch von Tisal? Nicht wahr, das habe ich richtig behalten?«
»Nun, nicht direkt. Ich stamme von Tisal. Meinen Familiennamen habe ich, wenn ich mich recht erinnere, heute mittag gar nicht genannt.«
»Und wie lautet er?« –
»Ach, erspart mir das! Ich mag ihn nicht.«
»Bitte, habt die Güte! Nun habt Ihr mich erst recht neugierig gemacht.«
»Rottnagel.«
»Gerion von Rottnagel – das ist doch kein übler Name...«
»Gerion Eboreus Eberhelm Rottnagel... Ohne ›von‹. Von Tisal halt, Ihr versteht...?«
Selissa warf den Kopf zurück und lachte. »Ihr seid wirklich und wahrhaftig ein seltsamer Kauz! Wie seltsam auch, daß Ihr Euch in einer Scheune einquartieren laßt, während Euch die Dukaten nur so aus den Stiefeln purzeln. Ist das die bekannte tobrische Sparsamkeit?«
»Was daran tobrisch ist, kann ich nicht beurteilen. Seht, ich bin hierher nach Ferdok gekommen, um auf dem Jahrmarkt meine Kunst zu zeigen. Der Markt beginnt aber erst in zwei Wochen. Bis dahin muß ich mit meinen Finanzen haushalten. Auch habe ich noch einige bedeutende Anschaffungen zu tätigen.« –
»Bedeutende Anschaffungen – das klingt geheimnisvoll. Was habe ich mir darunter vorzustellen?«
Gerion winkte ab. »Dinge, die ich für meine Kunst benötige. Es würde Euch nur langweilen, wenn ich hier auf Einzelheiten einginge.«
»Was für eine Kunst das wohl sein mag...? Seid Ihr ein Gaukler?«
»So könnte man es nennen.«
»Dann müßt Ihr gewiß neue Keulen und Bälle und solche Dinge
kaufen.«
Gerion zuckte die Achseln.
»Werde ich Euch auf dem Jahrmarkt finden?«
»Oh, ich denke schon. Ich habe einen kleinen Wagen, der zur Zeit auch im Hammer und Amboß untergestellt ist. Den werdet Ihr schon entdecken.« Gerion hatte wieder nach Selissas Hand gegriffen. Diesmal entzog sie sie ihm nicht. Sie leerte ihr Meskinnesgläschen mit der Linken. »Einen sehr schönen Ring tragt Ihr da«, bemerkte Gerion. »Ich betrachte ihn schon den ganzen Abend. Kann ich ihn mir einmal genauer ansehen?«
Selissa hielt ihm die Hand vor das Gesicht. »Da bitte schön, schaut her. Er zeigt unser Familienwappen: die Schelle und das Quert...« Sie kicherte. »Ach, Quatsch, die Quelle und das Schwert. Abnehmen mag ich den Ring nicht, er läßt sich so schwer vom Finger ziehen. Immerhin, so kann er mir nicht gestohlen werden...«
»Da seid Euch nur nicht so sicher«, erwiderte Gerion, »ein wirklich geschickter Dieb... Ja, sogar ich könnte ihn Euch ohne weiteres stehlen.«
Selissa hob die Brauen und sah Gerion fragend an. »Das würdet Ihr tun? Na, das könnt Ihr nicht! Ich meine, Ihr wäret doch nicht so gemein und schnittet mir den Finger?«
Gerion faßte wieder nach ihrer Hand. »Wo denkt Ihr hin? So etwas Scheußliches würde ich niemals zustandebringen. Außerdem wäre das dann Raub und nicht Dieberei.«
»Nun, dann schafft Ihr es nicht! Niemals!« Selissa schüttelte die schwarzen Locken. »Ohne Gewalt schafft Ihr es nie!«
»Wie war‘s mit einer Wette, wenn Ihr Euch so sicher seid?«
»Jederzeit!«
»Sagen wir, um fünf Dukaten«, schlug Gerion vor.
»Pah, das ist keine Wette, die den Namen verdient. Ich sage hundert, alter Freund! Schlagt ein oder laßt es bleiben! So wettet man bei den
Lanzerinnen!« Selissa hieb die linke Faust auf den Tisch. Gurvan schoß aus seinem Versteck hervor, blickte aufgeregt in die Runde und knurrte zur Theke hinüber, wo er einen einbeinigen Zwerg entdeckt hatte, der ihm offenbar verdächtig erschien.
»Dann kann aus der Wette nichts werden. Ich besitze keine hundert Dukaten, und ich sehe auch keine Möglichkeit, diese Summe auf zutreiben.« –
Selissa hielt den Meskinneskrug über ihr Glas und beobachtete mit kritischem Blick, wie die letzten Tropfen einer nach dem anderen von der Krugtülle fielen. »Da will er nun nicht mehr wetten«, murmelte sie dabei. »Da hat er es mit der Angst zu tun bekommen, der Hasenfuß... Na gut, dann mache ich Euch einen anderen Froschlach...« Sie mußte so heftig lachen, daß ihr dicke Tränen in die Augen traten. Nachdem sie wieder Atem geschöpft hatte, setzte sie noch einmal an: »Einen anderen Vorschlag: Wenn Ihr gewinnt, bekommt Ihr von mir hundert blihinkende Dukaten, verliert Ihr aber, so werde ich Eurem stihinkenden Ungeuheuer den Kopf abschlagen und die Reste an die Goblins verkaufen. Nun, was haltet Ihr davon?«
Gurvan setzte sich neben der Gardistin nieder und legte ihr die Schnauze aufs Knie. Sie schob den Hundekopf zur Seite und verzog das Gesicht. »Habe ich dir schon gesagt, daß du einen schlechten Atem hast, hm?« Und zu Gerion gewandt: »Na, habt Ihr Euch entschieden?«
Der Zauberer warf einen langen Blick auf seinen graubärtigen Hund und streckte endlich der Gardistin die Rechte entgegen. »Es sei!« –
Selissa schlug ein.
Tatsächlich trat, wie Selissa es angekündigt hatte, wenig später der erste Gaukler auf die Bühne des Bardenkrugs, aber die Gardistin vermochte der Nummer nicht mehr recht zu folgen, und Gerion war der Meinung, er habe schon Besseres gesehen. Also schlug er Selissa vor, der Schenke den Rücken zu kehren.
»Wohin gehen wir, zu dir oder zu mir?« fragte Gerion, als sie vor dem Bardenkrug standen. Er hatte die Gardistin, die er um halbe Haupteslänge überragte, um die Taille gefaßt. Sie lehnte den Kopf gegen seine Schulter. Der Regen hatte ein wenig nachgelassen, aber ein kalter Wind strich durch die leere Gasse.
»Zu mir können wir nich. Keine Kerle in der Kaserne nach acht Uhr, sacht Operst Praiodaningen-Berg. Und du, du wohns inner Scheune!« Selissa kicherte albern. »Inner ollen Scheune wohnt der Herr Verführer! Aber warum eigentlich nicht? Ich habs soo lange nicht mehr im Stroh gemacht.« Sie tat einen Schritt nach vorn, den Zauberer mit sich ziehend.
Auf dem Weg durch die nächtlich stillen Gassen der Ferdoker Unterstadt sang Selissa das Lied der Lanzerinnen: »Reit, Rondra, reite voran, reit Boron, reit uns zur Seit – schenkt Schnaps, schenkt Wein, schenkt Ferdoker ein!« Je weiter sie mit Gerion durch die Nacht marschierte, desto langsamer und leiser wurde ihr Gesang. Als sie durch das Scheunentor schritt, verstummte sie ganz, warf sich über Gerions Strohlager und war einen Wimpernschlag später fest eingeschlafen. Gerion zog ihr die hohen Stiefel aus, holte eine schwere Decke aus seinem Wagen und breitete sie über der Gardistin aus.
2. Kapitel
Zweite Schwadron: Zu Pferd!« Für einen Augenblick geriet die lange Reihe aus stehenden Menschen und Rössern in eine bunte turbulente Bewegung: Messinghelme und Kürasse blinkten im wäßrig blassen Schein der ersten Morgensonne, blaue Umhänge flatterten, Lanzenspitzen mit rotblauen Wimpeln neigten sich, Pferde tänzelten vorwärts und zurück. Dann saßen dreißig Lanzerinnen in den Sätteln, wandten die Köpfe nach links und rechts, dirigierten mit sanftem Schenkeldruck die Pferde, bis diese, Brust an Brust, wieder eine geschlossene Front bildeten. Nur hier und da schlug noch ein aufgeregtes Pferd den mächtigen Kopf nach unten und hob die Reiterin auf seinem Rücken mit einem Ruck aufwärts. Tätschelnde Hände und halblaut gemurmelte beruhigende Worte sorgten dafür, daß endlich fast jede Bewegung erstorben war.
Mit ernster Miene starrten die Reiterinnen geradeaus, scheinbar in endlose Ferne. Dreißig schlanke Lanzenschäfte stachen senkrecht in den Himmel. Ein kräftiger Wind von Süden strich über den Kasernenhof, trieb ein paar feuchte Strohhalme über den Platz, brachte die Dreieckswimpel unter den blitzenden Lanzenspitzen zum Flattern, spielte in Mähnen und Schweifen und auch in den dicken Strängen aus schwarzgefärbtem glänzenden Pferdehaar, die den Gardistinnen von der hohen Helmzier bis tief hinunter auf den Rücken fielen.
»Schauut lliinks!«
Die Köpfe der Reiterinnen ruckten zur Seite. Durch die Gasse zwischen den Ställen und dem Koch und Waschhaus trabten auf kräftigen, makellosen Schimmeln zwei Frauen heran. Die eine trug einen Offiziershelm mit einem hohen Busch aus roten Straußenfedern und einem Stirnschmuck aus Pardelfell; der grauhaarige Kopf der anderen war unbedeckt. Für eine kurze Weile blieben die beiden bei der Gruppe der Karren, Packtiere und Waffendiener stehen, die sich neben den Ställen versammelt hatten, dann setzten sie ihren Weg fort.
Weibel Fiona Dergelstein, die das ›Frontmachen‹ der Lanzerinnen vom Rücken ihres stämmigen grauen Wallachs aus kommandiert hatte, hob die Rechte zum Gruß und meldete mit kräftiger Stimme: »Erstes Gardebanner in Front und dienstbereit!«
Die Frau mit dem Offiziershelm erwiderte den Gruß mit förmlicher Geste, die Grauhaarige beschränkte sich auf ein sparsames Kopfnicken und wandte die Brust ihres Schimmels der Linie der Reiterinnen zu. »Guten Morgen, Gardistinnen!«
»Guten Morgen, Frau Oberst!« hallte es hell über den Platz – danach ein schrilles, einsames Wiehern und anschließend leises, unterdrücktes Gelächter.
Oberst Govena von HirschingenBerg grinste. »Gardistin Hornschuh, wann wird dein Gaul es jemals lernen, die Schnauze zu halten, wenn er nicht gefragt ist?«
»Ich weiß es nicht, Frau Oberst.«
»Hast du ihn nicht aus Gareth mitgebracht?«
»Doch, Frau Oberst... äh... jawohl, Frau Oberst.«
»Dann wundert mich gar nichts mehr. Jeder Garether ist eine Plappertasche!«
»Jawohl, Frau Oberst!«
»Gardistin Jergenquell!«
»Frau Oberst?«
»Wie siehst du aus? Blaß wie ein Gletscherwurm! Und dein Pferd? Wie ein Truthahn in der Mauser! Schon mal etwas von einem Werkzeug namens ›Striegel‹ gehört?«
»Jawohl, Frau Oberst.«
»Kann es sein, daß du eine Viertelstunde vor dem Wecken unter meinem Fenster vorbeigeschlichen bist, Jergenquell?«
»Das ist möglich, Frau Oberst.«
»Nun, darüber werden wir uns bei Gelegenheit unterhalten. Jetzt sind andere Dinge wichtiger. Leutenant Singer, den Tagesbefehl!«
Die Reiterin mit dem roten Helmbusch, eine breitschultrige blonde Mittdreißigerin, trieb ihren Schimmel ein paar Schritte nach vorn. »Rondra zum Gruße, Gardistinnen!«
»Rondra zum Gruße, Frau Leutenant!«
»Um es kurz zu machen: Wir erhielten gestern nachmittag Kunde von einem Answinistenhaufen, der sich knapp zwanzig Meilen südwestlich von hier in den Wäldern herumtreiben soll. Wie es heißt, handelt es sich um einen darpatischen Grafen, eine Baronin, ein paar Ritter und etliche Waffenknechte. Die Schurken haben sich teilweise verstreut und bereits einige Gehöfte in der Gegend überfallen und ausgeplündert. Die ganze Schar dürfte vermutlich versuchen, sich unten am Großen Fluß wieder zusammenzufinden, um dann durch die Koschberge zu schleichen und schließlich nach Albernia weiterzuziehen. Wie ihr wißt, gilt Albernien noch immer als unruhige Provinz, der ideale Zufluchtsort für Schurken und Aufrührer aller Art. Die Bauern aus der Gegend um den Dinkelwald schätzen die Anzahl der Eindringlinge auf etwa ein halbes Hundert. Die meisten sind unberitten und nicht sehr gut bewaffnet. Darum sollte es uns...«
»Euer Auftrag lautet«, warf Oberst Hirschingen ein, »die Anführer der Rebellen festzunehmen und nach Ferdok zu schaffen, damit ihnen später hier oder in Gareth der Prozeß gemacht werden kann. Auch von dem bewaffneten Volk sind so viele wie möglich gefangenzunehmen: Die fürstlichen Minen können jederzeit kräftige Hände gebrauchen.
Seht also zu, daß ihr recht viele zu fassen bekommt! Aber, daß wir uns recht verstehen: Das Leben einer Lanzerin ist mir stets wichtiger als eine Schurkenhaut, Geht also keine unnötigen Risiken ein! Wer von der Bande sich widersetzt, wird ohne viel Federlesens niedergemacht.« Mit einem Kopfnicken gab die grauhaarige Obristin das Wort an Leutenant Singer zurück, und die blonde Offizierin fuhr fort: »Abrücken in einer Viertelstunde. Der Einsatz sollte nicht länger als zwei, höchstens drei Tage dauern. Wir werden das Banner aufteilen. Zwanzig Reiterinnen werden mit mir kommen und im weiten Bogen südöstlich am Fluß entlang vorrücken. Weibel Dergelstein, zehn Lanzerinnen und der Troß reiten direkt nach Südwesten zum Dinkelwald, erkunden dort die Lage und erwarten uns oder weitere Befehle in dem Dorf Ziegenhain. Beide Gruppen sollten Ziegenhain spätestens um die vierte Stunde heute nachmittag erreicht haben. Für den Fall, daß eine Gruppe ausbleibt, gelten die üblichen Befehle betreffs Botenreiter und Codierungen. Die Parole für heute heißt: ›Rabenbrut‹. Noch Fragen?«
Die Gardistinnen blieben stumm.
»Also dann... Rondra sei bei euch!«
»In Zweierreihe! Beequem!« kommandierte Weibel Dergelstein. Selissa trieb ihre Fuchsstute Phexkind auf der baumgesäumten Allee nach vorn, um zur Gardistin Zelda aufzuschließen, wandte sich dann im Sattel um und schaute noch einmal auf das Tor, die Mauern und die spitzen schieferschwarzen Dächer Ferdoks zurück. In der hellen Morgensonne glänzten die noch immer regennassen Mauersteine und Schieferplatten wie frisch poliert. Die Stadt am Großen Fluß sah aus wie ein eben der Schachtel entnommenes und sorgfältig aufgebautes Spielzeugdorf. Wie aus Rindenstückchen geschnitzt erschienen auch die winzigkleinen Schiffe im Hafen jenseits der Stadt. Selissa ließ den Blick über die Dächer wandern, bis sie den Giebel des Praiostempels, die Kuppel des Rondratempels und das hohe rote Ziegeldach der Gardekaserne identifiziert hatte. »Schön«, murmelte sie. Dann hob sie die Hand an den Helm, schirmte die Augen ab, sah kurz hinüber nach Osten, wo die Sonne gleißendhell über der weiten Ebene stand, und richtete schließlich den Blick nach Westen zu den blauen Fernen der Koschberge. Die zerklüfteten kahlen Gipfel jenseits des Flusses und die dunklen Waldsäume auf den Hängen waren an diesem Morgen erstaunlich klar zu sehen und schienen zum Greifen nahe. »Es wird heute wohl wieder Regen geben... hm... Zelda?«
Die blonde Zelda war eben damit beschäftigt, ihren Helmriemen um den Sattelknauf zu wickeln. Dabei hatte sie den Arm durch die Handschlaufe der Lanze geschoben, um die Hände frei zu haben, aber der Lanzenstiel war aus der Halterung am rechten Steigbügel gerutscht, und nun hatte die Gardistin arge Probleme, Helm, Lanze und Zügel im Griff zu behalten, während gleichzeitig der Wind in ihren Haaren zauste. Sie stieß nur ein mißmutiges Knurren aus.
»Oh, die Gardistin Gutnot ist schlechter Dinge«, stellte Selissa sarkastisch fest und beschieß, einstweilen auf eine Plauderei zu verzichten und lieber noch ein wenig ins Land zu schauen.
Im Vorüberreiten riß sie eine dicke gelbe Birne von einem Alleebaum, eine ›Fürsten‹Birne. »Alles Obst, das an den Bäumen wächst, welche im Kosch die Straßen säumen, ist dem Fürsten von Kosch zu eigen, aber Bürger und Bauern dürfen von diesem Obst nehmen, sofern sie hungrig sind«, murmelte Selissa leise in sich hinein. Die Birne war außerordentlich süß und so saftig, daß Selissa sich beim Abbeißen seitlich aus dem Sattel beugen mußte, um zu verhindern, daß ihr der Saft auf Rock und Küraß tropfte. Solche Birnen erntet nur der Reiter, dachte sie zufrieden. Alle Früchte, die in Armesreichweite der Fußgänger gehangen hatten, waren längst abgepflückt worden, noch bevor sie richtig reifen konnten. Nachdem Selissa die Birne verspeist hatte, pflückte sie eine zweite, ein weniger prächtiges Exemplar. Ich habe einen Hunger wie ein Wolf, stellte sie bei sich fest. Kein Wunder eigentlich, hat es doch mein Gastgeber versäumt, mich zu einem anständigen Frühstück einzuladen. Kopfschüttelnd besann sie sich auf das Erwachen in der frühen Morgenstunde, auf den Schreck, als sie entdeckt hatte, daß sie auf einem Strohhaufen in einer finsteren Scheune lag; auf die bleierne, schmerzhafte Dumpfheit in ihrem Kopf, die einfach nicht weichen wollte, so oft sie auch den Kopf hin und her warf, die Lider aufriß und zusammenkniff. Erst als der alte Gaukler ihr die Hand auf die Stirn gelegt und ihr geraten hatte, an etwas Schönes, Kühles zu denken, an eine taufrische Wiese zum Beispiel, war es ihr etwas besser gegangen. Gerion Eboreus Eberhelm Rottnagel – welch ein Name! Und wie hatte er Fiona genannt: Cella unter den Reiterinnen. Selissa blickte nach vorn auf den breiten Rücken der Weibelin und grinste. Welch ein seltsamer Tag das gestern gewesen war: die Rauferei in der Goldenen Lanze, die Fahrt durch die Stadt mit einem Handkarren, auf dem ein scheintoter Gaukler auf Stroh gebettet lag, und dann dieser merkwürdige Abend im Bardenkrug... Wie haltlos sie geschwatzt hatte! So viele Dinge hatte sie noch nie einem Fremden über sich erzählt. Aber es hatte Spaß gemacht, Gerions Aufmerksamkeit zu genießen und sich von seinem freundlichen, klugen Spott necken zu lassen. Ein kauziger Bursche, aber ein Ehrenmann. Was hätte er alles mit mir anstellen können, in dieser Nacht... Ich hätte mich wohl kaum wehren können.
Sie zog ärgerlich die Brauen zusammen. Ihr war in den Sinn gekommen, wie aufgeregt sie nach dem Ring getastet hatte, als ihr kurz nach dem Erwachen die alberne Wette wieder eingefallen war. »Er ist noch da. Was denkt Ihr von mir?« hatte Gerion gefragt. »Glaubt Ihr, ich vergehe mich an Betrunkenen? Vermutlich seid Ihr der Meinung, nur Leute, die einen Helm tragen, besäßen ein Ehrgefühl, hm?«
Auf diese Worte hatte Selissa in ihrem berauschten Kopf keine Antwort gefunden. Röte stieg ihr in die Wangen, während sie daran dachte,wie sie stumm in die Stiefel geschlüpft war und ohne Gruß das Weite gesucht hatte wie eine alberne Küchenmagd!
›Gewiß billige ich Euch eine Ehre zu‹, hätte sie sagen sollen. ›Nur wer das vermag, darf sich selbst ehrenhaft nennen, alter Fahrensmann. Und was die Wette betrifft: Meinen Rausch hättet Ihr ruhig nutzen können. Man muß des Gegners Schwächen zu gebrauchen wissen. Aber nun ist es zu spät, und eine zweite Gelegenheit werdet Ihr nicht bekommen! So lebt denn wohl, werter Herr!‹ Ja, das wären die richtigen Worte gewesen...
Nun denn, das war‘s gewesen: Und so hatte sie eben nichts gesagt...! Geschehen war geschehen. Und, bei Rondra, was scherte es sie, was dieser abgerissene alte Herumtreiber von ihr dachte, ein Zechpreller und Leutbetrüger! Und wenn er sich in dieser Nacht nicht über sie hergemacht hatte, dann wahrscheinlich nur deswegen, weil er sowieso schon viel zu alt für solche Dinge war! Selissa warf den Birnenstrunk so heftig auf das Pflaster, daß er zerspritzte.
Die Gardistin nestelte den Helmriemen auf und plazierte die schwere Messinghaube zwischen ihren Schenkeln auf dem Sattelknauf. Die Sonne war weiter am Firmament hinaufgestiegen und brannte jetzt warm auf die nackten Schultern und Beine der Gardistin. Heller Schaum stand auf Kruppe und Flanken der Stute. Von Regenwolken war weit und breit nichts zu sehen. Ein Traviatag war angebrochen, wie er freundlicher kaum sein konnte. Der Reiterzug hatte inzwischen die gepflasterte Allee verlassen und trottete nun, sich stets südwestlich haltend, über eine schnurgerade sandige Landstraße einer bewaldeten fernen Hügelgruppe entgegen. Wenn Selissa zurückschaute, erkannte sie weit hinter sich und etliche Schritt tiefer im Flußtal die Wagen, Reit und Tragtiere des kleinen Trosses. Fiona hatte ein paarmal traben lassen, darum waren die Waffendiener inzwischen mehr als zwei Meilen zurückgeblieben.
Selissa grüßte lächelnd zu einem Bauern hinab, der seinen Ochsenkarren von der Straße gelenkt hatte, um die Gardistinnen passieren zu lassen, und nun mit gezogenem Strohhut neben seinem langhornigen braunen Ochsen stand.
Tsaiane von Weidenbruch lenkte ihren grauen Wallach an Selissas Seite und deutete zur Sonnenscheibe hinauf. »Meister Praios meint es heute gut mit uns. Man fühlt sich, als sollte man bei lebendigem Leib gekocht werden. Ich schwitze an Stellen, die ein anständiges Mädel gar nicht beim Namen nennen darf...« Kein Lächeln begleitete ihren Scherz.
Selissa sah sie aufmerksam von der Seite an. »Was ist los, Schwesterherz? Du blickst recht finster aus der Wäsche. Der Tag ist doch prächtig, oder nicht? Und das bißchen Hitze soll doch eine Ferdoker Lanzerin nicht verdrießen.« Sie boxte Tsaiane sanft gegen die Schulter. »Würde ich dich nicht besser kennen, fürwahr, ich könnte denken, du machtest dir Sorgen über unseren Ritt. Diese paar answinistischen Strolche werden wir jagen wie die Hasen, bei Rondra, du wirst schon sehen!«
Noch immer blieb Selissas Freundin ernst. Sie schaute gedankenverloren über das Land. »Wie jung und ahnungslos du bist! Und wie fest du auf die Göttin vertraust! Kommt dir denn nie der Gedanke, die Herrin könnte einmal anderswo beschäftigt sein, wenn du sie gerade brauchst...?« Tsaiane straffte sich und schüttelte den Kopf. »Ach, ach, was tue ich hier? Liege dir mit meinen düsteren Stimmungen in den Ohren. Solches Geschwätz hört niemand gern. Es ist ja nur...« Nun knuffte sie ihrerseits Selissas runde Schulter. »Schwesterchen, bitte, hab acht auf dich! Das alles hier, es würde mir nicht mehr halb so viel bedeuten, wenn du nicht mehr dabei wärst. Ich will nur...« Tsaiane brach ab und schaute nach vorn.
An der Spitze des Zuges reckte Fiona die rechte Faust in die Luft und schwenkte sie in einem engen Kreis: das Zeichen zum Sammeln. Selissa tippte ihrer Füchsin mit den Fersen in die Flanken, und Phexkind schoß nach vorn, als hätte man sie eben aus dem Stall geführt. Die endlosen Meilen auf den Straßen schien sie gar nicht bemerkt zu haben. Selissa mußte ihr recht brutal den Kopf zur Seite reißen, um sie rechtzeitig vor dem Pferd der Weibelin zum Stehen zu bringen.
Nachdem die Gardistinnen sich in einem losen Halbkreis um Fiona versammelt hatten, wies die Weibelin nach vorn auf die dunklen Hügel. »Seht ihr diese auffällige Doppelkuppe in Südsüdost, die so aussieht wie ein Paar Arschbacken?«
Die Lanzerinnen lachten und nickten.
»Einen Daumensprung links davon eine kahle Stelle, eine Rodung – erkannt?«
»Jawohl.«
»Das ist dieses götterverlassene Ziegenhain. In zwei Stunden sollten wir dort sein; wir sind also mehr als pünktlich. Darum sitzt ab und vertretet euch ein wenig die Beine.«
»Weibel, da ist eine Rauchfahne zu sehen, ein Stück rechts und etwas näher zu uns als Ziegenhain.«
Die Nivesin Juahan hatte die besten Augen im ganzen Banner – da konnte es keinen Zweifel geben.
»Ja, nun sehe ich es auch«, bestätigte Fiona. »Ein Herdfeuer, möglicherweise.«
»Für ein Herdfeuer ist der Rauch sehr dunkel«, gab Juahan zu bedenken. »Auch ist er erst seit kurzem in der Luft, und welcher Bauer zündet erst nach der Mittagsstunde sein Kochfeuer an?«
Weibel Dergelstein blickte auf den fernen Rauch, dann auf ihre Reiterinnen und biß sich auf die Unterlippe. Dann richtete sie sich im Sattel auf. »Helm auf! Iiin Zweierreihe! Mir nach! Teerab!«
Die Gardistinnen banden die Kinnriemen fest, lenkten die Pferde von der Straße auf die herbstlich kahlen Felder und trabten dem fernen Waldrand entgegen.
Kurz bevor die Gruppe die ersten Bäume erreichte, gab Fiona das Zeichen zum Halten. Die Rauchfahne war dicker geworden. Eindeutig stammte sie von einem größeren Feuer, das höchstens noch eine knappe Meile entfernt war. Ein Karrenweg führte in den Wald hinein und wies unmittelbar in die Richtung, aus der der wehende Rauch aufstieg. »Keine Zeit mehr für lange Erkundigungen«, sagte die Weibelin mehr zu sich selbst als zu den Reiterinnen. Dann hob sie die Stimme: »Tsaiane, Selissa, zu mir! Die anderen folgen! Lanzen frei! Gaalopp!«