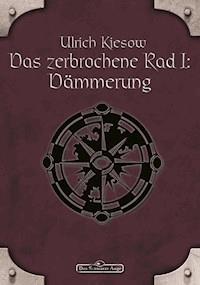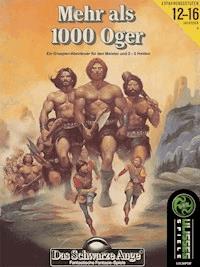Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ulisses Medien und Spiel Distribution GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Schwarze Auge
- Sprache: Deutsch
"Yppolita wird mich hassen, solange sie lebt. Das weiß ich ganz genau. Sie wird unentwegt auf Rache sinnen und eines Tages wiederkehren, um den Thron zurückzuerobern. Es wird einen Krieg geben, der viele unserer Besten das Leben kosten wird. Das darf nicht geschehen. Darum, Hana, wirst Du meine Schwester in die Trollzacken führen und sie dort erschlagen und vergraben." Hana hob die Hand zum Gruß und verließ den Raum. Es stand ihr nicht an, ihrer Königin zu widersprechen ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titel
Ulrich Kiesow
Die Gabe der Amazonen
Achtzehnter Roman in der Welt von Das Schwarze Auge©
Originalausgabe
Impressum
Ulisses SpieleBand 18
Kartenentwurf: Ralf HlawatschE-Book-Gestaltung: Michael Mingers
Copyright ©2012 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems. DAS SCHWARZE AUGE, AVENTURIEN, DERE, MYRANOR, RIESLAND, THARUN und UTHURIA sind eingetragene Marken der Significant GbR.Alle Rechte von Ulisses Spiele GmbH vorbehalten.
Titel und Inhalte dieses Werkes sind urheberrechtlich geschützt. Der Nachdruck, auch auszugsweise, die Bearbeitung, Verarbeitung, Verbreitung und Vervielfältigung des Werkes in jedweder Form, insbesondere die Vervielfältigung auf photomechanischem, elektronischem oder ähnlichem Weg, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Ulisses Spiele GmbH, Waldems, gestattet.
Print-ISBN: 3-453-10971-6 (vergriffen)E-Book-ISBN: 978-3-86889-634-3
1. Kapitel
Unsere Königin Gilia starb vor drei Jahren. Bis zu ihrem Tod reiste sie jährlich ins hunderttürmige Gareth, zum großen Turnier, um dem Kaiser ihre Aufwartung zu machen, um hin und wieder an einem Wettstreit der Waffen teilzunehmen und wohl auch, um sich am Anblick der besten Kriegsleute aus aller Welt zu erfreuen.
In all den Jahren ging sie zweimal des Nachts in das Zelt eines Ritters. Beim ersten Mal – das ist nun einundzwanzig Jahre her – legte sie sich zu Halman ui Bennain, dem Fürsten von Albernia, und zwei Jahre darauf besuchte sie einen Kämpfer namens Rhoaril, der, wie man sagt, aus Al‘Anfa stammte.
Königin Gilia gebar drei Kinder: Yppolita und ihren Zwillingsbruder, der – wie es unser Brauch befiehlt – gleich nach der Geburt getötet wurde, und Ulissa.
Yppolita, Fürst Bennains Tochter, ist die ältere, Ulissa, Rhoarils Tochter, die jüngere der beiden Schwestern.
Auszug aus der Kurkuma,
einer Amazonenchronik
Unser ganzes Dorf und viele Sippen aus dem Blautann und von jenseits des Flusses waren gekommen, das Sommerendfest zu feiern. Hand in Hand traten Männer und Frauen hinaus auf die Lichtung, wo das große Feuer loderte. Sie trugen ihre golden und silbern schimmernden Feiergewänder; ihre Lider waren gesenkt, niemand sprach ein Wort.
Der Große Zoriel hatte sich auf einem Stein am Feuer niedergelassen und rückte eben seine Leier auf den Knien zurecht. Er hob den gekrümmten Daumen, schaute einmal in die Runde und schlug die Saiten an: Zarte Töne schwebten durch die Luft, fügten sich zu einer wehmütigen Melodie. Ich schloß die Augen, um dem Spiel zu lauschen, doch da klopfte mir plötzlich das Herz bis zum Hals: Konnte es denn wahr sein
– der Große Zoriel würde tatsächlich mein Lied singen, das Herbstlied, vor allen Männern und Frauen! Zoriels Daumen strich über die Saiten, ich hielt den Atem an. Und Zoriel sang:
Weißer Nebel atmet schweigend über Baum und Wiese hin ...
Plötzlich kam eine seltsame Unruhe auf. Irgendwo krachte und polterte es. Das Feuer selbst und der lichte Glanz auf den Gewändern schienen zu verblassen. Doch Zoriel setzte von neuem an:
Weißer Nebel atmet schweigend über Baum und Wiese hin. Sommertag so matt sich neigend komm herbei nun, dunkler ...
Ein dicker Stein fiel aus dem Himmel herab und zerschmetterte Zoriels Leier mit dumpfem Schlag. Jähes Schweigen.
Und wieder klatschte etwas schwer ins Gras.
Mehr Steine kamen geflogen. Wir wurden beschossen!
Ich rollte über den Boden – etwas klammerte sich an meinen Beinen fest. Ich trat zu, strampelte und riß gleichzeitig den Dolch aus dem Gürtel.
»Oh, Ingerimms Zorn soll euch auf dem Abtritt treffen!« knurrte jetzt eine heisere Stimme in nächster Nähe, und platsch! schlug wiederum eines dieser Geschosse ein.
»Wenn ich die Strolche erwische, ich werde sie würgen, bis ihnen die Augäpfel aus dem Schädel kullern!«
Endlich hatte ich mich aus dem wohligen Gespinst meines Traums befreit, die Wirklichkeit hatte mich wieder. Ach, am liebsten hätte ich sofort zurückgeträumt zum großen Sommerendfest; denn was hatte diese Wirklichkeit schon zu bieten? Über mir ein schwarzes, kahles Astgewirr vor einem blaßgrauen schweren Himmel. An meiner Seite die nasse Asche eines kümmerlichen Feuers und jenseits der Feuerstelle: Larix, der Sohn des Juglans, bei einem Wutausbruch. Der breitschultrige Zwerg schmetterte gerade wieder einmal seinen Hörnerhelm ins Gras. Klatsch! Gleichzeitig mißbrauchte er Ingerimms göttlichen Namen in endlosen Verwünschungen.
»Gestohlen! Kein Zweifel! Kaladon, das Schwert meiner Väter! O Ingerimm, laß ihren Kot zu Stein erstarren, noch bevor er aus dem Körper tritt!«
Ich setzte mich auf. Meine Beine hatten sich in den Decken verwickelt. Während ich das schwere, klamme Tuch abstreifte, versuchte ich, Larix zu besänftigen: »Nimm‘s nicht so schwer, Alter! Sieh mal, dein Schwert ...«
»... war doch eigentlich eher ein überlanger Dolch.« Viburn kam um die Feuerstelle herum und mischte sich in unser Gespräch.
Ich zog unwillkürlich den Kopf ein, denn ich ahnte, was nun kam. Es gab Zeiten, da man mit dem Sohn des Juglans prächtig scherzen konnte, und es gab Momente, wo man besser die Zunge hütete. In Augenblicken, da Larix seinen beuligen Helm auf den Boden drosch, schwieg man lieber still ...
Der Zwerg aber schien Viburn gar nicht zu beachten. Er bückte sich über seinen Rucksack und kramte in seinen Sachen, dabei summte er leise vor sich hin. Plötzlich schleuderte er ohne aufzublicken Viburn die leere Feldflasche an den Kopf. Der Havener riß gedankenschnell die Hände hoch und fing die Flasche in der Luft, knapp vor seinem Gesicht – aber er hätte besser nach unten geschaut. Denn nun war der Zwerg herangesprungen und säbelte ihm mit einem mächtigen Tritt die Beine weg. Viburn war kaum auf den Boden geprallt, da kniete der Zwerg schon auf seiner Brust.
Die Linke hatte er in Viburns dunkelblonde Locken gekrallt, die Rechte umklammerte einen Hammer, zum Schlag erhoben. Larix‘ Gesicht war dunkelrot angelaufen, die schwarzen Brauen sträubten sich wie erschreckte Kiefernspanner, die kleinen blauen Augen funkelten aus schmalen Schlitzen. »Nun wiederhol es, Streuner, was ist mit meinem Schwert?«
Viburn versuchte es mit einem Lächeln, entschied sich aber schnell um und setzte eine jämmerliche Miene auf. »Meine Rippen!« keuchte er. »Larix, Sohn des Juglans, du drückst mir den Brustkorb ein!«
»Was hast du über Kaladon gesagt?«
»Über wen?«
»Kaladon, das Schwert meiner Väter. Du hast es beleidigt!«
Viburn stieß ein gepreßtes Lachen aus. »Wie kann man ein Schwert beleidigen?« japste er.
Dem Burschen war nicht mehr zu helfen.
Larix hob den Fausthammer noch ein Stück höher. Wahrscheinlich hätte er Viburn tatsächlich erschlagen, wenn Junivera nicht eingeschritten wäre. Junivera und Elgor hatten den Streit von ihren Schlafplätzen aus beobachtet.
»Larix, was ist geschehen?« fragte Junivera.
»Der Streuner hat mich beleidigt!«
»Das meine ich nicht. Ich rede von deinem Geschrei zuvor und deinen lästerlichen Flüchen. Wer hat etwas gestohlen?«
Larix ließ den Hammer sinken und schüttelte den Kopf. »Das hätte ich fast vergessen«, murmelte er. »Mein Schwert. Die Schurken haben Kaladon gestohlen.« Er gab Viburn frei, und der Havener sprang auf.
»Ich werde mal schauen, ob ich eine Spur entdekke!« rief er und war schon im Gebüsch verschwunden.
Elgor von Bethana legte sein Kettenhemd an, während Junivera den mit Löwinnen bestickten Schal der Rondrageweihten um ihre Schultern drapierte.
»Sicher waren es dieselben Strolche wie letzte Nacht«, sagte ich. »Gestern Juniveras Reisemantel und mein Bogen und nun Larix‘ Schwert. Sie scheinen uns gefolgt zu sein.«
»Ich hatte die vorletzte Wache«, brummelte Larix halb zu sich selbst. »Da war Kaladon noch da. Wer hatte die letzte Wache?«
Ich biß mir auf die Lippen, aber Junivera sprach den Namen aus: »Viburn.«
Larix schaute sich nach allen Seiten um, aber der Havener war nirgendwo zu sehen.
Der Krieger Elgor hakte die Schnalle des Schwertgürtels ein, dann gesellte er sich zu uns. »Wenn ihr nicht so langsam marschiert wäret, hätten die Diebe uns nicht folgen können«, sagte er.
Immer wenn die Rede auf unser langsames Marschtempo kam, fühlte Larix sich angesprochen. »Wenn du uns nicht geraten hättest, die Straße zu verlassen und quer durch den Wald zu trotten, wären wir längst am Ziel«, entgegnete er.
Elgor öffnete den Mund, aber Junivera schnitt ihm das Wort ab: »Diese ewigen Streitereien bringen uns nicht weiter. Entweder brechen wir jetzt auf, oder wir bleiben und suchen nach den Dieben. Für eure Maulfechtereien ist unsere Zeit zu schade.«
Weder Elgor noch Larix hielten dem ernsten Blick aus Juniveras braunen Augen stand. Der Zwerg begann leise fluchend seinen Packsack einzuräumen. »Es kann Tage dauern, bis wir die Diebe finden«, murmelte er. »Ich bin dafür, daß wir weiterziehen.«
Ich stimmte ihm zu und sprang auf. »Ich werde Viburn zurückholen.«
Inzwischen war es hell geworden, und so dauerte es nicht lange, bis ich ihn gefunden hatte. Viburn kniete an einem Bachlauf auf dem Boden und untersuchte einen Fußabdruck. Der Streuner hatte den Hut abgenommen, die langen Locken zurückgeworfen und hielt die kantige, leicht gebogene Nase dicht über dem Boden. In der Nacht war ein wenig Schnee gefallen. Seit dem Morgengrauen regnete es zwar, aber auf den dickeren Ästen, den ledrigen Blättern der Stechpalmen und auf einigen Stellen am Boden war der Schnee noch nicht geschmolzen. Mitten in einem solchen Schneefleck war ein deutlicher Fußabdruck erkennbar. Offenbar handelte es sich um einen schmalen, nicht sehr großen Menschenfuß. Die Zehen wiesen zum Bach.
»Schau dir das an«, sagte Viburn, »diese armseligen Strolche stapfen barfuß durch den Schnee.«
»Wohin führt die Spur?« fragte ich.
»Keine Ahnung. Das ist der einzige brauchbare Abdruck, den ich gefunden habe.« Viburn schüttelte sich. »Denk dir, Arve, die sind an dieser Stelle in den Bach gestiegen und dann im Wasser weitergegangen
– eine scheußliche Vorstellung, nicht wahr?« »Wie kommst du eigentlich darauf, daß es mehrere Diebe sind?«
Viburn stand auf und klopfte sich feuchten Schmutz von den Knien. »Stimmt, dafür gibt es keinen Beweis. Ich bin einfach davon ausgegangen, daß niemand es wagen würde, unsere furchterregende Truppe ganz allein zu überfallen. Vielleicht haben wir es tatsächlich mit einem Einzelgänger zu tun.«
Wir gingen noch ein Stück am Bach entlang, konnten die Fußspur aber nicht wiederfinden. Schließlich kehrten wir zum Lager zurück. Schon von weitem schallte uns ein vertrauter Wortwechsel entgegen.
»Ich steige nicht auf diese Mißgeburt – ein für allemal!«
»Aber Larix, sei doch vernünftig. Hier im Wald kommst du auf deinen ... äh ... kommst du einfach nicht schnell genug voran.«
»Sprich dich ruhig aus, Elgor von Bethana! Auf deinen kurzen Beinen, wolltest du sagen. Ein Packesel ist ein Packesel, mein Lieber! Du wirst es nicht erleben, mich auf diesem Grautier zu sehen! Ich bin doch kein Proviantsack!«
»Was hättest du denn gern, ein Vollblutshadif oder ein Kampfkamel?«
»Ihr beide seid unerträglich«, fuhr Juniveras dunkle Stimme dazwischen. »Dann geht Larix eben zu Fuß, aber wenigstens könntet ihr schon einmal das Gepäck auf den Esel schnallen. Ich frage mich, wo Viburn und Arve bleiben.«
Wenig später waren wir unterwegs. Wie gewöhnlich ging ich an der Spitze. Da ein gehöriger Schuß Elfenblut in meinen Adern fließt, fiel mir die Rolle des Pfadfinders zu, seit wir kurz hinter Rommilys die Straße verlassen hatten. Mir wäre es allerdings nicht im Traum eingefallen, so kurz nach dem Beginn unserer Reise schon einen Schleichpfad durch den Wald zu suchen. Im Spätherbst ist der Wald dunkel, feucht und kalt. Die Wölfe sind hungrig, und auf eine warme Herberge darf man nicht hoffen. Wir hätten auf der Straße bleiben sollen, die sich eine Tagesreise nördlich von uns durch das breite Tal zwischen Trollzacken und Schwarzer Sichel wand. Später, kurz vor Beilunk, hätten wir immer noch untertauchen und unsere Spuren verwischen können. Aber Elgor bestand auf äußerste Heimlichkeit. Außerdem hatte er eine alte Karte aufgetrieben, die einen vergessenen Pfad längs der Nordflanke der Trollzacken zeigte. Was konnte einfacher sein, als diesem Pfad zu folgen
– noch dazu für einen Halbelf?
Es hat keinen Sinn, einem Edelmann und Mitglied des Kriegerstandes zu widersprechen. Krieger sind die geborenen Anführer; damit muß man leben.
Natürlich war der Pfad seit Jahrzehnten zugewachsen. Schon nach wenigen Stunden hatten wir ihn verloren – falls es ihn jemals gegeben hatte. Ich versuchte, nordöstliche Richtung zu halten, und führte die Gruppe ständig bergauf. Auf diese Weise mußten wir irgendwann auf die andere Seite der Trollzacken gelangen, so hoffte ich jedenfalls. Auf hinderliches Gestrüpp konnte ich bei meiner Pfadfinderei keine Rücksicht nehmen, ich suchte immer den kürzesten Weg. Und deshalb kamen wir nicht eben schnell voran. Seit Stunden mühten wir uns nun durch einen dichten Lärchenwald. Ich wußte nicht mehr, wie viele schwarze, kratzige, seltsam knorplige Lärchenzweige ich schon zur Seite gebogen hatte. Die Arme wurden mir schwer. Der Boden war mit einer dichten gelben Schicht abgefallener Nadeln bedeckt, wenigstens unsere Füße schritten bequem auf einem weichen Polster dahin. Hinter mir ging Elgor. Bei jedem Schritt prallte seine Schwertscheide klappernd gegen sein Kettenhemd. Ihm folgte der ewig brummelnde Larix. (»Ich gehe vielleicht nicht sehr schnell, aber wenigstens leise. Manche Leute scheppern durch den Wald wie der Karren eines Kesselflickers.«)
Junivera hatte es übernommen, unseren Packesel zu führen. Sie war die einzige, der das seltsame Tier willig folgte. Am Schluß, immer ein wenig zurückhängend, ging Viburn, der Streuner aus Havenas dunklen Straßen.
Viburn hatte ein einfaches Motto: ›Ich bin mein einziger Freund, denn ich bin der einzige Mensch, auf den ich mich wirklich verlassen kann.‹ Trotzdem würde ich Viburn als meinen Freund bezeichnen. Ich kenne ihn von Kindesbeinen an. Als Halbelf ist man nichts Rechtes, weder Mensch noch Elf, und findet nur schwer einen Freund ... Ich habe Viburn schon früher oft aus den Augen verloren, doch immer, wenn ich ihm wieder begegnet bin, war nichts Fremdes zwischen uns getreten. Wir konnten uns an einen Tisch setzen und ein Gespräch fortsetzen, das wir vor Jahren unterbrochen hatten, weil Viburn damals wieder einmal ›ganz dringend frische Luft schnappen‹ mußte.
Ihm hatte ich es zu verdanken, daß mir jetzt die Lärchenzweige das Gesicht zerkratzten. Als ich ihn in einer Schenke in Havena traf, hatte er nämlich gerade ›eine tolle Sache aufgetan‹. Wie gewöhnlich war Viburn auf ungewöhnliche Weise an die tolle Sache geraten:
Fürst Halman ui Bennain von Albernia besuchte gern verkleidet die übelsten Kaschemmen seiner Residenzstadt Havena. Er liebte diesen Hauch von Abenteuer und auch die Frauen der Nacht, die sich so sehr von seiner eigenen und den Hofdamen unterschieden. Halmans heimliche Ausflüge waren natürlich in der Unterwelt bekannt, und die Wirte sorgten dafür, daß der Fürst an kernigen Raufereien teilnehmen und geheimnisvollen Frauen begegnen konnte. Mein Freund Viburn nun wollte dem Fürsten zu einem Abenteuer eigener Art verhelfen: einem echten Raubüberfall. Der Plan konnte gar nicht schiefgehen. Zuerst kippte Viburn den beiden Leibwächtern des Fürsten, die Halman – ebenfalls verkleidet – auf allen Ausflügen begleiteten, ein Schlafpulver ins Bier.
Dann brauchte er nur noch abzuwarten, bis sich der Fürst in den frühen Morgenstunden – und notgedrungen ohne Geleit – auf den Heimweg machte. In einer dunklen Gasse sprang Viburn aus dem Schatten, hielt dem schwankenden Fürsten einen Dolch an die Kehle und sprach das klassische »Geld oder Leben!« Fürst Bennain prallte erschrocken zurück, tastete mit der Linken verzagt nach seinem Beutel, packte aber plötzlich mit der Rechten Viburns Hand, preßte sie erbarmungslos zusammen und erwiderte »Weder – noch!«
Fürst Bennain kommt durch keine Tür, ohne sich zu bücken, ist fast so schwer wie ein Pferd und so kräftig wie ein Stier. Das sind die wesentlichen Voraussetzungen, die Viburn bei seinem Plan nicht berücksichtigt hatte.
Tags darauf wurde Viburn aus dem Kerker und vor den Fürsten gezerrt. Der Hauklotz war aufgestellt, ein vermummter Mann mit einer Axt stand bereit. Auch wenn Viburn wußte, daß man es nach albernischem Recht nicht auf seinen Kopf, sondern nur auf seine rechte Hand abgesehen hatte, verspürte er doch ein flaues Gefühl im Magen.
Fürst Bennain stand, flankiert von mehreren Höflingen, vor dem Klotz und blickte Viburn finster entgegen. Der Streuner wurde von drei Soldaten unerbittlich vorwärts geschoben. Da trat eine stattliche Frau hinaus auf den Burgplatz, auf dem die Bestrafung stattfinden sollte. Sie hob die Hand. »Halt, ich will vorher noch ein paar Worte mit dem Schurken reden.« Sie wandte sich Viburn zu. »Was hast du verbrochen?«
»Er hat mich überfallen, und dafür muß er jetzt bezahlen«, knurrte der Fürst. »Am besten gehst du wieder hinein, meine Liebe.«
Die Dame – offenbar die Fürstin selbst – ließ sich nicht abweisen. »Dich habe ich nicht gefragt, Halman, mein Lieber, ich will es von ihm hören.« Sie deutete auf Viburn. »Also sprich: Wie hat sich die Sache zugetragen? War mein Mann etwa allein? Wo bist du ihm begegnet, und wann ist das geschehen?«
Viburn setzte zu einer Antwort an, da erspähte er aus den Augenwinkeln ein seltsames Zucken im Gesicht des Fürsten. Er schaute genauer hin. Nein, es konnte keinen Zweifel geben: Fürst Bennain zwinkerte ihm zu.
»Willst du endlich reden? Darf es wahr sein? Jetzt feixt dieser Schurke sogar!« Die Fürstin rauschte heran, und Viburn brachte blitzschnell seine Gesichtszüge in Ordnung. Er fühlte sich seltsam beschwingt. Wenn er jetzt keinen Fehler machte, dann war er gerettet. Er räusperte sich. »Ich will Euch alles gestehen, edle Dame, und nichts verschweigen. Das schwöre ich bei allem, was mir heilig ist ...« Zeit gewinnen, dachte Viburn, Zeit gewinnen. »So also hat es sich zugetragen ...: Die Sonne war eben untergegangen, da sah ich den Fürsten vor dem Praiostempel – im Gespräch mit einigen Ratsherren. Zwei Wächter standen an seiner Seite, schwer bewaffnet!« Fürst Bennain nickte unmerklich, und Viburn fuhr fort: »Ich wartete, bis das Gespräch zu Ende war und der Fürst seine Schritte zum Palast lenkte. Es dauerte eine Weile, denn die Herren disputierten hitzig und verbissen. Endlich trennten sie sich. Der Fürst und die beiden Wachen schlugen den Weg zum Palast ein. Ich schlich ihnen nach. In einer dunklen Gasse beschloß ich zu handeln. Blitzschnell sprang ich vor, schlug den einen Wächter nieder, dann den andern, und schon wollte ich dem Fürsten – o Herr, vergebt mir! – das Messer an die Kehle setzen. Aber der Fürst packte mich – so« (Viburn umklammerte mit der Rechten seine Linke) »und wollte mir schier die Hand zerbrechen. Dann nahm er mich gefangen und schleppte mich in den Palast. Darum stehe ich nun hier und muß um Gnade flehen.«
»Genauso hat es sich zugetragen«, bestätigte der Fürst. Er lauschte einem Höfling, der ihm etwas ins Ohr flüsterte. »Oh, ich höre gerade, ich habe wichtige Geschäfte zu erledigen. Ich fürchte, wir müssen die Bestrafung verschieben.«
Er gab Viburn einen herzhaften Tritt ins Gesäß.
»Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, du Galgenstrick! Führt ihn hinweg und werft ihn in das finsterste Loch!«
Viburn wurde von den Soldaten fortgezerrt und hörte gerade noch, wie die Fürstin sagte: »Ein schlechter Mensch! Du solltest ihm beide Hände abhacken lassen, mein Lieber – und vielleicht den linken Fuß ...«
Später am Tage besuchte Fürst Halman ui Bennain den Streuner Viburn im Verlies, um ihm einen Handel vorzuschlagen. Der Fürst eröffnete das Gespräch: »Ich könnte dich totschlagen und heimlich wegschaffen lassen. Das weißt du.«
Viburn schüttelte die Locken aus dem Gesicht. »Aber das habt Ihr nicht wirklich vor, sonst sprächet Ihr zu mir nicht davon.«
Der Fürst lächelte. »Meine Frau hat recht, du bist ein schlechter Mensch – aber dein Kopf arbeitet schnell. Wenn ich dir deine rechte Hand und die Freiheit schenke, würdest du mir einen Gefallen tun?«
»Das kommt darauf an.«
Fürst Halman hob verwundert die Brauen. »Bursche, treib es nicht zu weit! Mir scheint, du vergißt deine Lage!«
»Nein, keineswegs«, versicherte Viburn rasch, »aber vielleicht bin ich besser bedient, wenn ich auf meine Hand und die Freiheit verzichte, als wenn ich Euch gefällig bin, hoher Herr. Bevor ich einschlage, möchte ich doch mehr über diese Gefälligkeit wissen, das müßt Ihr verstehen.«
Der Fürst zog einen Höcker heran und ließ sich nieder. »Jedermann glaubt, ich hätte zwei Kinder, den Prinzen Cuano und die Prinzessin Algei. Aber ich habe noch eine zweite Tochter. Sie heißt Yppolita und lebt in der Fremde. Es gibt nur wenige Menschen, die von Yppolita wissen – meine Frau gehört nicht dazu. Ich habe Yppolita noch nie gesehen; ihre Mutter wünschte es nicht. Vor drei Jahren starb die Mutter, und ich schickte meiner Tochter einen Brief. Ich erhielt bald eine Antwort und ließ einen zweiten Brief überbringen. Meine Tochter wollte mich gern kennenlernen, ich schickte einen dritten Brief, in dem ich ein Treffen vorschlug. Doch nun erhielt ich keine Antwort mehr. Ich suchte den Treffpunkt trotzdem auf – ich hatte das Turnier in Gareth vorgeschlagen –, aber meine Tochter erschien nicht. Seit zwei Jahren habe ich von Yppolita nichts mehr gehört. Ich fürchte fast, sie lebt nicht mehr. Aber ich möchte Gewißheit haben. Darum bat ich ein paar enge Vertraute, Nachforschungen für mich anzustellen. Die Gruppe will morgen aufbrechen, und ich bitte dich, sie zu begleiten. Alle drei sind nämlich zuverlässige Leute, in gewissen Dingen aber unerfahren. Sie haben eine weite Reise vor sich, und mir scheint, daß sie jemanden wie dich gebrauchen könnten – auch wenn sie das vielleicht nicht glauben.«
Viburn war überrascht. »Das scheint mir kein schwieriger Auftrag zu sein, mein Fürst. Welchen Haken hat er?«
Fürst Bennain runzelte die Stirn, fuhr aber mit ruhiger Stimme fort: »Ich würde es nicht Haken nennen, aber ich weiß, was du meinst. Meine Tochter ist eine Königin, die Königin der Amazonen.«
Viburn hätte fast einen Pfiff ausgestoßen, aber er beschränkte sich darauf die Lippen zu spitzen und bedächtig zu nicken. »Niemand weiß, wo der geheime Palast der Amazonen liegt«, sagte er. »Jeder Fremde, der ihn ungebeten betritt, ist verloren, und wer den Amazonen in die Hände fällt, der stirbt einen schweren Tod – so heißt es jedenfalls. Das darf man doch – in aller Bescheidenheit – als Haken bezeichnen.«
Fürst Bennain unterdrückte ein Lächeln. »Hast du gedacht, ich schenke dir die Freiheit ohne Gegenleistung?« Er sprang auf und trat an das Gitterfenster in der Kerkertür. Die Hände hatte er auf den Rücken gelegt und schlug mit den Fingern der linken in die Handfläche der rechten. »Was ist nun mit unserem Handel?« fragte er nach einer Weile, »entscheide dich!«
Viburn dachte nach, zumindest tat er so. »Wer sagt Euch, daß ich mich nicht aus dem Staube mache, sobald Ihr meine Zelle öffnet?«
Du wirst mir dein Ehrenwort geben, wollte Fürst Bennain sagen, aber dann fiel ihm ein, daß er mit einem Streuner verhandelte. »Stimmt«, murmelte er, »aber wieso stellst gerade du mir diese Frage? Das verstehe ich nicht.«
Nun war es an Viburn ein Schmunzeln zu unterdrücken. Vorsichtshalber wandte er das Gesicht von seinem Gegenüber ab. »Weil ich Euch eine bessere Sicherheit vorschlagen kann als zum Beispiel ein Ehrenwort. Ihr zahlt mir meinen gesamten Lohn erst bei meiner Rückkehr aus.«
»Deinen Lohn?« Halman, Fürst von Albernia, riß die Augen auf.
»Stellt Euch vor, Ihr versprecht mir einen guten Lohn, wenn ich Eure Gruppe sicher zum Palast und wieder heim geleite, aber die Dukaten bekomme ich erst dann, wenn wir wieder in Havena eintreffen. Sagt selbst, wie könnt Ihr jemanden von meinem Schlage fester in die Hand bekommen?«
Der Fürst gab keine Antwort. Er hatte sich wieder auf den Hocker gesetzt und das Kinn in die Hand gestützt. Eine Zeitlang herrschte Schweigen in der Zelle, dann fragte er: »Wieviel verlangst du?«
»Hundert Dukaten.«
»Das ist viel Gold.«
»Je höher der Lohn, desto größer die Sicherheit.«
Ein paar Stunden später stellte Fürst Bennain dem Streuner die Gruppe vor, die er führen sollte: den Ritter Elgor von Bethana, einen rothaarigen, breitschultrigen Burschen von fünfundzwanzig Jahren, zweifachen Turniersieger von Gareth und Neffen des Fürsten (die roten Haare und die scharfgebogene Nase ließen aber darauf schließen, daß ein beträchtlicher Anteil thorwalischen Piratenbluts in Elgors Adern strömte), den Zwerg Larix, Sohn des Juglans (auch Larix war ein Edelmann und Elgors bester Freund; mit seinen sechzig Jahren konnte Larix als jugendlicher Zwerg gelten; er empfand sich als gleichaltrig mit Elgor und wich kaum einmal von seiner Seite; die beiden galten als unzertrennlich, auch wenn sie sich dauernd wegen irgendeiner Kleinigkeit in den Haaren lagen), und Junivera, die Rondrageweihte, Fürst Bennains Hofpriesterin. Junivera, eine schwarzhaarige, großgewachsene Frau, war der Meinung, daß niemand in Aventurien der Kriegsgöttin Rondra besser diente als die Amazonen. Sie hatte ihr Lebenlang davon geträumt, einmal den Palast der Amazonen zu betreten.
Viburn war von der Schar der ihm Anvertrauten wenig begeistert.
»Ein zänkischer Zwerg«, sagte er später zu mir, »ein blasierter Muskelprotz und ein kräftiger Backfisch mit einem religiösen Fimmel ... Lieber ginge ich allein!«
Wir saßen an einem Tisch im Goldenen Drachen, und Viburn versuchte, mich zum Mitkommen zu überreden. »Ich gebe dir die Hälfte meines Goldes«, sagte er zum Beispiel, »also zehn Dukaten!« Da ich Viburn kannte, ahnte ich, daß für ihn vermutlich das Zehnfache dabei heraussprang, aber weil Viburn mich nicht minder gut kannte, wußte er ebenfalls um meine stille Vermutung – dennoch hätte er in einer solchen Situation niemals mit offenen Karten gespielt, sein Ehrgefühl hätte es nicht zugelassen – Streuner sind eben seltsam in Fragen der Ehre.
»Was soll ich bei der Sache?« fragte ich. »Ihr seid ohnehin schon zu viert, dabei erledigt man so etwas besser allein.«
»So ist es«, stimmte Viburn zu. »Ich brauche dich, um die anderen drei im Zaum zu halten.«
»Und nicht etwa, weil du dich in jedem Wald jämmerlich verlaufen würdest?«
»Ach nein – du weißt, daß das nicht stimmt. Ich biete dir fünfzehn Dukaten – auch wenn für mich dann kaum etwas übrigbleibt.«
»Wie sollen wir den Palast jemals finden? Ich habe keine Ahnung, in welcher Richtung wir suchen müssen.«
»Fürst Bennains Botenreiterinnen kannten den Ort. Leider sind beide von ihrem letzten Ritt nicht zurückgekehrt. Aber bevor sie aufgebrochen waren, hatten sie Bennain immerhin berichtet, daß Kurkum am Fuß der Berge von Beilunk liegt.«
»Kurkum?«
»So nennen die Amazonen ihre Burg.«
»Die Berge von Beilunk sind groß. Auf der Nord-oder auf der Südseite?«
Viburn schlug mir auf die Schulter. »Aha, altes Langohr, du bist gewonnen! Siebzehn Dukaten, schlag ein!«
»Siebzig!«
Der Streuner sah mich entgeistert an. »Dir ist ein Borbaradmoskito ins Ohr geflogen! Warst schon immer ein Wirrkopf, aber allmählich muß ich mir Sorgen machen. Schade um deinen regen Verstand – zumindest um die Elfenhälfte, der menschliche Anteil war nie viel wert. Hast du überhaupt in deinem Leben als Kiefernzapfensammler jemals mehr als zehn Dukaten auf einem Haufen gesehen?«
»Siebzig.«
Viburn trank sein Bier aus und sprang auf. »Ins Ohr geflogen und von dort mitten ins Hirn. Es ist ein Jammer! Dreißig!«
»Fünfundsechzig.«
»Einunddreißig.«
Als wir uns schließlich einigten, waren wir schon ziemlich betrunken. Der Wirt fing eben an, die ersten Gäste zur Tür hinaus in die kalte, unfreundliche Nacht zu stoßen. Da Viburn und ich in einem stillen Winkel saßen, hätten wir uns noch eine Weile im Goldenen Drachen halten können, aber wir beschlossen, vernünftig zu sein, denn schließlich stand uns eine lange und schwere Reise bevor – und außerdem rückte der Wirt ohnehin kein Bier mehr heraus.
2. Kapitel
Die Mädchen hatten eine glückliche Kindheit. Fast täglich zogen sie hinaus auf die Jagd. Sie ritten auf den stolzesten Pferden, und Hana, unsere Schwertmeisterin, gab ihr ganzes Wissen an Ulissa und Yppolita weiter. Bald schwang Ulissa den schweren Reitersäbel schnell wie der Wind, und Yppolita konnte ein Schilfrohr mit einem Hieb der Länge nach spalten. Früh schon wurde Yppolita auch in Staatsgeschäften unterwiesen, da sie eines Tages den Thron der Mutter besteigen sollte.
Während des Vormittags ließ der Regen nach. Als die letzten Tropfen fielen, sprangen plötzlich Böen auf. Bald zerriß ein kräftiger Wind die bleierne Wolkendecke. Kalt pfiff er zwischen knarrenden Stämmen hindurch; hoch über unseren Köpfen stießen dürre Zweige klappernd aneinander.
Larix sog prüfend die würzige Luft ein. »Heute nacht gibt es den ersten Frost«, stellte er fest. »Es riecht nach Firuns Atem.«
Unser Weg führte uns durch einen kahlen Kalkbuchenwald. Die mächtigen, weißgefleckten Baumstämme standen in großen Abständen, und wir kamen gut voran. Zu unserer Rechten stiegen, von den Baumwipfeln halb verdeckt, die düsteren Gipfel der nördlichen Trollzacken auf, zur Linken öffnete sich vor unseren Blicken das weite Tal zwischen dem Massiv der Trollzacken und den südlichen Ausläufern der Schwarzen Sichel. Wir konnten viele Tages-reisen weit nach Norden sehen, sogar die Straße von Wehrheim nach Warunk war gut zu erkennen. Längs dieser Straße wirkten die einsamen Gehöfte der mutigen Einödbauern wie aufgereiht, winzige Häuschen mit erdig-braunen Strohdächern, die einem Beobachter niemals aufgefallen wären, hätte nicht jedes von ihnen inmitten einer kleinen Rodung gestanden.
Wie kleine Brandflecken im dicken braungrünen Wolltuch des Waldes markierten die Äcker der freien Bauern den gewundenen Verlauf der Straße. Und über allem lag ein Muster aus Schatten und gemächlich über die Landschaft treibenden Inseln aus Sonnenlicht. Hoch in der Luft zogen zwei riesige Bergadler ihre Bahn. Bisweilen wehten ihre langgezogenen, schrillen Schreie heran. Es lag eine seltsame Sehnsucht in diesen Rufen, gerade so, als ob die Könige der Lüfte der Welt von der grenzenlosen Einsamkeit der Erhabenen künden wollten. Manchmal hatte ich Mühe, schmerzvolle Tränen zu unterdrücken, wenn der Adlerruf an meine Ohren drang – undeutbare, namenlos drängende Wünsche stiegen dann in mir auf.
Unwillkürlich verhielt ich meinen Schritt, und El-gor von Bethana trat mir schmerzhaft in die Hacken. »Verdammt, Arve, kannst du nicht aufpassen«, schimpfte er, anstatt sich bei mir zu entschuldigen – so ist es eben Kriegerart.
Elgor machte es einem nicht leicht, ihn zu mögen. Wenn ich nur an den Abend in Rommilys denke: Viburn hatte einen betrunkenen Waldelf aufgetrieben und an unseren Tisch geschleppt, eine abstoßende, sabbernde Gestalt. Der Bursche hatte sich fast um den Verstand gesoffen – von der Würde seines Volkes war ihm nichts geblieben, aber er hatte schon einmal vor den Mauern von Kurkum gestanden und wußte erstaunliche Dinge vom Amazonenreich zu berichten. Unser ›Verhör‹ ließ sich prächtig an, schließlich waren Viburn und ich nicht unerfahren in solchen Dingen: eine Auskunft für einen Becher Rommilys-Bier (ein abscheuliches Gesöff, das aus vergorenem Gerstenbrot hergestellt wird).
Natürlich merkte der Waldelf nichts von unserer Verhörmethode. Für ihn war das Ganze eine lockere Plauderei, die von gelegentlichen Trinkpausen unterbrochen wurde, wenn er vom Thema abkam. Bald hatte er es gelernt, den Bierfluß gleichmäßig zu steuern.
So erfuhren wir, daß beim Tod der Amazonenkönigin Gilia nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein sollte. Angeblich hatten ihre machthungrigen Töchter, die nach Gilias Tod gemeinsam die Herrschaft über Kurkum antraten, eine Hand im Spiel. »Es sind-nd Hek-sen, alle b-beide«, sabberte unser Informant, »aber Ulis-sissa ist die schlimmere!«
Seit zwei Jahren hatte der Waldelf kaum noch etwas aus Kurkum gehört, aber es gab wilde Gerüchte: Ulissa hatte danach ihre Schwester umgebracht, und Yppolita dann Ulissa im Streit erschlagen; beide Herrscherinnen waren also tot, die führungslosen Amazonen völlig verwildert und in Barbarei versunken. Das Gerstenbier zeitigte nun eine unerwünschte Nebenwirkung: Die Erzählungen des Säufers wurden zunehmend konfuser. Sein Becher war wieder einmal leer.
»Wie bist du nach Kurkum gelangt?« fragte Viburn beiläufig. »Das war sicher keine einfache Reise?«
»Schwer, schwer«, nickte der Waldelf, »und sehr gefähr-lich!« Dabei schob er den leeren Becher über den Tisch.
»Du bist von Beilunk aus in die Berge gezogen, nicht wahr?«
»In B-beilunk brau-en sie ein gutes Bier!«
»Von Beilunk in Richtung Osten, oder?«
»Meine Kehle ist so so trok-ken, ich kann kaum sprechen.«
Der Säufer griff sich an den Hals, es sah aus, als müßte er ersticken. Viburn wandte sich leise an Elgor. »Ich fürchte, wir brauchen noch etwas Geld, wir müssen ihm ein frisches Bier kaufen.«
Unsere Unterhaltung mit dem Waldelf dauerte nun über zwei Stunden. Und sie war nur sehr mühselig vorangekommen. Da Viburn kein Geld hatte und ich nur zwei Silbertaler besaß, hatte Elgor das kostspielige Gespräch finanziert.
Er hatte uns gewähren lassen, aber ich konnte mehrfach beobachten, wie er mit Mühe eine Bemerkung unterdrückte. Doch jetzt war er mit seiner Geduld am Ende. Er beugte sich vor, packte den Trinker mit beiden Händen am Kragen und zog ihn quer über den Tisch. Alle Gäste in der Schenke schauten zu uns herüber.
»Ich habe es satt!« brüllte Elgor dem Elf, der hilflos die Augen verdrehte, ins Gesicht. »Du bekommst noch ein Bier! Aber vorher erzählst du uns haarklein, was wir wissen wollen: Was geschah mit Yppolita? Wo liegt der Palast? Wie kommen wir auf dem schnellsten Weg dorthin? Also los, rede, dann kannst du dich meinetwegen zu Tode saufen!«
Nie zuvor an diesem Abend hatte der Waldelf so nüchtern ausgesehen. Er befreite sich aus Elgors Griff und stand auf.
»Ihr seid an den Falschen geraten«, sagte er laut und sah sich gehetzt im Schankraum um. »Ich bin doch nicht käuflich. Außerdem weiß ich überhaupt nicht, wovon ihr sprecht. Euch sollen die Oger fressen!« Mit diesen Worten warf er sich herum, stürzte zur Tür und verschwand in der Nacht.
Wenig später folgten ihm drei schwarzgekleidete Gestalten – vermutlich Frauen –, die während des ganzen Abends dicht bei der Tür gesessen hatten. Als wir am nächsten Morgen in den Pferdestall unserer Herberge kamen, fanden wir den Säufer mit durchschnittener Kehle in seinem Blute liegend. Auch unsere Pferde waren tot und hatten das Stroh in den Ställen mit ihrem Blut getränkt. Nie zuvor im Leben hatte ich solche Lachen aus dunklem Blut gesehen – der Geruch war unerträglich. Übelkeit schnürte mir die Kehle zu. ›KEHRT UM!‹ hatte jemand mit Blut auf die weißgetünchte Stallwand geschrieben ...
Natürlich sind wir nicht umgekehrt, aber wir mußten unsere Reise zu Fuß fortsetzen, und Elgor ordnete an, unseren Weg von nun an abseits der Straße zu suchen. Wie gesagt – er macht es einem nicht leicht, ihn zu mögen. Nun ja, andererseits bin ich selten einem höflicheren Menschen begegnet. Bei allen Mahlzeiten nimmt er als letzter von den Speisen und niemals zu viel. Er unterhält das Feuer, sucht mitten in der Nacht nach neuen Scheiten und meldet sich an jedem Abend freiwillig für die Hundswache am frühen Morgen, der Zeit, in der man sich krank fühlt vor Müdigkeit. Beim Aufbruch hebt er einem den Packen auf die Schultern und prüft, ob alle Gurte richtig sitzen. Dann erst schultert er seinen Rucksack. Er redet Wirt und Wirtin mit ›Ihr‹ an, statt die Leute zu duzen – und beschwert sich weder über zu wenig Salz in der Suppe noch über zu viele Tierchen im Bett. Er klagt überhaupt niemals, nicht über das Wetter, nicht über das Essen oder die Leute. »Was soll ich mich verdrießen lassen von Dingen, die ich nicht ändern kann?« so sagt er manchmal. »Ich muß mich um die Sachen kümmern, die ich ändern kann.« Ein seltsamer Mensch!
Inzwischen war es Mittag geworden. Als Larix zum dritten Mal nach einer Rast verlangte, gaben wir ihm nach. Wir beschlossen, kein Feuer anzuzünden – das bedeutete kalte Kost: Brot, Käse und für jeden einen kleinen Bissen Räucherfleisch. Auf das Fleisch mußten wir jedoch verzichten, denn es erwies sich, daß die nächtlichen Diebe auch an unserem Schinkenrestchen Gefallen gefunden hatten. Die Entdeckung löste einen neuerlichen Tobsuchtsanfall bei Larix aus. Diesmal verstieg er sich sogar zu der Drohung, er wolle »die Burschen fangen, braten und mit Haut und Haaren verspeisen«. Mitten in seinen Verwünschungen brach er plötzlich ab. Ein stilles Lächeln huschte über sein rotes Gesicht.
»Was meint ihr, ob die Diebe uns wieder gefolgt sind?«
Ich zuckte die Achseln.
Larix rieb sich die kurzen Hände. »Ich denke, ich werde den Strolchen heute nacht eine kleine Überraschung bereiten. Wartet‘s nur ab!«
Als wir wieder aufbrachen, hatte der Wind alle Wolken vom Himmel gefegt. Die Sonne, die um diese Jahreszeit nicht mehr weit am Himmelsdach hinaufwanderte, schien gleißend hell. Der Wind kniff mir in die Wangen und trieb mir das Wasser in die Augen. Kein Zweifel, der Winter war eingekehrt. Seit unserer Rast gingen wir ständig bergab. Der Wald wurde wieder dichter, er bot jetzt einen guten Schutz gegen den Wind, aber er hemmte auch unseren Schritt. Uralte Stämme lagen kreuz und quer übereinander, mächtige Wurzelteller ragten so hoch auf wie kleine Häuser. In den Kratern, die sie gerissen hatten, standen kleine Teiche, gefüllt mit stillem, dunklem Wasser, auf dessen Grund sich träge, rotbäuchige Molche wälzten. Aus vermodernden Baumleibern sproß bleiches Dorngestrüpp. Als hätten spielende Kobolde sie dort aufgesteckt, standen dicht an dicht fleischfarbene Pilze mit schlaffen, großen Hüten auf dem schwarzen Holz. Über uns hatte das Rauschen des Sturmes zugenommen, aus der Ferne war mehrmals das Krachen schwer stürzender Bäume zu hören.
Manchmal hört man einen Höfling oder Städter sagen, er liebe den Wald. Ich denke, solche Leute wissen nicht, wovon sie sprechen. Wenn man durch einen Wald geht, gibt er einem vor allem eines zu verstehen: ›Ich war schon hier, bevor du kamst, und ich werde hier sein, wenn du nicht mehr bist und niemand mehr da ist, der von dir spricht. Ich brauche dich nicht, ja, ich bemerke dich nicht einmal ...‹ Wie also kann man jemanden lieben, der einem so wenig Beachtung schenkt.
Während wir uns mühselig einen Weg durch das vom steten Brausen des Windes erfüllte Waldesdunkel suchten, waren wir alle nach und nach still geworden, so als ob die abweisende Fremdheit des Waldes allmählich immer tiefer in unser Gemüt gesickert wäre. Mit einer unausgesprochenen Erleichterung registrierten wir nun, daß sich das Gehölz vor uns lichtete. Kräftiges Grün schimmerte durch die Stämme. Bald kamen wir an den Rand einer weiten Lichtung. Mitten auf der runden, smaragdgrünen Grasfläche standen drei schwarze Wölfe und blickten uns aufmerksam entgegen.
Ich blieb stehen, wich aber zur Seite aus, weil ich nicht wieder Elgors Fußtritt spüren wollte.
»Wölfe«, stellte der Ritter nüchtern fest, nachdem er neben mich getreten war.
»Waldwölfe«, ergänzte ich, »die schlimmsten von allen.«
Elgors Schwert glitt scharrend aus der Scheide. Inzwischen waren Junivera, Larix und Viburn herangekommen. In einem Halbkreis standen wir am Waldrand und betrachteten die reglosen Wölfe, die unsere Blicke starr erwiderten.
Elgor trat auf die Lichtung hinaus. »Wir werden uns doch wohl nicht von drei räudigen Kötern aufhalten lassen!« rief er, hob das Schwert und ging mit ruhigen Schritten auf die Wölfe zu. Als er auf zehn Mannslängen herangekommen war, standen die Wölfe auf und trabten in den Wald hinein.
»Na bitte!« sagte Elgor und winkte mit der Klinge. »Man muß ihnen nur zeigen, daß man keine Angst vor ihnen hat. Dann suchen sie sich eine leichtere Beute. Ich mag noch nicht oft im Wald gewesen sein, aber mit Wölfen kenne ich mich aus.«
»Wir sollten ihnen den Esel überlassen«, entgegnete ich, »dann lassen sie uns wahrscheinlich in Ruhe.«
Larix war empört. »Du täuschst dich! Hast du nicht gesehen, wie Elgor die Biester verscheucht hat? Laßt uns weitergehen.«
Er gesellte sich zu Elgor, der noch immer in der Mitte der Lichtung stand. Gemeinsam mit Junivera und Viburn ging ich ihnen nach.
»Es sind Waldwölfe«, beharrte ich. »Und Elgor hat sie nicht verscheucht. Sie haben sich uns gezeigt. Damit wollen sie uns sagen: Wir sind da, und wir fordern einen Wegzoll. Wenn ihr uns gebt, was wir verlangen, lassen wir euch ziehen.«
»Wir sollten tun, was er sagt«, stimmte Viburn mir zu. »Er weiß, wovon er spricht. Wir müssen unser Gepäck halt selbst tragen. Das ist doch nicht so schlimm. Larix hat sowieso dafür gesorgt, daß die Proviantsäcke federleicht geworden sind.«
»O nein! So schnell gibt ein Bethana keinem Räuber nach, das gilt für Diebesgesindel in Menschen- und in Tiergestalt.«
Junivera und Larix schlossen sich Elgors Meinung an. Wir waren überstimmt.
Auf der anderen Seite der Lichtung drangen wir wieder in den Wald ein. Elgor hatte jetzt die Führung übernommen. Er hatte seinen Kriegsbogen vom Packesel geschnallt, die Sehne eingehängt und einen Pfeil eingelegt. Hinter ihm ging Viburn mit gezogenem Rapier. Ich verwünschte den Dieb, der meinen Bogen gestohlen hatte, und steckte den Dolch griffbereit in den Gürtel. Junivera folgte mir mit dem Esel auf dem Fuß. Am Schluß ging Larix, er hielt den Fausthammer umklammert. Wenigstens war der Wald hier nicht allzu dicht – hohe Laubbäume ringsumher, und auf dem Boden wuchs hüfthohes Farnkraut.
Viburn tippte Elgor auf die Schulter und deutete nach vorn.
Elgor riß den Bogen hoch und schoß. Er schüttelte den Kopf und ging weiter.
Der Streuner ließ sich ein paar Schritte zurückfallen und sah sich zu mir um. »Unser zweifacher Turniersieger! Im Bogenschießen hat er gewiß keinen Preis gewonnen.«
Hinter uns hörten wir Schreie. Das Farnkraut war in Bewegung geraten. Gemeinsam mit Viburn rannte ich zurück.
Zwei schwarze Ungeheuer hatten Larix an beiden Füßen gepackt und zerrten ihn in Windeseile durch den Farn. Der Sohn des Juglans wehrte sich verzweifelt und hieb wild mit dem Hammer durch die Luft, aber seine Arme waren zu kurz, er konnte die Bestien nicht erreichen. Viburn watete mit erhobenen Armen durch die Farnwedel. Ich blieb stehen und warf meinen Dolch. Die Klinge prallte vom Schulterblatt des linken Wolfes ab, offenbar hatte sie nur sein Fell geritzt. Immerhin heulte das getroffene Tier auf und verschwand im Unterholz. Sofort stemmte Larix den freien Fuß in den Boden, der Zwerg wurde herumgewirbelt, Laub flog auf, ein dumpfes Krachen war zu hören. Als wir bei Larix eintrafen, hockte er auf dem Boden und feixte uns entgegen. Neben ihm lag der Wolf. Die Zunge hing ihm aus dem dampfenden Maul, seine Flanken pumpten, die Augen waren weit aufgerissen und seltsam verdreht. Das Fell auf dem Schädel glänzte feucht.
Larix wischte liebevoll den Fäustel ab. »Der wird uns nicht wieder belästigen«, sagte er mit einem Blick auf den Wolf, der sich soeben langsam streckte.
Elgor rief uns etwas zu, und wir liefen zurück. Junivera saß auf einem Baumstamm, ihr wadenlanger, geschlitzter Rock war hochgestreift. Gerade beugte sich Elgor über sie, um eine häßliche Wunde in ihrem Unterschenkel zu untersuchen. Die Priesterin mußte starke Schmerzen haben – sie war sehr blaß und preßte die Zähne aufeinander. »Das Biest war plötzlich da«, murmelte Elgor. »Die Wölfe haben im Farn gelauert wie Giftschlangen ... Ich habe so etwas noch nicht erlebt ...«
Junivera zog sich an Elgors Schulter hoch, aber das Bein versagte ihr den Dienst. Sie sank zu Boden.
»Das sieht schlimm aus«, murmelte Viburn. »Mir scheint, der Wolf hat eine Sehne erwischt.«
»Wir müssen das Bein schienen«, sagte Larix. »Ich habe ein paar Kräuter in meinem Ranzen. Junivera, wir werden dir einen wunderbaren Verband anlegen und dich auf den Esel setzen ... Und in ein paar Tagen kannst du wieder laufen – du wirst es sehen.«
Junivera schüttelte den Kopf. »Ich kann mir selber helfen. Laßt mich allein!« Auf ihrer Stirn standen ein paar dicke Schweißtropfen. Ihr Gesicht war so bleich, daß ihre braunen Augen dunkel wie Gemmen aus Jett darin glänzten. Sie erinnerte mich plötzlich an eine Hexe, der ich einmal im Blautann begegnet war – eine schöne Frau, aber sie hätte mich fast getötet ...
»Wir können dich doch nicht hier zurücklassen!« Elgor schüttelte den Kopf. »Die Wölfe werden wiederkommen.«
»Das meine ich nicht.« Die Geweihte hatte Mühe, ein Stöhnen zu unterdrücken. »Ihr sollt euch nur von mir entfernen ... Bildet meinetwegen einen Ring um mich, aber schaut nicht zu mir her – was auch geschehen mag.«
»Wie du willst.« Elgor trat zurück. »Also los, verteilt euch!« sagte er zu uns, »und seht sie nicht an!«
Wir gingen ein paar Schritte in den Wald hinein und wandten Junivera den Rücken zu. Kaum hatten wir uns umgedreht, als die Priesterin einen lauten Sprechgesang anstimmte, der hin und wieder von einem dumpfen Stöhnen unterbrochen wurde. Plötzlich stieß sie einen Schreckensschrei aus, dann war alles still. Gerade als ich mich fragte, wie lange wir wohl noch auf unseren Plätzen ausharren sollten und ob wir nicht einen Fehler machten, rief Junivera uns zu sich heran. Die Haare klebten an ihrem schweißnassen Gesicht. Sie hatte einen breiten Streifen des Kleides abgerissen und als notdürftigen Verband um die Wade gewickelt. »Es ist gut«, sagte sie, »wir können weitergehen.« Damit sprang sie auf, ergriff den Esel beim Zaum und ging ohne zu hinken in den Wald hinein.
Ich rannte rasch noch einmal zu der Stelle zurück, wo der tote Wolf lag, um meinen Dolch zu suchen. Bald hatte ich ihn gefunden und lief hinter meinen Gefährten her. Elgor und die anderen waren am Rand einer weiteren Lichtung – ganz ähnlich der ersten – stehengeblieben. Mitten darauf standen fünf schwarze Wölfe und starrten uns an.
Elgor hob das Schwert. »Vorwärts! Diesmal werden wir es den Biestern zeigen!« Er senkte den Kopf und stürmte los. Larix folgte ihm.
Junivera aber griff nach dem Strick, mit dem unser Gepäck auf dem Esel festgeschnallt war, und sah mich fragend an.
Ich nickte ihr zu.
Während Viburn und die Priesterin unsere Ranzen und Säcke einen nach dem anderen ins Gras warfen, waren Elgor und Larix bis zur Mitte der Lichtung vorgedrungen. Diesmal trabten die Wölfe nicht in den Wald, sondern wichen langsam zum Rand der Lichtung zurück. Als sie die Bäume erreicht hatten, schlüpften vier weitere Wölfe aus dem Farn, so daß der Krieger und der Zwerg nun einem Halbkreis von neun Wölfen gegenüberstanden. Die großen schwarzen Tiere kamen langsam und seltsam steifbeinig näher.
Der Esel, von allen Lasten befreit, hob den Kopf und rieb mit den weichen Lippen über Juniveras Schulter. Der Geweihten traten plötzlich zwei dicke Tränen in die Augen. Sie drehte den Esel um, flüsterte ihm etwas ins Ohr und gab ihm einen Klaps auf das Hinterteil.
Ein letztes Mal ließ der Esel sein vertrautes Ihh-Ahh ertönen, dann galoppierte er mit ungelenken Sprüngen davon. Wie flache, schwarze Schatten huschten die Wölfe an Elgor und Larix vorbei und verschwanden im Wald. Irgendwo war das Rascheln und Knacken von Reisig zu hören – ein Geräusch, das sich rasch in der Ferne verlor.
Die Abenddämmerung sank allmählich herab. Ich hatte wieder die Rolle des Pfadfinders übernommen. Elgor schloß zu mir auf.
»Ich meine immer noch, wir hätten den Bestien nicht nachgeben dürfen.«
»Dann wären wir verloren gewesen.«
»Du hältst wohl große Stücke auf diese Wölfe?«
»Waldwölfe«, verbesserte ich. »Sie sind anders als die Wölfe, die du kennst. Eine alte, schlaue Rasse – und sie sind sehr stolz.«
»Stolz?«
Ich nickte. »Sie halten sich für die Herren des Waldes – und vielleicht sind sie das auch. Es fällt ihnen leicht, Hirsche oder Rehe zu erbeuten, denn sie verbinden wölfische Kraft und Zähigkeit mit der Gerissenheit eines Goblins. Aber es genügt ihnen nicht, daß ihre Beutetiere sie fürchten. Sie verlangen Achtung von jedermann, der ihren Wald betritt.«
»Und diese Achtung haben wir gezeigt, indem wir unseren Esel opferten?«
»So ist es. Du hast erlebt, wie sie kämpfen, und wirst zugeben, daß sie nicht dumm sind. Sie wissen, daß sie sterben können, wenn sie Menschen oder Orks überfallen. Einen Hirsch zu jagen, ist viel gefahrloser für sie. Trotzdem haben sie uns angegriffen, weil wir uns weigerten, ihnen diese Art von Ehre zu erweisen. Sie sind tatsächlich sehr stolz – fast könnte man sagen, eitel.«
Elgor warf die dicken roten Zöpfe nach hinten. »Was wäre geschehen, wenn wir ihnen den Esel nicht überlassen hätten?«
»Wie stark war das Rudel ... Neun Köpfe vermutlich? Nun, sie hätten uns so lange überfallen, bis keiner von ihnen mehr am Leben gewesen wäre. Sie können gar nicht anders handeln.«
»Hm.« Elgor nickte bedächtig. »Wieso kennst du dich so gut mit diesen Wölfen aus?«
Ich streifte den Jackenärmel hoch und zeigte ihm ein paar lange, weiße Narben. »Ich bin im Blautann aufgewachsen, im fernen Weiden. Es gibt eine Menge Waldwölfe dort. Mein Vater war Jäger in Weiden.«
Elgor blickte gedankenverloren auf meinen Arm. »Mir scheint, du hast irgendwann einmal deinen Wegzoll nicht entrichtet, hm?«
Ich rollte den Ärmel wieder herab. »Nein, als mein Vater und ich dem Rudel begegnet sind, hatten wir nichts dabei, das wir den Wölfen hätten geben können. Mein Vater hat mich auf einen Baum gesetzt – ich habe noch versucht, ihn hochzuziehen ...«
Der Krieger legte mir die Rechte auf die Schulter. »Entschuldige«, sagte er ernst. »Ich wollte nicht neugierig sein. Ich schätze, beim nächsten Mal werde ich sofort auf dich hören, wenn du uns einen Rat über Waldwölfe gibst.«
3. Kapitel
An den Staatsdingen jedoch fand Yppolita keinen Geschmack, denn in ihrem jugendlichen Feuer dachte sie, daß es auf der Welt nichts gäbe, was ein starkes Schwert nicht zu erringen vermöchte. Sollte es Dinge geben, die einem zufielen, ohne daß man darum kämpfen mußte, so konnten solche Dinge keinen Wert besitzen.
Ulissa aber, die jüngere Schwester, begeisterte sich sehr für die Staatskunst. Sie ließ sich von Yppolita wortgetreu alle Aufgaben wiedergeben und bewunderte die Männer und Frauen, von denen die Schwester berichtete, Menschen, die große Reiche errichtet hatten, ohne gewaltige Schlachten, aber mit List, Intrigen und Skrupellosigkeit ...
Nicht weit von uns erhob sich ein kleiner, mit knorrigen Eichen bewachsener Hügel aus dem Wald. Diese Kuppe hatten wir uns zum Lagerplatz für die Nacht auserkoren. Elgor, Larix und Junivera strebten mit zügigen Schritten dem Hügel entgegen, sie schienen die schweren Ranzen und Decken, die jeder von uns auf dem Rücken trug, gar nicht zu bemerken. Gemeinsam mit Viburn folgte ich ihnen. Seit die Sonne hinter den Bergen verschwunden war, spürten wir die Kälte noch deutlicher. Ich freute mich auf ein warmes Lagerfeuer.
Viburn hielt mich plötzlich an der Schulter fest und zeigte auf Juniveras Beine. Die Priesterin ging unmittelbar vor uns, und ich hatte unwillkürlich schon seit längerer Zeit das Spiel ihrer Wadenmuskeln betrachtet. Ich sah genauer hin und wußte mit einem Mal, was Viburn so verwirrte: Juniveras notdürftiger Verband war – ohne daß sie es bemerkt hatte – auf den Knöchel gerutscht. Ihre blasse, aber wohlgerundete Wade war völlig unversehrt. Keine Schramme, kein Kratzer, kein Blut, keine Narbe – nicht die Spur eines Bisses.
Überrascht blieb ich stehen. Viburn zog mich weiter. »Was, da staunst du? Aber das ist ein gutes Zeichen, Arve. Rondra ist mit uns!«
»Meinst du wirklich, die Göttin selbst hat ihr geholfen?«
»Du hast doch gehört, wie sie um ein Wunder betete. Rondra muß ihr Gebet erhört haben – eine andere Erklärung gibt es nicht.«
»Das kann man nicht sagen«, wandte ich ein. »Ich habe selbst schon wundersame Heilungen erlebt – bei Leuten, die kaum die Namen der Zwölfe kannten. Vielleicht versteht sich Junivera ja ein wenig auf die Magie oder auf die Künste der Elfen ...«
Viburn schüttelte heftig den Kopf. »Nicht unsere wackere Junivera. Ich bin schon so manchem Geweihten begegnet, aber keinem, der so ernst und streng in seinem Glauben gewesen wäre. Nein, ich möchte wetten, daß Junivera alle Zauberkunst mit äußerster Vorsicht betrachtet, denn es ist ja bekannt, daß auch die göttliche Löwin die Zauberei wenig schätzt. Alter Freund – so seltsam das gerade aus meinem Munde klingen mag – ich bin mir recht sicher, daß wir soeben Zeugen eines echten Rondrawunders gewesen sind.«
Ich sah Viburn aufmerksam von der Seite an. Da war keine Spur des gewohnten spöttischen Grinsens in seinem Gesicht zu erkennen. »Was wäre wohl geschehen«, fragte ich schließlich, »wenn Rondra kein Wunder getan hätte?«
»Ich weiß es nicht. Ich fürchte, wir hätten Junivera den ganzen Weg nach Rommilys zurücktragen müssen. Vielleicht wäre sie am Wundfieber gestorben, vielleicht wäre ihr Bein für immer steif geblieben ... Du, Arve, sie scheint ihrer Göttin sehr nahe zu sein. Vielleicht werden wir uns irgendwann darüber freuen, Junivera bei uns zu haben.«
Wir hatten den Rastplatz erreicht. Während die anderen Feuerholz sammelten, lieh ich mir Elgors Bogen, um für ein Abendessen zu sorgen. Aber ich hatte kein Jagdglück. Es gab kaum Wild, und wenn ich einmal ein Karnickel entdeckte, dann hatte ich solche Mühe, den unhandlichen Bogen zu spannen, daß die schmackhafte Beute in aller Seelenruhe davonhoppeln konnte. Schließlich kehrte ich mit einem Armvoll Reiterhüten, einer späten Pilzart, ins Lager zurück.
Das Feuer war bereits angezündet, es flackerte hell – zu hell, wie ich fand, und das sagte ich auch.
Larix winkte ab. Der Sohn des Juglans war blendender Laune. Nicht einmal die Aussicht auf ein Pilzgericht anstelle eines Hasenbratens konnte ihn verdrießen.
»Soll es doch hell brennen«, sagte er. »Das schreckt die wilden Tiere ab.«
»... aber nicht die Diebe ...«
»Die sollen ruhig wissen, wo wir lagern. Ja, das sollen sie ruhig wissen.«
Er stimmte ein Liedchen an und summte und pfiff unaufhörlich vor sich hin. Ich stellte fest, daß er alle unsere Stricke um sich herum ausgelegt hatte. Drei Tauenden hatte er mit Schlingen versehen, und eben verflocht er die Enden der drei Seile zu einem Strang.
»Zwerge haben kleine Beine, aber großen Mut«,
summte er.
Ȁrgre keine Zwerge, sonst sei auf der Hut!
Zwerge haben kleine Hände, aber große Wut!
Ärgre keine Zwerge, sonst liegst du selbst im Blut!«
Viburn setzte sich zu ihm und beobachtete aufmerksam die kurzen emsigen Finger bei der Arbeit. »Sag an, Sohn des Juglans, was treibst du da?« Larix blickte nicht auf und würdigte ihn keiner Antwort. Er hatte aus den drei Seilen ein dickes Tau geflochten, das wohl sieben Mannslängen maß. Jetzt spleißte er mit der Dolchspitze kleine Schlitze in den Strang, las ein wenig Laub vom Boden auf und zog die Blattstiele in den Strick ein.
»Eine Girlande?« fragte Viburn. »Wie schön ...«
»Ärgre keine Zwerge, sonst liegst du selbst im Blut!« Ohne seinen Gesang zu unterbrechen, steckte Larix ein letztes Zweiglein in den Strang, betrachtete sein Werk mit schiefgelegtem Kopf und zupfte noch ein paar Blätter zurecht. Schließlich stand er auf und schleppte unser gesamtes Gepäck ein paar Schritt vom Feuer weg, um es sorgfältig unter einem mächtigen Eichbaum aufzuschichten. Dann legte er die drei Schlingen auf dem Boden um die Packen aus, ergriff das dicke Tau mit den eingeflochtenen Blättern und warf es schwungvoll über einen Eichenast.
»... sonst sei auf der Hut!«
Der Zwerg führte den Strick über den Boden bis zu seinem Schlafplatz. Anschließend tarnte er die Schlingen und den Strang auf dem Boden sorgsam mit Laub. Endlich setzte er sich ans Feuer und wickelte das Tau einmal probeweise um sein Handgelenk.
Er sah so zufrieden aus, wie nur ein zufriedener Zwerg aussehen kann. »Wo bleibt mein Essen? Ich denke, wir speisen heute Waldpilze nach Elfenart?«
Ich schob ihm seinen Anteil auf den Holzteller.
»Jetzt sollten wir das Feuer niederbrennen lassen«, sagte er, »sonst könnten die Diebe womöglich meine Falle entdecken.«