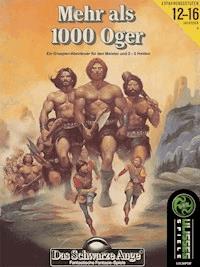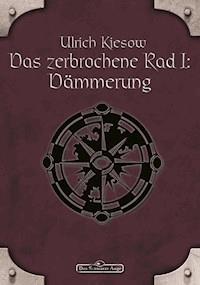
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ulisses Medien und Spiel Distribution GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Schwarze Auge
- Sprache: Deutsch
Die Schergen des Borbarad überziehen Aventurien mit Mord und Brand. Wer sich dem Dämonenmeister nicht unterwirft, wird vernichtet. Unaufhaltsam scheint der Vormarsch der dämonischen Heerhaufen. Selbst im Bornland findet Borbarad verräterische Paktierer, aber er stößt auch auf seine erbittertsten Feinde: den wackeren Grafen von Geestwindskoje und die berühmte Thesia von Ilmenstein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 665
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titel
Ulrich Kiesow
Das Zerbrochene Rad: Dämmerung
Erster Teil
Sechsundfünfzigster Roman in der Welt von Das Schwarze Auge©
Originalausgabe
Impressum
Ulisses SpieleBand 56
Kartenentwurf: Ralf HlawatschE-Book-Gestaltung: Michael Mingers
Copyright ©2012 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems. DAS SCHWARZE AUGE, AVENTURIEN, DERE, MYRANOR, RIESLAND, THARUN und UTHURIA sind eingetragene Marken der Significant GbR.Alle Rechte von Ulisses Spiele GmbH vorbehalten.
Titel und Inhalte dieses Werkes sind urheberrechtlich geschützt. Der Nachdruck, auch auszugsweise, die Bearbeitung, Verarbeitung, Verbreitung und Vervielfältigung des Werkes in jedweder Form, insbesondere die Vervielfältigung auf photomechanischem, elektronischem oder ähnlichem Weg, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Ulisses Spiele GmbH, Waldems, gestattet.
Print-ISBN: 3-453-18805-5 (vergriffen)E-Book-ISBN: 978-3-86889-629-9
Widmung
Da ich einen recht umfangreichen Roman geschrieben habe, finde ich es angemessen, ihn gleich mehreren lieben Personen zu widmen:
Für Britta, Ina und Niels, die mir in harten Tagen beim Leben und beim Arbeiten sehr geholfen haben.
Prolog
›Viele behaupten, das Rad sei jünger als der Mensch – es müsse jünger sein, denn er, der Mensch, habe es in seiner göttergegebenen Findigkeit erschaffen. Was soll uns das, meine Tochter? Der Belege für menschlichen Einfallsreichtum gibt es viele. Die Erfindung des Rades muß den Menschen nicht zugeschrieben werden; sie finden ohnedies stets Gründe genug, sich in eitler Selbstgefälligkeit zu ergehen.
Viel weiter bringt uns der Gedanke, das Rad sei gerade so alt wie der Mensch, weil es, das Rad, nämlich eine Idee ist, und weil alle Ideen von gleichem Alter sind: die Idee des Rades, die Idee des Menschen und die Idee des Lebens. Der Maraskaner mit seinem vielerorts verlachten Glauben an Rur und Gror hat diese Dinge schon immer gewußt, denn was sonst als die Idee des Rades ist die Weltenscheibe, die ein Bruder dem anderen zuwirft? So sie aber die Idee des Rades
und der Welt ist, ist sie sehr wohl auch die Idee des Lebens, denn die drei sind eines.
So ist also das Rad die Idee des Lebens. (...) Und da es eine Idee ist, verkörpert es nicht das Leben, so wie es wurde und heute ist, sondern so, wie es war und sein soll: heil und wohlgerundet, um eine feste Mitte kreisend und doch voranstrebend.‹
Rohal, genannt ›der Weise‹ – aus den Aufzeichnungen seiner Schülerin Sunya al Shehinfar
›Seht das Rad –
Es ist zerbrochen vor der Zeit!
Ließ uns zurück in Bitterkeit.
Der Speichen fünf sind ihm geblieben
Ihre Namen sei‘n hier aufgeschrieben:
Sind Haß, Schmerz, Zorn und Not und Wut.
In Bächen fließen Trän‘ und Blut!‹
Grabinschrift für einen Ilmensteiner Trommlerjungen
Das zerbrochene Rad: fast überall in Aventurien verbreitetes Symbol für den Einbruch des Todes in das Leben.
Personen
Aus dem Mittelreich
PRINZ BRIN VON GARETH, König von Garetien (Reichsbehüter des Mittelreiches)
BARON LEOMAR VOM BERG (Reichsmarschall)
HERZOG WALDEMAR VON TRALLOP ZU WEIDEN
PRINZESSIN WALPURGA VON WEIDEN
GILIA VON KURKUM (Amazone, Tochter der Königin)
MARKGRAF ARVE VOM ARVEPASS
AYLA VOM SCHATTENGRUND (Schwert der Schwerter, Hochgeweihte der Göttin Rondra)
NAHEMA AI TAMERLEIN (Magierin)
GERION ROTTNAGEL (Magier)
SELISSA VON JERGENQUELL (Kriegerin)
Auf Gut Geestwindskoje
GRAF ARVID VON GEESTWINDSKOJE
GRÄFIN ALGUNDE VON GEESTWINDSKOJE (Arvids Gemahlin)
JUNKER ERBORN, JUNKERIN SELISSA (Arvids und Algundes Kinder)
GRÄFIN YASINDE VON GEESTWINDSKOJE (Arvids Schwester)
EDLE DELA VON SCHERPINSKOJE (Hauslehrerin)
ASKEJ KRUSCHIN (Verwalter)
WASSJEF (Page)
GORM (Kutscher)
LENTO (Koch)
MARISSJA (Köchin, Lentos Ehefrau)
MARIS (Sohn von Lento und Marissja)
TESBINJA (Magd)
Im Dorf
DUNA SCHORKIN (Dorfschulzin)
TIRULF, LITTJEW und MATAJEW (Dunas Söhne)
FREDJA SCHORKIN (Dunas Onkel)
VESTISSJA (Perainegeweihte)
DONSEMKIN (reicher Bauer)
Die Ilmensteiner
GRÄFIN THESIA VON ILMENSTEIN
BARONIN MIRHIBAN SABA AL KASHBA VON PERVIN
GRAF WAHNFRIED VON ASK
GRAF ISIDOR VON NORBURG
GRAF VIGO VON ARAUKEN
BARON UGO DAMIAN ESCHENFURT
PIRMAKAN VON SCHERPINSKOJE (Meistermagus)
RIHINJA VON SCHERPINSKOJE (Pirmakans Schülerin)
ORSCHIN (Knecht aus Pervin)
Die Ouvenmaser
FÜRSTIN TSAIANE VON OUVENMAS
DUNJEW (Genannt Dunjoscha; Tsaianes Bruder)
GRAF LJASEW VON UTZBINNEN (Kanzler)
GRAF SEMKIN OUVENSTAMM VON GEESTWINDSKOJE (Vetter von Graf Arvid)
Allerlei Adlige, Freie und Unfreie
BARON ELGENI VON KUNSK-ARBACH
BARONIN VARINKA PARUNJEW
BARONIN WARJA VON ELENAU
BARON JOSCHIN VON ELENAU (Bruder von Warja)
BERSCHIN OMLAUKEN (Wirt)
NUSCHINJA (Berschins Frau)
TILDA BEILSTEIN (Söldnerin)
HESINDIANE und EFFERDANE VON HORLINHAG (Söldnerinnen)
FREGORIS TANNSCHIN (Söldner)
Notmärker und Borbaradianer
GRAF URIEL (Herr der Grafschaft Notmark)
TJEIKA VON JATLESKANAU-NOTMARK (Adelsmarschallin)
STANE TER SIVELLNG-NOTMARK (Tjeikas Gemahl)
MENGBILLAR (Magier, Graf Uriels Ratgeber)
STIAN VON ZORNBRECHT (Oberst)
LUTISANA VON PERRICUM (Söldnerführerin)
DARGO VON DREIEICHEN (Hauptmann aus dem Mittelreich)
GIRTE VON STRANGNITZ (Rittmeisterin)
RABESCHA GUMPLEW (Weibelin der Burgwache, Graf Uriels älteste, uneheliche Tochter)
UGO TER SAPPEN (Leutnant)
TSCHINJUSCHA (Hexe)
SCHERSCHAI (Goblinfrau)
1. Kapitel
In den Misa-Auen im Phex 1019 n. BF.
Grimbart wacht auf
In den ersten Tagen des Phex hielt der Frühling Einzug in das Land zu beiden Seiten der Misa. Er hatte sich lange geziert in diesem 1019. Jahr nach Bosparans Fall, welches zugleich das 26. Jahr des Kaisers Hal war, aber nun war er endlich gekommen. Strotzend vor urtümlicher und zugleich übermütiger Kraft, schlenderte er am Fluß entlang, blähte vergnügt die Backen und blies seinen linden Atem bis weit in das Auenland hinein. Die Sonnenscheibe, in der viele den lebendigen Herrn Praios sehen, andere nur Seinen Schild und wieder andere nur ein Sinnbild Seiner Macht, verbündete sich mit dem Frühling, verharrte still an einem hohen Himmel, der so makellos blau war wie ein Königsmantel, und sandte Strahlen aus warmem Licht auf das Land. Auf solche Art berührt und von unterwärts durch sanft schiebende Sprossen und Keimlinge bedrängt, brach allenthalben die feuchte, dampfende Erde auf. Vereinzelte Schneeflächen, die, im Schatten verborgen, bisher vom Praiosschild übersehen worden waren, schmolzen nun still dahin. Auf den weiten Sumpfwiesen zwängte sich helles Grün durch die gelbbraunen Matten des alten Grases. Am Waldrand öffneten sich die Knospen an Weißdornstrauch und Holunderbusch und tief im Innern des Waldes bedeckte sich der Boden unter den hohen Buchen, Ulmen und Eichen mit den gelben Sternen des Scharbockskrautes.
Inmitten dieses alten Hochwaldes, der am äußersten Rand der Misa-Auen die den Fluß umgebenden Erlenund Weidengehölze ablöste, hatte unweit der Straße von Vallusa nach Skorpsky vor einigen Jahren ein zorniger Sturm gewütet und etliche Baumriesen umgeworfen. Zumeist hatte die Sturmfaust, als sie mit ihren mutwilligen Hieben in den Wald gefahren war, gleich mehrere Bäume an einer Stelle umgestürzt, und so, indem er die mächtigen Stämme dutzendweise streckte, hatte der Sturm ein paar kleine, mittlerweile wieder mit Gesträuch und verfilzten Dornranken überwachsene Lichtungen geschaffen. Hier, im Windschutz der großen Bäume, die der Sturm verschont hatte, war der Frühling schon ein Stück weiter vorangekommen als anderswo. Die meisten Büsche trugen schon zartes Laub, und ein paar strebsame Bienen untersuchten brummend die ersten Peraineblümchen. In den Zweigen einer Birke, die am Rand einer solchen Lichtung stand, kletterte, kaum mannshoch über dem Boden, ein Rotkehlchen umher, turnte hinaus auf das äußerste Ende eines dünnen Zweigleins und setzte sich in Pose. Nachdem es ein paarmal mit dem Schwanz gewippt hatte, riß es den Schnabel auf und schmetterte mit bebender Kehle der Wärme und dem goldenen Licht einen Willkommensgruß entgegen.
So laut schrillte der kleine Vogel in die Frühlingsluft, daß tief unter der Erde eine alte Dächsin mit Namen Grimbart von dem fröhlichen Lärm erwachte, sich eine Weile mit verdrießlicher Miene den Schädel an einer Wurzel rieb, um sich anschließend knurrend und brummelnd daranzumachen, altes Laub und trockene Halme durch einen langen Tunnel ins Freie zu schieben. Draußen angelangt, hob sich die Dächsin auf die Hinterbeine, zwinkerte heftig und sog sodann mit beweglich zuckender Nase die würzige Luft ein, deren Düfte von Erwachen und allgegenwärtigem Sprießen sie auf ihre Weise durchaus zu schätzen wußte, denn die graubärtige Alte beschäftigte vor allem eines: sie hatte schrecklichen Hunger. Also hob sie noch einmal prüfend die Nase und machte sich dann auf die Suche. Wenn es hier nach frischen Sprossen und aufplatzenden Knospen roch, mußten sich diese Dinge wohl auch finden lassen. Grimbarts Augen waren ihr bei ihrer Unternehmung keine große Hilfe: Sie hatte noch nie besonders gut gesehen, und im Alter war ihre Sicht keineswegs besser geworden. Das helle Tageslicht, das das Rotkehlchen zu seinem trillernden Gruß bewegt hatte, schätzte die Dächsin wenig. Ihre Zeit war die Dämmerung oder gar die tiefe Nacht, wenn selbst die albernen Füchse in ihren Bauen verharrten und die verfressenen Wölfe zu pelzigen Ringen gerollt irgendwo im Grase schliefen. Aber was sollte sie tun: Der Abend war fern und der Hunger groß.
Die alte Grimbart folgte dem süßen Duft faulenden Holzes und stieß auf einen im braunen Altfarn vermodernden dicken Ulmenstamm. Die kräftigen Krallen faßten zu und fetzten schichtweise feuchtes, bröckliges Holz zur Seite. Etwas Dickes, Weißliches wand sich im Moder. Der gestreifte Dachskopf schoß vor, Kiefer schnappten, Zähne malmten: eine Hirschkäferlarve, weich, köstlich, saftig, eine prächtige Vorspeise – aber eben nur eine Vorspeise. Die Dächsin suchte weiter. Mit pendelndem Kopf trottete sie weiter zu dem kleinen Tümpel hinter dem Windwurf. Ein Sturm hatte hier vor ein paar Wintern eine Buche umgestoßen, und in dem Erdloch, das der ausgerissene und nun senkrecht stehende Wurzelteller zurückgelassen hatte, hielt sich fast das ganze Jahr hindurch eine tiefe, klare Wasserlache. Rings um das winzige Gewässer konnte man jederzeit mit etwas Glück auf einen schmackhaften Kammolch stoßen oder gar auf einen fetten Grasfrosch.
Etwas gluckste, Wasser spritzte auf, noch bevor die Graubärtige den Tümpelrand erreicht hatte. Sie schnaufte verdrießlich. Ich bin zu langsam geworden, dachte sie. Eine wehmütige Erinnerung an die beiden Gefährtinnen – die eine ihre zweitälteste Tochter, die andere eine entfernte junge Verwandte –, mit denen sie bis zum letzten Winter das Höhlenlabyrinth geteilt hatte, stieg in ihr auf. Ach, die beiden hatten nie einen rechten Sinn für den Ernst des Lebens entwickelt; halbe Tage hatten sie mit irgendwelchen Albereien, Fangenspielen und Schnurrbartputzen verbracht, aber sie waren wirklich gut im Molchefangen gewesen. Man brauchte nur neben ihnen zu kauern und zu warten, bis eine von ihnen Erfolg hatte, sie dann energisch anzufauchen und konnte jederzeit darauf hoffen, daß sie vor Schreck die Beute fallenließ... Schöne Zeiten, aber dann war Grimbart Ohneschwanz von einem Ork erschlagen und aufgefressen worden und die hübsche Grimbart Silberkopf an einem Pfeil gestorben, den ihr eins von diesen Menschenkindern so tief in den Rücken geschossen hatte, daß er nicht wieder herauszuholen war, ganz gleich, wie lange Grimbart Silberkopf sich über den Boden rollen oder an Baumstämmen reiben mochte. Am Ende hat sie eine widerwärtig gelbtriefende Beule auf dem Rücken gehabt, mit dem Pfeil mittendrin, und war ganz heiß gewesen. Im Bau war sie gestorben, und die alte Dächsin hatte den Wohnkessel mit der Toten mühselig mit Erde verschließen müssen, damit nicht der ganze Bau von dem Gestank, den Silberkopf verströmte, erfüllt wurde ...
Tja, nun mußte man sehen, wie man allein zurechtkam ... Es waren einfach zu viele Zweibeiner in der Gegend unterwegs. Das lag an diesem harten Steinweg, auf dem die Pferde die rumpelnden Kästen mit den aufgehockten Menschen schleppten, und der in der Ferne auf den Fluß stieß, der die schwimmenden Holzinseln trug, wiederum mit aufhockenden Menschen darauf. Faules Völkchen, das! Der Fluß floß einen ganzen Tagesmarsch fern vom Bau, aber Grimbart war schon zweimal bis zu seinem Ufer gewandert. O ja, man war in der Welt herumgekommen, man kannte sich aus! Darum wußte man auch, daß es keinen Sinn hatte, fortzuziehen. Anderswo lebte es sich auch nicht besser. Manch einer denkt, die Götter hätten die Welt für die Dachse gemacht, aber in Wahrheit haben sie sie für die Menschen erschaffen, und die sind nirgends gute Nachbarn ... Die Überlegungen der alten Dächsin wurden von einem hellen, rasch näher kommenden Kläffen unterbrochen: ein Hund, ein stinkiger Köter, auch das noch! Das Gebell – zuerst war es in der Nähe des Dachsbaus erklungen – folgte offenbar der Fährte, die die Dächsin zurückgelassen hatte. Ein verdammter Schnüffler! seufzte die Alte und drehte sich, mißmutig brummelnd, dem Geräusch entgegen. Da kam auch schon ein braunweißes Etwas um den Windwurf geflogen, wehende lange Ohren, dicke weiße Pfoten und ungelenk galoppierende dünne Beine. Der Hund schoß um die Wurzelscheibe herum, sah die Dächsin, stemmte die Beine in den Boden und kam dicht vor ihr zum Stehen. Seine Augen waren weit aufgerissen, seine schrille Stimme überschlug sich vor Aufregung. Er duckte sich, bellte, ruckte vor, schnappte in die Luft, zuckte zurück, zog die Lefzen kraus, bellte, zuckte zurück, bellte ... Die Dächsin schob den flachen Kopf nach vorn und entblößte ihre graugelben Fangzähne – ein Anblick, der dem Hund für einen Moment das Kläffen verschlug, doch dann setzte das schrille Gebell von neuem ein, heftiger denn je. Brummend rückte die Alte ein paar Schritte weiter vor, dabei warf sie dem Hund einen Blick zu, der ihm sagen sollte: Entscheide dich! Verpiß dich oder bleib hier! Falls du in der Nähe bleiben willst, bedenke, ich habe schrecklichen Hunger, und ich esse notfalls auch jungen Hund! Überraschend behende ließ die Dächsin den gestreiften Kopf vorschnellen, mit einem lauten Klacken schlossen sich ihre Kiefer unmittelbar vor der Hundeschnauze in der Luft. Wenn sie den Braunweißen erwischt hätte, seine Reaktion hätte nicht dramatischer ausfallen können: Hell aufjaulend, als hätte man ihm auf den Ohrlappen getreten, warf sich der Hund herum. Seine tolpatschigen Pfoten wirbelten braune Erdklumpen auf, bis sie endlich Tritt gefaßt hatten und er laut winselnd davonschoß, als hätte er zwei Difaroide bei der Paarung erblickt. Grimbart schüttelte mißbilligend den Kopf, kratzte sich mit der Hinterpfote die von Flöhen heimgesuchte Bauchdecke und begab sich schließlich wieder auf die Nahrungssuche. Es gab gewiß eine Menge dummer Tiere auf der Welt, aber solch ein junger Hund, der schlug sie alle ...
Lissa rannte, so schnell sie ihre Pfoten trugen. Wie kleine Banner flatterten ihr die langen Ohren um den Kopf. Umzublicken wagte sie sich nicht. Vielleicht war das fraßgierige, schwarzweiß gestreifte Ungeheuer unmittelbar hinter ihr und wartete nur darauf, daß seine Beute für einen winzigen Augenblick den Schritt verhielt. Sie stolperte über einen Maulwurfshaufen, überkugelte sich, rappelte sich auf, galoppierte weiter, verfing sich in einem Brombeergestrüpp, strampelte sich frei und hatte endlich ihr Ziel erreicht: eine mit trockenem gelben Gras bestandene kleine Wiese. Zwei Pferde, die dort mit Fesselleinen zwischen den Vorderbeinen standen, blickten kaum vom Grasen auf, als das winselnde Fellbündel herangaloppierte. Nur eine große blonde Frau an einer Feuerstelle rief besorgt: »Lissa, Lissa! Wo hast du nur gesteckt? Komm her zu mir, armes Hündchen!« Die Hündin sprang zu ihr hin, tappte ihr mit den Pfoten auf Brust und Schultern und leckte ihr stürmisch das Gesicht, bis sie sanft zurückgeschoben wurde. »Nun ist es gut! Brauchst keine Angst mehr zu haben. Wir sind ja bei dir.« Die Frau, sie trug einen mit einem roten Band umwickelten dicken Zopf, rieb sich die runden Schultermuskeln, die von ihrem ärmellosen Lederhemd unbedeckt blieben. »Der Wind ist nun doch recht frisch geworden, meinst du nicht auch, Lindion?« sagte sie zu ihrem Begleiter.
Der Angesprochene antwortete nicht, hob nicht einmal den Kopf mit den langen braunschwarzen Locken, die dem Kauernden bis fast zum Gürtel herabhingen. Er hatte das eine Ende eines Langbogens zwischen den Füßen eingeklemmt und bog das andere einwärts, bis sich die Sehne entspannte und er sie aushaken konnte. Er wickelte sie sorgfältig um das Bogenholz, zog das Ende unter der letzten Umschlingung durch und steckte es fest. Dann legte er den Bogen ins Gras, schüttelte die Locken aus der Stirn, faßte sie mit beiden Händen und schob sie sich hinter die oben spitz zulaufenden großen Ohrmuscheln. Nachdem er ein schmales Lederband um die Stirn geschlungen hatte, bückte er sich nach einem dicken Ast, warf ihn ins Feuer und beobachtete aufmerksam, wie blaue Flämmchen aus dem Holz sprangen, wuchsen und, sich gelb verfärbend, es schließlich ganz einhüllten. Ein dicker brauner Käfer von der Art, die die Leute in Nordtobrien ›Troßwagen‹ nennen, flog dicht über dem Gras auf das Feuer zu. Die schmale Hand des Elfen schoß vor. Lange dünne Finger schlossen sich, locker wie ein Käfig, um das Insekt. Lindion hob die Hand ans Ohr und lauschte dem zornigen lauten Brummen, das durch die Fingerspalten drang. Dann warf er den Käfer weit von sich. Der dicke Troßwagen torkelte durch die Luft, sackte ab, wäre fast ins Gras gefallen, stieg dann aber schwerfällig wieder auf. Er beschrieb einen unregelmäßigen Kreisbogen, sehr tief über den von einem leichten Wind bewegten gelben Halmen, und näherte sich von neuem dem Feuer. Wieder fing ihn der Elf mit einem geschickten raschen Griff. »Wenn du das noch einmal tust«, sagte er zu dem Käfer in seiner Hand. »werde ich mich nicht mehr einmischen. Ich habe dich sowieso nur gerettet, weil ein solch dummer, dicker Brummer wie du besser einem hungrigen Vogel zur Speise dient, als daß er sinnlos im Feuer verbrennt.« Er ließ es zu, daß der Troßwagen seinen kantigen Körper halbwegs durch eine Öffnung zwischen Daumen und Zeigefinger hindurchzwängte, klemmte ihn dann aber ein und verfolgte mit heiterer Miene die hilflosen Ruderbewegungen der Beine und des lappigen Fühlerpaares.
Versonnenen lächelnd betrachtete Gilia ihren Gefährten. Helles Sonnenlicht tanzte auf den weichen dunklen Locken, die sein edles, vollendet ebenmäßiges Gesicht umrahmten. Es ist dieses Ebenmaß, das die Elfen von den Menschen trennt, dachte Gilia – wie schon so manches Mal, seit sie sich Lindion angeschlossen hatte. Fast eines jeden Menschen Gesicht weist irgendeine Unregelmäßigkeit auf, doch Lindions Antlitz ist von anderer Art. Jeder der beiden hochstehenden Wangenknochen war auf die gleiche Weise ausgeprägt, der lange Nasenrücken, schmal wie ein Säbelrücken, verlief in vollkommen gerader Linie von den großen Augen zu den zierlichen Nasenflügeln. Wenn Lindion lächelte, so wie jetzt, hoben sich beide Mundwinkel auf genau die gleiche Höhe, und seine feingeschwungenen vollen Lippen gaben eine Reihe schimmernd schöner Zähne frei. Die braunen Augen waren von langen dunklen Wimpern verdeckt, doch Gilia kannte ihre Tiefe, den zwiefachen Sog, der von ihnen ausging, wann immer der Blick des Elfen ein Gegenüber aufmerksam maß, mit jener gelassenen Aufmerksamkeit, mit der er jetzt den strampelnden Käfer betrachtete.
»Laß ihn los!« bat sie. »Ich bin sicher, er hat seine Lektion gelernt.«
»Moment noch«, erwiderte er knapp.
Aus dem kastanienbraun glänzenden Hinterleib des Käfers quoll plötzlich eine glasige gelbe Flüssigkeit. Ein paar Tropfen rannen an Lindions Handgelenk hinab. Er streckte Gilia die Hand mit dem zappelnden Tier entgegen. »Koste doch einmal, Prinzessin!« forderte er sie auf. »Das ist Käferöl. Sehr süß, und es macht schön!«
Gilia verzog angeekelt die Lippen und wandte den Kopf zur Seite. »Ich mag es nicht, wenn du Prinzessin zu mir sagst«, murmelte sie. »Die Zeiten sind vorüber ...«
Die Hand mit dem Käfer war ihrem Mund gefolgt. »Nun los!« beharrte der Elf. »Tu‘s mir zuliebe!«
Die junge Frau kniff die Lider zusammen, schob die Zungenspitze vor und tupfte sie in einen der gelben Tropfen. Kaum hatte sie Lindions Handgelenk berührt, zuckte sie zurück und spie heftig aus. »Pfui, ist das ekelhaft!« rief sie laut. »Du bist ein widerlicher Schuft!«
Der Elf warf lachend den Kopf zurück. »Wie konntest du nur ...? Hast du denn gar kein Gespür für die Sinnhaftigkeit der Natur? Wie kannst du nur glauben, ein gefangenes Tier verspritze einen süßen Saft, ja, soll es denn selbst die Soße zu einem Mahl beisteuern, bei dem es das Hauptgericht ist? Was eine gefangene Kreatur dir schenkt, wird immer bitter sein, schöne, dumme Prinzessin! Die Neugierde ist gewiß eine wertvolle Triebkraft, aber der Kopf muß einem sagen, wann man ihr folgen soll und wann nicht.«
Gilias blaue Augen blitzten zornig. Sie biß sich auf die Lippen, denn sonst hätte sie dem Elfen erklärt, daß sie sich fast sicher gewesen war, der Saft werde eklig schmecken, und daß sie sich Lindions Wunsch nur gefügt hatte, weil er ›Tu‘s mir zuliebe‹ gesagt hatte. Aber solche Geständnisse hörte Lindion nicht gern, nicht mehr, seit ein paar Tagen ... »Gib ihn frei!« bat sie noch einmal. »Nun, da er dir soviel Freude bereitet hat ...«
Lindion hob den Kopf. Seine dunklen Augen blickten ernst. »Du hast mich gebeten, dein Lehrer zu sein, erinnerst du dich nicht?«
»Doch, doch.« Gilia nickte heftig. »Aber manchmal machst du es mir nicht leicht, deine dankbare Schülerin zu sein.«
Der Elf betrachtete noch eine Zeitlang den gefangenen Troßwagen, dann, als die Hündin auf den Käfer aufmerksam geworden war und sich Lindions Hand mit schnüffelnder Nase näherte, warf er ihn wiederum in die Luft. Diesmal strebte der Käfer laut und zornig brummend in gerader Linie den Bäumen zu. Lissa verfolgte ihn hüpfend und aus voller Kehle bellend bis zum Waldrand.
Lindion sah den beiden nach. »Du hättest das Tier nicht mitnehmen sollen, Gilia«, sagte er mit dunkler, leiser Stimme, wie in Gedanken versunken. »Es nützt uns in keiner Weise, aber es vertreibt alles Wild in einem Umkreis von mehr als tausend Schritt.«
Die Frau zuckte die Achseln und lächelte versöhnlich. »Du hast gewiß recht, aber nun ist Lissa einmal bei uns, und ich kann sie hier, mitten in der Wildnis, doch nicht einfach davonjagen. Sie würde nur ein paar Tage überleben, so jung und tapsig, wie sie ist.« Die Hündin, die ihren Namen gehört hatte, kam herbeigesprungen, näherte sich geduckt Gilias Füßen, biß plötzlich in das lederne Hosenbein und zerrte knurrend daran herum.
Lindion beobachtete das Spiel mit unbewegter Miene. »Du hast recht. Es würde nicht überleben, aber ich kann es töten, so daß es kaum etwas spürt. Das wäre die beste Lösung.«
Die Frau zuckte zusammen. Ihr Kopf ruckte hoch, und sie starrte ihren Gefährten an. In ihrem Blick mischten sich Überraschung und Zorn. »Eine Lösung nach Elfenart, hm? Wahrscheinlich denke ich wieder einmal falsch, wenn ich deinen Vorschlag grausam finde.« Sie hob den rechten Zeigefinger und ahmte die langsame, jedes Wort betonende Sprechweise des Elfen nach. »Es gibt keine Grausamkeit in der Natur. Alles folgt einem Zweck ... Die Zweckmäßigkeit ist gewissermaßen die Moral der Natur. Ein Bär, der einen Bienenstock zerstört, ohne den Honig zu fressen, würde unmoralisch handeln, aber ein solches Handeln kommt im Wald nicht vor ... Das wäre das richtige Denken, nicht wahr?«
Lindion nickte. »Das ist das richtige Denken, daran zweifle ich nicht. Nur weil uns mehr Verstand gegeben ist als den meisten Tieren, sind wir nicht vom Zweckdenken der Natur freigestellt. Wir können nur weiter blicken als manch andere Kreatur und haben folglich mehr Verantwortung zu tragen als sie, da wir nicht nur die unmittelbaren, sondern auch die mittelbaren Folgen unserer Taten bedenken müssen. Auf keinen Fall sind wir von der Pflicht entbunden, niemals unnötig Leben zu gefährden oder gar zu vergeuden. Und wenn es die Zweckmäßigkeit erfordert, Leben gegen Leben aufzurechnen, dann müssen wir uns diesem Zwang stellen und dürfen nicht einfach die Augen davor verschließen.«
Sie öffnete den Mund zu einer Erwiderung, schloß die Lippen aber sofort wieder. Erst nach ein paar Augenblicken trug sie in beherrschtem Ton ihre Antwort vor: »Eine Lösung, bei der ein unschuldiges Lebewesen grundlos getötet wird, folgt wohl kaum dieser vielgepriesenen Zweckmäßigkeit. Meinetwegen können wir zur Misa zurückkehren und Lissa dort einem Schiffer schenken, wenn sie dir so sehr auf die Nerven geht.«
Lindion verschränkte die Hände hinter dem Kopf, legte sich rücklings ins Gras und blickte in den Himmel hinauf. Wieder sprach er leise und langsam, so, als formuliere er für sich selbst einen Gedanken: »Ohne daß ich dich je dazu aufgefordert hätte, hast du mir mehr als einmal überschwenglich versprochen, du wolltest meine Denkund Lebensweise zu der deinen machen; aber du bist weiter davon entfernt denn je. Du wirst zeit deines Lebens denken und handeln wie ein Mensch: Du hältst Gefühle für Argumente, selbst in solchen Momenten, da du in aller Ruhe eine Entscheidung treffen kannst. Wenn aber einmal höchste Eile geboten ist, folgst du nicht deinen Gefühlen, die schneller Rat geben können, als der Blitz aus den Wolken fährt, sondern verfängst dich in den Schlingen deiner Gedanken ...«
Gilia stieß den spielenden Hund mit dem freien Fuß zurück und sprang erregt auf. »Mir ist jeder Sinn für elfische Betrachtungen vergangen! Da wir beide wissen, worauf du am Ende hinauswillst, kann ich dir von vornherein sagen: Mir ist es gleich, ob es meine Gefühle oder meine Gedanken waren, die meine Entscheidung bestimmt haben. Sie ist so oder so unumstößlich – also finde dich damit ab: Lissa bleibt am Leben.«
Der Elf regte sich nicht. Er blickte hinauf in den Himmel, am Gesicht der dicht bei seinem Kopf stehenden Frau vorbei, und folgte mit den Augen der Bahn einer schnell ziehenden Wolke.
»Es hat unter dem Himmelsdach alles seine Zeit: die Gefühle und die Gedanken. Einmal muß man dem einen folgen, ein andermal dem anderen. Meistens aber gilt es abzuwägen, dem einen und dem anderen Rat zu lauschen und beide Teile zu einem Ganzen zu verbinden. Solches Handeln ist gewiß das natürlichste. Manchmal aber muß man eine Entscheidung treffen zwischen beiden Teilen, nein, manchmal muß man dem stärkeren von beiden folgen, und oft ist es das Denken, das den Sieg davonträgt, denn es hat sich in langer Erfahrung herausgebildet und gestärkt, während die Gefühle stets neu und frisch sind und niemals etwas lernen. Unter allen Wesen seid ihr Menschen von der seltsamsten Art, denn ihr hört selbst dann nicht auf eure Gedanken, wenn sie euch ganz unzweideutig das Richtige raten. Selbst ein dummes Tier wie das Pferd fügt sich beim Handeln vorwiegend seinen Einsichten und nicht seinen Gefühlen. Es mag noch so sehnsüchtig auf eine fette grüne Weide schielen – wenn es einmal gelernt hat, daß dort der grimme Wolf lauert, wird es sich sein Futter zwischen den Stacheldisteln nebenan suchen. Es kann sich den Wolf nicht einfach fortdenken, so wie ihr Menschen das gern tut: Wenn wir zwischen dieser Wiese und der Misa gestern noch zehn Orks beobachtet haben, dann mußtest du sie vermutlich erst in deinen Gedanken verschwinden lassen, bevor du mir vorschlagen konntest, wir sollten zur Misa zurückkehren und fünf Leben aufs Spiel setzen, nur um das eines Hundes zu retten, der noch nicht einmal ein richtiger Hund ist und nicht weiß, was er verliert.«
Gilia hob abwinkend die Hand. »Ach was! Wir sind den Schwarzpelzen auf dem Herweg mühelos ausgewichen. Sie werden uns auch auf dem Rückweg nicht erwischen ...«
»... und uns auf dem nochmaligen Rückweg wiederum ungeschoren lassen«, warf Lindion ein. »Gefühle und Hoffnungen leiten dich! Aberwitzige Hoffnungen! Deine Narrenliebe zu diesem Hund macht dich blind und taub! Was weißt du schon von den Nasen und der Beharrlichkeit der Orks? Es mag sein, daß sie unsere Fährte doch noch aufgenommen haben und irgendwo dort drüben in den Wäldern stecken. Dann hat der Hund ihnen soeben gemeldet, wo sie ihre Beute suchen müssen.«
»Höre ich Ironie oder gar Sarkasmus aus deinen Worten? Welch unelfischer Klang!« Gilia kniete sich ins Gras, um der Hündin, die sich vor ihr auf den Rücken geworfen hatte, gedankenversunken den von einem dünnen Flaum bedeckten runden Bauch zu streicheln. »Ach, was rede ich da?« murmelte sie nach einer Weile. »Das waren alberne Worte. Verzeih, Lindion!«
»Was gäbe es da zu verzeihen? Du hast ausgesprochen, was du denkst. Es ist nicht deine Schuld, daß du den Menschen in dir nicht verleugnen kannst. Auch für den Zorn, der in deinen Worten lag, bist du nicht verantwortlich zu machen. Euch Menschen ist es eigen, in Zorn zu geraten, wenn ihr etwas nicht versteht.«
»Euch Menschen ...«, wiederholte Gilia. »Du weißt, daß ich es nicht mag, wenn du von den Menschen im allgemeinen sprichst, obwohl du eigentlich mich persönlich meinst – als gehörte ich zu einem Volk von Ameisen.«
»Du erträgst es nur deshalb nicht, gemeinsam mit allen Menschen genannt zu werden, weil du anders sein wolltest als alle anderen und weil du darauf gehofft hast, ich könnte dir dabei helfen. Und nun näherst du dich dem Tag, da du dir eingestehen mußt, daß es dir nicht gelingen wird. Das macht dir angst, das versetzt dich in Zorn.«
»Du weißt, daß ich um deinetwillen nach dieser Veränderung strebe, Lindion.« Gilia wischte sich mit dem Handrücken eine einzelne Träne von der Wange. »Ich will immer bei dir sein, und ich will so sein wie du.«
Noch immer schaute der Elf zu den treibenden Wolken hinauf. »Es wird dir nicht gelingen«, sagte er. »Weder das eine noch das andere ... Wir werden uns trennen, Prinzessin«, fuhr er nach einer Pause fort, »sobald wir Skorpsky erreichen. Wir haben uns geirrt, du und ich.«
Gilia zuckte zusammen, als hätte sie ein Schlag getroffen. Ihre Hand wanderte weiter über den warmen Hundebauch, während sich ihre Augen mit Tränen füllten. Mit heiserer Stimme fragte sie schließlich: »Das soll das Ende sein? So willst du es haben? ›Wir haben uns geirrt‹ – und den Göttern befohlen?«
Der Elf gab keine Antwort. Gilias Blick suchte seine Augen, doch sie fand keine Verheißung darin, keine Liebe – nur eine beklemmende Fremdheit. Ist das schon immer so gewesen? schoß es ihr durch den Kopf. O nein! O Rahja, bitte nein! Er schaut immer gleich, nicht wahr? Auf den Troßwagen wie auf mich – aber der Käfer hat sich wenigstens gewehrt und ihn mit bitterem Saft bespuckt! Sie unterdrückte ein Schluchzen und hätte gern auch ihre Worte unterdrückt, aber die drängten sich ihr unaufhaltsam über die Lippen: »Warum kam es nicht früher, dieses Ende nach deiner Art? Warum nicht, solange noch etliche Dukaten in meinem Beutel steckten? Warum nicht, bevor ich die letzten Goldstücke dem Hauptmann in Vallusa gab, damit er dich aus dem Kerker entließ?«
»Ich hatte dich nicht darum gebeten. Das weißt du.« »Warum nicht während einer dieser Abende am Spieltisch, als du mich um einen Dukaten nach dem anderen batest? Ja, darum hast du mich gebeten – oder erinnerst du dich nicht mehr daran?«
Als Lindion den Blick wieder schweigend zum Himmel wandte, loderte in Gilia plötzlicher Haß auf wie eine den Atem raubende Flamme. Sie haßte den Elf für sein Schweigen, und sie haßte sich für ihre kleinlichen Worte. Es war ihr, als könne sie die Gedanken ihres Gefährten hören, der sich durch jedes ihrer Worte in seiner Überzeugung bestätigt fühlen mußte, daß kleinliche, dukatenzählende Menschenfrauen nicht zu souveränen, auch in der Abschiedsstunde gelassen den Himmel beobachtenden Elfenmännern paßten. Vor etlichen Monden, wenige Tage, nachdem Gilia dem Elf zum ersten Mal begegnet war, hatten sie einmal – zum Spaß und rein theoretisch, so hatte sie es empfunden – über den Abschied geredet, der irgendwann kommen würde. Tief überzeugt von den eigenen Worten, hatte sie Lindion darin zugestimmt, daß es ein schlichter Abschied ohne viele Worte, ohne Aufrechnen und Vorhaltungen sein würde, geprägt von einer gewissen Lässigkeit, mit einem Achselzucken als bekräftigender Geste. Anschließend würde jeder sich umwenden und seiner Wege gehen, um später einmal mit Freuden an eine Zeit denken zu können, die bis zu ihrem allerletzten Moment außergewöhnlich gewesen war. So hatte sie es sich ausgemalt, und nun hatte sie es verdorben – wie sie in ihrem Leben alles verdarb. Weitere kleinliche Vorwürfe stiegen in ihr auf. Gleich würden sie hervorsprudeln, eine endlose Flut der peinlichen Vorhaltungen, jede einzelne nicht dazu gedacht, Lindion umzustimmen, sondern sie, Gilia, nur tiefer in den Staub der Erbärmlichkeit zu stoßen. ›Du hast mich von Kurkum fortgelockt, wo ich glücklich war.‹ So würde sie beginnen. ›Fortgelockt mit falschen Versprechungen!‹ ... auch wenn er ihr niemals irgend etwas versprochen hatte. Jedes Geschenk das sie ihm gemacht hatte, würde sie aufzählen, wenn nicht ... Wenn nicht irgend etwas ganz Schreckliches geschah und sie zum Schweigen brachte. Sie stöhnte auf. Noch immer auf dem Boden hockend, zog sie langsam ihren Dolch aus der Gürtelscheide, hob ihn empor und stieß ihn der kleinen Hündin so heftig in die Kehle, daß er zum Nacken wieder herausfuhr und sich tief in den weichen Boden grub. Lissa streckte stumm Vorderund Hinterpfoten aus, dehnte sich weiter und weiter ... und erschlaffte mit einem Ruck. Ihre braunen Augen schauten wie die des Elfen zum Himmel empor.
Gilia zog den Dolch aus der Wunde – helles Blut schäumte in das weiße Fell ergriff das Tier: es war weich, warm und seltsam schlaff – mit beiden Fäusten und schleuderte es dem Gefährten auf die Brust. »Hier, nimm! Ich hoffe, es ist recht so!«
Sie hob wiederum den Dolch und stieß von neuem zu, diesmal um sich selbst die Klinge tief in den Oberschenkel zu bohren, aber ihr Handgelenk steckte plötzlich in einer eisernen Klammer. Sie starrte verständnislos auf die schlanken Elfenfinger, auffällig verdickt an den Knöcheln, und versuchte, die Dolchklinge so zu drehen, daß sie Lindions Handgelenk zerschnitt, da traf sie eine wuchtige Ohrfeige mitten im Gesicht, so daß sie nach hinten geschleudert wurde. Den Dolch immer noch in der Faust, rollte sie durch das Gras, warf sich herum, sprang auf. Lindion sah sie abwartend an, hob aber kaum die Hände.
Ihr Blick fiel auf die tote Lissa, die lächerlich verdreht im Gras vor Lindions Füßen lag, und sie ließ den Dolch fallen, riß die Hand hoch und stopfte sich die Faust, so tief sie es eben vermochte, in den stöhnenden Mund.
»Komm zu dir!« mahnte die Elfenstimme, melodiös, leidenschaftslos. »Bedenke, du bist die Tochter einer Königin. Du solltest dich nicht gehenlassen.«
Gilia hob die Hand vor die Augen und betrachtete die blutigen Spuren, die ihre Zähne auf den Knöcheln zurückgelassen hatten. Ihr Blick verschwamm, weil ihr wieder Tränen in die Augen traten. Sie schluckte, schloß die Lider und nickte langsam mit dem Kopf, wie eine Schülerin, die sich müht, einen Lehrsatz zu memorieren. Als sie wieder sprach, war ihre Stimme fest geworden, und ihre Züge hatten sich geglättet. »Die Tochter einer Königin war ich einmal, dann war ich die Magd eines Elfen – aber auch das ist nun vorüber. Ich sollte dich erschlagen, Lindion, denn du hast mein Leben zerstört.«
Der Elf hatte damit begonnen, einige verstreut liegende Ausrüstungsgegenstände zusammenzutragen. »Es wird Zeit, daß wir aufbrechen«, sagte er über die Schulter. »Wir waren schon zu lange an diesem Fleck. Ich habe ein ungutes Gefühl, wenn ich an diese orkischen Strauchdiebe denke.« Er schnürte einen Leinensack zu und fuhr dann fort: »Ein Leben kann genommen, aber niemals zerstört werden. Dein Leben ist ein Krug, den du füllen mußt. Solange der Krug nicht zerschlagen ist ...«
»Spar dir deine klugen Worte«, warf Gilia ein. »Sie sind an mich verschwendet. Du magst dich gut zurechtfinden in deiner Welt der unwiderlegbaren Argumente und beherrschten Gefühle, stets behende Aufwand und Ertrag miteinander verrechnen und zufrieden deine von keiner Sentimentalität getrübten Schlüsse ziehen. Wenn ich in unseren gemeinsamen Tagen eines gelernt habe, so dieses: Nie könnte ich so sein wie du – deine Lebensklugheit hat etwas Ekelerregendes!«
Lindion befestigte, während er sprach, den Leinensack am Pferdesattel. »Für unsere Liebe gab es zwei Möglichkeiten: Ich hätte so werden können wie du oder du so wie ich. Du hast mir immer wieder versprochen, daß du mir folgen würdest, aber nun siehst du selbst, daß es dir nicht möglich ist. Diese Einsicht mag dir helfen, über deinen verletzten Stolz und den Verlust der von dir erträumten Zukunft hinwegzukommen.«
»Wie schnell Fremdheit wachsen kann«, stellte Gilia mit nüchterner Stimme fest. »Mit jedem Augenblick wirst du mir fremder – ich erkenne dich kaum mehr.«
Lindion zuckte die Achseln, und sie begann mit Hilfe eines kleinen Handbeils die Grassoden am Rand der Lichtung abzutragen.
»Was tust du da?« fragte der Elf. »Ich hebe eine kleine Grube für Lissa aus. Ich kann sie nicht einfach so liegenlassen.«
Lindion legte den Kopf in den Nacken und wandte das Gesicht mit geschlossenen Augen dem Wald zu.
»Laß es lieber bleiben«, sagte er nach ein paar Augenblicken. »Mein ungutes Gefühl wird stärker. Wir sollten uns auf den Weg machen.«
Die blonde Frau blickte nicht von ihrer Arbeit auf. »Reite, wenn du reiten willst. Ich werde den Weg nach Skorpsky auch ohne dich finden.«
»Wann wirst du je zu einer klaren Sicht der Dinge gelangen, Gilia? Der lebende Hund war es nicht wert, unser Leben aufs Spiel zu setzen, und der tote ist es erst recht nicht. Du machst nichts ungeschehen, wenn du dem Tier jetzt ein Grab bereitest, als wäre es ein Mensch, der an die Zwölfgötter glaubt. Laß es hier liegen, damit es anderen Tieren zur Nahrung dienen kann. Nichts Unrechtes ist an diesem Kreislauf, und ...«
Gilia arbeitete verbissen weiter. »Reit fort und genieß deinen klaren Blick auf die Dinge!« rief sie. »Stör mich nicht länger bei meinen sentimentalen Nutzlosigkeiten!«
Lindion bückte sich, um den Lederriemen zu lösen, der die Vorderbeine seines Pferdes miteinander verband. Er führte das Tier am Zügel hinüber zu der Frau, die weiterhin das Handbeil in die schwarze Erde trieb und mit beiden Händen lockere Brocken aus der Grube schaufelte. »Sei vernünftig!« mahnte er. »Die Orks werden kommen – dessen bin ich mir gewiß. Mein Gefühl täuscht mich nicht, und es ist stärker geworden. Noch bevor die Sonne über dem Wipfel dieser alten Ulme steht, werden die Schwarzpelze hier auf der Lichtung erscheinen ...« Er sah Gilia ein paar Augenblicke lang bei ihrer Arbeit zu, dann fuhr er fort: »Ich kämpfe nicht für einen toten Hund. Verstehst du das?«
Die Frau warf ihm einen raschen Blick zu. »Zwischen uns ist alles gesagt.«
Lindion stieg in den Sattel, schlug dem Braunen die Zügel auf den Hals und stieß ein leises Schnalzen aus. Ohne sich noch einmal umzublicken, trabte er über die Lichtung und lenkte das Reittier zwischen zwei Haselsträuchern hindurch auf den schmalen Waldpfad nach Norden.
Gilia starrte auf die weiche Erde in ihren Fäusten. »Nimm ruhig das Pferd!« murmelte sie leise. »Es gehört zwar mir, aber ich schenke es dir.«
Erst als ihr die Grube tief genug erschien, schaute sie wieder auf und blinzelte in die Sonne, die tief über dem kahlen Wipfel der alten Ulme stand. Sie ging hinüber zu der toten Hündin, schnallte die Wasserflasche vom Pferdesattel und wusch sorgfältig das an einigen Stellen bereits angetrocknete Blut aus dem weißen Fell. Dann trug sie den Leichnam, der ihr schwerer schien, als es die lebende Lissa je gewesen war, zu dem Erdloch und legte ihn hinein. Sie deckte als erstes die Grassoden über das Fell und stieß dann die ringsumher aufgehäufte Erde in das Loch. Mit einem Kopfnicken verabschiedete sie sich und ging zu ihrem Apfelschimmel hinüber. Als sie sich vornüberbeugte, um ihm die Fußfessel zu lösen, traf sie ein Pfeil in die Seite. Vom Aufprall herumgeworfen, stürzte Gilia ins Gras, stemmte sich aber sofort wieder hoch. Noch im Knien riß sie den schlanken Amazonensäbel aus der Scheide. Vom Waldrand drang ihr kehliges Geschrei an die Ohren. Sie stand auf und drehte sich so daß sie das Pferd im Rücken hatte. Dann stürmten die Orks aus ihren Verstecken. Sie trugen weite Hosen oder Röcke und bunte Wämser über dem schwarzen Fell – offenbar hatten sie vor kurzem lohnende Beute gemacht. In den haarigen Fäusten hielten sie steingespickte Knüppel, kurzstielige Äxte und breite Säbel, in deren Schneiden sie tiefe Scharten gefeilt hatten.
»Für die Königin, für Rondra!« murmelte Gilia und hob ihre Klinge.
2. Kapitel
Gut Geestwindskoje im Rondra 1020 n. BF.
Flottenmanöver
»Ein stolzes Schiff, fürwahr, Herr Flottenmeister. Welchen einen Namen wollen wir ihm wohl geben? Laß mich überlegen! Ein schöner Name muß es sein ... Kaiserin von Ferdok, so soll es heißen!«
»... von Ferdok? Nie gehört, Admiral. Von Festum meinst du wohl ...? Kaiserin von Festum, meinetwegen.«
Erborn von Geestwindskoje schüttelte so heftig den Kopf, daß ihm die braunen Ringellocken ins Gesicht fielen. Mit vorgestülpter Unterlippe blies er sie zur Seite, womit er wenig ausrichtete, aber die Hände konnte er nicht zu Hilfe nehmen: Mit der linken hielt er den Kopf einer Ziege zurück, die unbedingt aus dem ›Perlenmeer‹ trinken wollte und mit der rechten zog er einen rostroten Wollfaden, an dessen Ende ein kleiner Viermaster schaukelte, durch das algig grüne Wasser im steinernen Viehtrog. » Ferdok, du Tropf!« Erborn warf seinem Spielgefährten einen strengen Blick zu. »Ferdok ist die schönste Stadt der Welt – das weiß ich von der Mutter.«
»Meinetwegen dann eben ›Kaiserin von Ferdok‹, Hochwohlgeboren.« Wassjef hob die Schultern und kehrte die Handflächen nach außen. »Mir ist es gleich. Hochwohlgeboren.«
Erborn zog das Schiffchen heran, hob es vorsichtig aus dem Wasser und legte es auf das Moospolster neben dem Trog. Sogleich drängte die Ziege ihren mit weißen Flecken übersäten braunen Kopf an ihm vorbei und begann geräuschvoll zu saufen, wobei sie die Schivone Sewerien zum Kentern brachte. Mißvergnügt fischte Erborn auch das zweite Schiff aus dem Steinbecken und blies ein paar Wassertropfen von den pergamentenen Segeln. Wassjef nahm ihm das Schiffchen vorsichtig aus der Hand. »Der Kielstein ist zu leicht, Hochwohlgeboren«, sagte er. »Ich will es mit einem anderen probieren.« Er suchte in dem kleinen Häufchen flachgeschliffener Kiesel, die er vom Strand mitgebracht hatte, nach einem geeigneten Steinplättchen, fand eines, entfernte das alte und schob das neue in einen Schlitz, den er von unten in den Rindenrumpf der kleinen Schivone geschnitten hatte. Die Sewerien bestand – ähnlich wie die Kaiserin – aus einem sorgfältig beschnitzten Stück Eichenborke, in dem oben ein paar entrindete dünne Weidenruten steckten, über die leicht gewölbt und zweimal durchstoßen, damit sie Rahsegeln ähnelten – rechteckige Pergamentblättchen geschoben waren, geschnitten aus einem Bogen, den Erborn aus der Schreibstube stibitzt hatte, und teils mit bunten Farben, teils mit einem Wolf geschmückt, dem bornischen Wappentier. Die Sewerien hatte drei Masten, die Kaiserin gar derer vier. Die beiden Jungen waren frühzeitig darin übereingekommen, daß ihre Perlenmeerflotte ausschließlich aus Dreiund Viermastern – möglicherweise, wenn sich ein geeignetes Rindenstück fand – auch aus einem Fünfmaster bestehen sollte.
Die Ziege hatte sich, nachdem sie den Kopf in den Nacken geworfen und ausgiebig die krummen Hörner geschüttelt hatte, staksbeinig schlendernd von der Tränke zurückgezogen und untersuchte nun die rings um den Trog verstreuten Rindenspäne auf ihre Eßbarkeit. Wassjef setzte die Sewerien aufs Wasser und prüfte ihre Standfestigkeit, indem er den Hauptmast kräftig zur Seite drückte. Mit einem Ruck schnellte das Schiffchen in die senkrechte Stellung zurück, sobald es losgelassen wurde. »Na also, Hochwohlgeboren«, stellte er mit einem befriedigten Nicken fest. »Nun ist sie unsinkbar.«
»Du sollst nicht immer ›Hochwohlgeboren‹ zu mir sagen, Wassjef«, murmelte Erborn während er mit verdrießlicher Miene die Kaiserin über das Moospolster schob. »Du weißt, ich mag das nicht. Und Mutter sagt auch, du brauchst das nicht zu tun.«
»Stimmt schon, Hochwohlgeboren. Aber genausowenig mag ich es, wenn Ihr ›Tropf‹ zu mir sagt.« Ein überraschender Ernst lag in der Stimme des hochaufgeschossenen flachsblonden Jungen. »Seht einmal, ich werde vierzehn im nächsten Efferd, und Ihr seid erst sechs ...«
»Fast sieben!«
»Ganz gleich. Was denkt Ihr wohl, was ich mit einem anderen Knir... mit irgendeinem anderen täte, der mich einen ›Tropf‹ geschimpft hätte?«
Erborn schob, ohne aufzublicken, das Schiffchen durch das Moos. »Ist ja schon gut«, murmelte er kaum hörbar. »Mein Vater sagt zu allen Leuten ›Tropf‹, und keiner findet was dabei.«
»Woher wollt Ihr das wissen?« Wassjef hatte einen scharfen kleinen Dolch aus der Gürtelscheide gezogen und schnitzte verbissen an einem Rindenbrocken herum. »Euer Kutscher, der alte Gorm, zählt jetzt fast siebzig Götterläufe. Habt Ihr ihn schon einmal gefragt, ob es ihm gefällt, so geheißen zu werden?«
Erborn gab keine Antwort. Er spürte an dem Brennen auf den Wangen, daß er rot geworden war, und hielt den Kopf weiter tief gesenkt, um die schändliche Farbe vor dem älteren Jungen zu verbergen. ›Tropf‹ hätte er wirklich nicht sagen sollen – es war ihm herausgerutscht, aber nun konnte er es nicht wieder zurücknehmen, denn bei einem Leibeigenen, das hatte ihm der Vater erklärt, entschuldigte man sich nicht. Andererseits war es sehr wichtig, daß Wassjef wieder gut mit ihm war, denn Wassjef schnitzte nicht nur prachtvolle Kriegsschiffe, er war überhaupt und in jeder Hinsicht bewundernswert. Er war fast so groß wie ein Erwachsener hatte lange blonde Haare, ganz wie Erborns Vater, er kannte unheimliche Geschichten von Dünengeistern und Gespensterschiffen, und er vertrieb Bardo, den tollwütigen Hahn, der den kleinen Kindern in den Nacken sprang, mit einem einzigen Besenstreich. Wenn er nur nicht so empfindlich gewesen wäre und bisweilen so seltsame Reden geführt hätte! Der Vater mochte es auch nicht leiden, wenn Wassjef diese merkwürdigen Dinge sagte. Manchmal gab es deswegen sogar Streit mit der Mutter. »Dein Ziehknabe!« schimpfte der Vater dann – womit er Wassjef meinte. »Das ist der Dank dafür, daß ich ihm das Lesen und Schreiben beibringen lasse – nun wiegelt er mir die Leut auf!«
Erborns Mutter hingegen schätzte Wassjef sehr. Sie hatte ihn gleich beim ersten Mal, als sie ihn erblickte, ins Herz geschlossen. Der Junge war damals neun Jahre alt gewesen, klapperdürr und in Lumpenfetzen gehüllt. Da niemand seine Eltern kannte – er hatte in einer kalten Efferdnacht, als Neugeborener in eine Decke gewickelt, vor der Tür des Pferdestalls gelegen –, hatte sich die Stallmagd Sula seiner angenommen. Sula, eine warmherzige Mittvierzigerin, hatte damals gerade ihre fünfzehnjährige Tochter auf rätselhafte Weise verloren: Das Mädchen war von einer Reise zu einem Heiler in einem Nachbardorf nicht zurückgekehrt und für immer spurlos verschwunden. Für ihre traviagefällige Tat war Sula von der Herrschaft mit Sonderrationen und einigen Goldstücken belohnt worden. Aber im selben Efferd, als Wassjef sieben Jahre alt geworden war, hatte der Rapphengst des Grafen von Geestwindskoje die Magd Sula totgetreten, und der Schweinemeister Freidjew, der danach den Waisen zu sich nahm, war im Efferd des nächsten Jahres unter die Räder eines Kornfuhrwerks geraten und gestorben – nach vier langen Monden qualvoller Schmerzen, die ihm sein zerquetschter Unterleib bereitet hatte. Seitdem hatte niemand unter den Knechtsund Magdsleuten auf Geestwindskoje sich des schweigsamen dünnen Buben annehmen mögen. Er habe das Unheil in sich, hieß es allenthalben, und er werfe es über die, welche sich mit ihm einließen.
Da Graf Arvid aber verboten hatte den Jungen davonzujagen oder ihm sonstwie zuzusetzen, hatte das Gesinde ihn stumm geduldet und nur danach getrachtet, ihm aus dem Weg zu gehen. Wassjef hatte in einem Verschlag neben der Futterkammer gewohnt und fast das Leben eines erwachsenen Knechtes geführt fast, denn nachdem der Graf das Gut verlassen hatte, um in die Welt zu ziehen, hatte niemand mehr darauf geachtet, daß Wassjef – wie die anderen Knechte und Mägde – seinen kargen Lohn erhielt, obwohl er seine Arbeit im Stall so gut verrichtet hatte, wie er es eben vermochte. Beim gemeinsamen Essen, während dem er stets abseits saß, bekam er erst dann die Schüssel, wenn die hölzernen Löffel der anderen die Speisen bis auf kümmerliche Reste herausgeschabt hatten.
Wassjef hatte nicht oft geweint, denn das Weinen half ja nicht, das tägliche Elend zu vertreiben, aber an manchen Tagen, da wußte er sich nicht dagegen zu wehren, da konnte er nicht anders, als sich in den Stall zu der dicken freundlichen Svelttalerin Mana zu flüchten, das Gesicht gegen ihren haarigen warmen Bauch zu drücken und zu weinen, stundenlang zu schluchzen und zu würgen, bis ihm ganz übel war, der Magen sich zusammenkrampfte und der Mund sich mit bitterer Galle füllte.
An einem solchen Tag, an dem scheinbar keiner der Zwölfe auch nur einen raschen milden Blick auf einen unglücklichen kleinen Jungen werfen mochte, hatte ihn die Gräfin gefunden – die schöne Gräfin Algunde, die der Herr von Geestwindskoje zusammen mit dem kleinen Prinzen Erborn aus der Fremde mitgebracht hatte. Wassjef hatte gar nicht bemerkt, daß jemand hinter ihn getreten war, und auch die leichte Hand auf seiner bebenden, zuckenden Schulter hatte er erst wahrgenommen, nachdem sie schon minutenlang dort gelegen und eine freundliche Frauenstimme gefragt hatte: »Nun, kleiner Mann, was ist denn so Schreckliches geschehen? Vielleicht kann ich dir helfen.«
An anderen Tagen hätte sich Wassjef der herrschaftlichen Dame mit ein paar ausweichenden Antworten zu entwinden getrachtet, aber weil er nun schon so lange geweint hatte, innerlich ganz weich war und alle Kraft ihn verlassen hatte, war es aus ihm herausgesprudelt – alles, von Anfang an. Am Ende hatte Wassjef neben der herrschaftlichen Dame auf der Futterkiste gesessen, den Kopf an ihre Schulter gelehnt und zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder jenes heilsam lindernde Gefühl verspürt, das eine streichelnde Hand zu verströmen vermag. »Ich kenne mich aus mit dem Stalldienst«, hatte die Gräfin schließlich gesagt. »Das ist eine harte Arbeit und gar nicht schön, nichts für einen kleinen Jungen wie dich. Du kommst zu uns ins Haus. Du sollst unser Page sein – und du kannst mit Klein-Erborn spazierengehen.« Am selben Abend noch hatte Wassjef eine kleine Kammer unter dem Dach des Gutshauses bezogen. Das war im Rondra vor fünf Jahren geschehen, an einem schwülen Sommertag, und in dem winzigen Dachzimmer war es brütendheiß gewesen, viel heißer als im zugigen Stall; aber Wassjef hatte geglaubt, er habe das göttliche Paradies betreten, und er hatte sich unwillkürlich nach der Magd Sula umgeschaut, die ihm vor vielen Jahren von den zwölf Paradiesen erzählt hatte und die dort vor langem eingezogen sein mußte. Am nächsten Tag hatte die Herrschaft eine Schneiderin aus dem Dorf ins Gut bestellt, die Wassjef maßnahm für seine neue Uniform, und am übernächsten Tag hatte die Gräfin Algunde ihn in die Bibliothek, einen Raum mit unglaublich vielen Büchern, rufen lassen und ihn einer grauhaarigen Frau gegenübergestellt Die Fremde hatte ein an den Ärmelsäumen durchgescheuertes langes schwarzes Kleid und eine kleine schwarzrandige Brille getragen und verlegen gelächelt. »Das ist die Dame von Scherpinskoje«, hatte die Gräfin erklärt. »Sie bringt mir das Schreiben und das Lesen sowie die Götterkunde, das Rechnen und viele andere nützliche Dinge bei. Diese ganze Lernerei fällt mir nicht immer leicht, lieber Wassjef, und da habe ich mir gedacht, vielleicht arbeitet es sich besser, wenn ich einen Leidensgenossen habe.« So war es gekommen, daß der junge Wassjef – außer dem Großdiener und dem Verwalter – unter dem Gesinde von Geestwindskoje der einzige war, der sich auf die hesindianischen Künste verstand.
Ja, sein Leben hatte sich seit jenem Tag im Rondra von Grund auf verändert. Selbst das Gesinde hatte nach und nach aufgehört, Wassjefs Nähe zu meiden oder ihn gar zu fürchten. Zunächst hatten Rude, der Großdiener, und die Köchin Merissja dem Grafen und seiner Frau fast täglich in den Ohren gelegen, um sie vor dem Jungen und dem Fluch zu warnen, der über dessen Haupt schwebte. Merissja hatte die Gräfin mit Worten und Bitten bedrängt, sie war vor ihr auf die Knie gefallen und hatte ihr Tränen der Verzweiflung auf die Füße hinabrieseln lassen, nur um Algunde von dem schrecklichen Vorhaben abzubringen, das die junge Frau nur allzubald das Leben kosten und den Grafen und ganz Geestwindskoje ins Unglück stürzen würde. Doch die Gräfin war nicht umzustimmen gewesen, und der Efferd war gekommen und gegangen, ohne daß irgend jemandem in Haus und Dorf Geestwindskoje ein bemerkenswertes Unglück widerfahren wäre. Nachdem auch im darauffolgenden Jahr kein Schicksalsschlag die Geestwindskojer getroffen hatte, waren die Knechte und Mägde – die jüngeren zuerst und solche, die noch nicht lange auf dem Gut lebten – nach und nach dazu übergegangen, den jungen Wassjef wieder als einen der Ihren zu betrachten, ihn zu necken und zu schelten, geradeso wie sie es miteinander taten. Und seit sich herumgesprochen hatte, daß der schlaksige blonde Bengel des Schreibens und Lesens mächtig war, nahmen auch die Älteren hin und wieder seine Dienste in Anspruch. Niemand nannte ihn mehr den ›Verfluchten‹. Bald waren seine frühen Jahre und die Düsternis, die über ihnen lag, auf ganz Geestwindskoje fast in Vergessenheit geraten – fast, denn Wassjef vergaß sie nie. An manchen Tagen erfüllte es ihn geradezu mit stiller Glückseligkeit, bei den anderen zu stehen und mit ihnen zu reden und zu scherzen; er spürte dann die Wärme körperlich, die entstand, wenn sich eine Gemeinschaft von Menschen zusammenfand, und er sonnte sich darin. Zu anderen Zeiten aber trat urplötzlich ein schmerzvolles Brennen in Wassjefs Augen, wenn er sich an den dicken Bauch der Stute und den Geruch des tränengenäßten Pferdehaars erinnerte, und er empfand eine tiefe Verachtung für die Leute von Geestwindskoje – nicht für alle wohlgemerkt, nicht für die Gräfin, die er liebte und für die er ohne Zögern in den Tod gegangen wäre, und für den kleinen Erborn, von dem er sich geliebt fühlte.
Jetzt blickte er hinab auf den Lockenkopf des kleinen Grafen, der mit dem Schiffsrumpf inzwischen eine dunkle Rinne in das Moos geschabt hatte und weiterhin den Blick gesenkt hielt. »Wenn du so weitermachst, geht die Kaiserin von Ferdok bald entzwei, Erborn!« mahnte er in strengem Ton.
Der Junge hob den Kopf. »Von Festum! Wassjef«, sagte er mit dankbar strahlenden Augen. »Wir wollen sie Kaiserin von Festum nennen.«
Vom Gutshaus wehten drei Gongschläge heran: Essenszeit für Gesinde und Herrschaft auf Geestwindskoje.
Erborn schätzte es sehr, an der langen Tafel im Speisesaal zu sitzen. Sein hochbeiniger Stuhl hob ihn fast auf die Höhe der Erwachsenen, und an der Mutter vorbei, die ihm gegenübersaß, konnte er durch die hohen Fenster auf das Dorf hinabschauen. Das Gutshaus stand auf einem Hügel und war fast auf allen Seiten von alten Eichen und Kastanien umgeben, aber zwischen den mächtigen Stämmen hindurch hatte man einen guten Blick auf die fernen Schilfdächer der hölzernen kleinen Bauernhäuser, die die sandig gelbe Dorfstraße säumten. Winzigkleine Gestalten saßen da unten auf überdachten Veranden oder einfach auf einem heckengesäumten Plätzchen vor dem Haus, versammelt um grobe weißgescheuerte Tische, und löffelten gemeinsam aus großen Schüsseln das Mittagsmahl. Aufmerksam beobachtete Erborns wie dampfende Kessel aus den Häusern getragen und die Holzschüsseln entleert wurden, wie die Menschen die Köpfe über dem Tisch zusammensteckten und mit ihren Löffeln hantierten. Er verfolgte aufmerksam jede Bewegung auf der Dorfstraße, wenn nach dem Essen der eine oder andere Bauer die sandige Piste überquerte, um sich auf einen kurzen Schwatz zu den Nachbarn zu gesellen. Erborn sagte dann leise die Namen der Leute auf, die er erkannte, und nahm sich vor, Wassjef bei nächster Gelegenheit nach jenen Namen zu fragen, die ihm noch nicht geläufig waren. Fuhrwerke boten ein schönes Bild, wenn sie mit mahlenden Rädern durch den Sand schaukelten, gezogen von dicken Pferden mit nickenden Köpfen oder kantigen Ochsen mit weit ausladenden Hörnern unter einem buntbemalten Joch. Zur Mittagszeit kam es allerdings selten einmal vor, daß ein Wagen auf der Dorfstraße unterwegs war.
»Willst du wohl endlich deine Suppe essen, kleiner Geestwind!«
Des Vaters Stimme dröhnte so plötzlich und laut in Erborns Ohr, daß der Junge zusammenfuhr und den Löffel in den Suppenteller fallen ließ. Klare Brühe schwappte über, kleine Würfel Roter Bete hupften rings um den Teller über das weiße Tischtuch.
Graf Arvid lachte schallend, seine Rechte zerwühlte Erborns Locken. »Auf diese Art kann man natürlich auch einen Teller leeren«, stellte er fest. »Nicht ungeschickt, kleiner Geestwind.« Die Mutter, Kruschin, der Gutsverwalter, Frau von Scherpinskoje und Tante Yasinde, die aus Festum angereist war und seit ein paar Tagen auf Geestwindskoje weilte, stimmten in Arvids Gelächter ein. Erborn hätte im ersten Schreck fast losgeheult, doch nun, da alle über ihn lachten, gewann der Ärger rasch die Oberhand. Er streifte des Vaters Hand ab und funkelte ihn zornig an. »Du sollst nicht immer ›Tropf‹ zum alten Gorm sagen!« rief er trotzig.
»Soso«, Graf Arvid hob die Schultern. »Und warum nicht, wenn ich fragen darf?«
»Darum nicht!« knurrte Erborn. »Fein! Eine feine Antwort!« Arvids Stimme hatte einen ernsten Klang angenommen. »Wenn du mit den Erwachsenen an einem Tisch speisen willst, mein Lieber, dann benimm dich gefälligst nicht wie ein Milchsäugling! Sonst bekommst du demnächst dein Breichen gemeinsam mit Selissa, im Kinderzimmer ... Und nun gib mir eine vernünftige Antwort: Wenn Gorm sich wie ein Tropf benimmt, warum, bei allen Zwölfen, soll ich ihn dann nicht so nennen?«
Die Vorstellung, demnächst nur noch in Gesellschaft der ewig plärrenden und bisweilen übel duftenden Selissa die Mahlzeiten einnehmen zu dürfen, hatte Erborn einen gehörigen Schreck versetzt. Er suchte nach einer Antwort, die den Vater zufriedenstellen würde, fand aber keine.
»Diese Mücken hat dir doch wieder Wassjef ins Ohr gesetzt, hm?« fragte Graf Arvid.
Erborn setzte zu einem heftigen Kopfschütteln an, besann sich aber sofort. Die Lage hatte sich ohnehin häßlich zugespitzt; wenn er sich jetzt noch bei einer Lüge ertappen ließe ... Der Vater haßte Lügen, log selbst nie und durchschaute jeden Schwindel sofort. Zur Not brauchte er nur nach Erborns kleinem Finger zu fassen, der jedesmal durch ein verräterisches Klopfen preisgab, wann Erborn die Unwahrheit sagte. Vorsichtig zog er die Hände vom Tisch, um auf dem Schoß die Fäuste zu ballen, die kleinen Finger tief in die Handflächen gepreßt.
Auf der Dorfstraße bewegte sich etwas: Pferde, vier Pferde, zwei Rappen, zwei Schecken, dahinter eine schwarze Kutsche, offen, leicht gebaute ein sogenannter Jagdwagen. »Besuch!« rief Erborn laut. »Wir bekommen Besuch!«
Eine Viertelstunde später hatte der Gast an der Mittagstafel Platz genommen, eine Gräfin aus dem hohen Norden, dem fernen Sewerien. Die schlanke große Frau trug ein enggeschnittenes Wams aus taubenblauem Samt und eine ebensolche Hose, die bis knapp über die Knie reichte, dazu schimmerndweiße Strümpfe aus Brabaker Seide und schwarze Schuhe mit goldenen Spangen. Ihre Haare waren von hellstem Blond und fielen ihr in ungebändigten Locken bis über die Schultern hinab. Von hellem Blau, fast wie Saphire, waren ihre Augen, und hell war ihre Haut. Eine lichthafte Kühle schien von ihr auszugehen – hätte man der Gräfin eine Stunde des Tages zuordnen sollen, so hätte wohl ein jeder den frühen Morgen gewählt. Sie schien umgeben von jener feinen Brise, die den Menschen auch an heißen Tagen eine seltsam wohlige Gänsehaut auf Arme und Beine zaubert. Von diesem Morgenhauch umweht, war die Gräfin an der Seite von Arvid durch den Türbogen getreten, hatte das Zimmer durchschritten und Algunde, Yasinde von Geestwindskoje, Frau von Scherpinskoje und zuletzt auch Erborn die Hand geschüttelt. Verwundert schaute der Kleine auf seine Hand und spürte dem kräftigen Händedruck nach, der Festigkeit, ja Härte der Handfläche: die Hand einer Reiterin.
Die Frau war nicht mehr jung, aber das war eher zu ahnen als zu sehen, und sie erschien Erborn schöner als das Bildnis der göttlichen Rondra in seinem Zwölfgötterbrevier.
Bei der Tür räusperte sich der Großdiener Rude. »Wird gewünscht, daß ein Suppengedeck für die Gräfin von Ilmenstein nachgetragen wird?« fragte er mit einer Verbeugung.
Thesia von Ilmenstein, die an Erborns rechter Seite Platz genommen hatte, tippte mit dem Zeigefinger gegen eines der roten Würfelchen auf dem Tischtuch. »Ich denke, ich verzichte«, sagte sie. »Ich habe heute früh im Gasthof recht ordentlich gespeist. Auch habe ich das Gefühl, daß diese Suppe nicht von jedermann am Tisch geschätzt wird ...«
Erborn schoß das Blut in die Wangen; ruckartig preßte er das Kinn auf die Brust, als ringsum am Tisch wieder das widerwärtige Lachen der Erwachsenen erklang.
»Mit Meskinnes darf ich dir nicht kommen, das weiß ich wohl, Thesia. Wäre denn ein Gläschen Feuer genehm?«
»Feuer ist genehm, Arvid«, antwortete die Ilmensteinerin, während sie den Blick über die hünenhafte Gestalt des Grafen wandern ließ. »Sag einmal, bist du in letzter Zeit wieder gewachsen?«
Arvid lachte. »Diese Frage habe ich lange vermißt. Ich glaube, seit zehn Jahren hat sie mir niemand mehr gestellt. Ich fühle mich gleich um Jahre jünger.«
Thesia nickte lächelnd. »Nicht wahr, das hört ihr gern, ihr langen Kerls. Ich fand immer, daß du besser nach Thorwal als ins Bornland paßt ...«
»Ach, wieso?« warf Algunde ein. »Ich finde, er ist ein rechter Bär, ein blonder Bär, gerade wie der Meister Petz, das Lieblingstier der Leute am Born.«
»Tja, wenn man es so sieht ...« Die Gräfin von Ilmenstein nahm Arvid das Gläschen mit dem klaren Schnaps aus der Hand und leerte es in einem Zug. Sie zog scharf die Luft durch die Nase ein, schloß die Augen und schüttelte den Kopf. »Echtes Premer Feuer, wie? Da geht einem das Herz auf.«
Arvid stellte den Schnapskrug auf den Tisch und ließ sich in einem Sessel gegenüber der Gräfin nieder. Zu seiner Linken saß seine Frau Algunde, zu seiner Rechten seine Schwester Yasinde. Frau von Scherpinskoje hatte sich mit einem Buch in einen Ohrensessel dicht beim Fenster zurückgezogen. Die schmalen Fensterflügel der Bibliothek waren weit geöffnet, um die warme Abendluft ins Zimmer zu lassen. Auf einem Zweig, ein paar Schritt vom Haus entfernt, saß eine Dotteramsel und flötete ihr wehmütiges Lied. Das dumpfe Muhen der Kühe, die nach dem Melker riefen, das rhythmische Dengeln eines Sensenschleifers und die vielfältigen anderen Geräusche, die vom nahen Feierabend auf dem Gutshof kündeten, wehten heran.
Graf Arvid füllte Bier aus einer Kanne in einen Krug, nahm einen prüfenden Schluck und nickte befriedigt. »Man weiß nie, was bei dieser Brauerei herauskommt. Den Trunk der letzten Woche habe ich ins Schweinefutter kippen lassen, und selbst den Säuen hat das Gesöff die Rüssel krummgezogen. Aber diesmal hat sich Meister Umbert selbst übertroffen. Schade, daß die Damen keinen wirklich guten Schluck zu schätzen wissen ... Braut ihr überhaupt kein Bier auf Ilmenstein?«
Thesia schüttelte den Kopf. »Was ich für das Gesinde brauche, kaufe ich beim Eschenfurt. Dem geht nie ein Bräu daneben. Es heißt, daß er persönlich nächtelang neben dem Kessel sitzt, damit ihm keine Mindergeister das Getränk verderben ... Sag, Arvid, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Das muß mehr als sechs oder sieben Jahre her sein, nicht wahr?«
»Sieben, denke ich. Bei der vorletzten Marschallswahl ...«