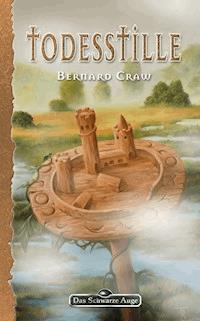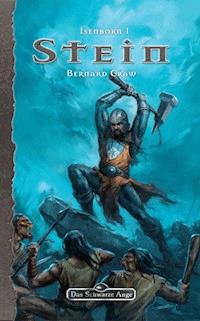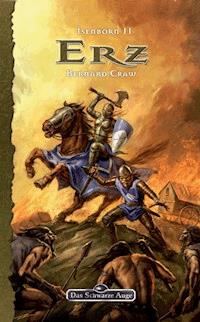Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ulisses Medien und Spiel Distribution GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Schwarze Auge
- Sprache: Deutsch
Ein mächtiger Dschinn beschützt das kleine Gwerrat im Herzen des Yalaïad, jener zwischen Aranien und Oron umkämpften Region. Dies macht das glückliche Beyrounat zu einer Zuflucht von besonderer strategischer Bedeutung. Erbprinz Rengûn sucht eine Gemahlin, um die Thronfolge zu sichern. Die übermenschlich schöne Layla al'Azila wirbt im Auftrag einer Oronierin um seine Gunst. Er willigt ein, gemeinsam mit einer Handvoll Gefährten in das Reich unter dem Banner der Dornrose zu reisen, um die Braut in Augenschein zu nehmen. Was neidische Götter den Starken andernorts verwehren, wird ihm im Land der Blutigen Ekstase versprochen - doch nur um den Preis seiner Seele ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 497
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Biografie
Bernard Craw wurde 1972 in Bramsche geboren. Er ist katholisch, ledig und hat als Unternehmensberater und Projektleiter die Welt der internationalen Konzerne kennengelernt. Nach einigen Jahren in Münster und Sindelfingen wohnt er seit 2000 in seiner Wahlheimat Köln.
Craw schreibt vor allem fantastische Literatur. Mit dem Rollenspiel Das Schwarze Auge kam er 1985 in Kontakt, und die geselligen Abende vor Dokumenten der Stärke und Plänen des Schicksals avancierten rasch zur dominierenden Freizeitbeschäftigung.
Der 2009 erschienene Roman Im Schatten der Dornrose wird von den Fans des Schwarzen Auges so intensiv diskutiert wie kaum ein anderer.
Wer sich über Craws literarische Aktivitäten informieren möchte, kann dies auf www.bernardcraw.net tun.
Titel
Bernard Craw
Im Schatten der Dornrose
Ein Roman in der Welt von Das Schwarze Auge©
Originalausgabe
Impressum
Ulisses SpieleBand 11046EPUB
Titelbild: Arndt DrechslerAventurienkarte: Ralph HlawatschAranienkarte: Björn LensingLektorat: Florian Don-SchauenBuchgestaltung: Ralf BerszuckE-Book-Gestaltung: Michael Mingers
Copyright ©2012 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems. DAS SCHWARZE AUGE, AVENTURIEN, DERE, MYRANOR, RIESLAND, THARUN und UTHURIA sind eingetragene Marken der Significant GbR. Alle Rechte von Ulisses Spiele GmbH vorbehalten.
Titel und Inhalte dieses Werkes sind urheberrechtlich geschützt.
Der Nachdruck, auch auszugsweise, die Bearbeitung, Verarbeitung, Verbreitung und Vervielfältigung des Werkes in jedweder Form, insbesondere die Vervielfältigung auf photomechanischem, elektronischem oder ähnlichem Weg, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Ulisses Spiele GmbH, Waldems, gestattet.
Print-ISBN 978-3-89064-136-2E-Book-ISBN 978-3-86889-845-3
Werber
Die untergehende Sonne hauchte einen Schimmer von Rosa auf den weißen Marmor des Palastes. Golgaron betrachtete die Ornamente, mit denen Generationen von Steinschneidern zur Verschönerung der Mauern beigetragen hatten. Vor allem Blumenmotive waren es, die an der glatten Fläche emporrankten, die Blüten dargestellt durch Einlegearbeiten von bunten Steinen, die im letzten Licht des Tages funkelten. Er strich mit den Fingerkuppen über die feinen Fugen, spürte den verschieden glatten Oberflächen nach, legte schließlich die Hand flach auf den Marmor, um die Kühle aufzunehmen. Das war angenehm, denn die Hitze des Tages stieg noch aus dem dunklen Boden auf.
Er trat näher an die Wand, schloss die Augen und lehnte die Stirn an den Stein. Die eiserne Brosche an seinem Turban klackte, als sie gegen das Hindernis stieß. Obwohl das Geräusch so nah war, hörte er es kaum über dem Lärm, den die Tausendschaften von Flamingos auf dem See veranstalteten. In der Mittagshitze suchten auch die Vögel mit den langen Hälsen, den gebogenen Schnäbeln und den stelzenartigen Beinen Zuflucht im Schatten. Wenn man im Inneren des Palastes war, konnte man sich einbilden, es handele sich um das Summen eines Bienenschwarmes. Jetzt jedoch kehrten die gefiederten Heerscharen zurück.
Mit geschlossenen Augen stellte sich Golgaron vor, er stünde auf einer Klippe, gegen die das Meer anbrandete, im Takt der Brecher an- und abschwellend. Die Geräuschkulisse war zum Verwechseln ähnlich. Er presste die Lippen aufeinander. Als Geweihter der Boron-Kirche war er bestimmt überempfindlich. Wenn er sich in einem Tempel seines Gottes aufhielt, verbrachte er die meiste Zeit in der Stille abgedunkelter Räumlichkeiten. Ein langsames, ruhiges Leben, das seiner Seele entsprach.
Er öffnete die Lider. Einige Schweißtropfen hatten sich gelöst und rannen über den Marmor. Aus der Nähe betrachtet sah es aus, als sei der Stein mit dünnem Glas überzogen.
Vermutlich wirkte er nicht gerade würdevoll, wie er so gegen die Wand gelehnt stand. Innerlich seufzend stieß er sich ab und ordnete seinen Kaftan. Schwarz war zu dieser Jahreszeit nicht gerade eine vorteilhafte Farbe. Eine gute Prüfung, schließlich sollte sich ein Anhänger des Totengottes von den Annehmlichkeiten des Lebens lösen, das Streben nach Nichtigkeiten hinter sich lassen. Dazu gehörte auch die Bequemlichkeit heller Kleidung, die täglich gewaschen werden musste. Es sollte genügen, dass sein Gewand nach aranischer Sitte weit geschnitten war und so beim Gehen die Luft zirkulieren ließ.
Um diesen Effekt zu fördern, pendelte Golgaron mit den Armen, als er auf den Kiesweg zurückkehrte. Wenn der Lärm ihn auch störte, so konnte er sich doch der Farbenpracht der Flamingos nicht entziehen. Ob es wohl stimmte, dass ihr Rosa mit dem Alter intensiver wurde? Die Jungen waren grau, bis sie sich mauserten. Einige der erwachsenen Vögel waren beinahe weiß, die meisten hatten das zarte Rosa der Zorena-Tulpen und einige wenige waren beinahe feuerrot. Waren dies die Altehrwürdigen, deren Lebensrad sich bereits häufig gedreht hatte? Der Boroni zuckte mit den Schultern. Im Grunde spielte es keine Rolle. Sie würden ihre Weisheit kaum an ihn weitergeben.
Er schüttelte einen Stein aus seiner Sandale, bevor er den Weg fortsetzte. Am Ufer des kleinen Gwerrat-Flusses ging er den Hügel hinab, fort vom See. Er beobachtete einen Pelikan, der waghalsig wasserte. Sahen diese Vögel überall so tollpatschig aus, oder misstrauten sie dem merkwürdigen Phänomen, dass dieser Fluss bergauf floss? Golgaron würde darauf achten, wenn er das nächste Mal einen Pelikan beobachtete. Dieser jedenfalls faltete seine Flügel auf dem Rücken zusammen und tauchte den Schnabel in das Wasser, den Menschen vollständig ignorierend.
Golgaron sah hinüber zu den kleinen Häusern am anderen Ufer. Die Bewohner des Dorfes hörten den Lärm am Morgen und am Abend wohl gar nicht mehr, schließlich war er jeden Tag da. Nachts, wenn die Vögel ihre Plätze gefunden hatten, war es immerhin still. Zudem war der Krach der Gefiederten zweifelsohne dem Klirren des Waffenstahls vorzuziehen, das in Aranien dieser Tage so häufig zu hören war. In dieser Gegend des Königreiches, dem Yalaïad, gab es kaum eine andere Siedlung, die ohne Palisaden auskam. Schließlich hatten die oronischen Dämonenpaktierer ihre Klauen nach dem Emirat ausgestreckt. Und mitten in den Kriegswirren, einer Oase der Ruhe gleich, das Beyrounat Gwerrat. Der Boroni gestattete sich ein feines Lächeln. Tagsüber war ›Ruhe‹ hier wahrlich nur im übertragenden Sinne zu verstehen.
Golgaron entschied, dass er nun lange genug umhergewandert war. Es war eine allgemein bekannte Tatsache, dass sich die Anwesenheit eines schwarz gewandeten Geweihten, der den guten Sitten zufolge nicht angesprochen werden durfte und jedermann durch seinen bloßen Anblick an den eigenen Tod erinnerte, nicht förderlich auf die ausgelassene Stimmung auswirkte, die bei einer Abendgesellschaft gewünscht war. Daher hatte er den Gauklern Gelegenheit gegeben, ungestört von seiner Präsenz den Grundton anzuschlagen, der das Beisammensein prägen sollte. Wenn ihnen dies in der vergangenen Stunde nicht gelungen sein sollte, so wäre ihre Mühe wohl ohnehin vergebens. Zudem mochte man Golgarons taktvolle Abwesenheit durchaus schätzen; hielte er sich aber dauerhaft fern, so konnte dies als unhöfliche Zurückweisung der Gastfreundschaft gewertet werden.
Würdevoll schritt der Boroni durch das offen stehende Palasttor. Über dem Portal war das Wappen der Beyrouni angebracht: ein Flamingo in einem Schild, auf dem ein Turban mit drei Pfauenfedern ruhte. Nur der mystischen Kraft dieses Ortes war es zu verdanken, dass ein derart kleiner Flecken die Beyrounatswürde erhalten hatte. Die Wache im Torhaus warf sich in Positur. Die junge Frau trug eine schimmernde Panzerplatte über der Brust, weniger Rüstung als Zierde, die die radschagefälligen Formen nachbildete. Golgaron bezweifelte, dass sich unter der weiten Seidenhose weiterer Schutz verbarg. Im Nabel glitzerte ein grüner Schmuckstein. Die Schneide der Hellebarde jedoch war lang und sah scharf aus.
Golgaron machte sich nichts aus Waffen, aber manchem Krieger in der Delegation mochte diese Zurschaustellung übel aufstoßen, waren sie doch alle gezwungen gewesen, ihre Klingen im Zeughaus an der Gwerrat-Quelle zu hinterlegen. Seinen Krummdolch hatte der Boroni nach kurzer Inspektion zurückerhalten, er würde den Dschinn nicht erzürnen. Der Geweihte trug ihn auch jetzt in der Schärpe.
Die Hitze blieb zurück. Wie bei den meisten tulamidischen Gebäuden bildete auch beim Palast der Beyrouni Sorena ein Innenhof den Mittelpunkt der Anlage. Hier wurden die Strahlen der Sonne durch die Fächer und Wedel der Pflanzen gemildert, ein Springbrunnen plätscherte im Zentrum und die zwei Stockwerke hohen, umliegenden Räumlichkeiten dämpften den Lärm der Flamingos.
Vor dem Brunnen lagen geknüpfte Teppiche, auf denen zwei nur mit Hüfttüchern bekleidete Akrobaten ihre Kunststücke vollführten. Das angenehme Abendlicht schimmerte auf ihren Muskeln. Der Brustkorb des einen wölbte sich vor, als er einen Handstand auf den Schultern seines Partners vollführte. Von der Abendgesellschaft waren leise Gespräche zu hören und das Gluckern der Wasserpfeifen, als er sein Gewicht auf einen Arm verlagerte, sich auf dem Kopf des anderen Akrobaten abstützte und sich dort hochdrückte, als stiege er auf Händen eine Treppe empor. Die Muskeln am Hals des unteren Gauklers schwollen wie Taue.
Die Musikanten bemerkte Golgaron erst, als sie ihr Spiel wieder aufnahmen. Zwei Flötisten und ein Lautenspieler ließen ihre Instrumente erklingen. Auf einen Sänger hatte man verzichtet, wohl, um die Gespräche nicht zu stören.
Golgaron nahm ein fingergroßes Gläschen Tee vom Tablett eines aufmerksamen Dieners. Er gönnte sich, den würzigen Geruch der grünen Flüssigkeit zu genießen, bevor er sie in zwei Schlucken trank. Tee war ein merkwürdiges Gebräu. Er konnte anregen und schläfrig machen, süß oder bitter schmecken. Diese Sorte wurde zwar heiß gereicht, aber sobald der Mund abkühlte, breitete sich auch im Körper angenehme Erfrischung aus.
Golgaron wartete, bis die Hausherrin ihn bemerkte. Die Beyrouni war eine Frau im fortgeschrittenen Alter. Unwillkürlich stellte er sich vor, wie er ihren Leichnam arrangiert hätte, wäre sie in diesem Augenblick verstorben. Hinter der Bahre hätten die fünf Kerzen gebrannt, Zeichen dafür, dass sich ein Rad bis ins Greisenalter gedreht hatte. Das Leben dieser Frau war bei weitem nicht so hart gewesen wie das der Bauern, deren Angehörige Golgaron häufig tröstete. Ihre Hände beschäftigten sich mit dem Mundstück der Wasserpfeife, das sie mit sorgfältig manikürten Fingern streichelte, deren Nägel golden lackiert waren. Soweit es ihr Gewand erkennen ließ, war ihre Haut frei von Narben.
Das radschagefällige Spiel mit seidenen Schleiern war an ihrer Kleidung zu beobachten, nicht nur vor dem Mund, sondern auch als Schmuck lose um die Arme wallend und den Ausschnitt bedeckend, doch sie wusste auch um die Jahre, die ihre unvermeidlichen Spuren hinterlassen hatten, und entzog dem Betrachter möglicherweise unangenehme Ansichten durch Lagen undurchsichtigen Stoffes. Sie muss einmal sehr schön gewesen sein, dachte Golgaron. Sie wird eine ästhetische Leiche hinterlassen, die der Mittelpunkt einer würdevollen Trauerfeier sein wird.
Kein Wunder, die Herrscherinnen Gwerrats hatten bei der Entscheidung für die Bräute ihrer Erben immer wählerisch sein können, so auch Sorenas Schwiegermutter. Wie die Beyrouni selbst es nun ebenfalls war, da sie nach einer Gemahlin für ihren ältesten Sohn Ausschau hielt, die ihr in der Regentschaft nachfolgen würde. Eigentlich sollte Golgaron in dieser Angelegenheit unbedingt die Interessen der aranischen Delegation vertreten, immerhin gehörte er ihr an, doch als Sorena ihm mit ruhigem Wohlwollen zunickte, da wünschte er nichts weiter, als dass sie die beste Wahl für ihr Fürstentum treffen mochte.
Schließlich richtete sich die Erbfolge zwar nach der männlichen Linie, die tatsächliche Regierungsgewalt ging aber auf die jeweilige Gemahlin über. Dies war im Yalaïad nicht so selbstverständlich, wie es auf der derzeit oronisch besetzten elburischen Halbinsel immer schon gewesen war, aber auch nicht gerade unüblich. Die Mutter wählte die Bräute aus. Der Erstgeborene konnte sich widersetzen, würde damit jedoch die Thronfolge riskieren, sollte einer seiner Brüder vor ihm heiraten.
Golgaron verbeugte sich in Erwiderung der Geste der Fürstin, die nun den Blick abwandte, ohne ihm auszuweichen. Sie schob das Mundstück unter den Gesichtsschleier und zog an ihrer Pfeife. Hätte sie auf einen der freien Plätze gedeutet, hätte Golgaron nicht ablehnen dürfen, so aber überließ sie es ihm, ob er sich in die Gesellschaft einbringen oder lieber für sich bleiben wollte. Er war ihr dankbar dafür.
Inmitten fröhlicher Menschen fühlte er sich oft einsam, daher neigte er dazu, sich am Rand zu halten. Der Trubel des Lebens lag ihm nicht. Er nahm einen zweiten Tee und ging unter den Arkaden um den Innenhof herum. Mosaike zierten die Wände. Wo in anderen Palästen große Schlachten für Rondras Ehre dargestellt waren, herrschten hier Blumenmotive vor. Ab und an fand sich auch ein schwertschwingender Held, doch wirkte dies eher als augenzwinkerndes Zugeständnis denn als Versuch, einen überragenden Vorfahren zu rühmen. Der Dschinn, der das Tal schützte, war ohnehin mehr Kraft als Person, wie man munkelte, und entzog sich daher einer bildlichen Darstellung.
Andererseits stellte die Kunst auch andere unsichtbare Kräfte dar, indem sie ihre Wirkung verdeutlichte – Baumwipfel etwa, die sich in einem Sturm bogen. Golgaron musterte die Mosaike, um vielleicht doch eine Spur des Wirkens jener Kraft zu finden, die diesen Ort seit Generationen schützte und sowohl den Araniern als auch den Oroniern ihre Grenzen gezeigt hatte, wenn die Krieger einer Partei versucht hatten, hier Quartier zu nehmen.
Er hatte zwar viele interessante Einzelheiten in den Arbeiten gefunden, winzige Vögel, an einer Stelle gar Käfer, doch keinen Hinweis auf den Beschützer von Gwerrat, als er sich bei seinem Rundgang Praiohardt Sahib näherte. Der Geweihte des Sonnengottes war ebenfalls Mitglied der Gesandtschaft und zudem Vormund für eine Handvoll Adepten seines Kultes. Zwei von ihnen belehrte er gerade. Überhaupt hielt der etwa vierzigjährige, gebräunte Mann offenbar nicht viel von borongefälliger Schweigsamkeit. Golgaron konnte sich kaum erinnern, seinen Gefährten auf dieser Mission gesehen zu haben, ohne dass er entweder geschlafen oder in ein Gespräch eingebunden gewesen wäre. Und er brauchte wenig Schlaf.
»Wir sind im Vorteil!«, stellte er gerade fest und schlug die Faust in die offene Handfläche, wie es seine Gewohnheit war, wenn er etwas bekräftigte. Er sah zu dem Boroni herüber, nickte beiläufig und wandte sich dann wieder seinen Schützlingen zu, die mit flammenden Augen an seinen Lippen hingen, dermaßen von ihrer Begeisterung überwältigt waren, dass sie nicht ruhig stehen konnten und unter seinen Worten wogten wie Schilf im Wind. »Das kann sich Sorena Effendi unmöglich bieten lassen! Keine Braut, keine Gastgeschenke, keine Delegation, nur eine einzelne Gesandte! Damit sind die Oronier zu weit gegangen! Wenn die edle Rahidra morgen eintrifft, wird die Sache besiegelt sein. Ach was, das ist sie jetzt schon!« Wieder hieb er mit der Faust in die Hand.
Einer der jüngeren Praioten nickte eifrig. »Oh, was wird es für ein Fest sein, Sahib, wenn wir zusehen werden, wie die Dämonenbuhle beschämt von dannen zieht!«
»Wir sollten ihr folgen und sie zur Strecke bringen, wenn sie Gwerrat verlässt«, ergänzte der andere.
Praiohardt dämpfte weise lächelnd den Enthusiasmus seiner Zöglinge. »Das wäre dem Herrn Praios nicht gefällig«, bestimmte er. »Wir genießen gemeinsam das Gastrecht, da wollen wir nicht zu einer Hinterhältigkeit greifen. Zudem wäre es unklug, denn es würde die Effendi verärgern. Zumal diese Paktierer nicht leicht zu erschlagen sind, Omar, das musst du immer bedenken. Manche von ihnen gehen noch nicht einmal zu Boron, wenn man ihnen die Lanze durch die Brust rammt, nicht wahr, Golgaron Sahib?«
Der Boroni nickte stumm und setzte seinen Rundgang fort, um dem Geschwätz zu entkommen. Während er weitere Mosaike betrachtete, schwelgte er in einem distanzierten Bedauern darüber, dass so viele Menschen ihre Lebenszeit mit eitlem Geplapper verschwendeten. In seiner Gnade hatte der Herr Boron es immerhin gefügt, dass all das unnütze Zeug nicht allzu lang das Gedächtnis belastete. Das Vergessen war wirklich eine großherzige Gabe des schweigenden Gottes für die Sterblichen. In Gedanken formulierte Golgaron ein Stoßgebet, dass er immerdar standhaft bliebe, damit seine Seele nach der Reise über das Nirgendmeer für wert befunden würde, in Borons Hallen Einlass zu erhalten und dort mit immerwährendem Schlaf in ungestörter Ruhe belohnt zu werden.
Genau dieses, die Ruhe der Toten, missachteten die Erben Borbarads in schändlicher Weise. Nicht immer waren Golgarons Träume angenehm, vor allem dann nicht, wenn sie sich mit seiner Zeit in Tobrien beschäftigten. Blasphemische Riten hatten dort die Leichen aus den Gräbern gezwungen, auf dass sie verfaulende Fäuste um Griffe von Schwertern und Stangen von Speeren schlossen und damit für den Willen ihrer wahnsinnigen Herren fochten. Solcherlei munkelte man auch von den oronischen Feinden, aber hier hatte Golgaron noch keinen Skelettkrieger über ein Schlachtfeld wanken sehen. Es mochte durchaus sein, dass man den Feind in den düstersten Farben malte, die der Fantasie der Geschichtenerzähler zur Verfügung standen – und diese wiederum wurde nicht nur von Tatsachen angeregt.
Als er ein Krächzen hörte, wurde Golgaron bewusst, wie viel Zeit vergangen war. Die Flamingos waren verstummt. Er trat an den Rand der Arkade und sah zum sternengeschmückten Nachthimmel auf. Noch war er dunkelblau, bald würde er sich in schwarzen Samt verwandeln. Die Diener hatten Kohlebecken und Fackeln aufgestellt, deren Schein die Pflanzen in rötliches Licht tauchte. Das auffällige Geräusch war von einem Zwergpapagei verursacht worden, der gerade im Mittelpunkt des Interesses stand. Er saß auf der Schulter eines Mannes mit zauseligem Bart, der ihm einen aufgefächerten Satz Karten hinhielt, an denen der Vogel mit dem gebogenen Schnabel zupfte. Die Beyrouni und ihre Gäste lachten. Der Mann nahm die Karte, die sein Vogel bevorzugt hatte, und legte sie vor sich auf den Teppich, um sie zu betrachten und den Umsitzenden ihre Bedeutung zu erklären. Es war nicht ungewöhnlich, dass sich ein Wahrsager der Dienste eines tierischen Gehilfen bediente. Den Mienen nach zu urteilen, erzählte er gerade eine heitere Variante der möglichen Zukunft, gerade recht für eine Gesellschaft wie diese. Die Gaukelei gehörte bei den meisten Wahrsagern zum Handwerk.
Der Wesir betrat den Garten. Er trug ein Gewand aus gelbem Damast. Die verschlungenen Rankenmuster waren nur dort zu erkennen, wo Licht in Schatten überging, denn sie waren aus dem gleichen Faden gewebt, nur in schräger Richtung. Mit der silbernen Spitze seines Zeremonialstabes pochte er auf den Boden. Der Wahrsager unterbrach seine Auslegung, und die allgemeine Aufmerksamkeit wandte sich dem Neuankömmling zu, der nun jedoch bemerkte, dass Golgaron sich abseits im Sternenlicht aufhielt. Er korrigierte seinen Standort, damit auch der Geweihte seine Worte vernähme. »Erhabene Effendi, Mutter der Voraussicht, Eure Diener hörten Euren Wunsch und gehorchten sogleich. Das Dampfbad ist bereitet und wird die nächsten Stunden über Erquickung für jene ermöglichen, die sich dorthin zurückzuziehen wünschen. Dienerinnen stehen parat, um mit Ölen und Salben die erschöpften Körper zu pflegen.«
»Ich danke Euch, Riban Sahib.« Ihre Stimme war rauer, als ihre gepflegte Gestalt hätte vermuten lassen. »Mit Fortschreiten des Abends wird sicher der ein oder andere die Gelegenheit nutzen wollen.«
Golgaron stellte sich vor, wie eine reinigende Paste die Poren seiner Haut öffnete und gemeinsam mit Schweiß und Staub des Tages abgeschabt würde. Dazu noch der heiße Nebel, der einen wusch, als ginge man durch eine Wolke aus dem Atem eines träumenden Drachen …
Er seufzte. Die Versuchungen des Luxus waren mannigfaltig. Missmutig beobachtete er, wie sich die Gesellschaft wieder dem Kartenleger zuwandte. Ab und zu warf jemand einen verstohlenen Blick zu ihm herüber. Auch die Diener des Sonnengottes Praios waren in den Kreis zurückgekehrt. Er verschränkte die Arme und lehnte sich gegen eine Säule. Die Sterne funkelten am Himmel und erinnerten ihn an glänzende Wassertropfen an den Wänden eines Dampfbades. Er löste sich von ihnen und sah sich im Garten um.
Der Dampf der Wasserpfeifen, der plätschernde Brunnen, alles erinnerte ihn an den Genuss, den er sich versagte. Er runzelte die Stirn. War ein Dampfbad denn wirklich unnützes Vergnügen? War es nicht vielmehr zu einem großen Teil auch Rücksichtnahme auf die anderen, wenn der Gestank des Tages abgewaschen wurde? Er scheuerte den Rücken an der Säule. Je mehr er darüber nachdachte, umso stärker juckte seine Haut. Im Grunde musste das Dampfbad in diesem Falle dem Herrn Boron gefallen. Nicht nur hülfe die Reinigung seinem Geweihten dabei, unwürdige Kratzereien zu vermeiden, auch galt es zu bedenken, dass Golgaron Mitglied der Delegation des zwölfgötterfürchtigen Aranien war, beinahe schon ein Gesandter des Seerosenthrons. Gut, dieser letzte Gedanke war ein wenig übertrieben, nicht die Mhaharani Shahi in Zorgan hatte diese Expedition gewünscht, sondern die Heeresleitung in Chalukand, aber diese handelte doch stets im Sinne des rechtmäßigen Herrscherpaares. Also war die Übertreibung keine allzu große, und ganz außer Frage stand doch, dass vom Eindruck der Delegation viel abhing, was den Krieg im Yalaïad anging. Keinesfalls borongefällig konnte es sein, wenn morgen seine Konzentration litte, weil er den ganzen Tag dem verpassten Dampfbad nachtrauerte. Außerdem praktizierte er durch sein Schweigen schon ausreichend Askese, da musste nicht auch noch der Körper kasteit werden, dessen empfindliche Ohren heute schon das Gezeter der Flamingos geduldig ertragen hatten.
So mit sich ins Reine gekommen, schlug Golgaron den Weg zum Ort der Entspannung ein. Die beiden Dienerinnen sahen ihn mit ihren mit feinem, schwarzem Strich umrandeten Augen unsicher an. Zweifellos hatten sie darüber getuschelt, welchen starken Recken ihre geübten Finger wohl zuerst massieren dürften, mit wem sie Plaudereien über Ritterlichkeit und romantische Märchen austauschen könnten. Nun stattete ihnen der Diener des Totengottes einen Besuch ab. Er war zwar jung und gesund, verfügte aber nicht über den gestählten Körper eines Kämpfers und eignete sich auch ausgesprochen schlecht für frivole Konversation. So war es eine Mischung aus Furcht und Enttäuschung, die auf den Gesichtern zu lesen war. Golgaron versuchte ein beruhigendes Lächeln, das aber eine der beiden noch stärker einschüchterte. Die andere verneigte sich und bat ihn herein.
Er streifte die Sandalen ab, ging an der Liege vorbei zum Regal und hob den Turban vom Kopf. Die Schlaufen verrutschten etwas, wahrscheinlich würde er ihn nachher neu binden müssen. Er legte die Kopfbedeckung so in ein Fach, dass die eiserne Brosche mit dem weißen Raben darauf gut zu sehen war. Noch war das Regal leer, also war er erwartungsgemäß der erste Gast, aber wenn später noch jemand käme, würde dieser stumme Hinweis ihn darauf vorbereiten, wen er im Bade vorfände. Seinen Dolch legte er daneben. Der Dienerin reichte er zuerst den Kaftan, dann das Untergewand, damit sie es zusammenfaltete und verstaute. Während sie noch damit beschäftigt war, ging er zu einem Hocker neben einer Ablaufrinne und goss sich aus bereitgestellten Kübeln heißes und kaltes Wasser über Haupt und Körper.
Die Dienerin sah ihn fragend an. Er entschied sich, zunächst das Dampfbad zu genießen, bevor er sich auf der Liege ausstrecken und ihre Dienste in Anspruch nehmen würde. Als sie seine Absicht erkannte, öffnete sie eilfertig die Tür, unter der bereits nasse Schwaden hervordrangen. Eine heiße Wolke waberte heraus. Er beeilte sich, an der gekachelten Säule in der Mitte des kleinen Raumes Platz zu nehmen, damit nicht zu viel Wärme entwiche.
Seine Gedanken wanderten ziellos, während die honigduftenden Nebel seine Nase und die Lungen weiteten. Die Hitze wirkte ermattend, aber er wusste, dass dieser Zustand beim Verlassen des Bades durch angenehme Belebung abgerundet würde. Als ihm die Lider schwer wurden, strich er die Nässe vom Körper – eine Aktion, die mit nur begrenztem Erfolg gesegnet war – und kehrte in den Vorraum zurück.
Die Dienerin reichte ihm ein weißes Tuch, mit dem er sich gründlich abtrocknete, bevor sie ihm half, mit kaltem Wasser nachzuspülen. Das weckte sogleich die Lebensgeister. Nachdem er sich nochmals abgetrocknet hatte, ließ er sich auf der Liege nieder. Die Dienerin war ein hübsches Ding, wie er jetzt feststellte. Sie trug keine Ringe an den Fingern, da diese bei der Massage gestört hätten, dafür aber einen bronzenen im linken Nasenflügel, von dem ein Kettchen zum Ohr führte. Bronzener Schmuck stand nach aranischer Sitte den Unfreien zu, die die Hälfte des Tages für die Herren arbeiteten, die ihnen Schutz gewährten. Der Dienst im Haushalt der Beyrouni war sicher kein schlechtes Los.
Golgaron schloss die Augen, als sie begann, die Paste mit einem Spatel auf seiner Brust zu verteilen. Sie ging geschickt vor, sanft, aber ohne zu kitzeln. Er verschränkte die Hände hinter dem Kopf. Die Dienerin sparte nur das Gemächt aus. Als sie bei den Füßen angekommen war, war der Überzug an der Brust schon trocken genug, um abgeschabt zu werden. Auch das hierfür vorgesehene beinerne Werkzeug gebrauchte sie mit großer Sorgfalt. Nebenbei entfernte sie so die Körperhaare, die seit der letzten Pflege gesprossen und die jedem zivilisierten Menschen ein Gräuel waren. Golgaron war zufrieden mit seiner Entscheidung, das Dampfbad aufzusuchen. Er drehte sich auf den Bauch, um auch die andere Seite behandeln zu lassen. Mit geschlossenen Augen döste er vor sich hin, als er nackte Füße über die Fliesen gehen hörte. Die Dienerin hielt für einige Augenblicke inne, während der neue Gast entkleidet wurde. Golgaron lauschte, aber auch der Neuankömmling übte sich in borongefälliger Verschwiegenheit. Den Kopf wenden und die Augen öffnen, um sich Gewissheit darüber zu verschaffen, welcher Gast gekommen war, wollte er auch nicht. Bald wurde seine Behandlung fortgesetzt, was Golgaron überraschte, denn er glaubte, nur die Schritte eines einzelnen Menschen gehört zu haben. Wenn aber die zweite Dienerin nicht mit hineingekommen war und die erste sich mit ihm beschäftigte, entkleidete sich der Gast dann selbst? Das wäre ungewöhnlich. Noch überraschter war der Boroni, als kurz darauf die Tür zum Hauptraum ging, sich dann aber Schritte entfernten. Wenn der Gast die Dampfkammer nicht betreten, sich aber zuvor entkleidet hatte, dann ging er jetzt nackt durch den Palast. Zwar waren die Aranier nicht prüde, liebten aber bei der Zurschaustellung des Körpers doch eine gewisse Verspieltheit.
Er ließ sich beim Abspülen helfen, verzichtete jedoch darauf, sich nochmals trocken zu reiben. Der heiße Dampf würde die Poren abschließend öffnen und so von den Resten der Salbe reinigen, die noch nicht entfernt und auch nicht in die Haut eingezogen waren. Als die Dienerin seine Absicht erkannte, wurden ihre Augen weit. Mit einer winkenden Bewegung schien sie ihm davon abraten zu wollen, den Hauptraum zu betreten.
Golgaron runzelte die Stirn. Das einfache Volk war manchmal übervorsichtig, was den Umgang mit den Dienern des Totengottes betraf. Vielleicht dachte die junge Frau, es sei ihm nicht gestattet, das Bad mit einem anderen Besucher zu teilen. Diese Sorge war jedoch gänzlich unbegründet. Er lächelte ihr zu, zog die Tür auf und schlüpfte hinein. Vielleicht hatte er die Geste auch gänzlich falsch interpretiert, denn wenn er seinen Ohren vertrauen konnte, war der Gast von vorhin unverrichteter Dinge wieder verschwunden. Im Grunde spielte das jedoch keine Rolle.
Die Plätze waren entlang der Wand des Raumes und um die zentrale Säule herum angeordnet, die auch als Rückenlehne diente. Der Dampf trieb zu dicht, als dass er hätte erkennen können, ob sich hier irgendwo bereits jemand niedergelassen hatte. Die Füße patschten auf dem Boden, während er zu seinem alten Sitz ging.
Er hatte gerade die Lider geschlossen, als er hinter sich eine zischelnde Stimme hörte: »Ihr wirkt viel weniger verstockt ohne Euren Kaftan, Diener des Raben.«
Als hätte er sich geschnitten, riss Golgaron die Augen auf und straffte den Rücken. Das war Layla al’Azila, die Brautwerberin aus Oron, ganz ohne Zweifel! Trotz des Zischelns, das jedes ihrer Worte begleitete, konnte keine Kurtisane und keine treu ergebene Gläubige der Liebesgöttin Radscha solchen Samt in ihre Stimme legen. Warum war er nicht früher darauf gekommen! Schon gestern hatte er den Eindruck gehabt, dass die schwarzhäutige Schönheit kaum den Boden berührte, über den sie so elegant schritt, dass selbst eine Mhaharani vor Neid erblassen musste. Offenbar war dieser Effekt nicht nur eine Täuschung der Augen. Leichtfüßig, wie sie war, hatte er vorhin nur die Schritte der zweiten Dienerin gehört, nicht die ihren. Nun ergab auch die stumme Warnung seiner Gehilfin einen Sinn.
»Ich weiß, man spricht für gewöhnlich nicht mit Euch, die guten Sitten verbieten es«, fuhr die Stimme in seinem Nacken fort. »Aber Ihr erscheint mir einfach zu … interessant.«
Der Dampf hatte seine Haut mit Wasser bedeckt. Dennoch spürte Golgaron, wie ihm der Schweiß aus den Poren brach.
»Da wir hier ganz allein sind und alle anderen beschäftigt scheinen, wird auch niemand bemerken, was wir hier tun.« Er hörte ihren Atem neben seinem Ohr. »Ganz gleich, was wir uns zu tun entschließen.«
Einige Herzschläge verharrte der Boroni in Erstarrung, dann sog er scharf die Luft ein und wandte sich um.
Layla lachte. Kaum Freude lag in diesem Geräusch, doch viel Anziehungskraft und ein wenig Herausforderung. Die Schwaden entzogen den Großteil ihres Körpers seinem Blick. Die leuchtenden Steine, die in die Wände eingesetzt waren, ließen die beinahe schwarze Haut der Frau blau und rot schimmern. Die weißen Zähne jedoch leuchteten, als hätten sie ihr eigenes Licht. »Habt Ihr Angst vor mir?«, spottete sie.
»Wer den Tod nicht fürchtet, der kennt keine Angst«, entgegnete er und ärgerte sich im selben Moment darüber, sein Schweigen gebrochen zu haben.
Sie legte den Kopf schräg, was ihre hohen Wangenknochen betonte Schatten werfen ließ. Die Nässe tränkte auch ihre Haut, deren Färbung auf Vorfahren von den Waldinseln hindeutete, Utulus vermutlich, denn sie hatte einen hohen, schlanken Wuchs. In dieser Gegend Aventuriens war es für einen Sklaven vergleichsweise einfach, durch Anhäufung von Reichtum seine Freiheit zu erkaufen und sogar in den Adel aufzusteigen. Bei Layla lag das vermutlich wenigstens eine Generation zurück, denn ihr Tulamidya hatte zwar eine lispelnden Lautfärbung, aber keinen Akzent. »Ist das wirklich so?«, fragte sie, Nachdenklichkeit heuchelnd. »Mich deucht, dass jene, die den Tod nicht fürchten, oftmals Angst vor dem Leben haben. Wäre das möglich?« Für ihren Augenaufschlag hätte jede Tänzerin ihre elegantesten Schritte gegeben.
Golgaron stand auf und wandte sich ihr zu, was den nützlichen Effekt hatte, dass ihre Rundungen unter ihm in den Dämpfen verschwanden und ihn nicht länger ablenken konnten. Er schüttelte langsam den Kopf.
»Die Konversation bereitet Euch kein Vergnügen, nicht wahr, frommer Zwölfgötterdiener?«
Er sog die Luft ein. Die Anrede deutete an, was alle vermuteten, viele zu wissen glaubten: dass Oron in die Finsternis gefallen war, der Kult der Zwölfe dort nichts galt, obwohl seine Tempel nicht geschleift worden waren. Layla jedenfalls schien sich außerhalb der Gemeinschaft von Praios, Peraine, Boron und ihren göttlichen Geschwistern zu stellen. Welch ein Frevel, und das gegenüber einem Geweihten! Dennoch kam Golgaron nicht umhin, sich einzugestehen, dass Radscha diese Frau überreich gesegnet hatte. Das Bild ihrer wohlgerundeten Brüste stand ihm vor Augen. Er ertappte sich dabei, auf Lücken in den Schwaden zu hoffen.
Layla schien seinen Wunsch zu erraten. Sie erhob sich ebenfalls, was nicht nur die Dämpfe zum Wallen brachte. Sie war beinahe so groß wie er. Der Blick auf die beiden schwarzen Granatäpfel war nun frei. »Das ist bedauerlich«, fuhr sie im Plauderton fort, »denn ich würde gern eine Frage mit Euch erörtern, die mich schon lange beschäftigt: Ich sah den weißen Raben auf der Brosche an Eurem Turban. Ist dies nicht das Zeichen des borongefälligen Ordens der Beni Etilia?«
Obwohl er sich dem Gespräch entziehen wollte, nickte er seine Zustimmung.
»Ihr müsst mir nun beistehen«, schnurrte sie. »Ist Etilia nicht eine Tochter des Menschengeschlechtes?«
»Das war sie«, bestätigte er, denn er konnte die Antwort nicht verweigern. Hatte diese Frau etwa einen Zauber über ihn geworfen, der ihn zwang, an diesem Gespräch teilzuhaben?
Sie lächelte. »Etilia wird als große Schönheit beschrieben, nicht wahr?« Sie strich sich das Wasser von den schlanken Armen, tauchte die Hände hinab in den Nebel, fuhr mit ihnen ihre biegsame Gestalt herauf und knetete ihre Brüste, bevor sie sich in den Nacken griff und die schulterlangen Haare vom Hals fortzog. »Eine wahrhaft verführerische Frau, wenn man der Sage glauben darf.«
Golgaron war zu keiner Reaktion fähig. Es kostete ihn all seine Beherrschung, den Blick auf die großen Augen zu fixieren, in denen ein Feuer brannte, das seine Nahrung nicht in der Welt des Greifbaren hatte.
»Als Etilias Zeit kam, so sagte man mir, trat sie vor den Herrn Boron, wie es jeder Mensch tun muss. Was dann geschah, ob er sie züchtigte oder nicht, darüber habe ich viele Geschichten gehört, keine wie die andere. Mir scheint, niemand weiß es, denn es gibt Dinge, die den Sterblichen nicht berichtet werden oder die dem Vergessen anvertraut sind, das Euer Gott so schätzt, nicht wahr, Sahib?« Sie zwinkerte kokett.
Golgaron wollte sich abwenden und das Bad verlassen, doch die Gesandte hielt ihn gebannt. War dies einfach die Anziehungskraft einer außergewöhnlichen Frau? Oft war man zu leichtfertig dabei, sich dem abergläubischen Volk anzuschließen und hinter allem arkane Kräfte zu vermuten. Vieles war nur eine Frage der Disziplin. Die Weisheit der Bücher verhinderte allerdings nicht, dass sich das Blut in Golgarons erhitztem Leib daran machte, seinen Schwellkörper zu erhärten.
Beiläufig kniff sich Layla in die Brüste. Ihre Warzen richteten sich sofort auf. »Was mich noch mehr interessiert, ist die Frage, was danach geschah. Noch nachdem der Totengott in für ihn untypisch wildem Rausch die gütige Marbo zeugte, meine ich. Aus ungeklärtem Grund schickte Boron seine Etilia zurück in die Welt der Sterblichen.«
»Er verschonte sie«, korrigierte Golgaron.
»Verschonen?« Sie lächelte. »Wovon denn verschonen? Lehrt die Boron-Kirche denn nicht, dass der Tod für die Gerechten frei von Schrecken sei?«
Er presste die Lippen zusammen. Wie konnte sie es wagen, die heiligen Lehren und die frommen Legenden gegeneinander auszuspielen? Er rief sich ins Gedächtnis, was ihm seine Lehrer beigebracht hatten: ›Streite nicht wie die Narren. Das Schweigen ist das stärkste Argument.‹
»Doch auch das ist es nicht, was mich beschäftigt. Was ich wissen will:«, sie stellte sich auf die Zehen, um ihm ins Ohr zu flüstern, berührte ihn beinahe mit den vollen Lippen, »Nachdem er sie fortschickte, was wurde da aus der armen Etilia? Sicher, auch dazu hat der Pöbel seine Märchen, doch Tatsache ist, dass der Tod sie zurückgewiesen hat, nicht wahr? Wenn sie ihm nicht willkommen ist, muss sie dann nicht auf ewig zwischen den Lebenden wandeln, ohne jemals die letzte Ruhe zu finden? Dann kann sie niemals Einlass erhalten in eines der Paradiese der Zwölfgötter. Ist das nicht grausam gegenüber einer so außergewöhnlichen Frau?«
Gebannt lauschte Golgaron, unfähig, sich abzuwenden.
»Niemand kann sagen, ob dieses Zeitalter wirklich den Menschen gehören wird, aber gewiss ist, dass der Herr Boron im Großen wie im Kleinen stets sein Recht fordert. So wird auch der Moment kommen, an dem die Menschen sich zur Ruhe legen und ihren Nachfolgern die Herrschaft über die Welt überlassen müssen. Eines fernen Tages werden sie alle dahingegangen sein. Alle außer der armen Etilia, die in Einsamkeit über eine verfluchte Welt schreiten muss. Und würden sie auch ein Meer füllen, es könnten nicht genug Tränen sein, den Fluch zu beweinen, den der Herr Boron dieser schönen Frau auferlegte.« Sie seufzte theatralisch. »Umso mehr erstaunt es mich, dass seine Diener so beständig gegen jene predigen, die ihr Schicksal teilen.«
»Wie meint Ihr das?«, keuchte er.
Sie entfernte sich wieder von ihm, sah ihm in die Augen. »Enttäuscht mich nicht, Sahib. Ihr wisst, wovon ich spreche. Wurdet Ihr gestern nicht als jemand vorgestellt, der Tobrien bereiste? Oder sollte unser Praiosdiener gelogen haben?« Sie schnalzte mit der Zunge. »Nein, das kann ich mir nicht denken. Er ist ein solch langweilig tugendhafter Mann, dieser Praiohardt. Wenn Ihr aber in Tobrien wart, so habt Ihr sie doch gesehen, diejenigen, die dem Grab entstiegen sind, die neu belebt über das Land wandeln, ganz wie Eure Etilia!«
»Blasphemie!«, rief er und löste sich aus ihrem Bann. Er wollte zur Tür eilen, glitt aber auf dem rutschigen Boden aus und stürzte.
Sofort war sie bei ihm und half ihm auf. Der Griff um seinen Arm war erstaunlich kräftig. »Eines müsst Ihr mir noch sagen«, verlangte sie. »Glaubt Ihr, dass der Herr Boron lächelt, wenn er an seine Etilia denkt? Und daran, was er ihr angetan hat?«
Ächzend riss er sich los und wankte hinaus. Sofort schloss er die Tür und lehnte sich dagegen. »Paktiererin«, stammelte er. Man sollte den Raum verkeilen und so kräftig heizen, dass das Leben aus dem obszönen Leibe wiche!
Die Dienerin räusperte sich und hielt ihm einen schwarzen Trockenmantel hin. Das Gesicht hatte sie abgewandt. Sie kämpfte augenscheinlich mit einem Lachen.
Golgaron sah an sich herab. Sein Körper hatte stärker auf die Nähe der schwarzhäutigen Schönheit reagiert, als ihm lieb war. Hastig bedeckte er sich und eilte hinaus.
In dem ihm zugewiesenen Zimmer kleidete er sich sorgfältig an und versuchte dabei, sich zu beruhigen. Während seine körperliche Erregung abklang, wurde sein Geist noch stärker aufgewühlt. Die Zuversicht Praiohardts konnte er nicht teilen. Nach dieser Begegnung traute er Layla vieles zu, auch den Geist der Beyrouni derart zu verwirren, dass diese die Hand ihres Sohnes einer Braut gab, die gar nicht anwesend war. Golgaron knirschte mit den Zähnen. Nein, dieser Kampf war noch lange nicht für Aranien, für die Zwölfgötter entschieden. Wie konnte er nur so untätig hier sitzen, wo es doch seine Pflicht war, jeden Moment zu nutzen, um eine günstige Entscheidung herbeizuführen?
Er atmete tief durch und begab sich in den Innenhof, wo die Gesellschaft noch immer beisammensaß. Er ließ sich auf einigen Kissen am Rande nieder, konnte seine Gedanken aber nicht genügend ordnen, um sich einzubringen. Das Gespräch drehte sich um Belanglosigkeiten, die Beyrouni diskutierte über verschiedene Sorten von Seide und beachtete ihn nicht weiter, nachdem sie ihm einmal höflich zugenickt hatte. Auch die anderen Anwesenden ignorierten ihn, wie es im Grunde gegenüber einem Diener Borons angemessen war, was es ihm nun jedoch besonders schwer machte. Da er nicht gewohnt war, eine Unterhaltung zu bestreiten, und seine Gedanken zudem immer wieder zu dem radschagleichen Körper im Dampfbad zurückkehrten, konnte er das Schweigen nicht überwinden.
Schließlich kündigte der Wesir den Thronerben und dessen Bruder an: »Die Prinzen Rengûn und Murasan, Ihr Herrschaften.«
Die beiden älteren Söhne der Beyrouni waren offensichtlich glänzender Laune. Auf ihren schimmernden Panzern klebte frisches Blut. Zufrieden beugten sie die Knie vor ihrer Hohen Mutter.
»Wir haben euch vermisst, meine Söhne«, meinte sie mit mildem Tadel. »Euer Bruder Marut, das jüngste meiner Kinder, war der einzige, der uns heute Gesellschaft leistete.« Sie seufzte. »Dabei sollte ich doch hoffen, dass euch die Flausen allmählich verlassen würden.«
Rengûn griff nach einem Kelch und trank in tiefen Zügen. »Sei doch nicht so streng mit uns«, bat er. »Nachdem wir uns heute ausgetobt haben, werde ich morgen die Geduld haben, alles anzuhören, was die ehrwürdigen Gäste uns vorzutragen haben.«
Praiohardt nickte zustimmend, ebenso wie Brobur, der Gesandte der Kirche der Schwertherrin.
Sorena seufzte. »Wart ihr wenigstens erfolgreich?«
Schalkhaft grinsend zog Prinz Rengûn das Krummschwert. Die Blutrillen waren ebenso rot wie die Schneide. Langsam hob er die scharfe Waffe an den Mund und leckte darüber. Dann verzog er die Lippen, als habe er in eine Zitrone gebissen. »Der Lebenssaft der Goblins ist nicht gerade schmackhaft.« Er rammte die Klinge neben einer Stechpalme in den Boden. »Aber was soll man von solch hässlichen Kreaturen schon anderes erwarten?«
Sein Bruder Murasan lachte dröhnend, und die meisten der Anwesenden fielen ein. Beyrouni Sorena war offensichtlich nicht in der Stimmung, den jungen Männern zu grollen. »Das schwer bezähmbare Ungestüm der Jugend«, seufzte sie nur und deutete auf freie Sitzkissen. Die Prinzen entledigten sich ihrer Stiefel und ließen sich mit klappernden Panzern nieder, um den Erzählungen der Besucher zu lauschen.
***
Zauberkräfte waren Ferramud nicht gegeben. Die Göttin Hesinde hatte den Sohn eines Kaufmanns lediglich mit jener Schärfe des Geistes gesegnet, die sie dem Vater verwehrt hatte. Die goldenen Glöckchen, mit denen Ferramud als Säugling gespielt hatte, waren schon verkauft gewesen, als er das Lesen gelernt hatte. Der Reichtum war seiner Familie durch die Finger geronnen, bald nach dem Verlust des Adelstitels war auch der silberne Griffel durch einen bronzenen ersetzt worden. Vater und Mutter hatten es nicht ertragen, für einen Reicheren die Bücher führen zu müssen. Das Gift hatte schnell gewirkt. Auch auf diese Art konnte Armut töten. Eine Weile hatte er versucht, herauszufinden, wer ihnen das Pulver besorgt hatte, aber schließlich hatte er es aufgegeben. Wenigstens waren ihnen körperliche Schmerzen erspart geblieben.
Ferramud hatte daraus gelernt. Er hatte weisen Menschen gelauscht, nicht den Geschichtenerzählern, deren Märchen angenehm in den Ohren klangen, deren Zuhörer aber das Schwelgen im Traum mit dem Verweilen in einer kümmerlichen Existenz erkauften. Er verurteilte sie nicht, aber sich selbst hatte er geschworen, nie wieder arm zu sein. Bei einem Kababyloth, einem Zahlendeuter, war er in die Lehre gegangen. Er kannte viele der komplizierten Berechnungen, mit deren Hilfe man aus den numerologischen Werten von Namen, Zeiten, Sternkonstellationen und machtvollen Worten den Plan des Schicksals enträtseln konnte. In diesem Gewerbe war er sicher nicht der Beste, aber verstecken musste er sich mit seinem Wissen auch vor niemandem. Dass er sich dennoch schminkte, bis er einem wenigstens zehn Jahre älteren Mann glich, hatte einen anderen Grund. Kababylothische Kalkulationen waren eine langwierige Sache. Kaum ein Kunde war ernsthaft an der Zukunft interessiert, geschweige denn wäre er bereit gewesen, auf die Enthüllung nicht immer angenehmer Wahrheiten Tage oder gar Wochen zu warten. Nein, man wollte Geschichten hören, die jenen aus ›Tausendundeinem Rausch‹ glichen, während man aus einer Wasserpfeife den Rosentabak rauchte und dabei an den Lippen eines alten Erzählers hing. ›Alt‹ war dabei wichtig. Ferramud zählte nicht einmal fünfundzwanzig Jahre. Dadurch, dass er seinem Aussehen nachhalf, machte er seine Kunden zufriedener und konnte sich mittlerweile die zwanzig Dinare Kopfsteuer leisten, die es ihm gestatteten, den Silberschmuck der Freien zu tragen und die Zeit so zu gestalten, wie es ihm gefiel.
Er hatte bereits viele Teile Araniens bereist, doch immer kehrte er gern nach Gwerrat zurück, an den Ort, an dem er aufgewachsen war. Die Beyrouni hatte damals starken Anteil genommen am Tod seiner Eltern. Selbstverständlich konnte er sie mit seiner Maskerade nicht täuschen, doch sie schien sich über dieses Schauspiel ebenso zu amüsieren wie über die Vorführung mit den bunten Karten gestern Abend, bei der ihm sein Zwergpapagei Ipp assistiert hatte. Stets behandelte sie ihn wie einen Ehrengast und gab ihm zudem Gelegenheit, seine Kunst vor ihren Besuchern zu präsentieren, was ihm eines Tages eine gut entlohnte Anstellung am Hofe eines Effendis einbringen mochte.
Jetzt saß er am Rande des Baldachins, unter dessen zartrosa, mit Goldquasten verziertem Tuch sich die Familie der Beyrouni niedergelassen hatte. Obwohl nur drei Kissen seinen Sitz polsterten, was nebenbei bemerkt eine starke und gute Zahl war, hätte ein schalkhafter Sänger beinahe eine Bevorzugung gegenüber den anderen Gästen erkennen können, denn keinem Mitglied der angereisten Delegationen war es gestattet, am Kopfende des Tisches Platz zu nehmen. Damit wahrte Beyrouni Sorena die Neutralität, die ihr kleines Fürstentum sich in den vergangenen Jahren erhalten hatte. Und mit der es bald vorbei sein wird, dachte Ferramud, egal, woher die Braut kommen mag, ist doch ganz Aranien in den Konflikt zwischen Moghuli Dimiona und dem königlichen Paar auf dem Seerosenthron involviert. Kräfte, von denen nichts in den Schriften der Götter stand, hatten die elburische Halbinsel hinter einer Hecke aus Dornen und Wein verschanzt, sodass dort das angeblich alttulamidische Reich Oron unangreifbar war. Ihrerseits hatten die Oronier eine Invasionsstreitmacht geschickt, um das Yalaïad zu unterwerfen; zu schwach, um diesen Auftrag erfolgreich abzuschließen, doch stark genug, um sich seit Jahren festzukrallen. Egal also, ob die Braut aus Aranien, aus Oron oder aus dem umkämpften Gebiet stammte, ihre Heimat wäre mit Gewissheit an den Kämpfen beteiligt, wenigstens mit entsandten Kriegern.
Diener standen in dem großzügigen, offenen Saal und fächerten den vornehmen Persönlichkeiten mit Büscheln aus Pfauenfedern Luft zu. Die Mittagsruhe war vorbei, draußen schwoll der Gesang der Flamingos beständig an und hier wurden den Gästen Tee und Gebäck gereicht.
Mit geringfügiger Verspätung, wie es die Koketterie mit der Etikette gebot, betrat Rahidra den Saal, geleitet von ihrem Vater Habled, einem vermögenden Seidenhändler aus Chalukand, der die Marmorsäulen im Vorübergehen musterte, als wolle er den Wert des Palastes schätzen. Er war ein eleganter Mann, und doch wirkte er plump neben seiner Tochter, deren Gewand eine Mischung aus Verführung und Wehrhaftigkeit darstellte. Ein spitzer Helm krönte ihr Haupt, umwunden mit einem feinen, orange-gelb gestreiften Turban, unter dem das lange, schwarze Haar wie eine Sturzflut hervorbrach, die erst an den Hüften endete. Ihre Haut hatte die Farbe von Bronze, auf den Platten ihres Spiegelpanzers blitzten golden herausgearbeitete Rosen, die auf ihrer Brust erblühten. Ihre Arme waren nackt und von Goldspangen geziert. Der seidene Umhang mochte dazu dienen, ihren Wohlgeruch jenen zuzufächeln, denen sie entgegenkam. Wärmen oder die Nässe abhalten konnte der durchscheinende Stoff nicht. Die Kettenglieder ihrer Rüstung reichten bis zu den Oberschenkeln, darunter war der leuchtend rote Stoff einer Pluderhose zu sehen. Der Sitte des Ortes gehorchend war ihr Schwertgehänge leer. Auch die Reiterstiefel hatte sie natürlich ausgezogen, sodass sie mit nackten Füßen über den weichen Teppich schritt. Dies hatte seinen besonderen Reiz, da auf dem rechten Spann mit rotbrauner Farbe eine Katze gemalt war, auf dem linken der Kopf eines Flamingos. Ein höfliches und zugleich deutliches Zeichen dafür, dass man wünschte, Aranien und Gwerrat möchten zueinander finden.
Ferramud räusperte sich, um nicht zu lachen, als die aranische Delegation sich bemühte, genügend Platz für Braut und Vater in ihrer Mitte zu schaffen, ohne an den Enden der Tafel der Hausherrin ungebührlich nahe zu kommen oder gar die Distanz zu der oronischen Werberin aufzugeben, die die andere Seite für sich allein hatte.
Layla al’Azila hatte eine außergewöhnliche Ausstrahlung, was schon dadurch deutlich wurde, dass trotz der siebenundzwanzig Gäste auf der anderen Seite nicht der Eindruck entstand, es gäbe ein Ungleichgewicht zwischen den Delegationen. Die Aranier waren offensichtlich voller gespannter Erwartung den bevorstehenden Gesprächen gegenüber, stießen sich an und tuschelten mit glühenden Augen, die vom Feuer ihres tulamidischen Blutes kündeten. Laylas goldbestäubte Lippen dagegen lächelten wissend oder amüsiert in dem obsidianschwarzen Gesicht. Im Vergleich zu Rahidras Aufzug wäre das rotschwarz gestreifte Gewand der Oronierin bescheiden erschienen, hätte es nicht ihre natürlichen Vorzüge in nahezu lasziver Weise betont. Ferramud hoffte bei jeder ihrer Bewegungen, der feucht schimmernde Seidenstoff möge so verrutschen, dass er die Knospen enthüllte, wurde jedoch bislang enttäuscht. Tee und Süßigkeiten hatte die Schwarze nicht angerührt. Sie machte sich einen Spaß daraus, mal einen jungen Kämpfer, dann wieder einen Gelehrten aus der aranischen Delegation zu mustern und mit kecken Augenaufschlägen verlegen zu machen, bis er den Blick abwandte. Für diese Avancen waren sowohl die männlichen als auch die weiblichen Mitglieder der Delegation empfänglich.
Praiohardt Sahib stand auf und räusperte sich. Der Geweihte des Sonnengottes hatte sich auch in den vergangenen Tagen als jemand erwiesen, der nervös wurde, wenn er seine Persönlichkeit nicht strahlen lassen konnte. »Hochverehrte Beyrouni Sorena Effendi!«, hob er an. »Ihr gebietet weise über ein Land des Glücks. Das Jauchzen Eurer Untertanen wird auch in Zorgan, Chalukand und den Palästen der Emire gehört.«
Ferramud gab seinem Papagei eine Nuss, die der kleine Vogel geschickt mit einem Fuß entgegennahm, um die harte Schale sogleich mit dem gebogenen Schnabel zu bearbeiten. Während der lang anhaltenden Lobhudelei über den Reichtum von Gwerrat, die Wohlgestalt seiner Bewohner im Allgemeinen, der Prinzen im Besonderen und Rengûns im Speziellen hörte der Wahrsager kaum zu, sondern spielte lieber mit seinem gefiederten Freund, den er von Finger zu Finger klettern ließ. Das war der Vorteil seiner niedrigen Stellung: Es wurde nicht als Unhöflichkeit empfunden, wenn er darauf verzichtete, dem Sprecher gebannt an den Lippen zu hängen. Manchmal bohrte sich eine Kralle schmerzhaft in die Hand oder der als Steighilfe gebrauchte Schnabel zwickte, aber niemals so sehr, dass eine Verletzung entstanden wäre. Als es an das Verteilen der Gastgeschenke ging, platzierte er seinen Vogel wieder auf der Schulter.
Viel Seide war dabei, ein Dutzend Ballen höchster Qualität. Rahidras Vater Habled reckte den Hals, als die Beyrouni darüberfuhr und die Eigenschaften des Gewebes flüsternd mit ihren Söhnen diskutierte. Krüge mit Olivenöl kamen dazu, auch goldenes Geschmeide. »Erweist uns die Gnade und nehmt diese Geschenke als Vorspiel zu den Freuden, die wir Euch schenken wollen, sollte Eure Weisheit sich für die liebreizende Rahidra entscheiden.«
Die Genannte lächelte zufrieden und warf einen triumphierenden Blick über den Tisch, wo die Oronierin dem Spektakel mit Gleichmut zusah. Die Beyrouni dagegen bedankte sich für die kostbaren Gaben. Auch Rengûn fand Worte des Lobes.
»Ihr seid zu gütig«, erklärte Praiohardt und verbeugte sich. »Ich will nun die Sitten ehren und der Gegenseite Gelegenheit geben, ihre Gaben vorzubringen.« Mit einem lauernden Ausdruck im Gesicht setzte er sich. Alle Augen wandten sich Layla zu.
Geschmeidig erhob sich die Schwarzhäutige von den brokatenen Sitzkissen und verneigte sich vor dem Baldachin der herrschenden Familie. »Effendi, ich kam ohne Karawane hier an. Wie Ihr wisst, falls Euer Interesse geruht, sich mit den Ereignissen außerhalb Eures glücklichen Tales zu beschäftigen, ist unsere Satrapengarde noch nicht bis hierher vorgedrungen, sodass die Straßen für unsere Waren nicht eben sicher sind.«
Praiohardt fuhr auf wie von einem Skorpion gestochen. »Was wollt Ihr damit sagen?«, donnerte er. »Wir sind keine Karawanenräuber! Aranien ist ein zwölfgötterfürchtiges Land!«
Beyrouni Sorena räusperte sich. Nicht laut, doch es war genug, um Praiohardt erröten zu lassen. Er stammelte eine Entschuldigung, als er sich setzte.
»Zwölfgötterfürchtig, ja …«, sinnierte Layla. »Das ist ein Unterschied, nicht wahr: ›zwölfgötterfürchtig‹ und ›zwölfgötterwissend‹. In Oron verwaisen die Tempel der sogenannten Zwölfe zusehends, nachdem das Volk die Möglichkeit hat, den wahren Offenbarungen zu lauschen.«
Diesmal brauchte es deutlichere Hinweise und längere Zeit, bis der Tumult auf aranischer Seite sich legte. Tulamidisches Blut ließ sich schnell in Wallung bringen, vor allem auch dann, wenn Heiliges mit Spott bedacht wurde. Der alte Feind, die Novadis, war nicht zuletzt wegen seines frevlerischen Rastullahglaubens verhasst, der die segnende Kraft der Zwölfe leugnete. Hier in Gwerrat betrachtete man solche Dinge deutlich entspannter. Der Dschinn des Flusses und des Sees sorgte für alles, ihn verehrte man, wenn auch auf andere Weise, als es die Geweihten mit ihren Göttern taten. Ein uralter Pakt mit der Herrscherfamilie garantierte den Wohlstand des Beyrounats. Hier gab es keinen Tempel. Wenn die Bauern das wunderkräftige Wasser aus dem See auf ihre Felder sprengten, wirkte dies zuverlässiger als der Segen der Peraine. Man respektierte die Künste der Rondra, doch dienten sie dem Abenteuer, nicht dem Schutz des Landes. Oronische wie aranische Soldaten hatten erfahren, welche Wache Gwerrat sicherte, als ihre Gefährten in von Zauberhand geschleuderten Wasserhosen ertrunken waren.
»Meine Damen, meine Herren«, verschaffte sich die Beyrouni Gehör. »Ich respektiere Eure Sitten, doch achtet auch die unseren. Es ist mein Wunsch und Wille, beide Seiten anzuhören. Wie soll mir das gelingen, wenn man die edle Layla nicht ausreden lässt? Nun erweist mir die Freude, bezähmt Euer Gemüt und macht es mir nicht so schwer, die rechte Gemahlin für meinen Sohn zu finden.«
Ferramud bemerkte, wie Davira zusammenzuckte. Sie lag in seiner Nähe neben dem Baldachin. Jeder wusste, dass sie die Geliebte des Zweitgeborenen Murasan war, doch war ihre Familie mit Armut geschlagen, wie auch ihr bronzener Unfreienschmuck verkündete. Sie würde nie als würdige Gattin im Palast der Beyrouni willkommen geheißen werden, niemals unter dem Baldachin mit dem Flamingowappen ruhen.
Layla neigte dankbar das Haupt, wobei ihr goldenes Lächeln noch immer einen spöttischen Zug hatte. »Dies ist auch nicht der einzige Grund, warum ich ohne prachtvolle Geschenke komme«, setzte sie die unterbrochene Rede fort. »Noch nicht einmal der wichtigere. Denn dieser besteht darin, dass ich mir dachte: ›Komme ich denn in ein Armenhaus, zu einer Bettlerin, die Almosen nötig hat?‹« Sie schlenderte den Tisch entlang zum Baldachin, einen Samtbeutel in den Händen haltend, auf dem all die Blicke hafteten, die sich von den Formen ihres Körpers hatten losreißen können. Elegant legte sie ihn in die Hände des Dieners, der die Gabe an seine Herrin weiterreichte.
Interessiert öffnete Sorena die Verschnürung und zog einen flachen Gegenstand hervor. »Ein Handspiegel«, stellte sie fest.
»Eine bescheidene Gabe«, räumte Layla ein, doch es lag kein Zugeständnis in diesen Worten. »Schätze habt Ihr genug, o Mutter der Weisheit. Doch Erkenntnis ist etwas, nach dem immer weiter zu streben sich lohnt. Die eigene Größe zu erkennen, diesen Wunsch entfacht die erhabene Moghuli im Reiche Oron.« Sie schlenderte zurück zu ihren Sitzkissen, während die Beyrouni die ›bescheidene Gabe‹ zur Begutachtung an ihre Söhne weitergab. Maruts Hand sackte herab, als er den Spiegel entgegennahm. Offenbar hatte er sein Gewicht unterschätzt, was wiederum darauf hindeutete, dass er aus massivem Gold bestand, nicht nur lackiert war. Die Fläche in der Mitte war dann wohl auch aus echtem Silber, die schwarzen und roten Edelsteine im Rand sicher keine gläsernen Nachbildungen.
»Das Wissen um die, nun, sagen wir: um die Gesetze der Welt, um die Art, wie die Sphären gefügt sind, beginnt beim Wissen um uns selbst«, postulierte Layla, als sie sich niederließ. Unvermittelt sah sie Rahidra direkt an. »Ihr gehört zum radschagefälligen Rosenorden, nicht wahr?« Sie wartete die Bestätigung nicht ab. »Doch sagt mir, habt Ihr Eurer Göttin jemals ins Antlitz geblickt? Oder nur ihren verschämten Geweihten, die alles mit kleinlicher Begrenztheit betrachten, die nicht wagen, sich auszumalen, was hinter dem Schleier wartet? Dies wird nur der Mutige erfahren, der den Vorhang entschlossen beiseite schiebt und die Schritte tut, vor denen die Sklaven zurückschrecken.«
»Aber bitte«, sagte Rengûn über das anhebende Gemurmel hinweg. »Wir wollen hier doch keine Predigten hören. Dies ist ein Palast, in dem wir froh sein wollen, kein Bethaus.«
Layla neigte das Haupt. Diese Geste der Unterwürfigkeit löste bei Ferramud eine von Begierde erfüllte Fantasie aus. »Verzeiht, wenn ich mich missverständlich ausgedrückt habe. Ich wollte keine kriecherischen Rituale vorschlagen, bei denen man gezähmten Göttern für Gaben dankt, die in Wahrheit Frucht der eigenen Kraft sind. Das Nachdenken ist es, das ich schätze, frei von Fesseln, vor allem, wenn es in klugen Köpfen wie denen der ay Gwerrats stattfindet.«
Die Beyrouni nickte huldvoll. »Euer Geschenk wird in dem Geist empfangen, in dem es gegeben wurde.«
Praiohardt kochte förmlich auf seinem Sitz, nur mühsam beruhigt von seinen Adepten. Ferramud erkannte die Klugheit in der Taktik der aranischen Delegation, ihn als Ersten sprechen zu lassen. Die weiseren Gesandten hatten wohl geahnt, dass die Oronierin keine leichte Gegnerin war und durchaus vermochte, ihre Gegner zu reizen und zu unbedachten Reaktionen zu provozieren. Da man den Abgesandten der Sonnenkirche unmöglich ignorieren konnte, war es klug gewesen, ihm seinen Auftritt zu geben, als die Stimmung noch entspannt gewesen war.
Wer mochte diese Planung wohl vorgenommen haben? Die Magierin von der Schule des Seienden Scheins? Gut möglich. Jene, die sich an den Akademien mit den magischen Kräften auseinandersetzten, waren es gewohnt, Dinge vorauszusehen, die der Aufmerksamkeit anderer entgingen. Oder der Boroni? Die Schweigsamkeit der Schwarzgewandeten führte oft dazu, dass man sie unterschätzte, aber hinter dem Panzer aus Stille woben sie komplexe Gedankengeflechte. Ferramuds Blick traf den des Geweihten. Durch die eisblauen Augen glaubte er in eine weite Halle zu sehen.
Vielleicht war der wahre Anführer der Aranier aber auch der Rondra-Geweihte Brobur, der sich nun erhob. Er trug einen mit Nieten verstärkten Panzer aus dunklem Leder, der Torso und Unterleib bedeckte. Den Helm mit dem eisernen Nackenschutz hatte er vor sich auf den Tisch gestellt. Weite Ärmel aus blauer Seide unterstrichen seine Gesten. »Mutter der Weisheit, Prinzen des Sees, Ihr hohen Damen und Herren, verzeiht, wenn sich die Eleganz meiner Sprache nicht mit der meiner Vorrednerin messen kann. Meine Liebe gilt der Herrin der Schlachtfelder. So sollte ich denn eigentlich mit den Zeiten zufrieden sein, mögen sich manche denken. ›Gibt es nicht Feuer und Kampf im ganzen Yalaïad?‹, so kann man fragen. Nun, ich will nicht leugnen, dass die Kämpfe so manch ehrenhaftes Gefecht bieten, in dem Helden geschmiedet werden, wie es meiner Göttin gefällt. Doch sind es nicht die Ritter des Mittelreiches, gegen die wir antreten, wie unsere Ahnen es einst taten. Vielmehr stehen wir mit allen Göttergesegneten«, er betonte das Wort, »gemeinsam gegen einen Feind, der nur wenig Ehre kennt. ›Satrapengarde‹ nennen sie ihre Streitmacht, doch scheint es, dass man nur jene zusammengerufen hat, deren Gier nach Gold und Mord längst jeden Anstand erstickt hat.«
Er schien auf Widerspruch von Layla zu warten und wirkte überrascht, als Prinz Rengûn eine Frage an ihn richtete: »Wird nicht in jedem Krieg und von jedem Heer geplündert und gebrandschatzt?« Es klang neugierig, kein Urteil lag in den Worten. Soweit Ferramud wusste, hatte in Gwerrat niemals mehr als ein Haus zur gleichen Zeit gebrannt, und das auch nur dann, wenn das Herdfeuer oder die Glut einer Pfeife vernachlässigt worden waren. Man wusste hier nur aus Erzählungen, was es bedeutete, wenn eine von Söldnern entfachte Feuersbrunst eine Stadt verheerte.
Brobur Sahib wog seine Worte sorgfältig. »Fürwahr, dies zu leugnen wäre schändlich. Doch gerade in dem Umstand, dass die Seele des Menschen unvollkommen ist und sich zur Grausamkeit hinreißen lässt, finden wir einen guten Grund, uns am hellen Stern der Göttin zu orientieren, die uns zu ehrenhaftem Verhalten anspornt. Feige Überfälle sind schändlich, nur der Kampf mit einem angemessenen Gegner bringt Ruhm, nicht das Hinschlachten von Bauernvolk.«
Rengûn nickte bestätigend zu diesen Erläuterungen. Auf Laylas Stirn meinte Ferramud eine Falte der Missbilligung zu erkennen, doch es mochte auch nur ein Schatten auf der schwarzen Haut sein.
»Wie ich schon sagte«, fuhr Brobur fort, »ist meine Denkweise die eines Kriegers. Unbestreitbar sind die Vorzüge der edlen Rahidra, doch bevor davon geredet werden soll, mag ich unumwunden darauf zu sprechen kommen, was wir alle wissen und was nicht schamhaft verschwiegen werden darf. Ja, Prinz Rengûn ist ein stattlicher Jüngling, doch niemand wird mich einen Lügner schimpfen, wenn ich behaupte, dass Aranien mit diesen reich gesegnet ist. Die anstehende Vermählung jedoch hat eine Bedeutung über das Glück des Paares und den Wohlstand von Gwerrat hinaus. Euer Dschinn, der Meister dieses Ortes, schuf hier etwas, das ich mich eine Bastion zu nennen erdreiste. Welcher Seite auch immer Ihr Euch zuzuwenden gedenkt, sie erhält eine beinahe uneinnehmbare Basis für Nachschub und Planung im Herzen des Yalaïad. Wo jetzt noch die Waffen schweigen, werden schon in wenigen Monden Krummschwerter geschliffen und Pfeile geschnitzt, dessen bin ich mir gewiss. Für die Yalaïatim ist es keineswegs gleich, ob dies von götterfürchtigen Händen getan wird oder von solchen, die Gift in die Ohren von Gläubigen träufeln und ihre Tempel zu Ruinen werden lassen.« Wieder wartete er ab, doch diesmal herrschte nur nachdenkliches Schweigen. »Ich bitte darum, diese Verantwortung zu bedenken, wenn Ihr entscheidet.« Er verbeugte sich tief, bevor er Platz nahm.
Nun traten die Fürsprecher auf. Der Vater erläuterte die Vermögensverhältnisse seiner Familie, deren Haupterbin die Braut war, danach pries ein Agha der Goldenen Drachen ihre militärischen Verdienste. Ferramud merkte sich noch nicht einmal den Namen des Kriegers, er spielte wieder mit seinem Papagei, eine Beschäftigung, an der sich auch Davira beteiligte. Sie kraulte die blauen Federn am Kopf des klugen Vogels, was dieser sich umso lieber gefallen ließ, als dass die Geliebte des zweitgeborenen Prinzen ihn auch mit Nüssen fütterte, die sie zuvor von der Schale befreit hatte.
Rahidra ging an der Seite des Tisches entlang und stellte sich dem Baldachin gegenüber auf. Ihre Hand griff ins Leere, als sie nach ihrem Krummschwert fassen wollte, wie es wohl ihre Gewohnheit war. Sie runzelte die Stirn, dann nahm sie den Erbprinzen in den Blick. Ihr Gesicht war bezaubernd geschminkt, mit glitzerndem Staub und Akzenten an Augen und Wangen. Ferramud konnte das beurteilen, hatte er sich doch über Jahre hinweg darin geübt, Farbe so aufzutragen, dass sie nicht künstlich erschien und dennoch einen Effekt erzielte, der der Natur entgegenwirkte oder sie überhöhte.
»Mutter der Weisheit, fürstliche Prinzen, vor allem Rengûn, von dessen Tapferkeit ich so viel Gutes vernahm. Die edlen Herren vor mir haben gesagt, was zu sagen ist in dieser Stunde, ich aber will der schönen Göttin gefällig einige bescheidene Verse kundtun:
Der Radscha Wonne,der Herrin Ehre,Rose und Schwert –sie sind mein Gefährt,sie leiten meine Wege.Im Rausche ich legemeinen Schild dem zu Füßen,den auf Seerosenthron zu grüßenmeine Ehre befiehlt,der das scharfe Schwert hielt,das zur Ritterin mich macht’.Doch sei stets bedacht:auch in der Schlachten Pein –mein Herz sei dein!«
Er wusste nicht, woran er es bemerkte. Vielleicht war es die Erfahrung, die einen Geschichtenerzähler erkennen ließ, wenn er das Publikum verlor. Ihm war, als sinke die Temperatur, als wehe ein kalter Windstoß unter dem Baldachin hervor. Das Lächeln der Beyrouni war unter dem durchsichtigen Schleier gefroren. Auch ihre drei Söhne wirkten erstarrt.
Der Damast von Rengûns Gewand raschelte, als er sich bewegte. »Nach diesem Vortrage mag ich wohl glauben, Teure, dass Euer Begehr darauf zielt, Aranien zu dienen …«
»Nicht Aranien allein«, fiel sie ihm mit lodernden Augen ins Wort, »mein Herz brennt für die schöne Herrin Radscha und ihre göttlichen Geschwister! Ihre Liebe will ich erringen!«
Rengûn räusperte sich. »Vielleicht hat einer von uns etwas missverstanden. Ich jedenfalls dachte, hier ginge es um meine Vermählung, nicht diejenige einer Himmlischen.«
Rahidra brauchte einen Moment, um aus ihrer religiösen Verzückung zurück in die Palasthalle zu finden. »Das ist doch ganz einerlei«, wischte sie den Einwand weg. »Der Mhaharan Shah ermutigt alle Ritter des Rosenordens, sich schöne Jü