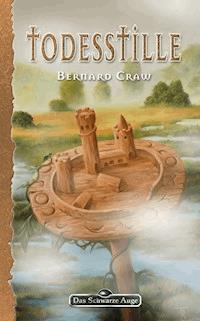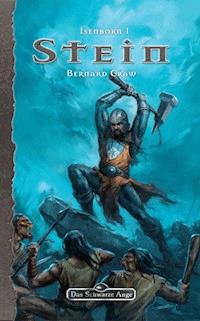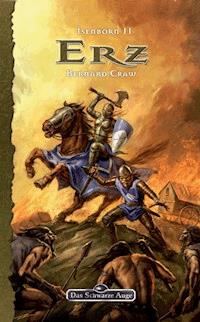Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ulisses Medien und Spiel Distribution GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Schwarze Auge
- Sprache: Deutsch
Die Dritte Dämonenschlacht ist vorüber - die düstere Bedrohung ist es nicht! Jetzt senden die dunklen Fürsten ihre Truppen in den Westen. Söldner, Drachen, ein Untotenheer und eine fliegende Festung sollen das Mittelreich zerbrechen. Inmitten dieses unheiligen Ansturms richten die Freiherren vom Isenborn ihr Banner über einem neuen Junkergut auf, während sich ihre Kinder fern der Heimat bewähren müssen: Fiana kämpft mit den Schergen des Dämonenkaisers um Isenborns Eisen, und Falk dient seinem Schwertvater als Knappe. Beide folgen dem Weg, den Mut und Pflicht sie weisen. Er wird sie zu Heldentum führen - oder in einen frühen Tod ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 455
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Biografie
Bernard Crawwurde 1972 in Bramsche geboren. Er ist katholisch, ledig und arbeitet hauptberuflich als Projektleiter in einem internationalen Konzern. Nach einigen Jahren in Münster und Sindelfingen wohnt er seit 2000 in seiner Wahlheimat Köln.
Craw schreibt vor allem fantastische Literatur. Mit dem RollenspielDas Schwarze Augekam er 1985 in Kontakt, und die geselligen Abende vorDokumenten der StärkeundPlänen des Schicksalsavancierten rasch zur dominierenden Freizeitbeschäftigung. Vor demIsenborn-Zyklusveröffentlichte er die DSA-RomaneTodesstilleundIm Schatten der Dornrose.
Wer sich über Craws literarische Aktivitäten informieren
möchte, kann dies auf www.bernardcraw.net tun.
Titel
Bernard Craw
Eisen
Isenborn-Zyklus Band 3
Ein Roman in der Welt von Das Schwarze Auge©
Originalausgabe
Impressum
Ulisses Spiele Band 11058PDF
Titelbild: Alan Lathwell Aventurienkarte: Ralph Hlawatsch Karte vonBurg Isenborn: Sabine WeissLektorat: Werner Fuchs Buchgestaltung: Ralf Berszuck E-Book-Gestaltung: Michael Mingers
Copyright ©2012 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems. DAS SCHWARZE AUGE, AVENTURIEN und DEREsind eingetragene Marken. Alle Rechte von Ulisses Spiele GmbH vorbehalten.
Titel und Inhalte dieses Werkes sind urheberrechtlich geschützt.Der Nachdruck, auch auszugsweise, die Bearbeitung, Verarbeitung, Verbreitung und Vervielfältigung des Werkes in jedweder Form, insbesondere die Vervielfältigung auf photomechanischem, elektronischem oder ähnlichem Weg, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Ulisses Spiele GmbH, Waldems, gestattet.
Rebellen
Verehrter Hochprophet!
Ich erlaube mir zu hoffen, dass Eure Verhandlungen mit den Trägern der anderen Splitter der Dämonenkrone im fernen Oron erfolgreich sind und Ihr eine sichere Heimreise haben werdet. Was mich betrifft, so bin ich Eurem Wunsche gemäß wohlbehalten in Yol Ghurmak eingetroffen. Die Veränderungen, die sich im ehemaligen Ysilia zeigen, lassen sich schwerlich allein mit der Macht des Agrimoth-Splitters erklären. Vielmehr sind sie nach meiner Überzeugung zu einem Gutteil auf die originären Kräfte Galottas zurückzuführen. Das Wirken verschiedener Dämonen, welche die Stadt nach ihrem Gusto formen, bedarf weitergehender Studien, über deren Ergebnis ich Euch zu einem späteren Zeitpunkt unterrichten werde. Ohne jeden Zweifel wird Yol Ghurmak eine formidable Residenz für den Mann abgeben, den viele bereits den ›Dämonenkaiser‹ nennen.
Man muss ihm zugestehen, dass er nach der schimpflichen Niederlage des erhabenen Borbarad, gepriesen sei sein Name, im Sommer sogleich die richtigen Maßnahmen ergriffen hat. Sofort nach der Rückeroberung und Sicherung der Trollpforte machte er sich an die Befestigung seiner eigenen Grenzen. Der Ausbau der Wehranlagen nach Norden hin, wo der Aufrührer Bernfried von Ehrenstein sein Pack um sich sammelt, hat wohl schon zuvor begonnen. Nun wurden auch die Pässe der Schwarzen Sichel mit Garnisonen versehen, wobei ohnehin nur der Sichelstieg relevanten Truppengrößen den Durchmarsch würde ermöglichen können. Dieser befindet sich fest in Galottas Hand, womit Bernfried wirkungsvoll vom Herzogtum Weiden isoliert bleibt. Daran ändert auch der Verlust der Feste Kleinwardstein nichts.
Von Yol Ghurmak aus hat Galotta wie eine Spinne sein Netz über Transysilien geworfen. Wenn sich mir der Sinn seiner rigiden Anweisungen auch nicht erschließt, etwa der Abgabe jeder Fehlgeburt bei Mensch und Tier an seine Büttel, so scheint er doch bereits in weiten Teilen des Landes genügend Autorität zu besitzen, um auch solche idiotischen Anweisungen durchsetzen zu können. Es mag sein, dass dies sein eigentliches Anliegen ist: durch derlei Gesetze die bedingungslose Treue des Pöbels zu prüfen, um die Störrischen sogleich aussortieren zu können.
Soweit sich sagen lässt, haben die Mittelreicher nach der Schlacht an der Trollpforte ihre Stärke bei Weitem nicht halten können. Die Händel ihrer Barone und Grafen erfordern die Anwesenheit der Truppen daheim, sodass ein gesammelter Heerbann kaum noch existieren dürfte. Dennoch ist der Feind nicht wehrlos. Insbesondere unsere dämonischen Diener haben den Unwillen jenseitiger Kräfte geweckt. In der Schwarzen Sichel haben sich erneut Greifen niedergelassen, die einige Vorstöße, die Galotta mit fliegenden Einheiten durchzuführen beabsichtigte, bereits im Keim erstickten. Auch Bernfrieds Verbände im Norden sind zwar weit von einer Schlagkraft entfernt, die ihnen an eine Rückeroberung unserer Territorien zu denken erlauben würde, doch haben sie andererseits keinen Raum mehr, in den sie zurückweichen könnten. Da die tobrischen Sturköpfe nicht zur Kapitulation neigen, ist davon auszugehen, dass sie kämpfen werden wie eine in die Ecke gedrängte Kobra. Deswegen ist mit ihrer Unterwerfung in naher Zukunft nicht zu rechnen.
So wage ich die Voraussage, dass sich Galotta entgegen seiner immer wieder geäußerten größeren Ambitionen in den nächsten Jahren auf die Festigung seiner Herrschaft in Transysilien beschränken und konzentrieren wird. Die Merkwürdigkeiten, derer ich hier in Yol Ghurmak ansichtig werde, veranlassen mich allerdings, diese Prognose auf die derische Sphäre zu beschränken. Was in dieser Stadt vor sich geht, entspringt entweder einem vollständig dem Wahnsinn verfallenen Geist, oder es dient einem Ziel, das in Geheimnissen begründet liegt, die jenseits des Sternenwalls wurzeln. Geleitet von der in meiner Position angebrachten Vorsicht empfehle ich, von Letzterem auszugehen. So werden wir wohl das aventurische Reich Galottas zunächst unverändert sehen, doch welche Mächte er anderswo sammelt, das bleibt eine Frage, die in künftigen Erkundungen zu klären sein wird.
Muakim al’Assarbad, Gesandter Xeraans an Galottas Hof
***
Flusswalde, Junkergut Isenborn, Herzogsmark Sokramor, Tobrien.
24. Tag im Praiosmond, 1022 BF.
Fiana hatte Wolflinde mitgenommen, weil sie für den Fall, dass es in Flusswalde zu handfesten Schwierigkeiten käme, einen fähigen Schwertarm an ihrer Seite hatte wissen wollen. Als die Söldnerin sie zum fünften Mal mit einem ironisch überhöhten ›junge Herrin‹ anredete, sah sie das einzig Positive an ihrer Wahl darin, dass Wolflinde mit ihr draufgehen würde, sollte es zu diesen Schwierigkeiten kommen.
»Wir sind als Holzfällerinnen hier«, erinnerte sie, obwohl sie das bereits mehrmals getan hatte. »Ich bin Friela, du bist Wehrgarde. Wir pflegen einen vertraulichen Umgang miteinander.«
»Das muss mir entfallen sein«, grinste Wolflinde. Sie hieb Fiana kumpelhaft auf den Rücken. »Doch erstens,liebste Friela, sind wir hier allein, es sei denn, hinter jenem Busch würde jemand lauern. Und zweitens hilft die Art der Anrede nicht, wenn wir herausfinden wollen, was hier wohl transportiert wurde.« Sie zeigte auf die Wagenspuren.
»Das,liebe Wehrgarde, werden wir hoffentlich in Flusswalde erfahren. Nur noch hundert Schritt Geduld, und schon erreichen wir das erste Haus.«
Mit ihren breitkrempigen Hüten und den Wildlederwesten ähnelten die beiden den hart arbeitenden Menschen, die in dieser Gegend ihr Brot mit dem Fällen von Bäumen verdienten. Diese Profession bot zudem den Vorteil, dass sie die mitgeführten Äxte unverdächtig machte. Zwar hielten die Werkzeuge keinem Vergleich mit einer ausbalancierten Waffe stand, aber zumindest waren Wolflinde und Fiana nicht wehrlos. Sie hatten sich lange genug im Wald verkrochen. Ein solches Leben hatte keinen Sinn. Es bewirkte nichts, auf diese Weise war ihre Freiheit verschwendet. Also würden sie versuchen, dem Feind zu schaden, der sich in Fianas heimischer Burg festgesetzt hatte. Der Schatz von Isenborn war das Eisen, das man aus dem Berg grub. Als ihre Eltern hier geherrscht hatten, war es über Flusswalde nach Ysilia verschifft worden. Es war durchaus plausibel, anzunehmen, dass sich daran nichts Wesentliches geändert hatte, obwohl Ysilia heute Yol Ghurmak hieß. Auch die neuen Herren würden dort ihre Schwerter und Rüstungen schmieden wollen.
Das von Fiana erwartete erste Haus war jedoch nur mehr eine Ruine, deren verkohltes Gerippe anklagend zwischen den Bäumen stand. »Hier lebte die Familie Nickelbrun«, erinnerte sich Fiana, als sie davor standen. Hinter ihnen rauschte der Ferrom. Heute war es entsetzlich heiß, aber Mitte des Mondes hatte es viel geregnet, sodass der Fluss beinahe Hochwasser führte.
»Waren sie unter den Flüchtlingen?«, fragte Wolflinde gelangweilt.
Fiana nickte stumm. Zwei Söhne der Nickelbruns waren bereits tot gewesen, als sich der Zug der Isenborner geteilt hatte. Bei den Verwundeten und Schwachen, die Fiana vergeblich zu schützen versucht hatte, war keiner aus der Familie zurückgeblieben. Ein Glück, so mochten sie es bis zu Jorlaks Höhle und unter den Bergen hindurch auf die Westseite der Schwarzen Sichel geschafft haben.
»Na, dann brauchen sie wohl kein Haus mehr«, kommentierte Wolflinde.
Fiana netzte ihre Lippen. Wenn man die Trümmer sah, nahm die Wirklichkeit festere Gestalt an. Cyrons Verrat, die Goblinhorden, die mondelang die Burg belagert hatten. Sie schüttelte den Kopf. Früher hatte man streunende Rotpelze mitunter auf Verdacht erschlagen, um sicherzugehen, dass sie die Hühnerställe nicht ausräumten. Inzwischen konnte sich Jorlak, ihr Goblindiener, sicherer auf dem Gebiet des Junkerguts bewegen als die Menschen in Fianas Gefolge, so sehr war dies ein Goblinland geworden. Überall zogen die Rotten herum, wobei es sich jetzt nicht mehr um Verbände handelte, die ausschließlich aus Kämpfern bestanden. Auch Kinder und Säuglinge waren nun dabei. Das ließ kaum Zweifel daran, dass die Rotpelze Isenborn jetzt als einen ihrer Jagdgründe betrachteten.
Die Spuren auf dem Weg deuteten jedoch darauf hin, dass auch Menschen wieder hier siedelten. Der Karren war von einem Ochsen gezogen worden, die Hufabdrücke waren deutlich zu erkennen. Fiana hatte noch nie eine Goblinsippe gesehen, die mit einem Ochsen zurechtgekommen wäre. Die Rotpelze richteten manchmal Wildschweine ab, um auf ihnen zu reiten. Ohnehin hatten sie zu diesen Tieren ein besonderes Verhältnis, sie spielten auch in ihren Riten eine wichtige Rolle. Pferde und Ochsen dagegen führten sie vorzugsweise der Verwendung auf einem Grillspieß zu.
Es gab noch einen weiteren Hinweis, der die Anwesenheit von Menschen wahrscheinlich erscheinen ließ: die Hammerschläge, die bereits am frühen Morgen die Gegend mit ihrem Hall erfüllten.
»Dann schauen wir mal, ob Flusswalde dieser Tage noch etwas anderes als Ruinen zu bieten hat«, sagte Fiana und schulterte die Axt.
Sie ließen das abgebrannte Haus hinter sich. Der Weg führte am Fluss entlang durch den lichten Wald, dessen Baumkronen in sattem Grün leuchteten. Ein Igel rollte sich ein, als sie ihm zu nahe kamen. Fiana hockte sich neben ihn, nahm ihn auf die Handfläche und tätschelte seine Stacheln.
»Gebraten schmecken diese Kameraden ganz annehmbar«, merkte Wolflinde an.
Fiana warf ihr einen strafenden Blick zu. »Ich bin sicher, in Flusswalde werden wir ein angemessenes Mahl erstehen. Wir können es nur nicht zuvor selbst töten, wenn es das ist, was dich stört.« Wolflindes Blutlust überstieg das Maß, das mit geistiger Gesundheit vereinbar gewesen wäre.
Die Söldnerin zuckte mit den Schultern. »Er wäre ohnehin zu schwach, als dass man seine Stärke an ihm würde messen können.«
»Und da deine Leidenschaft, blutige Streifen durch das Gesicht zu ziehen, uns heute eher hinderlich wäre, hat er wohl das Glück, vollkommen nutzlos für uns zu sein.« Sie setzte den Igel neben dem Weg ab.
Im Winter hatten die Isenborner Flusswalde wie auch die anderen vier Weiler des Junkerguts evakuiert und damit dem Feind überlassen. Die Goblins hatten sich jedoch offenbar nicht die Mühe gemacht, Feuer an jedes einzelne Haus zu legen. Da die Bebauung eher locker war, standen einige Höfe noch so, wie man sie zurückgelassen hatte. Die Mehrzahl aber zeigte zumindest Spuren eines Brandes. Eines wurde wieder aufgebaut, und Hammerschläge aus einiger Entfernung kündeten davon, dass es nicht das Einzige war.
Die Arbeiter waren in Trupps eingeteilt. Einige Goblins entasteten Baumstämme und schälten die Rinde ab. Menschen, die Fiana nicht kannte, schnitten Balken heraus und hobelten sie glatt. Einige andere balancierten über Stützpfosten und waren damit beschäftigt, einen Dachstuhl zu zimmern.
»Travia zum Gruße, ihr guten Leute!«, rief Fiana. Ihr Herz schlug schneller. Wenn einer der Goblins sie erkannte und Alarm schlüge, würden sie Fersengeld geben müssen. Das war allerdings unwahrscheinlich. Während der Kämpfe um die Burg und auf dem Zug durch die Schwarze Sichel hatte sie beinahe ständig ihre Vollrüstung getragen. Selbst wenn sie jemand mit hochgeklapptem Visier oder ohne Helm gesehen hätte, so war ihre Erscheinung in der Gewandung einer einfachen Waldarbeiterin doch eine völlig andere. Zudem reichte das Gedächtnis eines Goblins kaum eine Woche zurück. Die Rotpelze belasteten sich weder mit der Vergangenheit noch mit der Zukunft.
Eine der Arbeiterinnen legte ihren Hobel ab und sah hoch. Vielleicht lag es daran, dass sie sich nicht gänzlich aufrichtete. Fiana hatte sofort den Eindruck, dass sie unsicher war.
»Was habt ihr?«, fragte Fiana.
»Denkt besser daran, dass die Namen der schändlichen Zwölf nicht mehr genannt werden dürfen.«
Fiana verstand nicht, was die Frau meinte, aber Wolflinde begriff schnell. »Wegen des ›Travia zum Gruße‹?«, fragte sie. »Das ist doch nur eine Floskel.« Sie machte eine wegwerfende Handbewegung. »So etwas darf man nicht zu ernst nehmen.«
Die Arbeiterin trug ihre Stimmungen offen auf dem Gesicht. Enttäuscht sah sie zur Seite, sagte jedoch: »Sie zu nennen ist verboten. Man hält sich besser daran.« Sie löste die Lederschnur, die ihren Schopf im Nacken zusammenhielt, fing einige Strähnen ein, die der Fessel entkommen waren, und zog sie wieder fest.
»Ihr kommt nicht aus der Gegend, oder?« Bisher hatte Fiana noch kein bekanntes Gesicht entdeckt.
Die Frau schüttelte den Kopf. »Wir sind aus Tobelstein.«
»Hierher beordert, um das Dorf wieder aufzubauen?«
Ihre Schultern hingen kraftlos herab. »Wer kann das sagen? Wir tun, was sie uns befehlen.«
»Wer?«
Eine feste Stimme rief: »Ich, wenn du nichts dagegen hast!« Ein Ritter kam aus Richtung des Ortskerns auf sie zu. Er trug eine Rüstung, aber weder Helm noch Schild. Die Linke hatte er um den Knauf eines Schwertes geschlossen, das er an der Seite trug. Über dem Harnisch spannte sich ein schwarzer Wappenrock mit einem roten Eichenblatt. Viele Ritter Arngrimm von Ehrensteins, des Dunklen Herzogs, hatten ihre Farben in Rot auf Schwarz geändert, um die neuen Zeiten willkommen zu heißen. Der Mann war wenigstens sechzig Jahre alt, hatte einen schütteren, weißen Bart und Augen, die ruhelos umherhuschten. »Und was seid ihr für Landstreicherinnen? Warum stellt ihr neugierige Fragen?« Er baute sich vor ihnen auf, war aber nicht größer als Fiana, was ihn augenscheinlich ärgerte, weil er nicht auf sie hinabsehen konnte. So legte er den Kopf zurück und schielte sie entlang seiner dünnen Nase an.
Fiana ermahnte sich, den Blick zu senken, was ihr angesichts eines solch aufgeblasenen Widerlings auf ihrem Erbgrund nicht eben leichtfiel. Lieber hätte sie ihn auf ein Duell gefordert und aus der Rüstung geprügelt. »Wir sind nur Holzfällerinnen. Wir wollen sehen, ob wir, wie in anderen Jahren auch, hier ein paar Zugtiere erstehen können, um unsere Stämme herzuholen und dann über den Ferrom zu flößen.«
»Aha! Dann seid ihr nicht mit dem feigen Pack geflohen, das dieses Land hat brachliegen lassen?«
»Wir bekommen nicht viel mit von den großen Dingen dieser Welt, Herr. Wir sind nur einfache Holzfällerinnen, Herr, die hart für ihr Auskommen arbeiten.«
»Habt euch in den Wäldern verkrochen, als es hier hoch herging, was? Kann ich mir denken.«
»Wir leben abgeschieden, Herr.«
»Wahrscheinlich in irgendeiner Höhle. Wie die Tiere.« Er spie aus.
»Eine Höhle hat immerhin eine feste Decke, die vor dem Regen schützt«, meinte Wolflinde und sah demonstrativ auf den Dachstuhl, bei dem noch nicht einmal das Gerippe fertig war.
Fiana drückte ihr warnend den Ellbogen in die Seite.
»Lass deine Gefährtin nur«, sagte der Ritter in lauerndem Tonfall. »Sie scheint zu Späßen aufgelegt. Das trifft sich gut, ich bin heute auch in der Stimmung.«
»Wie schön für Euch«, versetzte Wolflinde.
»Ja, nicht wahr?«, brüllte er. Mit einem Mal war sein Kopf feuerrot. »Mitkommen!« Ohne darauf zu achten, ob seinem Befehl Folge geleistet wurde, drehte er sich um und schritt los.
Fiana zog Wolflinde mit, die breit grinste. Die vielleicht gefährlichste ihrer Wahnvorstellungen richtete sich darauf, dass sie zwar schon eine Menge Goblins, aber noch nie einen Menschen erschlagen hatte, geschweige denn einen Ritter. Dieser Mann mochte für sie so verlockend sein wie ein Lamm für eine Wölfin. Nur, dass er trotz seines Alters gewiss nicht so wehrlos war. Jede Gefahr für sich oder auch ihre Gefährten hatte Wolflinde jedoch schon bei den Kämpfen des Winters völlig ausgeblendet. Es brachte nichts, sie zu ermahnen. Wenn man ihren Waffenarm an seiner Seite wollte, musste man akzeptieren, dass sie ein zweischneidiges Schwert war, an dem man sich auch selbst schneiden konnte. Fiana hoffte nur, dass sich dieser Preis nicht als zu hoch herausstellen würde.
Der Ritter führte sie am Bootshaus vorbei, wo ein Soldat in Arngrimms Farben die Ausbesserung der flachbodigen Kähne beaufsichtigte, mit denen man das Eisenerz transportieren konnte. Nach Fianas Dafürhalten wäre es angesichts der schweren Beschädigungen einfacher gewesen, gleich neue Boote zu zimmern. Wahrscheinlich wussten das auch die Arbeiter, wagten aber wohl nicht, die einmal gegebene Anweisung infrage zu stellen.
»Hier wird also bald wieder Eisen verschifft?«, fragte Fiana möglichst beiläufig.
Der Ritter blieb stehen, als sei er gegen eine Wand geprallt, und wandte sich schnaubend um. »Woher weißt du das?«
»Ich sehe die Kähne, und da denke ich mir ...«
»Denken«, fauchte er und stach seinen Zeigefinger beinahe in ihre Nase, »ist etwas, das du dir abgewöhnen solltest! Und zwar schnellstens! Du bist hier, um zu arbeiten, sonst nichts!«
Fianas Faust krampfte sich um den Stiel ihrer Axt. »Sehr wohl, Herr Ritter«, knirschte sie.
»Nichts anderes will ich in den nächsten Stunden von dir hören. Und nun Schluss mit der Trödelei!« Er winkte und setzte seinen Marsch fort.
Sie folgten dem Ferrom flussaufwärts. Sein Lauf verengte sich hier und wurde auch tiefer. Er teilte sich, noch bevor sie die letzte Ruine des Ortes erreichten. Hier stand der Karren, der wohl die Spuren in den Weg gedrückt hatte. Auf ihm lag ein Baum, dessen schwarze Rinde ölig glänzte. Die Äste waren mit Seilen verzurrt, sodass sie nach oben in die Form eines Eis gebogen wurden, die Wurzeln mit Leinenbahnen umwickelt, was Fiana vermuten ließ, dass sich noch Erdreich daran befand. Das Gebilde war über sechs Schritt lang, weswegen es weit über das Ende des Wagens hinausragte. Der Transport war sicher alles andere als leicht gewesen. Warum wohl hatte man sich diese Mühe gemacht? Feuerholz war das jedenfalls nicht!
Auf dem Landstück zwischen den beiden Flussarmen hatten Arbeiter eine Grube ausgehoben. Jetzt waren sie damit beschäftigt, ein Gerüst zu bauen, das einem Galgen ähnelte. »Wollt Ihr jemanden aufknüpfen lassen?«, fragte Fiana.
Der Ritter sah sie wütend an. »Ja, dich, wenn du weiter unnütze Fragen stellst! Wenn nicht, wollen wir mit diesem Ding den Baum über das Wasser heben und auf der anderen Seite einpflanzen.«
Daher die Grube. Fiana nickte.
»Ihr helft hier mit!«, bestimmte der Ritter und stapfte davon.
Fiana und Wolflinde wechselten einen Blick und zuckten mit den Schultern. Sie legten Äxte, Hüte und Taschen ab und begaben sich zu den Arbeitern. Erst jetzt bemerkte Fiana, dass das Tier, das den Wagen zog, kein gesunder, kräftiger Ochse war. Es hatte zwar eine muskulöse Gestalt, aber weder Augen noch Ohren oder Hörner. Wo sie hätten sein sollen, sah der Kopf aus wie geformtes Wachs. Eine Missbildung? Bei den isenborner Schafherden waren solche Dinge auch immer wieder aufgetreten, Tiere mit fünf Beinen, einmal sogar mit zwei Köpfen. Sie waren aber niemals erwachsen geworden, meist direkt bei der Geburt gestorben. Das Zugtier jedoch war groß und stämmig.
»Also, wie habt ihr euch die Sache gedacht?«, fragte Fiana die drei Arbeiter. Die Wache musterte sie skeptisch, wandte sich dann aber wieder dem Stock zu, an dem sie lustlos schnitzte.
»Wir haben das Rundholz an zwei Stellen fixiert, damit es nicht umfallen kann.« Es war ein entasteter Stamm von einem Spann Durchmesser. Er stak in einem Gerüst, das zwei Führungen hatte, wie übergroße Ösen, sodass er senkrecht aufgestellt werden konnte. »Oben nageln wir einen Querbalken an. Über den werfen wir ein Seil, an dem wir den Baum hochziehen können. Natürlich lang genug, damit wir beim Herumschwenken über den Bach kommen.«
»Das sollte funktionieren.«
Etwa eine Stunde brachten sie beinahe schweigend zu. Sie holten Kanthölzer, um die Konstruktion weiter abzustützen, schlugen spannlange Nägel ein, sägten eine Führungsrille in den Querbalken. Während dieser Arbeiten hatte Fiana das merkwürdige Gefühl, der auf dem Wagen liegende Baum beobachte sie. Sie bildete sich ein, dass sich in seiner schwarzen Rinde Augen abzeichneten und auch ein höhnisch grinsendes Maul. Wenn sie dann blinzelte, waren sie fort. Wie ein Monster in den Schatten, das immer nur da war, solange man nicht zu genau hinsah.
Als sie bereit waren, holte die Wache den Ritter. »Wurde ja auch Zeit!«, tadelte dieser. »Wird ein hartes Stück Arbeit, euch die Faulheit auszutreiben! Diese Isenborns waren zu weich, keine Frage.«
Fiana sparte sich den Hinweis darauf, dass die Arbeiter gar nicht von hier stammten.
»Also dann: Sehen wir mal, was eure Mühe taugt! Zieht an!«
Da sie zu fünft am Seil standen, war es kein Problem, den Baum aus dem Wagen zu wuchten. Der Querbalken ächzte ein wenig, hielt dem Gewicht aber stand.
»Gut! Dann mal rüber damit!«
Sie sprangen über den Bach, wobei sie abwechselnd das Seil sicherten. Nur Wolflinde blieb zurück, sie hatte die Aufgabe, den Stamm zu drehen, damit die Last herumschwenkte. Das war schwieriger als gedacht, da der schwarze Baum einen erheblichen Zug ausübte und das Rundholz festkeilte. »Etwas Kernseife wäre gut«, ächzte Wolflinde.
»Noch etwas?«, schnauzte der Ritter. »Das Filet von einem Meeresfisch, vielleicht? Ein Mundtuch mit Eslamsbrücker Spitze?« Sein Gesicht war wieder dunkel gerötet. Er schien sich häufig aufzuregen. »Wenn es dir nicht rutschig genug ist, dann spuck doch drauf! Los jetzt!«
Als sich die Konstruktion schließlich zu einer quietschenden Bewegung erbarmte, ging es recht schnell. Fiana und die anderen Arbeiter konnten den Baum über der ausgehobenen Mulde in Position bringen.
»Jetzt macht den Stoff ab!«, rief der Ritter.
»Sehr wohl«, murrte Fiana. Sie hatte richtig vermutet, um die Wurzeln herum befand sich ein Ballen dunklen Erdreichs.
»Und jetzt ablassen!«
Sie pflanzten den Baum ein und schütteten das Loch zu. Als ein Arbeiter einen Eimer Wasser aus dem Fluss schöpfte, herrschte der Ritter ihn an: »Was fällt dir ein?«
»Frisch gesetzte Pflanzen muss man wässern, Herr«, antwortete der Mann kleinlaut.
»Diesen Baum nicht! Der holt sich schon, was er will.« Er lachte vor sich hin. Der Anlass für diese Heiterkeit blieb Fiana verborgen. »Kipp es zurück! Na los!«
Der Arbeiter tat wie geheißen. Zum Abschluss zerschnitten sie noch die Seile, die die Äste zusammenhielten. Fiana hatte erwartet, dass sich die Spannung lösen würde wie beim Holz eines Bogens, wenn man die Sehne abstreifte. Aber das geschah nicht. Die schwarzen Äste räkelten sich wie Tentakel. Eine durchsichtige, übelriechende Flüssigkeit trat an ihrer Rinde aus und lief den Stamm herunter. Fiana rümpfte die Nase.
»Na endlich!«, rief der Ritter. »Und jetzt weg da! Wer sich fortan diesem Baum nähert, hat mit Prügelstrafe zu rechnen!«
Sie sprangen zurück über den Bach. Warum man wohl ausgerechnet am Zusammenfluss einen Baum pflanzte? In manchen Weilern gab es heilige Föhren, unter denen die Druiden Recht sprachen, aber die standen meist im Zentrum, nicht am Rande. Boronanger und Richtstätten waren Orte, die man gern abseits legte. Vielleicht bezeichnete der schwarze Baum für die neuen Herren eine solche Stätte?
»Bringt den Wagen zum Bootshaus und spannt den Ochsen aus!«, befahl der Ritter. Er sagte ›Ochse‹. Offenbar war dieses Tier tatsächlich mal einer gewesen, zur Welt gekommen wie jeder andere Ochse auch. Aber warum hätte man es dann so grausam verändern sollen? Fiana schauderte. War das Entfernen der Augen die Methode, die dunkle Herren anwendeten, um den Effekt von Scheuklappen zu erreichen? Sie war froh, als ein anderer den Nasenring fasste und das Gespann fortführte.
Vor dem Bootshaus war kaum ein Fortschritt der Arbeiten erkennbar, doch auch wenn es noch Tage dauern würde: Früher oder später wären die Wasserfahrzeuge fertig. Dann trügen sie das Eisen flussabwärts, irgendwohin, wo es zu Schwertern für die Dämonenmeister verarbeitet werden würde. Das ließe sie nicht zu, dachte Fiana grimmig.
Die Arbeiter hatten einige roh gezimmerte Tische aufgestellt, auf denen sie Brote und Käse auslegten. Von allen Seiten kamen sie herbei, insgesamt etwa fünfzig, dazu drei Soldaten und der Ritter. »Essen fassen!«, brüllte dieser. Fiana war schleierhaft, warum er schon wieder wütend war. Vielleicht wegen der Unterbrechung, die die Arbeit durch die Mahlzeit erfuhr. Er war wohl von seinem Naturell her zum Ausbeuter geboren.
Fiana trat an den Tisch, goss Milch in einen Becher, Kühe oder Ziegen musste es also auch wieder geben. Während der Belagerung hatten sie alle Weidetiere verspeist, die mit den Bauern in die Burg gekommen waren. Sie riss ein Stück aus einem Brotlaib und setzte sich auf einen Felsen. Erst, als sie mit dem Essen begann, merkte sie, wie hungrig die Anstrengung sie gemacht hatte.
Sie rückte ein wenig zur Seite, damit sich ein junger Mann neben sie setzen konnte. Er schmatzte so laut, dass sie ärgerlich zu ihm hinübersah.
»Was macht Ihr hier, junge Herrin?«, flüsterte er. »Sie haben ein Goldstück auf Euren Kopf ausgesetzt!«
Jetzt erkannte sie ihn. Fendrik Herbstbüchel, ein Bauernsohn. »Ich werde meine Heimat doch nicht diesem Geschmeiß überlassen.«
Fendrik nickte.
»Kannst du mir nach dem Essen in den Wald folgen? Dort könnten wir uns ohne allzu neugierige Ohren bereden.«
Wieder nickte er stumm.
Als sie das Brot verspeist hatte, streckte sie sich, stellte den Becher auf den Tisch und ging strammen Schrittes davon, als habe sie eine Aufgabe zu erledigen.
Sie musste nicht lange auf Fendrik warten. Der junge Mann zog die Mütze vom Kopf und kniete vor ihr nieder. »Rettet uns, junge Herrin!«, bat er.
Ihr stiegen die Tränen in die Augen angesichts der Hoffnung, die dieser einfache Mensch in sie setzte. Sie zog ihn hoch. »Das will ich. Aber es wird seine Zeit dauern.«
»Wo sind Eure Hohen Eltern, junge Herrin? Und ihre Ritter? Werden sie diese üblen Burschen bald von hier vertreiben?«
Betreten schüttelte sie den Kopf. »Sie sind fort. Ich bin die einzige Isenborn, die zurückgekehrt ist.« Und sie hatte nur eine Handvoll Getreue um sich, aber das verschwieg sie.
Fendrik verstand nicht. »Wann werden sie kommen, junge Herrin?«
Sie schluckte. »Sie sind fort, Fendrik. Warum hast du dich dem Zug nicht angeschlossen?«
Verlegen drehte er die Mütze in den Händen. »Meine Eltern und ich wollten den Hof nicht aufgeben. Mit den Rotpelzen würden wir schon fertig, hat Vater gesagt. Damit hatte er ja auch recht, irgendwie. Sie haben das Haus geplündert, aber etwas Vieh haben wir vorher in den Wald gerettet. Genug, um mit einer neuen Zucht zu beginnen. Aber jetzt haben die neuen Herren es uns genommen. Sie geben uns die Hälfte zurück, wenn wir fleißig beim Aufbau von Flusswalde helfen, sagen sie.«
Fiana legte ihm die Hand auf die Schulter. »Es wird eine harte Zeit werden, Fendrik. Aber ihr werdet es schaffen, du und deine Eltern. Isenborner Eisen bricht nicht!«
»Nein, Herrin. Es beugt sich nie.« Mit trotzigem Stolz in den Augen sah er sie an.
Sie entschied, dass sie ihm trauen konnte. »Ich will wissen, wann das Eisen hier ankommt, um verschifft zu werden. Es wäre aber unklug, zu oft hierher zu kommen. Kannst du in diesen Baum dort«, sie zeigte auf eine Birke, die so verdreht gewachsen war, dass es schwer fiel, darin natürliche Kräfte am Werk zu sehen, »zwei Kerben schnitzen, wenn die Barren eintreffen?«
»Das kann ich tun, junge Herrin.«
Eine Unruhe lenkte ihre Aufmerksamkeit auf das Dorf. Sie dankte Fendrik und ging zurück.
Ein weiterer Wagen war eingetroffen, eine Art Kutsche mit eisernem Aufbau, verhängt mit dunkelgrauem Stoff. Seine Räder sanken tief in den Boden ein. Aus dem Inneren waren schmatzende Geräusche zu vernehmen.
»Was glotzt ihr so?«, blaffte der Ritter die Umstehenden an. »Hier gibt es für euch nichts zu sehen! An die Arbeit!«
Fiana sah Wolflinde an, nickte flussabwärts und zog ihren Hut ins Gesicht. Die Söldnerin schlenderte zu ihr herüber.
»Wir haben genug gesehen«, flüsterte Fiana. »Ziehen wir uns zurück, bevor wir unser Glück zu sehr strapazieren.«
Tatsächlich schien der Ritter zwar alles bestimmen zu wollen, hatte aber kaum Kontrolle darüber, was vorging. Niemand hielt sie auf, als sie das Dorf verließen.
»Ich wüsste gern, was sich in dieser Kutsche befindet«, sagte Fiana, als sie zurück in der Wildnis waren.
»Zufällig habe ich einen Blick erhascht.« Wolflinde pfiff eine fröhliche Melodie.
»Wie hast du das denn geschafft?«
»Stoff ist nicht so schwer, dass er sich nicht anheben ließe.«
»Und das hat dieser Ritter nicht bemerkt?«
»Doch, und bevor Ihr kamt, hat er sich auch schon artig aufgeregt.«
»Er hätte sein Schwert ziehen können!«
»Leider tat er das nicht.« Wolflinde nahm die Axt von ihrer Schulter und tätschelte das Blatt.
Stirnrunzelnd schüttelte Fiana den Kopf. Sie musste lernen, diese Frau so zu nehmen, wie sie war, sonst würde sie wahnsinnig werden. »Was ist denn nun in der Kutsche?«
»Eine weiße Made.«
»Und sonst?«
»Nichts, soweit ich erkennen konnte.«
»Dafür scheint mir das Gefährt recht großzügig.«
»Nicht, wenn die Made drei Schritt lang ist und eineinhalb durchmisst.«
»Was sollte denn das für ein Ungetüm sein?«
»Eines, das man vor Licht schützen muss.«
»Viele Dämonen fürchten den Sonnenschild des Herrn Praios«, überlegte Fiana.
»So sagt man«, bestätigte Wolflinde.
»Du scheinst mir diese Sache nicht ganz so leicht zu nehmen, wie du es sonst mit Gefahren aller Art handhabst.«
»Man sagt noch mehr von diesem dämonischen Gezücht. Wie etwa, dass man mit ehrlichem Stahl nichts dagegen auszurichten vermöchte.«
»Dann haben wir ja Glück, dass Semira bei uns ist.«
»Stimmt.« Wolflinde grinste. »So ist das Kräuterweiblein doch noch zu etwas anderem nütze, als die Wunden von Schwächlingen zu versorgen.«
»Vergiss nicht, dass auch dein Schädel dieser Pflege bedurfte.«
Die Söldnerin tat den Einwand mit einem Schulterzucken ab. »Das ist jetzt vorbei. Meine Klinge dürstet nach frischem Blut.«
***
Am Ferrom, Junkergut Isenborn, Herzogsmark Sokramor, Tobrien.
1. Tag im Rondramond, 1022 BF.
»Reicht das? Seid Ihr nah genug?«
Semira sah nicht auf. Sie hockte im Schilf, ignorierte die sie umschwirrenden Mücken und drückte die Steine, die sie im Ferrom gesammelt hatte, in den Schlamm. Der Fluss hatte sie glatt geschliffen, einer ähnelte in seiner Form einem Gänseei, aber er war grau, durchzogen von einigen blauen Schlieren. »Es wird gelingen«, antwortete die Druidin mit der kindlichen Stimme, die Fiana verriet, dass sie in Kontakt mit der Erdgöttin stand, deren Kraft sie anrufen würde.
Fiana sah über das Schilf hinweg den Flusslauf hinab. Sumu war keine milde Gottheit, nicht so wie die gütigen Schwestern Travia, Peraine und Tsa. Die Druiden sprachen nicht viel über sie. Die Weisen der Wälder verspürten weniger Drang, ihr Wissen mit den Menschen zu teilen, als es bei den Jüngern der Zwölfgötter der Fall war. Beide, Druiden und Geweihte, hätten ob eines Vergleichs die Nase gerümpft, aber Fiana schien es, dass Sumu in ihrem Wesen am ehesten Firun glich, dem grimmen Gott des Winters und der Jagd. Manchmal nannte man sie ›die Mutter‹, aber wenn sie ihre Kinder liebte, dann konnte sie es gut verbergen. Niemand bestritt, dass sie den Druiden große Macht gab, aber sie verschenkte sie nicht. Man konnte Dinge von ihr erbitten, doch sie forderte immer einen Preis. Fiana fürchtete, dass die Forelle, die in einem Eimer neben Semira zappelte, nur der geringste Teil der Bezahlung war, mit der die Druidin den bevorstehenden Zauber erkaufen würde. Gern hätte sie gewusst, wie groß die Gefahr für Semira war, aber der Respekt verbot eine entsprechende Frage. Sie hatten verschiedene Pläne besprochen. Dieser war der beste, der erfolgversprechendste.Sofern der Zauber gelingt.
Sie waren einfach zu wenige. Fiana, Semira, Wolflinde, zwei ehemalige Söldner und Jorlak, ihr goblinischer Diener. Mehr Kämpfer hatten sich nicht retten können. Immerhin hatten sie ein halbes Dutzend Hörige durchgebracht, die in der Baronie Aschenfeld Obdach auf entlegenen Höfen gefunden hatten.
Mit sechs Kämpfern war es zu riskant, ein Tau über den Fluss zu spannen, um die Kähne mit den Eisenbarren abzufangen. Abgesehen von der Unsicherheit, ob ein solches Hindernis die Boote wirklich aufgehalten hätte, mussten sie nach Fendriks Informationen mit einem Dutzend bewaffneter Feinde rechnen. Obwohl Fiana in ihrer Vollrüstung und mit ihrer gründlichen Ausbildung darauf hoffen durfte, jedem Einzelnen gewachsen zu sein, hätte die schiere Anzahl sie so sicher überwältigt wie ein Wolfsrudel einen Elch.
Fiana unterdrückte ein Seufzen. Sie war die Anführerin, sie musste zu der Entscheidung stehen, sonst konnte sie von niemandem verlangen, ihr zu folgen. Semira setzte in manchen Situationen ein kindliches Vertrauen in sie. Fiana hoffte, dem gerecht zu werden. Heute war sie so etwas wie Semiras Leibwächterin. Mit der vierunddreißig Stein schweren Rüstung konnte sie im Uferschlamm ohnehin nicht rennen. Glendolon, ihr Ross, hatte sie im Wald angebunden, wo der Grund trocken war und seine Hufe nicht einsanken. Das verhinderte auch, dass die Feinde ihn erspähten und dadurch gewarnt würden, aber er konnte ihr auf diese Weise natürlich auch nicht nützen. Zweifelnd sah sie an ihren Beinen hinunter. Die Eisenstiefel waren schon wieder bis über die Knöchel in den nassen Boden eingesunken. Mit einem schmatzenden Geräusch zog sie die Füße heraus und machte einen Schritt zur Seite.
Auch Semira sank ein, aber für sie war das vermutlich sogar von Vorteil, weil sie dadurch mehr Kontakt zum Wasser des Flusses hatte, das den Schlamm durchtränkte. Obwohl sie im Dreck hockte, wäre ihr Gewand nach ein paar Schritten wieder sauber. Das war bei ihr wie bei dem Wasser, dem sie so verbunden war: Nach einer Weile sank aller Schmutz zu Boden, und was zurückblieb, war rein und klar.
Wolflinde war ebenso wie Giselmar und Waidwig viel leichter gerüstet als Fiana, und für Jorlak kam ohnehin nichts anderes infrage als der auf seine speziellen Maße gefertigte Lederpanzer. Dadurch waren sie in diesem Gelände beweglicher, wenn auch niemand schnell laufen konnte. Sie hockten ein Dutzend Schritt weiter flussabwärts. Giselmar war der einzige Fernkämpfer. Da sie nur fünf Bolzen für seine Armbrust aufbieten konnten, hatte Fiana sogar in Erwägung gezogen, diese Waffe ganz aus dem Gefecht zu nehmen und stattdessen auf die Gunst Rondras zu vertrauen, die den Einsatz von Fernkampfwaffen missbilligte, doch da sie einer doppelten Übermacht gegenübertraten, würde die Göttin hoffentlich über diesen Umstand hinwegsehen. Schließlich waren sie alle nur fehlbare Menschen und brauchten jeden Vorteil, den sie sich verschaffen konnten, um gegen die Feinde der Zwölfgötter bestehen zu können.
Wenigstens hatten sie gute Schwerter in ihrem Arsenal, Fiana dazu noch eine Streitaxt und einen Morgenstern. Auch die Kampfschilde waren fest, nur dass Waidwig den seinen nicht effektiv handhaben konnte. Vor den Brüchen in seiner Schulter hatten auch Semiras Heilkünste letztlich kapituliert. Er konnte den Arm bewegen, aber die Verwachsungen hinderten ihn daran, den Schutz über den Kopf zu heben. In den vergangenen Wochen hatte Fiana oft mit ihm geübt, damit er so fechten lernte, dass er mit dem Schwert von oben kommende Schläge parieren konnte.
Fiana wollte nicht klagen. Alle anderen Verletzungen, auch Wolflindes Kopfwunde, waren verheilt. Semira hatte gute Arbeit geleistet.
Jorlak kletterte von dem Baum, der einsam so nah am Wasser stand, dass er im Frühling nach der Schneeschmelze im Fluss stehen musste. Das war das verabredete Zeichen. »Sie kommen«, meldete Fiana, zog das Schwert und hockte sich hin, sodass die Halme sie vollständig verbargen. Ihr Puls ging schneller, nicht nur, weil viel von den nächsten Momenten abhing, sondern auch, weil es ihr unheimlich war, sich unmittelbar neben einer Druidin aufzuhalten, während diese Magie wirkte. Die Märchen waren voll von fehlgeschlagenen Versuchen, mystische Kräfte unter den Willen zu zwingen, was laut den Geschichtenerzählern oftmals darin resultierte, dass sich Dämonen Einlass in die Welt verschafften. Fiana schauderte bei der Erinnerung an das widernatürliche, grüne Feuer, das Cyron gegen Isenborns Burgtor befohlen hatte. Als Semira die Forelle aus dem Eimer nahm, sie unter Gemurmel mit dem Obsidiandolch aufschlitzte und ihre Innereien auf dem Boden verteilte, versuchte sich Fiana mit Gedanken an Dinge abzulenken, die zu der Welt gehörten, in der sie sich auskannte. Wie viele Soldaten mochten sich auf den Kähnen aufhalten? Wirklich zwölf, wie Fendrik vermutet hatte? Und wie wären sie bewaffnet? Leider trugen nur zwei Eisenrüstungen, so die Meldung. Die schweren Panzer konnten ihnen im Wasser leicht zum Verhängnis werden. Fendrik kannte sich mit Soldaten nicht aus, deswegen hatte er über die Befehlsstruktur nichts sagen können. Fiana wusste jedoch, dass Sprösslinge aus adeligen oder begüterten Häusern häufig Karriere machten und solche, die sich aus dem einfachen Volk hochdienten, ihren Sold gern in gute Rüstungen anlegten, die einem festen Hieb standhalten konnten. Deswegen war durchaus wahrscheinlich, dass es sich bei den in Eisen Gepanzerten um Korporale oder Weibel handelte. Wenn sie tatsächlich umkämen, dann wäre der Feind seiner Befehlshaber beraubt, was ein nicht zu unterschätzender Vorteil für Fianas Gruppe wäre.
Semiras Singsang stahl sich in Fianas Verstand. Sie konnte nicht widerstehen, den Blick von den eintönigen Halmen zu der Druidin schwenken zu lassen, und bereute es sofort.
Das blonde Haar fiel der Frau in Wellen über die Schultern. Diese Wellen waren ständig in Bewegung, als sprudelten die Strähnen aus einer Quelle an ihrem Scheitel. Das allein war schon ein Anblick, bei dem Fiana nicht ganz wohl gewesen wäre. Viel unheimlicher aber war die Tatsache, dass sich die Druidin die Unterarme aufgeschlitzt hatte. Die Hände staken bis zu den Gelenken im Schlamm. Das Blut lief aus den geöffneten Adern herab, sammelte sich jedoch nicht zu einer Lache, sondern strömte mit unnatürlicher Zielstrebigkeit dem Fluss entgegen. Es sah aus wie zwei winzige Bäche, die im Schilf untertauchten. Semira sang noch immer ihre unverständlichen Verse. Die Silben hörten sich an, als seien sie in Wasser gesprochen, plätschernd, rauschend oder gluckernd. Die Lider der Druidin waren geöffnet, doch von den Augen war nur das Weiße zu sehen.
Nervös verlagerte Fiana ihren Standort um einen halben Schritt, da sie bereits wieder eingesunken war. Was, wenn bei dem Ritual etwas schiefginge? Von Dämonen oder anderen magischen Phänomenen ganz abgesehen hätte Fiana noch nicht einmal zu erkennen vermocht, wenn Semira etwas zugestoßen wäre. Urgroßvater, derjenige in ihrer Familie, der sich am eingehendsten mit den Druiden auseinandergesetzt hatte, war davon überzeugt gewesen, dass die Weisen ihre eigene Lebenskraft einsetzten, um Zauber zu wirken. Er hatte auch geglaubt, dass jeder Druide die Kraft habe, einen großen, letzten Fluch zu schleudern, indem er Sumu mit seinem eigenen Leben bezahlte.Deine Erfahrung fehlt mir, Urgroßvater.Fiana schluckte.Du fehlst mir.Eines der vielen Leben, die Cyron auf dem Gewissen hatte und für das sie ihn eines gerechten Tages bezahlen lassen würde.
Fiana zwang sich, Semiras Gesicht genau zu beobachten. Sie hätte sich selbst ohrfeigen können dafür, dass sie es versäumt hatte, sich von der Druidin erklären zu lassen, woran sie einen unplanmäßigen Verlauf hätte erkennen und was sie in einem solchen Fall hätte tun sollen. Gesund sah jedenfalls nicht aus, was da mit der zierlichen Frau geschah. Das Blut floss und floss. Hätte es sich um einen anderen Gefährten gehandelt, hätte Fiana die Wunden unverzüglich verbunden. Das Gesicht der Druidin war bereits bleich wie Kalk. Schließlich brach auch noch Wasser zwischen ihren Lippen hervor, was sie aber nicht am weiteren Intonieren ihrer Zauberformel hinderte. Schnell fragte sich Fiana, wie solche Mengen Flüssigkeit überhaupt in den Magen der zierlichen Frau gepasst hatten. Sie sah auch nicht, dass sich die Kehle bewegen würde, um sie hochzuwürgen. Es war, als wandelten sich die Worte im Mund der Druidin zu Wasser.
Erst als sie die aufgeregten Rufe vom Fluss her hörte, wurde ihr klar, dass sich auch ein anderes Geräusch verändert hatte: Das Rauschen des Ferrom war jetzt nur noch von flussaufwärts zu vernehmen, nicht mehr von flussabwärts. Zur einen Hälfte war es die Neugier, die Fiana aufstehen ließ, zur anderen das Unwohlsein, das sich bei der Betrachtung der Druidin in ihr regte. Sie spähte über das Schilf hinweg und wurde Zeugin eines unglaublichen Anblicks.
Das Wasser staute sich wie an einer unsichtbaren Wand. Der Ferrom floss einfach nicht weiter. Hinter einer Grenze, die dünne Stränge von Semiras Blut zogen, lag das Flussbett entleert wie eine ausgeschüttete Schüssel. Hätte es sich um einen natürlichen Damm gehandelt, hätte das Wasser seinen Weg seitlich in das Schilf suchen müssen, aber das tat es nicht. Die nachdrückenden Wellen schoben es auf wie einen Hügel, wie Schnee, der gegen eine Mauer geweht wurde. Diesen Hügel hinauf trieben die drei Kähne mit den Eisenbarren und den schwarz gekleideten Soldaten. Ihre Stangen richteten nichts aus. Falls sie überhaupt noch Grund fanden, so hatte das keinen Effekt. Der Ferrom hatte sich im wahrsten Sinne des Wortes mit Semira gegen sie verschworen. Ihre Schreie verrieten Wut und Angst.
Letztere war durchaus berechtigt, denn so wirkungsvoll die unsichtbare Wand dem Wasser Einhalt gebot, so gegenstandslos war sie für die Kähne. Der erste glitt über die magische Barriere hinaus und fiel dann wie ein Stein, da er kein Wasser mehr unter sich hatte, das ihn getragen hätte. Der Sturz an sich war für die Besatzung nicht dramatisch, sie fiel gut vier Schritt, bis das Holz des Bootes mit vernehmlichem Knacken auf das sandige Flussbett schlug. Das mochte ein paar Prellungen und vielleicht auch einen Bruch geben, war aber sicher nicht lebensbedrohlich.
Das allerdings konnte man von dem zweiten Kahn nicht sagen, der nun über den Köpfen der Besatzung des ersten Bootes auftauchte und auf diese niederstürzte. Die beiden Wasserfahrzeuge waren nicht exakt in der gleichen Linie gefahren, aber doch so, dass zwei Soldaten von dem Gefährt zermalmt wurden. Der dritte Kahn fuhr weiter backbord. Auch er stürzte in das ausgetrocknete Flussbett, jedoch ohne die anderen zu berühren.
»Das reicht«, sagte Fiana. »Wir haben sie.«
Sie wandte sich um. Semira schien sie nicht gehört zu haben, sie brabbelte noch immer ihre Zauberworte hervor und war darüber noch ein Stück bleicher geworden, was Fiana zuvor als unmöglich erachtet hätte. Die Haut der Druidin war wie Milch. Fiana trat zu ihr und schüttelte sie. »Semira! Wir haben sie!«
Die Druidin hustete. Wegen des Wassers, das aus ihrem Mund quoll, sah es so aus, als übergebe sie sich.
»Lasst dem Fluss wieder seinen Lauf!«, bat Fiana aufgeregt.
Semira zog die Hände aus dem Schlamm. »Es geschieht doch schon.«
Mit einem gewaltigen Donnern brachen die aufgehaltenen Fluten los, als hätten sie ein Schleusentor gesprengt. Die flachen Boote, deren Schwimmfähigkeit nach dem Sturz ohnehin bezweifelt werden durfte, wurden von den Wellen bedeckt. Die Eisenbarren, die sie transportierten, würden den Grund nicht mehr verlassen und auch die beiden Soldaten mit den teuren Rüstungen merkten nun, dass sich in Eisen schlechter schwamm als in Leder.
Einige Söldner stießen prustend durch die Wasseroberfläche. Die Strömung trieb sie flussabwärts und war so stark, dass sie schnell an Fianas wartenden Kameraden vorbeigezogen wurden. »Ihnen nach!«, hörte sie Wolflindes Ruf. Das war Fianas Zugeständnis an die Söldnerin gewesen. Im Grunde war das einzige Ziel dieser Mission, die Lieferung des Eisens an die Waffenschmiede in Yol Ghurmak zu verhindern, aber Wolflinde gierte danach, einen Menschen zu töten. Das war der ganz persönliche Dämon, der ihre Seele in den Klauen hielt. Fiana hätte lieber das Risiko vermieden, einen ihrer Leute verwundet oder gar tot zu sehen, aber nach den diversen Lagebesprechungen verstand sie auch, warum Söldnerführer stets darauf achteten, die Wünsche ihrer Untergebenen angemessen zu berücksichtigen. Im Grunde war es einfach: Man konnte nur Leute führen, die einen ihrerseits als Anführer akzeptierten. Das konnten sie entweder tun, weil sie jemanden fürchteten oder weil sie glaubten, dass er ihnen zu dem verhalf, was sie begehrten. Die Borbaradianer neigten zur ersten Methode, Fiana wollte es mit der zweiten versuchen, und es gab nichts, was ihre fähigste Untergebene so sehr begehrte wie Menschenblut an ihrer Schwertklinge.
Da Fiana keine unmittelbare Gefahr ausmachen konnte, hockte sie sich zu Semira nieder. »Geht es Euch gut?«
Semira schabte das Blut mit der flachen Seite ihres Obsidiandolchs von den Armen, als würde sie einen nassen Boden abziehen. Unerklärlicherweise entfernte sie dabei nicht nur den roten Lebenssaft bis auf den letzten Tropfen, sondern legte auch eine makellose Haut frei, die nicht das kleinste Anzeichen eines Einschnitts aufwies. Allein ihre unnatürliche Blässe und ihr leichtes Schwanken kündeten von der Anstrengung, die sie sich zugemutet hatte. Die Antwort blieb sie Fiana schuldig, wahrscheinlich war sie noch nicht vollständig in die Welt des Greifbaren zurückgekehrt.
»Kann ich etwas für Euch tun?«, fragte Fiana, wobei sie jedes Wort betonte. Auch diese Ansprache zeitigte keinen Erfolg, sodass ihr nichts weiter blieb, als die Druidin zu beobachten, die sorgfältig ihren Dolch in die Scheide schob und ihn in den Falten ihres Gewandes verschwinden ließ. Die fließenden Bewegungen in ihrem Haar hatten sich auf die wenigen Wirbel reduziert, die stets darin spielten. Ihre Atmung war ruhig und gleichmäßig, Augen und Mund hielt sie geschlossen. Ihre Erscheinung war dazu angetan, Fiana zu beruhigen.
Da sie für die Druidin nichts tun konnte, stand sie auf und hielt nach ihren Kameraden Ausschau. Der Ferrom floss so beständig, als habe sich hier nichts Ungewöhnliches ereignet. Am anderen Ufer sah sie zwei Söldner in nassen, schwarzen Wappenröcken flussaufwärts hasten. Da sie unerreichbar waren, konnte Fiana nicht verhindern, dass sie die Kunde nach Flusswalde brächten. Das war eine Schwäche des Plans, die sie bewusst akzeptiert hatte. Anderenfalls hätte sie ihre winzige Streitmacht teilen müssen, um beide Ufer zu bewachen. Möglicherweise war es auch gar kein Nachteil. Es konnte nützlich sein, wenn der Feind wusste, dass er hier nicht sicher war. Vielleicht bemühte er sich dann um mehr Bedeckung für seine wichtigen Vorhaben und bedeutenden Persönlichkeiten, sodass weniger Soldaten erübrigt werden könnten, um die Bevölkerung zu drangsalieren.
Fiana hörte einen Schrei. Ein Söldner kam auf sie zugerannt, oder was man in diesem Gelände als ›rennen‹ bezeichnen konnte. Auch seine Füße sanken tief in den Schlamm ein, sodass eine schnelle Schrittfolge nicht möglich war. Er versuchte dies durch weite Schritte auszugleichen, was Sprüngen nahekam, die seine Schultern und seinen Kopf wie einen auf Wellen tanzenden Korken aus dem Schilf hoben, das ihm, ähnlich wie Fiana, bis zur Brust reichte. Er schien nicht verwundet und unbewaffnet, verwendete die Arme, um die Halme zur Seite zu drücken. Offensichtlich hatte er sie gesehen, denn er hielt direkt auf sie zu. Fiana klappte ihr Visier herunter und stellte sich vor Semira.
Der Soldat war vollkommen außer Atem, als er sie erreichte und einen guten Schritt vor ihr auf die Knie fiel. »Erbarmen, Herrin!«, japste er. »Ich ergebe mich Eurer Gnade!«
Fiana überlegte noch, was sie antworten sollte, als Wolflinde schon heran war und ihr mit einem entschlossen geführten Schräghieb die Entscheidung abnahm. Das Schwert drang an der linken Schulter ein und schlug bis zum Brustbein durch, wo es stecken blieb. Der Mann riss den Mund weit auf, brachte jedoch kein Wort mehr heraus. Er war bereits tot, nur noch das Schwert in Wolflindes Faust hielt ihn aufrecht.
Fiana sah sich nach weiteren Gegnern um, fand aber keine. Sie entschloss sich, ihr Schwert dennoch vorerst in der Hand zu behalten, als sie das Visier wieder aufklappte. »Das hättest du nicht tun sollen«, wies sie Wolflinde zurecht. »Wir hätten ihn verhören können.«
Wolflinde grinste, was ihre Zähne wie Fänge schimmern ließ. Sie hatte sich heute mehr als einmal ihren großen Wunsch erfüllt, Menschenleben gewaltsam zu beenden. Die Blutspritzer in ihrem Gesicht und auf ihrem Lederpanzer zeugten davon. »Er war nur ein einfacher Scherge. Was hätte er uns schon verraten können?«
»Das tut nichts zur Sache!«, donnerte Fiana. »Er wollte sich mir ergeben! Ich hatte darüber zu entscheiden, nicht du!«
Wolflinde zuckte mit den Schultern. Sie war augenscheinlich bester Laune. Mit einem beherzten Tritt löste sie die Leiche von ihrer Klinge. »Enthaupten?«, fragte sie.
Fiana atmete tief durch. Wolflindes Eigenmächtigkeiten grenzten an Rebellion. Aber waren sie nicht genau das – Rebellen?
Fiana nickte. Sie wandte sich ab, als Wolflinde ihr Werk beendete. Am besten warfen sie die Leichen auch noch in den Fluss, um ganz sicherzugehen, dass kein Nekromant seine unheilige Kunst daran erproben könnte.
»Über diese Sache wird noch zu reden sein, Wolflinde.«
»Ganz wie Wohlgeboren wünschen.«
»Ich bemerke deinen Spott sehr wohl!«
»Oh, der gilt nur dem Leben als solchem, junge Herrin, nicht Euch im Speziellen.«
Fiana runzelte die Stirn. »Was stimmt nicht mit dir, Wolflinde?«
»Mit mir?« Sie zuckte mit den Schultern. Als sie ihre Klinge am Wams des Erschlagenen trocknete, lag ein Lächeln auf ihren Lippen. Es hatte einen traurigen Zug. »Wieso wollt Ihr das wissen? Warum fragt Ihr nicht, was mit der Welt nicht stimmt? Wenn ich verrückt bin, dann ist es dieses Leben auch, scheint mir. Zumindest passe ich gut hinein. Verrückt sind wohl eher die Bauern, die ihre Felder beackern, als sei Tobrien noch ein freies Land.«
»Sie haben ein hartes Los.«
»Das haben Bauern immer. Aber ich bezweifle, dass sie unter der Herrschaft Galottas und Arngrimms hoffen dürfen, ein rechtschaffenes Leben zu führen. Wer weiß? Vielleicht wird das Getreide, das sie ihren neuen Herren abliefern, auf der Seelenwaage gegen sie gewogen werden. Wäre es da nicht besser, gleich die ganze Ernte zu verbrennen? Und wer vermag zu sagen, ob ich nicht in die Paradiese der Zwölf gebeten werde, weil ich diesen Diener der Paktierer aus dem Leben getilgt habe?«
»Es war nicht ehrenhaft, wie du gehandelt hast.«
Wieder zuckte Wolflinde mit den Schultern. »Soll Rondra die Nase über mich rümpfen. Ich bin sicher, dass Kor lächelt, wenn er mich sieht.«
***
Flusswalde, Junkergut Isenborn, Herzogsmark Sokramor, Tobrien.
Nacht vom 4. auf den 5. Tag im Rondramond, 1022 BF.
Ihre Eltern hatten Fiana beigebracht, dass man zu den Konsequenzen seiner Handlungen stehen musste. Deswegen war sie hier. Statt Wolflinde begleitete sie Giselmar. Die Halbelfe war zu heißblütig. Wenn sie überhaupt etwas ausrichten wollten, dann mussten sie einen kühlen Kopf bewahren. Beobachtend zogen sie die Umhänge um sich, damit sie in ihrem Versteck nicht entdeckt würden.
Leider könnten sie den Menschen hier kaum helfen. Die Menge stand am Zusammenfluss des Ferrom, wo der verfluchte Baum schwarz in die dunkle Nacht ragte. Alle Dorfbewohner waren hier versammelt, hauptsächlich also die Arbeiter, die aus verschiedenen Baronien hierher geschafft worden waren. Der Ritter, von dem Fiana inzwischen wusste, dass er Vennemar vom Braunstein hieß, stand zwischen vier Soldaten, die die Menge mit finsteren Blicken musterten. Rotpelze mit rostigen Waffen waren überall. Sie brachen sogar in ein Haus ein, während die Bewohner hier standen. Niemand hinderte sie daran.
»Wir warten!«, verkündete Vennemar mit lauter Stimme. »Ihr habt euch das selbst zuzuschreiben! Was auf dem Fluss geschah, ist unverzeihlich! Ihr hättet aufmerksamer sein, diese Rebellen aufspüren und uns melden müssen! Eure Nutzlosigkeit hat den Herrn Cyron erzürnt! Zittert vor dem Zorn, mit dem sein Abgesandter erfüllt sein wird!« Wieder war Vennemars Kopf dunkel angelaufen. Schon bei ihrer ersten Begegnung hatte Fiana den Eindruck gewonnen, dass er ein Mensch war, der sich gern aufregte.
Giselmar und sie hockten in einem Gebüsch nördlich der Versammlung, außerhalb des Dorfes. Sie trugen weite, erdfarbene Umhänge, die sie gut in der Dunkelheit verbargen. Fiana zog Giselmars Kapuze etwas zur Seite, als sie ihm zuraunte: »Wie viele Goblins sind das wohl?«
»Drei Dutzend wenigstens«, flüsterte er. »Vielleicht auch vier oder fünf.«
Es waren einfach zu viele! Fiana war naiv gewesen, als sie geglaubt hatte, ihr Überfall hätte nur deswegen keine Folgen, weil sich alle daran Beteiligten dem Zugriff des Feindes entzogen hatten. Warum hatte sie nicht auf die Gerüchte gehört? Die neuen Herren hatten ein gänzlich anderes Verständnis von Gerechtigkeit. Auf ein Vergehen folgte eine Strafe. Wen diese traf, war von untergeordnetem Interesse. ›Unschuld‹ war ein ihnen fremdes Konzept.
»Diese dort sind nicht von hier«, flüsterte Giselmar und zeigte auf eine Rotte Goblins, die zu den anderen stieß. Sie trugen Knochen durch die Flügel der breiten Nasen, offenbar ein Stammeskennzeichen. Solche waren auch an der Belagerung Isenborns und der Verfolgung des Zuges durch die Sichel beteiligt gewesen. Fiana dachte mit einiger Befriedigung daran zurück, wie sie damals einigen von ihnen die affenartigen Schädel zertrümmert hatte. Jetzt ging einer dieser Goblins, der einen viel zu weiten Brustharnisch trug, zu Ritter Vennemar und wechselte Worte mit ihm, die sie nicht verstand. Nur seine kehlige Artikulation war über die Entfernung vernehmbar.
Vennemar nickte und antwortete. Der Goblin ließ einen prüfenden Blick aus seinen tief liegenden Augen über die versammelte Menge schweifen und zog sich dann mit zwei Gefährten wieder in die Dunkelheit zurück.
Kurz darauf war er wieder da, begleitet von einem Reiter auf einem kleinen Pferd, den Fiana gut kannte: Alrico Deforso, der almadanische Barde, der mit dem Trupp gekommen war, der den Eisenzug im letzten Winter hatte abholen sollen. Er hatte mit ihnen bei der Belagerung ausgeharrt und sie durch die Sichel begleitet, wobei seine Fähigkeiten als Leutnant ihnen eine große Hilfe gewesen waren. Dann jedoch war seine Gefährtin schwer verwundet worden. In seiner Not hatte er sich um Hilfe an Cyron gewandt, der ihn wohl mit den Versprechungen seiner finsteren Kunst auf seine Seite gezogen hatte.
Fianas Herzschlag beschleunigte sich. Alrico würde sie auf den ersten Blick als Tochter der Freifrau vom Isenborn erkennen, wenn er sie sähe. Insofern stellte er eine weitere Gefahr dar. Andererseits hatte er sie entkommen lassen, als sie sich in seiner Hand befunden hatte. Auf welcher Seite stand er wirklich? Dass er in Begleitung von Goblins hier auftauchte, und offensichtlich nicht als Gefangener, sondern als respektierter Offizier, sprach dafür, dass sein Bündnis mit dem abtrünnigen Magier und Mörder noch Bestand hatte. Doch auch damals hatte er seinen Meister getäuscht ...
Fiana hatte bereits darüber nachgedacht, ob Alrico jemand wäre, der ihr gegen Cyron hätte helfen können. Sie hatte sich entschlossen, zunächst die Lage im Junkergut zu erkunden, aber wenn er nun schon einmal hier war, ergab sich vielleicht eine günstige Gelegenheit zur Kontaktaufnahme.
Zunächst ging es jedoch um die Menschen von Flusswalde. Alrico stieg aus dem Sattel und nickte Vennemar zu. Dieser erhob nun die Stimme: »Ich sagte bereits: Eure Nutzlosigkeit ist schändlich! Wer nutzlos ist, frisst nur das Essen weg! Zudem ist Unfähigkeit ebenso ansteckend wie Faulheit! Beides werde ich austilgen!« Wieder war sein Kopf tiefrot.
»Zehn unserer Soldaten sind in diesem Fluss gestorben!« Er zeigte auf den Ferrom, dessen Wasser dunkel durch die Nacht gurgelte. »Jeder Einzelne von ihnen war mehr wert als ihr alle zusammen! Aber ich will dieses eine Mal noch gnädig mit euch verfahren.«
Sein boshaftes Lachen ließ Fiana Schlimmes befürchten.
»Darum fordere ich von euch nur ein Leben für jeweils zwei, die durch eure Schuld verschwendet wurden. Und meine Güte kennt kaum Grenzen: Ihr dürft sogar selbst entscheiden, wer von euch entbehrlich ist!«
Das Schweigen der Menge zeugte von dem gleichen Entsetzen, das auch Fiana ergriff.
»Habt ihr nicht verstanden?«, rief Vennemar. »Wählt fünf von euch aus! Ich habe keine Lust, lange zu warten!«
Zögerlich erhob sich Gemurmel unter den Menschen. Angstvoll huschten ihre Blicke von einem zum anderen.
»Ihr habt euch das selbst zuzuschreiben!«, schrie der Ritter. »Wäret ihr aufmerksamer gewesen, dann hätten wir die Rebellen zur Strecke gebracht, das Eisen wäre auf seinem Weg nach Yol Ghurmak und niemand müsste sterben! Ihr habt anders gehandelt, jetzt seht ihr, wohin euch das führt!«
Fiana griff nach ihrem Schwert. Aber es waren so viele Goblins! Es wäre Selbstmord gewesen, jetzt einzugreifen! Zudem wollte sie sich gar nicht vorstellen, welche Vergeltung gefolgt wäre, wenn sie den Ritter getötet hätte. Gern hätte sie Alricos Gesicht gesehen, um seine Rolle in diesem grausamen Spiel einschätzen zu können, aber er stand mit dem Rücken zu ihr.
Vennemar war kein geduldiger Mensch. Er griff sich einen Mann mittleren Alters und warf ihn in die Arme dreier Goblins, die ihn zu Boden rangen. Die beiden Soldaten hatten die Hände an den Griffen ihrer Schwerter, was ausreichte, die verängstigte Menge zurückzuhalten. Nur eine Frau rief: »Ihn dürft Ihr nicht nehmen! Er hat einen kleinen Sohn, dessen Mutter letztes Jahr von einem Ochsenkarren überfahren wurde! Was soll denn aus Mikal werden?« Sie hob den etwa Fünfjährigen über den Kopf, um das Herz des Ritters zu bewegen.
Dieser ging mit langsamen Schritten zu der Frau und nahm ihr den Jungen ab, um ihn von Nahem zu betrachten.
»Er kann doch nicht ohne seine Eltern aufwachsen«, flehte die Frau.
»Dann sollten wir wohl auch ihn richten«, entgegnete Vennemar kalt. »Damit hätten wir schon zwei.«