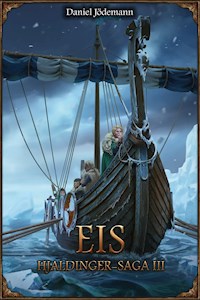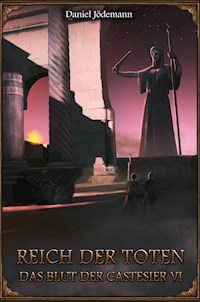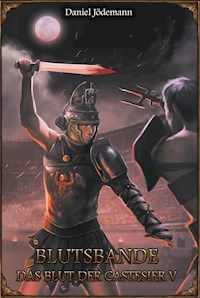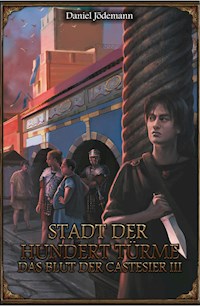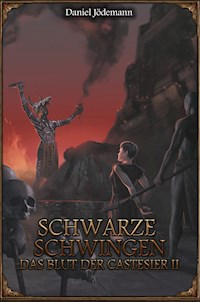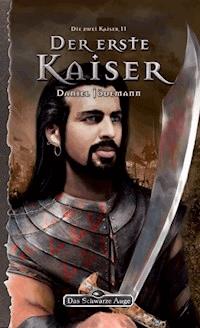Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ulisses Medien und Spiel Distribution GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Schwarze Auge
- Sprache: Deutsch
Havena war einst eine der reichsten Städte Aventuriens - bis die Menschen den Zorn des Meeresgottes Efferdweckten: Eine Flutwelle verheerte Havena und schuf die Unterstadt. Dennoch übt Havena auch heute noch auf viele eine große Anziehungskraft aus. Dies gilt auch auf den Efferd-Geweihten Mero Cervoletha, der mit seinem Glauben hadert und in Havena neu anfangen möchte. Die Magierin Cairbre Arnstätter hofft dagegen, mit ihrer Familie wieder ins Reine zu kommen, während die Kauffrau Vilai ni Vecushmar sich damit konfrontiert sieht, dass ihr Handelshaus kurz vor dem Ruin steht. Das Schicksal dieser drei Menschen wird schon bald untrennbar miteinander verbunden sein, während sich in der Unterstadt eine ebenso entsetzliche wie uralte Macht zu regen beginnt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Biografie
Daniel Jödemann (geboren 1978 in Bielefeld) lebt und arbeitet in Wuppertal.
Mit der Welt des Schwarzen Auges kam er erstmals Anfang der 90er Jahre in Berührung. Nach mehreren erfolgreichen Teilnahmen an Abenteuerwettbewerben begann er 2004 schließlich auch offiziell für Das Schwarze Auge zu schreiben und war seitdem an zahlreichen Publikationen beteiligt. Unter anderem hat er Texte zu den Regionalspielhilfen Angroschs Kinder, Am Großen Fluss, Aus Licht und Traum sowie Herz des Reiches beigesteuert und Abenteuer für die Bände Kar Domadrosch, Fremde Gefährten, Skaldensänge, Stromschnellen und Mächte des Schicksals verfasst. Außerdem war er einer der Autoren des Abenteuers Die letzte Wacht und hatte die Redaktion für die Abenteueranthologie Ehrenhändel inne.
Für die Spielhilfe Am Großen Fluss verfasste er schon die neue Stadtbeschreibung für Havena, was ihn auch auf die Idee brachte, einen Roman zu schreiben, der in dieser Stadt spielt.
Neben seiner Tätigkeit als Autor ist Daniel Jödemann auch als Illustrator tätig und hat für zahlreiche DSA-Publikationen Stadtpläne und Karten angefertigt.
In den Nebeln Havenas ist der erste Roman von Daniel Jödemann.
Daniel Jödemann
In den Nebeln Havenas
Ein Roman in der Welt von Das Schwarze Auge©
Originalausgabe
Impressum
Ulisses SpieleBand 98
Redaktion & Lektorat: Catherine BeckCover: Axel SauerwaldLektorat: Catherine BeckKartenentwurf: Ralf HlawatschBuchgestaltung: Ralf BerszuckE-Book-Gestaltung: Michael Mingers
Copyright © 2018 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems.DAS SCHWARZE AUGE, AVENTURIEN, DERE, MYRANOR, RIESLAND, THARUN und UTHURIA sind eingetragene Marken der Significant GbR.
Titel und Inhalte dieses Werkes sind urheberrechtlich geschützt.
Der Nachdruck, auch auszugsweise, die Bearbeitung, Verarbeitung, Verbreitung und Vervielfältigung des Werkes in jedweder Form, insbesondere die Vervielfältigung auf photomechanischem, elektronischem oder ähnlichem Weg, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Ulisses Spiele GmbH, Waldems, gestattet.
Print-ISBN 9783957529442E-Book-ISBN 9783868898903
Danksagung
Mit Dank an Momo Evers für Starthilfe, an Katharina Pietsch für viele ehrliche Worte,an Nina Jödemann, Uli Lindner, Moritz Mielke, Marcus Tebeck, Sebastian Thurau und Tyll Zybura, sowie Olaf Michel, der Vilai aus der Taufe hob
Personen
Hauptpersonen:
Mero Cervoletha, Efferd-Geweihter
Cairbre Arnstätter, Magierin von der Akademie von Licht und Dunkelheit zu Nostria
Vilai ni Vecushmar, Kaufherrin und Mitglied im Ältestenrat von Havena
Weitere:
Beronir Crayenried, Kaufherr und Ratsmitglied
Orlagan, Leiter des Kontors Vecushmar
Graustein, Vorsteher des Alten Efferd-Tempels
Deidra Arnstätter, Cairbres Mutter
Moran Arnstätter, Cairbres Vater
Lyn Arnstätter, Cairbres Schwester
Faeruin Arnstätter, Cairbres Bruder
Larona Seeträumerin, Geweihte im Alten Efferd-Tempel
Gilia, Geweihte im Alten Efferd-Tempel
Eghina Maegharin, Vorsteherin des Hauses der göttlichen Woge, des neuen Efferd-Tempels
Domnall Dalpert, Vorsteher des Hesinde-Tempels
Gylda, Matrosin auf der Herrin von Grangor
Alrikas, Bauernsohn aus dem Seenland
Connar Seehoff, Schreiner
Idra Seehoff, Connars Ehefrau
Fiacha Gredero, junge Kapitänin aus Havena
Elwene Aranol, Kurtisane und Ratsmitglied
Finian Borotraen, Zunftmeister der Lederer und Vorsteher des Ältestenrats
Yasmina von Lyckmoor, Spektabilität der Akademie von Licht und Dunkelheit zu Nostria
Amaro ya Bosvani, Kapitän der Herrin von Grangor
Cuilwyn Tarvola, ehemalige Kapitänin mit Sitz im Rat der Kapitäne
Roana, Wirtin der Herberge Travias Kochtopf
Jarwen Horbas, Tuchhändler aus Kyndoch
Elfwin Horbas, Tuchhändlerin aus Kyndoch
Ein namenloser, verrückter ›Prophet‹
Lata, die Drachenschildkröte
In Träumen und Rückblicken:
Mialan ni Vecushmar, Vilais Mutter
Scartho ui Vecushmar, Vilais Vater
Gardien D’Serpent, Anführer des untergegangenen H’Ranga-Kults
Anmerkung zur Aussprache:
Albernische Namen klingen für mittelreichische Ohren oftmals fremdartig. So werden im albernischen Dialekt, dem Alberned, aufeinander folgende Vokale in Eigennamen in vielen Fällen getrennt ausgesprochen und nicht verschliffen (zum Beispiel Ca-IR-bre, Vi-la-I, De-I-dra und Fae-RU-in).
»[…] Wie die Zeugen uns berichtet hatten, fanden wir dort die sterblichen Überreste der frevelhaften Kultanhänger und auch den Leichnam jenes Mannes vor, der die Götzenanbeter angeführt hatte. Zudem waren die Gebäude auf der Insel, die den Männern und Frauen wohl als Unterschlupf dienten, dem Erdboden gleichgemacht. Viele der übel zugerichteten Leichen wiesen auch grässliche Wunden auf, wie sie keine Waffe zu schlagen vermag. Es mag also tatsächlich der Wahrheit entsprechen, dass hier ein furchtbares Untier gewütet hatte. […]
Die Überreste sowohl der Kultisten als auch ihres Anführers wurden von den Geweihten eingesegnet und schließlich verbrannt. […]
Zur Last gelegt wurde jenen Frevlern nicht zuletzt auch die Entführung sowie Ermordung mehrerer Bürger der Stadt und Bewohner des Umlands während der letzten zwanzig Götterläufe, darunter erst kürzlich das Kaufherrenehepaar Vecushmar. […]«
— schriftlicher Bericht der Stadtgarde an Ardach Herlogan, Vogt von Havena, im Boron des Jahres 1028 nach Bosparans Fall
»[…] Am nächsten Tage fanden wir das Achaz-Dorf, von dem uns Callozzo, unser Führer, berichtet hatte. Es lag tatsächlich tief in den Echsensümpfen. Doch schon von weitem sahen wir die Rauchfahnen aufsteigen. […]
Tatsächlich war niemand mehr am Leben. Alle Echsenmenschen waren erschlagen worden oder in ihren Hütten verbrannt. Schließlich fanden wir einen Überlebenden, der ein Priester oder Häuptling sein mochte und ein grausiges Krakenamulett auf der Brust trug. Als Callozzo dessen letzten Worte vernahm, die der Echs in seiner eigenen Sprache zischelte, bestand er darauf, dass wir sofort umkehrten. […]
Auf mein Drängen hin berichtete Callozzo mir später, dass der sterbende Priester ihm von einem Abgesandten seines Götzen erzählt hatte, den der Echsenmensch wohl Den Klingenträger oder etwas in der Art genannt hatte. Dieser war vor einiger Zeit zu den Achaz gekommen, um von ihnen zu lernen. Danach hat er wohl dieses Blutbad unter ihnen angerichtet. […]
Den genauen Namen, den Callozzo mir in der befremdlichen Sprache der Echsenmenschen nannte, vermag ich hier nicht niederzuschreiben und will es auch gar nicht. […]«
— aus dem Expeditionsbericht des Fernhändlers Hagromar Vansteppen, Kannemünde, im Phex des Jahres 1023 nach Bosparans Fall
»Lata, die alte und weise Drachenschildkröte, ist des Efferd treuste Streiterin und Sendbotin. Seit Jahrhunderten und Jahrtausenden ficht sie in seinem Namen gegen das finstere Gezücht in den Tiefen der Meere, welches Efferd seine ewige Herrschaft über die See und alles, was darin lebt, streitig zu machen versucht.
Bisweilen mag sich Lata auch den Menschen zeigen, um Botschaften des Launenhaften zu übermitteln oder tritt aus eigenem Antrieb vor, um vor großem Unheil zu warnen.«
— übertragen aus dem Delphin-Manuskript, dem heiligen Buch der Efferd-Kirche, ca. 600 vor Bosparans Fall
Prolog
Bleich lugte der Mond hinter den Wolkenfetzen hervor, die träge über den Himmel zogen, und hüllte das Umland in fahlen Schein. Gezackte Mauerreste erhoben sich aus dem tintenfarbenen Wasser. Auf einigen Inseln reckten sich verkrüppelte blattlose Bäume dem Himmel entgegen. Nebelfetzen, die aus sich selbst heraus zu leuchten schienen, trieben zwischen den Ruinen, und doch war kein Windhauch zu spüren.
Ein Reiher war unvorsichtig genug, um nach Einbruch der Dunkelheit hier auf Beutesuche zu gehen, und ließ sich auf dem Wasser nieder. Die Oberfläche, auf der sich der Mond wie auf poliertem schwarzem Marmor spiegelte, kräuselte sich wellenförmig um den Vogel herum. Nur wenige Momente später schoss etwas aus der Tiefe hervor, ein Maul voller verdrehter Zähne schloss sich gedankenschnell um den Reiher und riss ihn unter Wasser. Schon bald war die Oberfläche wieder glatt, nichts deutete mehr auf das hin, was sich eben hier abgespielt hatte. Nun kehrte wieder trügerische Ruhe ein.
In Havena hieß es, die verfluchte Unterstadt wäre gefährlich. Es hieß, Schatzsucher, die sich in die Unterstadt wagen, wären tollkühn. Es hieß, wer des Nachts hierher kam, der muss wahrlich von Todessehnsucht erfüllt sein. Oder aber er genießt den Schutz eines wohlwollenden Gottes.
Die einsame Gestalt, die in dieser Nacht hier unterwegs war, kannte all diese Geschichten, war sie doch in der Stadt aufgewachsen. Dies schien sie jedoch nicht davon abzuhalten, allein und nur in einem kleinen Boot mitten in der Nacht in die Unterstadt hinauszurudern.
Es war ruhig in dieser Nacht, kein Geräusch war zu hören, kein Wind, kein menschlicher oder tierischer Laut. Selbst die Kreaturen, die zwischen den versunkenen Gebäuden hausten, schienen darauf bedacht zu sein, keinen Ton von sich zu geben.
Das Boot verharrte schließlich irgendwo zwischen den zahllosen Inseln. Die Gestalt legte die Ruder beiseite und wartete. Dabei wandte sie nicht ein einziges Mal den Kopf und spähte auch nicht in die finsteren Ruinen, aus denen heraus bleiche Augenpaare den Ankömmling beobachteten. Fast schien es so, als würden auch die Kreaturen der Unterstadt neugierig darauf warten, was die Gestalt in dem Boot in dieser Nacht dazu veranlasst hatte, sich hinaus in die Ruinenstadt zu wagen. Bange Momente verstrichen.
Dann ging ein Ruck durch das Boot.
Schwarze, kräftige Fangarme schossen rundherum aus dem Wasser, peitschten gierig empor, suchten und tasteten. Faustgroße Saugnäpfe glitten schmatzend am Holz des Bootes entlang. Schon erreichten die Tentakel die Gestalt. Die zerbrechliche Nussschale wurde angehoben.
Zunächst schien es so, als ob die Gestalt in dem Boot das Untier einfach gewähren lassen würde. Schon knarrten die Planken bedrohlich, ächzten wie ein verwundetes Tier. Jeden Moment würde das Boot nachgeben und zerschmettert werden. Dann hob die Gestalt darin den Arm.
Die Fangarme verharrten.
Einen Moment lang schien die ganze Unterstadt den Atem anzuhalten.
Dann setze der massige Krake das Boot langsam, geradezu behutsam, wieder auf dem Wasser ab. Es schien fast so, als hätte er einen schwerwiegenden Fehler bemerkt und wäre nun darauf bedacht, nicht noch größeren Schaden anzurichten. Kurz glitt einer seiner Tentakel sanft über den Arm der Person in dem Boot. Dann ließ sichder Krake zurück in die Tiefe sinken und verschwand schließlich mit kraftvollen Schwimmbewegungen zwischen den versunkenen Ruinen.
»Bald«, murmelte die Gestalt in dem Boot leise und senkte den Arm wieder. Es schien so, als würde sie zu sich selbst sprechen. »Der Tag wird kommen. Bald …«
1. Kapitel
11. Ingerimm 1028 BF
Auf dem Meer der Sieben Winde
Schäumend brach sich die See am Bug des Seglers. Fast unmerklich hob sich der Bugspriet, um sich dann ebenso langsam wieder dem Meer entgegenzusenken. Die Herrin von Grangor war voll beladen mit Waren aus den Städten des Horasreichs, und doch schnitt die Schivone pfeilschnell und ruhig durch das Wasser. Der Beleman, jener Wind, der so vorherrschend war für das Meer der Sieben Winde, blies kräftig und trieb die Herrin mit geblähten Segeln vor sich her.
Mero Cervoletha stand am Bug und sah auf das Meer hinaus. Immer wieder spritzte Gischt am Bug der Herrin empor und benetzte seine Kleidung. Das Gewand eines Efferd-Geweihten war jedoch dafür gemacht, Wasser standzuhalten. Zudem genoss Mero den kühlenden Schleier, der sich auf sein Gesicht legte.
Es war Ingerimm, also noch immer Frühling, und doch brannte die Sonne heiß vom Himmel; keine Wolke war zu entdecken. Mero hatte angenommen, dass seine Reise nach Norden ihn in kühlere Gegenden führen würde. Doch je weiter die Reise führte, desto wärmer wurde es.
Rund vier Tage sollte die Reise von Bethana nach Havena dauern. Die Herrin von Grangor machte aber so gute Fahrt, dass sie ihr Ziel einen halben Tag eher erreichen würde. Amaro ya Bosvani, der als Kapitän auf der Schivone das Sagen hatte, war überzeugt davon, dass die Gegenwart eines Geweihten des Efferd an Bord der Grund für das gute Wetter war. Mero hatte Bosvani nicht widersprochen, tief drinnen war er jedoch nicht der Meinung, dass ausgerechnet seine Anwesenheit den Segen des Meeresgottes auf die Schivone herabrufen sollte.
Auf der Fahrt hatte der junge Geweihte an Bord dennoch eine Andacht für Offiziere und Mannschaft abgehalten, wenn auch nur, weil man es von ihm erwartete. Mero hatte den Frauen und Männern von Efferds Gnade erzählt, von günstigen Winden, die Schiffe vorantrieben, und dem Regen, der die Felder bewässerte. Er hatte ihnen von den Stürmen berichtet, die der Launenhafte in seinem Zorn schicken konnte, die Schiffe versenken und die Äcker ertränken konnten. Dabei hatte er sich bemüht, selbstbewusst zu klingen, doch wie immer, wenn er predigte, kam er sich wie ein Scharlatan vor.
Sehr viel lieber hatte sich Mero dagegen an den Arbeiten an Bord beteiligt, auch wenn die Offiziere ihm zu verstehen gaben, dass es nicht von ihm erwartet wurde. Mero zog jedoch die Gegenwart der einfachen Matrosen vor und war froh, seinen Teil beitragen zu können. Die Seeleute schätzten ihn dafür, auch wenn sie offensichtlich nicht vergaßen, dass sie einen Priester vor sich hatten, dem sie Respekt zu zollen haben. Wenn er den Matrosen beim Segel setzen und Taue spleißen helfen konnte, kam Mero sich jedenfalls nützlicher vor, als wenn er die Mannschaft zur Gottgefälligkeit ermahnte.
Heute jedoch zog er es vor, im Schatten des Großsegels zu stehen, wo er vor Praios’ Strahlen geschützt war. Das Meer erstreckte sich wie ein weiter blauer Teppich vor ihm, nur an Steuerbord, östlich von ihm, konnte Mero einen grünen Streifen am Horizont ausmachen. Natürlich war die Herrin küstennah unterwegs, dies war die sicherste Art zu navigieren. Vermutlich passierten sie sogar schon das Delta des Großen Flusses.
»Euer Gnaden?«
Die helle Stimme riss Mero aus seiner Versenkung. Der Geweihte fuhr herum und blinzelte; das Licht, das sich im Wasser brach, hatte tanzende Flecken vor seinen Augen zurückgelassen.
»Verzeiht. Ich störe Euch. Ich komme später wieder …«
Mero erkannte Gylda, eine Leichtmatrosin, die, wie er wusste, ebenfalls aus Bethana stammte. Sie trug einen alten Namen der aventurischen Mythologie; angeblich war Gylda der Name der ersten Herrscherin des Güldenlands, jenes legendären Kontinents weit jenseits des Meeres der Sieben Winde.
»Ganz und gar nicht«, hielt er Gylda, die sich bereits wieder abgewandt hatte, zurück. »Was kann ich für dich tun?«
Die junge Frau trat neben ihn an die Reling. Zwischen den Händen drehte sie einen Marlspieker.
»Wir werden wohl bald Havena erreichen«, ergriff Mero erneut das Wort, als Gylda nicht sofort weitersprach. »Efferd ist uns gewogen: Er hat uns gutes Wetter gesandt und den Beleman, der uns schnell voranbringt.«
Gylda nickte und blickte hinaus auf das Meer. Dann deutete sie plötzlich auf das Meer hinaus: »Seht Ihr?«
Mero folgte ihrem Blick und kniff die Augen zusammen. Tatsächlich erspähte er dort eine Anzahl schlanker grauer Gestalten, welche die Schivone begleiteten und immer wieder ausgelassen aus dem Wasser sprangen. Fast war der Geweihte beschämt, dass er die Tiere nicht selbst gesehen hatte, während er in Gedanken versunken gewesen war.
»Delphine, ganz recht«, bestätigte Mero rasch, ganz so, als habe er die Tümmler schon länger beobachtet. »Der Meeresgott lässt uns von seinen heiligen Tieren begleiten. Das ist ein gutes Zeichen.«
Mero beobachtete die Delphine, die ebenso schnell wie die Schivone durch das Wasser glitten. Die Sonne glänzte auf ihren Rücken, wann immer sich eines der Tiere aus dem Wasser erhob.
Mero wandte sich wieder Gylda zu und stellte fest, dass die junge Frau glücklich lächelte. Der Geweihte war etwas überrascht; der Anblick der Delphine hatte die Matrosin offensichtlich sehr bewegt.
»Ich habe Eure Andachten verfolgt und davor auch viele andere. Ich war auch oft im Tempel von Bethana«, begann Gylda nun; ihre anfängliche Schüchternheit war nahezu verflogen. Es kam Mero vor, als sollte der letzte Satz eine Rechtfertigung sein.
»Ich habe sehr lange darüber nachgedacht«, fuhr sie mit fester Stimme fort. »Und ich habe mich gefragt, ob ich wohl eine gute Geweihte abgeben würde. Eine des Efferd, meine ich.« Erwartungsvoll, beinahe ängstlich blickte sie Mero an.
Mero war kaum überrascht über diese Frage. Er hatte Gylda während seiner Andachten beobachtet und ihre tiefe Gläubigkeit, ihre innige Liebe zur See und Efferd selbst gespürt. Einmal hatte Gylda ihn angesprochen und nach seinem Leben als Priester befragt. Sie war ein Kind einfacher Zimmerleute aus Bethana, so hatte sie Mero erzählt. Ihre Liebe zum Meer hatte sie jedoch dazu getrieben, zur See zu fahren.
Wieso kann ich nicht so empfinden?, fragte er sich. Wieso stehe ich nicht hier und jauchze, wenn Efferd uns einen solchen Gunstbeweis zeigt?
»Nun, mein Kind«, begann Mero und schenkte der nur wenige Jahre Jüngeren ein mildes Lächeln. »Es gehört bei weitem mehr dazu, eine Priesterin des Efferd zu werden als nur der Wunsch. Tiefe Gläubigkeit ist vonnöten, Disziplin und Entschlossenheit. Der Weg bis zur Weihe ist lang und schwierig. Du solltest dir gut überlegen, ob du ihn einschlagen willst.«
Die Angesprochene nickte gefasst, ganz so, als hätte sie diese Antwort bereits erwartet. Mero sah jedoch Enttäuschung auf ihrem Gesicht. »Ich danke Euch, Euer Gnaden. Ich werde mich bemühen, fest im Glauben zu sein und Eure Worte beherzigen.«
Mero nickte ihr zum Abschied zu, und Gylda begab sich wieder an ihre Arbeit. Doch schon als sie die letzten Worte gesprochen hatte, schalt Mero sich selbst einen Narren.
Es wäre besser gewesen, wenn er sie ermuntert hätte, diesen Weg zu verfolgen. Anscheinend brachte sie alle Voraussetzungen mit, die sich die Efferd-Kirche von Novizen wünschte: Die Matrosin liebte offenbar den Gott des Meeres, war diszipliniert und wohl auch in der Lage, ihre Launen auszuleben und auf ihre Gefühlen zu hören.
Denn keiner der Zwölfgötter war launenhafter und unberechenbarer als der Meeresgott. Von einem Moment auf den anderen, und vollkommen überraschend für die Menschen, konnte seine Stimmung umschlagen – ganz so, als wenn plötzlich auf ruhiger See ein Sturm aufzieht. Die Priester des Efferd waren deshalb angehalten, ebenfalls ihren Launen nachzugeben und es dem Gott nachzutun.
Mero dagegen war schon immer anders gewesen.
Schon als seine Eltern ihn in das Noviziat gegeben hatten, war Mero ungewöhnlich zurückhaltend. Heute vermutete Mero bisweilen, dass die Geweihten ihn nur angenommen hatten, weil sein Vater Rahjol Cervoletha, der als Signore, als Großgrundbesitzer, zu Reichtum gekommen war, für seine üppigen Spenden an den Tempel geschätzt wurde. Und das Gotteshaus von Bethana war immerhin der wichtigste Tempel der ehrwürdigen Efferd-Kirche.
Auch während seiner Ausbildung hatte Mero sein zurückhaltendes Wesen nie ganz ablegen können. Seine Vorgesetzten gaben ihm jedoch zu verstehen, dass sie ihn wegen seiner disziplinierten Art und seiner Folgsamkeit schätzten. Immerhin zählte auch Schicksalsergebenheit zu den Idealen der Efferd-Geweihtenschaft.
Zudem war er ein herausragender Schwimmer und Taucher; schon als ›Grauling‹ – so die gängige Bezeichnung für Novizen des Efferd aufgrund ihrer Tracht, einer grauen Kutte – war er einmal in der Lage gewesen, einen erfahrenen Geweihten im Wettschwimmen zu schlagen. Dennoch war sich Mero nie ganz sicher, ob er wirklich einen guten Priester abgeben würde.
Und mehr noch: ob der Gott selbst bereit war, ihn als Geweihten anzuerkennen.
Dann kam der Tag seiner Weihe. Als Prüfung, die jeder Novize vor seiner Weihe abzulegen hatte, hatte Meros Lehrer einen schwierigen Tauchgang für ihn gewählt: Mero sollte eine Muschel bergen, die zuvor in tiefes Wasser geworfen worden war. Tatsächlich hatte er im Nachhinein schon mehrfach gedacht, dass die Art der Prüfung für ihn nur deshalb ausgewählt wurde, um seinen Talenten entgegenzukommen.
Und doch war dieser Moment, dieser eine Augenblick während seiner Weihe, als Efferd Mero anerkannte und ihn zu seinem Priester machte, der glücklichste in seinem Leben. Mero hatte bis zuletzt gezweifelt. Es kam immerhin bisweilen vor, dass ein Grauling noch nicht bereit für die Weihe war und abgelehnt wurde. Tatsächlich sah sich Mero schon die Prüfung im nächsten Jahr wiederholen, nur um wieder zu versagen und schließlich in Schimpf und Schande fortgejagt zu werden, zurück zu seiner beschämten Familie. Denn es lag immer bei dem Gott selbst, ob er Novizen auch wirklich als Geweihte annahm. Ja, es hatte Mero tatsächlich überrascht, dass Efferd ihn erwählte.
Mero hatte zunächst noch zwei weitere Jahre im Tempel von Bethana gedient. Seine Eltern waren erstmals richtig stolz auf ihren jüngsten Sohn gewesen, der Geweihter am Haupttempel des Efferd geworden war. Und doch war es gerade seine Weihe, die ihm die Zeit danach schal und leer vorkommen ließ. Sicher, Efferd hatte ihn angenommen, ihm einen winzigen Teil seines göttlichen Selbst eingegeben. Dennoch hatte Mero seine letzten Zweifel nie beseitigen können. Und die Tatsache, dass sich dieses Gefühl, dieser Zustand der Klarheit und Glückseligkeit, den er bei seiner Weihe erfahren durfte, danach nie wieder eingestellt hatte, gab Mero zu denken.
Schließlich fasste Mero den Entschluss, in einem anderen Tempel einen neuen Anfang zu wagen. Die Efferd-Kirche war sehr einflussreich in Bethana. Dort hatten einst die allerersten Siedler aus dem Güldenland Efferd aus Dank das erste Gotteshaus auf dem neuen Kontinent errichtet. Dementsprechend bedeutsam und traditionsreich war der Tempel auch. Havena dagegen hatte für Mero immer etwas Besonderes, etwas Mystisches gehabt. Und wenn er in der Bibliothek des Tempels die alten Geschichten und Berichte über die Stadt gelesen und stundenlang die alten Karten angestarrt hatte, dann wünschte er sich, durch Havenas Gassen zu laufen, am Kai zu stehen und Segelschiffe aus aller Herren Länder einlaufen zu sehen. Schon der Klang des Namens sprach von Abenteuer. Und mehr noch: Er sprach von Efferds Zorn und Efferds Gnade. Für Mero gab es keinen anderen Ort auf Dere, an dem sich das Wirken des strengen Gottes so deutlich gezeigt hatte; Havena hatte einst den Zorn des Meeresgottes in seiner voller Härte zu spüren bekommen. Efferd selbst hatte dort seine Spuren hinterlassen – Narben, die sich bis heute an der Stadt zeigten.
Vielleicht würde er dort das finden, was er so verzweifelt suchte.
2. Kapitel
11. Ingerimm 1028 BF
Vor der Küste Albernias
Die Herrin von Grangor warf vor der Küste Anker. Mero wusste, dass die Einfahrt in den Nordarm des Deltas des Großen Flusses, an dem Havena lag, gefährlich war. Nun war er begierig darauf zu sehen, wie die Schivone in den Hafen gelangen würde.
Die Matrosen nickten Mero freundlich zu, als er sich auf den Weg zum Heck machte, und der Priester erwiderte ihre Grüße. Die Vorfreude hatte ihn nun gepackt; er konnte es kaum erwarten, endlich die Mauern Havenas zu erblicken. Immer zwei Stufen auf einmal nehmend, erklomm Mero die zwei Decks der Achtertrutz, die hoch über der Wasserlinie aufragte. Hier war der Geweihte wieder der brennenden Sonne ausgesetzt. Am Ruder standen der Kapitän und sein Steuermann beieinander, beide blickten auf, als Mero hinzutrat.
»Werden wir jetzt einen Lotsen an Bord nehmen?«, fragte er und bereute die Frage sofort wieder. Ich klinge ja wie ein aufgeregter Schiffsjunge auf seiner ersten Fahrt, dachte er. Kapitän Bosvani muss mich für einen Dummkopf halten.
Dennoch antwortete der Kapitän höflich. »Ganz recht. Kein Kapitän würde den Großen Fluss ohne einen Lotsen befahren.« Bosvani deutete nach achtern. »Und da kommen sie schon.«
Tatsächlich steuerte ein kleines Ruderboot auf die Schivone zu. Zwei Personen entdeckte Mero in der Nussschale. Kaum hatte das Boot die Seitenwand der Herrin erreicht, griff einer der beiden Lotsen nach einer bereitgehaltenen Strickleiter und erklomm die Bordwand. Rasch stieg er bis zur Achtertrutz hinauf und trat Bosvani entgegen.
»Efferd zum Gruße.« Als der Lotse die schmuddelige Schiffermütze vom Kopf zog, fiel eine Flut roter Locken herab. Mero bemerkte erst jetzt, dass es sich um eine Frau handelte. Kurz musterte sie Mero, dann grüßte die Lotsin auch ihn. Anhand seines mit Schildpatt und Perlmutt besetzten türkisfarbenen Gewandes war er für jeden leicht als Gefährte von Wind und Wogen, so der Titel der einfachen Efferd-Geweihten, zu erkennen.
Dennoch irritierte Mero dieser eine Augenblick, in dem die Lotsin ihn bemerkt und sichtlich gezögert hatte, ehe sie auch ihn begrüßte. Es kam schließlich häufig vor, dass Schiffe Efferd-Geweihte an Bord hatten.
Nun trat sie neben das Steuerrad. »Holt den Anker ein! Setzt Segel!«, befahl sie ruhig.
Und Mero wurde klar, dass Kapitän Bosvani nun nicht mehr Herr über sein Schiff war.
Die knappen Kommandos der Lotsin führten die Schivone zielsicher in den Großen Fluss. Das Schiff passierte dabei den hoch aufragenden Leuchtturm, der auf einer kleinen Insel in der Flussmündung stand. Mero wusste, dass der Turm von der Havener Geweihtenschaft des Efferd selbst unterhalten wurde. Immerhin handelte es sich dabei um eine wichtige und vertrauensvolle Aufgabe, die über Wohl und Wehe der ankommenden Schiffe entscheiden konnte.
Der Fluss mochte an der Mündung gut und gerne 150 Schritt breit sein, und doch war die Passage gefährlich: Untiefen und Sandbänke, die immer wieder abgetragen wurden und neu entstanden, lauerten unter der Wasseroberfläche auf ankommende Schiffe. Die Fahrrinne kannten nur die Lotsen genau, prüften und maßen diese doch immer wieder die Tiefe des Wassers. Es war nicht auszudenken, was passieren würde, wenn ein schwerer Segler wie die Herrin von Grangor hier auf Grund liefe. Mero wusste die Arbeit der Lotsen zu schätzen, die sich auf ihre Weise bemühten, einen Teil von Efferds Willen zu entschlüsseln. Dies war eine Aufgabe, der sich auch viele Geweihte des unergründlichen Meeresgottes verschrieben hatten.
Jenseits des Flusses erstreckte sich die Marschenlandschaft, die von den Alberniern Muhrsape genannt wurde: ein unzugängliches und unwirtliches Moor, wenn Mero den Erzählungen Glauben schenken konnte. Am Rande der Muhrsape lag Havena, die Hauptstadt des seit kurzer Zeit erst unabhängigen Königreichs Albernia. Die Schivone war keineswegs allein auf dem Fluss unterwegs: Sie überholten Fischerboote und kleine Segler, deren Mannschaften dem stolzen Schiff zuwinkten. Am Ufer stakten Fischreiher umher und suchten nach Beute, einmal zog ein Schwarm kreischender Möwen vorbei. Mero hielt aber nach etwas anderem Ausschau. Etwas, wovon er schon viel gelesen und gehört hatte und dessen Anblick er sich schon oft ausgemalt hatte. Der Ort, wo Efferd selbst vor drei Jahrhunderten gewirkt hatte. Und er musste nicht lange warten.
Das Nordufer löste sich in eine Vielzahl von kleineren und größeren Inseln auf. Mero entdeckte die ersten verfallenen und überwachsenen Ruinen, die sich auf diesen Inseln erhoben, und dann Mauerreste, die aus dem grünen Wasser aufragten.
Sie passierten die Unterstadt von Havena.
Auf einigen Inseln wuchsen Bäume und Büsche, deren Äste jedoch keine Blätter trugen. Vereinzelt konnte Mero noch Reste von Dachstühlen und sogar bedenklich schräg stehende Säulen erkennen.
Dennoch wurde der Anblick der versunkenen Weststadt Havenas den Geschichten nicht gerecht. Sicher, es war Flut, und der Großteil der Unterstadt war überspült. Es war durchaus ein beeindruckender Anblick – die Unterstadt nahm die ganze Fläche zwischen dem Meer und Havena ein –, dennoch kamen Mero nicht sogleich Götterfluch und Geister in den Sinn. Er war etwas überrascht; eigentlich hatte er erwartet, dass ihn der Anblick mehr berühren würde.
Kurz überlegte Mero, ob er die Lotsin auf die verfluchte Unterstadt Havenas ansprechen sollte. Diese blickte allerdings nur starr geradeaus. Tatsächlich hatte sie den Geweihten seit der knappen Begrüßung keines Blickes mehr gewürdigt. Dann entdeckte Mero aber auch schon die Mauern der Stadt und die Hafeneinfahrt.
Zwei schnelle Flussschiffe überholten die Schivone, ein mehrmastiger Handelssegler lief gerade aus und war wieder auf dem Weg zum Meer. Mero sah, dass das Schiff hoch im Wasser lag, anscheinend hatte es den Großteil seiner Ladung in Havena gelöscht. Eine Galeere kam ihnen entgegen, auf deren Deck Mero Geschütze und Bewaffnete entdeckte. Es handelte sich eindeutig um ein Kriegsschiff, das vermutlich von einer Patrouillenfahrt auf dem albernischen Teil des Flusses zurückkehrte. Auch wenn die Kriegshandlungen zwischen Albernia und den Nordmarken nach Meros Wissen zum Erliegen gekommen waren, belauerten sich die Gegner zu Lande und zu Wasser weiterhin misstrauisch.
Schließlich lief die Herrin in den Hafen ein. Dort herrschte gerade geschäftiges Treiben, da jeder Kapitän das Hochwasser nutzen wollte, um sein Schiff hinaus- oder hineinzulenken. Große Segler passierten einander nur um Haaresbreite. Mero entdeckte die Flaggen Nostrias und des Horasreiches, nicht jedoch die des Mittelreichs: Seitdem der Handel mit dem Kaiserreich zum Erliegen gekommen war – eine Folge des Krieges, der nach der Loslösung Albernias ausgebrochen war – sah man keine Schiffe des Neuen Reiches mehr in Havena. Die einheimischen Kapitäne ließen stattdessen einzig die albernische Flagge auf ihren Schiffen hissen.
Nachdem die Herrin von Grangor einen Liegeplatz gefunden hatte, die Segel eingeholt waren und das Schiff sicher vertäut war, verabschiedete sich Mero von Kapitän Bosvani und dankte ihm für die sichere Überfahrt. Mero versäumte es auch nicht, den Kapitän zur nächsten Andacht im Efferd-Tempel einzuladen, bevor er wieder in seine Heimat zurückkehrte. Da Bosvani mit zwei oder drei Tagen Aufenthalt in der Stadt rechnete, versprach er, dem Gottesdienst beizuwohnen.
Dann betrat Mero Nalleshof, das Viertel der Seeleute, und damit erstmals havenischen Boden. Er schulterte das Bündel, in dem er seine Habseligkeiten verschnürt hatte, und versank im Gewühl der Menschenmassen. Die Kaianlagen waren von Leben erfüllt: Zahlreiche Hafenarbeiter, stämmig gebaute Männer und Frauen, eilten bereits herbei, um die Ladung der Herrin von Grangor zu löschen. Schweiß glänzte auf ihren Gesichtern; Mero beneidete sie nicht um ihre kräftezehrende Arbeit in der Hitze.
Hier, am Seehafen, standen die hoch aufragenden Speicher dicht an dicht. Die Gebäude warfen lange Schatten, in denen Schiffseigner und Kapitäne beieinander standen, mit Ladepapieren wedelten und die Arbeit überwachten. Güter wurden hineingetragen oder auf Wagen verstaut, um sie sofort weiterzutransportieren. Der Lärm war ohrenbetäubend: die Rufe der Arbeiter, kreischende Möwen, die es auf den Fang eines Fischkutters abgesehen hatten, und das Grölen und Lachen von Matrosen, die auf der Suche nach einer Schänke waren, in der sie ihre Heuer versaufen konnten. Mero atmete tief durch und schmeckte Salz auf der Zunge. Er war bereits jetzt davon überzeugt, dass es eine gute Idee gewesen war, einen neuen Anfang in Havena zu wagen. Mero konnte es gar nicht abwarten, die Stadt zu erkunden und die Einwohner kennenzulernen, die für ihre Efferdgläubigkeit ja so bekannt waren.
Dennoch sollte er sich besser rasch in seinem neuen Tempel melden. Mero sah sich um und fragte sich, welche der vielen kleinen Gassen und Straßen ihn am schnellsten nach Unterfluren bringen würde. Er beschloss, nach dem Weg zu fragen.
»Efferd zum Gruße«, wandte er sich an zwei Hafenarbeiter, die sich offensichtlich gerade eine Pause gönnten. »Würde mir bitte jemand den schnellsten Weg zum Tempel des Meeresgottes weisen?«
Die beiden Männer waren verstummt, als Mero hinzugetreten war. Ihr Lächeln schwand, unbewegt starrten sie Mero an. Der Geweihte bemühte sich, sein eigenes Lächeln aufrechtzuerhalten, doch die abweisende Reaktion der Arbeiter überraschte ihn.
»Welchen Tempel meint Ihr denn?«, hakte schließlich nach langen Momenten des Schweigens einer der Männer nach und wich Meros Blick aus.
»Das Haus der göttlichen Woge«, setzte Mero hastig nach. Natürlich – es gab zwei Efferd-Tempel in Havena.
Der Arbeiter deutete zu einer nahen Gasse hinüber. »Folgt der Tuchmachergasse bis zur Brückenstraße. Wendet Euch dann nach Norden. Geht dann über den Halplatz und hinter dem Tempel des Praios rechts.« Noch immer wich er Meros Blick aus.
»Habt Dank, so werde ich den Weg ganz bestimmt finden. Efferd zum Gruße.« Mero bemühte sich, besonders freundlich zu klingen, doch der Arbeiter nickte nur und wandte sich ab.
Über die Schulter bemerkte Mero, dass die beiden Männer ihm nachsahen, als er sich auf den Weg machte.
Nun musste er wieder an das Verhalten der Lotsin denken, das ähnlich abweisend gewesen war. Meros Hochgefühl schwand. Havena hatte sich einst Efferd als Schutzgott erwählt, und keine Stadt war dem Meeresgott so eng verbunden. Er hatte nicht erwartet, hier als Efferd-Geweihter derart kühl, ja geradezu unfreundlich begrüßt zu werden.
3. Kapitel
11. Ingerimm 1028 BF
Nostria
Dumpf hallten ihre Schritte auf dem Pflaster wider, als Cairbre Arnstätter im schwindenden Licht des hereinbrechenden Abends durch Nostria eilte. Seit dem Ausbruch der Blauen Keuche vor nahezu zwei Jahren war die Stadt zu weiten Teilen entvölkert worden; jeden vierten Bürger hatte Boron zu sich in sein Totenreich gerufen. Nun griff das Verbrechen um sich, die Stadtgarde war nahezu machtlos gegen die Banden. Cairbre betrat Nostria nach Einbruch der Dämmerung deshalb nur ungern. Sie war sich unsicher, ob sie ihren Reisemantel fester um sich ziehen sollte, um möglichst kein Aufsehen zu erregen, oder jedem Beobachter offen die Robe darunter zeigen sollte. Die junge Frau befürchtete, dass sie für Straßenräuber und Banden wie leichte Beute aussah. Doch ihr kunstvoll beschnitzter Stab mit dem großen Speckstein an seinem oberen Ende sollte sie eigentlich schon gut sichtbar als Magierin ausweisen. Cairbre vertraute darauf, dass dies jedermann davon abhalten würde, sie als Ziel für einen Überfall auszuwählen. Und falls doch, so wusste sich die zierliche Adepta zu wehren.
Cairbre näherte sich dem Zentrum der Stadt. Prachtvoll geschmückte Häuserfronten, geprägt von kleinen Figuren und Verzierungen, säumten hier die Straßen, doch Cairbre wusste, dass dahinter nur einfache Gebäude zu finden waren. Selbst die reichen Bürger konnten sich in Nostria, der Stadt, die zusehends dem Verfall anheimfiel, gerade einmal den Anschein von Prunk leisten.
Unbehelligt gelangte sie zum Freiheitsplatz, in dessen Mitte sich der fünf Schritt hohe Stein von Nosteria erhob – das Symbol nostrischer Unabhängigkeit. Das Königreich, das denselben Namen trug wie seine Hauptstadt, mochte zwar klein sein und nach Meinung vieler im Untergang begriffen, stolz war man hier dennoch auf seine Eigenständigkeit.
Cairbre beachtete weder den Stein, noch bedeutete ihr als geborener Havenerin Nostrias Unabhängigkeit besonders viel. Stattdessen eilte sie zu der kleinen Taverne am Südrand des Platzes. Ein Schild über der Tür verriet ihren Namen: Eichenkeller.
Die Schänke erwies sich als gemütliche Stube mit einem großen Kamin, der trotz der frühlingshaften Temperaturen kräftig befeuert war und neben der Wärme auch ein angenehmes Licht verbreitete. Eine Handvoll kleiner Tische standen hier dicht gedrängt. Die wenigen Gäste, die es an diesem Abend hierher verschlagen hatte, saßen zumeist nahe des Tresens, fernab des Kamins, der drückende Hitze verbreitete. Ihren Namen hatte die Schänke wohl von den holzgetäfelten Wänden, die man eher in einem Studierzimmer oder einer Bibliothek erwarten würde.
Auf ihrem Weg durch den Schankraum passierte Cairbre zwei graubärtige Magier vom Orden der Schlange der Erkenntnis, der ein Haus in der Stadt unterhielt. Sie nahm sich auch die Zeit, einen fülligen Geweihten der Peraine zu grüßen, der allerdings nicht einmal von seinem Weinkrug aufsah. Dann trat sie auf den Ecktisch zu, an dem eine einzelne schlaksige Gestalt saß.
»Eure Spektabilität?«
Die Angesprochene blickte von einem Stapel Pergamente auf, die vor ihr auf dem Tisch lagen. »Cairbre?« Ihr Gesicht hellte sich auf, als sie die Adepta erkannte. »Tretet doch näher, meine Liebe.«
Yasmina von Lyckmoor schob die Papiere beiseite und winkte dann dem Wirt zu, der gähnend hinter seiner Theke stand. Die Akademieleiterin bestellte zwei Becher Wein und erlaubte sich, kaum dass der Wirt außer Hörweite war, einen augenzwinkernden Kommentar: »Der Wein ist furchtbar schlecht, und wenn Ihr nichts gewohnt seid, werdet Ihr morgen wohl einen schweren Schädel haben. Dafür habe ich hier jedoch meist meine Ruhe – dachte ich zumindest …«
»Verzeiht mir, Spektabilität«, entschuldigte sich Cairbre sofort. »Aber ich muss dringend mit Euch sprechen.«
»Schon gut, schon gut, Cairbre. Ihr müsst Euch nicht entschuldigen. Ihr seht so aus, als würde Euch etwas Wichtiges auf dem Herzen liegen.« Dann sah sie plötzlich auf.
»O je.« Yasminas Stirn legte sich in Falten. »Ich habe also doch vergessen, den Jahresbericht an die Gilde zu unterzeichnen? Nein, wie dumm von mir …«
»Nein, das ist es nicht«, wandte Cairbre rasch ein. Sie kannte die gelegentliche Zerstreutheit der Akademieleiterin nur zu gut und war natürlich sichergegangen, dass Yasmina die heute von Cairbre angefertigten Schriftstücke und Berichte auch unterzeichnet und gesiegelt hatte.
»Hesinde sei Dank.« Yasmina atmete auf. »Aber setzt Euch doch erst einmal, Collega.«
Cairbre legte ihren Reisemantel ab und lehnte ihren Stab neben den Yasminas an die Wand, bevor sie sich setzte. Sie wusste es zu schätzen, dass Yasmina sie mit der vertraulichen Anrede bedachte, die unter Gildenmagiern üblich war. Zwar stand ihr diese Anrede durchaus zu, immerhin war sie schon seit zwei Jahren keine Studiosa mehr, sondern eine Adepta, eine Magierin mit abgeschlossener Ausbildung, aber in Anwesenheit der Akademieleiterin kam es Cairbre nicht selbstverständlich vor. Gerade in Cairbres ersten Jahren an der Akademie von Licht und Dunkelheit war sie es eher gewohnt gewesen, von Yasmina mit einem strengen Blick bedacht zu werden und die Aufforderung »Arnstätter! Ihr meldet Euch nach dem Unterricht in meiner Studierstube!« zu hören. Doch diese Zeiten waren lange vorbei, und Cairbre war der älteren Magierin heute dankbar dafür, dass diese sie immer so hart geprüft hatte. Auch wenn dies früher lange Stunden des Nachsitzens bedeutet hatte. Es hatte lange gedauert, bis Cairbre angefangen hatte, ihre Studien ernst zu nehmen und das rebellische Mädchen, das ihre Eltern vor elf Jahren an der Akademie abgegeben hatten, hinter sich zu lassen.
Als beide Frauen dann einen vollen Becher mit Apfelwein vor sich stehen hatten, forderte Yasmina die Jüngere auf, ihr Anliegen vorzubringen.
Cairbre zog es immer vor, gleich zum Punkt zu kommen: »Ich habe beschlossen, die Akademie zu verlassen.«
Yasminas Lächeln schwand. Cairbre sah die Enttäuschung auf dem Gesicht der Älteren. »Wisst Ihr bereits, an welche Akademie Ihr Euch begeben werdet, um Eure Studien fortzuführen?«, erkundigte sich Yasmina schließlich.
Cairbre verstand. Es geschah sicher oft, dass junge Adepten, die nach Abschluss ihrer Ausbildung noch für einige Jahre der Studien in Nostria blieben, schließlich doch in die Welt hinauszogen. Die Akademie besaß zwar einen guten Ruf in der Weißen Gilde und ihre Abgänger galten als hervorragende Verwandlungsmagier, die Mittel waren aber aufgrund notorischer Geldknappheit begrenzt, und andere Bibliotheken waren besser gefüllt.
Sie schüttelte den Kopf. »Das ist es nicht. Ich möchte meine Familie besuchen. Deshalb wäre es besser, wenn Ihr Ersatz für mich findet. Ich weiß nicht, ob und wann ich nach Nostria zurückkehren werde.«
Cairbre sah, dass Yasmina zögerte. Die Adepta hatte von der Akademieleiterin nach Abschluss ihres Studiums vor drei Jahren das Angebot erhalten, den Posten ihrer Schreiberin und Sekretärin zu übernehmen. Sie hatte dankend angenommen, auch wenn Cairbre überrascht gewesen war, dass Yasmina sie für diese verantwortungsvolle Aufgabe in Betracht zog.
Doch in all diesen Jahren war Cairbres Familie nie ein Gesprächsthema zwischen den beiden gewesen. Sie hatte den ohnehin seltenen Ausgang nur gelegentlich dazu genutzt, um ihre Familie zu besuchen. Viele andere Schüler dagegen nahmen mitunter weitere Reisen auf sich, um ihre freie Zeit mit ihren Verwandten zu verbringen. Cairbre zog es vor, in Nostria zu bleiben, sie fühlte sich nach all den Jahren an der Akademie sehr viel heimischer und brachte den Magistern und dem Akademiepersonal – und unter ihnen vor allem Yasmina – inzwischen weitaus familiärere Gefühle entgegen als ihren Eltern oder ihrer Schwester.
Dass sie nun so plötzlich beschlossen hatte, zurück nach Havena zu gehen, musste Yasmina deshalb überrascht haben.
»Ich glaube, es wird Zeit«, erklärte Cairbre. »Ich habe sie seit Jahren nicht mehr gesehen.« Es gelang ihr dabei nicht ganz, die Zweifel aus ihrer Stimme zu verbannen, obschon sie sich alle Mühe gab.
»In Eurer Heimatstadt ist zaubermächtiges Volk nicht gern gesehen«, warf Yasmina ein. »Und ich würde nur ungern eine so hervorragende Schreiberin und äußerst talentierte Collega verlieren.«
Cairbre lächelte über das Lob und über Yasminas halbherzigen Versuch, sie umzustimmen, schwieg dazu aber.
»Wusstet Ihr eigentlich, dass ich einen jüngeren Bruder habe?«, fragte sie stattdessen.
Yasmina schüttelte den Kopf. Sie hatte es natürlich nicht gewusst; Cairbre hatte bislang ja auch nie ein Wort über ihn verloren.
»Er heißt Faeruin. Er zählt gerade einmal acht Götterläufe. Ich kenne ihn eigentlich gar nicht. Vor fünf Jahren habe ich ihn das erste und auch letzte Mal gesehen. Ich würde ihn gerne wiedersehen und … noch andere Dinge regeln.«
Yasmina stellte ihren Becher wieder ab und seufzte tief. Cairbre merkte, dass die Akademieleiterin ihr Bedauern nicht zur Gänze aus ihrer Stimme zu verdrängen vermochte. »Nun gut. Euer Entschluss scheint festzustehen. Und – Hesinde ist meine Zeugin – wenn Cairbre Arnstätter sich erst einmal etwas in den Kopf gesetzt hat, dann wird sie niemand mehr davon abbringen. Wenn ich in den letzten Jahren etwas gelernt habe, dann dies.« Yasmina zwinkerte der Adepta aufmunternd zu. »Bevor Ihr geht, werdet Ihr Euch aber noch ein ausgezeichnetes Belobigungsschreiben von mir ausstellen lassen. Damit solltet Ihr an jeder Akademie der Weißen Gilde eine gute Anstellung finden. Und natürlich seid Ihr in Nostria auch in Zukunft jederzeit wieder willkommen, solltet Ihr Euch dazu entschließen, zurückzukehren.« Yasmina lächelte. »Und ich hoffe, dass Ihr mir zumindest schreibt und mich bisweilen vielleicht sogar besuchen kommt und erzählt, wie es Euch ergangen ist.«
Cairbre dankte Yasmina und versprach ihr, in Kontakt zu bleiben. Tatsächlich war es vor allem die Akademieleiterin, die ihr den Entschluss schwer gemacht hatte, Nostria zu verlassen. Sie wünschte sich fast, dass ihre eigene Mutter mehr wie Yasmina sein könnte.
Kurz überlegte Cairbre, ob sie sich der Magierin mit ihren Sorgen anvertrauen sollte, entschied sich jedoch dagegen und verabschiedete sich lieber rasch. Sie war es nicht gewohnt, über ihre Gefühle zu sprechen und sich anderen zu öffnen. Und das galt selbst für Yasmina, die sie auf den Weg der Vernunft gebracht und der sie so viel zu verdanken hatte. Doch Cairbres Entschluss stand fest. Und entgegen dem, was sie Yasmina erzählt hatte, war ihr kleiner Bruder nicht der wichtigste Grund dafür, nach Havena zurückzukehren. Aus Yasminas zweifelndem Blick hatte Cairbre aber erahnen können, dass die Magierin wusste, was eigentlich hinter dem Entschluss ihrer Schreiberin stand, sie kannte Cairbre inzwischen gut genug: Die junge Adepta hatte sich nach langem Überlegen dazu durchgerungen, sich nicht mehr länger zu verstecken. Sie wollte sich endlich den Dämonen stellen, die zu Hause auf sie warteten.
Cairbre musste sich allerdings eingestehen, dass sie sich davor fürchtete, ihrer Familie wieder gegenüberzutreten – vor allem ihrer Schwester, deren Leben sie einst zerstört hatte, als sie beide noch Kinder waren.
4. Kapitel
13. Ingerimm 1028 BF
Havena / Unterfluren
Es missfiel Orlagan, dass die Arbeiter hinter seinem Rücken Scherze über ihn machten. Und mehr noch störte es ihn, untätig herumzustehen. Fast drei Jahrzehnte hatte er für Mialan und ihren Ehemann Scartho das Kontor geleitet. Doch nun, nachdem ihre Tochter das Geschäft so überraschend hatte übernehmen müssen, sehnte er sich nach den alten Zeiten zurück.
Im Kontor der Familie Vecushmar in der Havener Neustadt herrschte auch an diesem Morgen reger Betrieb. Die Arbeit hatte, wie immer, schon bei Sonnenaufgang begonnen, wenn die ersten Karren und Kutschen beladen wurden. Die hier verladenen Waren mussten noch vor dem Morgenhochwasser, und damit vor dem Auslaufen der schweren Handelsschiffe, zum Hafen geschafft werden. Das Kontorgebäude stand in Unterfluren, dem Hesinde-Tempel Havenas gleich gegenüber und nahe der Garethstraße. Waren, die vom Hafen kommend hier eingelagert wurden, verließen schon bald auf Ochsenkarren die Stadt und wurden ins gesamte Königreich geliefert. Umgekehrt hatte man es auch vom Garether Tor nicht weit, wenn albernische Waren eintrafen. Diese wurden meist ebenfalls nur wenige Tage im Kontor gelagert, ehe sie schließlich weiterversendet wurden.
Das Geschäft war schon seit Generationen in Familienbesitz, doch erst Mialan ni Vecushmar, jene Frau, die Orlagan so sehr geschätzt hatte, hatte es zu dem gemacht, was es heute war. Sie hatte das Handelshaus mit Härte, Fleiß sowie untrüglichem Gespür für das Geschäft so weit aufgebaut, dass das Kontor mit den anderen Handelshäusern der Stadt mithalten konnte. Mialan war eine geachtete Frau gewesen, sie hatte sich sogar einen Sitz im Ältestenrat, dem bürgerlichen Rat der Stadt Havena, erarbeitet, wo ihre Stimme großes Gewicht gehabt hatte. Ihre Geschäftspartner wussten zwar, dass Mialan in geschäftlichen Dingen keine Freundschaften und nur selten persönliche Sympathien kannte, schätzten aber auch die zupackende und ehrliche Art der Kaufherrin, die aus einem kleinen Kontor ein florierendes Unternehmen gemacht hatte.
Doch diese Zeiten schienen unwiederbringlich vorbei. Zwar waren auch heute Morgen dutzende Arbeiter damit beschäftigt, schwere, in wasserdichte Stoffe verpackte Tuchballen zu verladen, Kisten mit Lederhäuten heranzuschleppen und Fässer mit Leinöl aus dem Lager zu rollen. Doch schon längst stapelten sich die Waren in der großen Lagerhalle der Vecushmars nicht mehr bis unter die Decke, und es war bereits Jahre her, dass eine Kutsche hatte warten müssen, weil die Arbeiter mit dem Verladen nicht mehr nachkamen.
Wie ihre Mutter trug auch Vilai den Namenszusatz ni, den in Albernia nur manche Adlige oder sehr alte und hochgestellte Familien trugen und der auf einen berühmten Vorfahren verwies. Und sie war eine Frühaufsteherin. Selbst Orlagan, der stolz auf sein Pflichtbewusstsein war, erschien später zur Arbeit. Wenn dann die Arbeiter eintrafen, war Vilai schon bereit und stand mit einer Ladeliste vor den gestapelten Kisten.
Vilai war, wie an jedem Morgen, auch heute damit beschäftigt, die Arbeiter und das Verladen der Waren zu beaufsichtigen. Auf diese Tätigkeit hatte nicht einmal ihre Mutter vor ihrem plötzlichen Dahinscheiden Wert gelegt und sie stets ihrem Kontorleiter überlassen. Orlagan stand auch heute immer zwei Schritte hinter seiner Arbeitgeberin und konnte nicht mehr tun, als auf Anweisungen von ihr zu warten, anstatt diese selbst zu erteilen.
Die Arbeiter, darunter viele Tagelöhner, die gerne für die Vecushmars tätig waren, weil hier gut und pünktlich gezahlt wurde, scherten sich wenig darum, wer ihnen denn nun die Anweisungen gab.
Gerade blickte Vilai von der Liste in ihrer Hand auf und reichte sie dann zurück an Orlagan, jedoch ohne ihn dabei auch nur anzuschauen. »Die Lieferung von Sindelfing ist spät dran«, erklärte sie in jenem ruhigen Tonfall, den er inzwischen viel zu gut kannte. »Wir sollten zunächst die Segeltuche für die Gerstendieks fertigmachen. Die Waren für Albhion verladen wir dann, wenn Sindelfing seine Wolltücher heranschafft.«
Orlagan bemühte sich, nicht belehrend zu klingen. Doch seine jahrzehntelange Erfahrung sagte ihm sofort, dass Vilais Entscheidung ein Fehler war. »Wir haben noch sechs Ballen Wolltuch im Vorrat. Bis diese verladen sind, wird sicher auch Sindelfing seine Lieferung geschickt haben. Dann komplettieren wir die Lieferung, und sie kann sofort los. Sobald wir andere vorziehen, kommt es zu Verspätungen.«
Vilai sprach weiter, als hätte sie ihren Kontorleiter gar nicht gehört: »Bis Sindelfings Kutschen hier sind, haben wir die Lieferung für Gerstendiek schon verladen. Dann können wir direkt von Sindelfings Wagen die Waren für Marcian Albhion verladen.«
Orlagan verzichtete auf weiteren Widerspruch, auch wenn es ihm nicht behagte. Solche Unterhaltungen hatten sie schon oft geführt. Anfangs, nur kurz nach dem Tod ihrer Eltern, hatte Orlagan gedacht, dass Vilai wegen des schmerzlichen Verlusts keinen Wert auf seinen Rat legte. Oder aber dass sie sich verzweifelt darum bemühte, das Geschäft auf ihre eigene Weise zu führen und sich von ihrer Mutter zu distanzieren; dass sie versuchte zu zeigen, dass sie alleine zurechtkommen würde. Und so hatte er behutsam versucht, Vilai seinen Rat anzubieten. Immerhin lag auch ihm sehr viel an dem Kontor, und Vilais Mutter Mialan war sicherlich die tüchtigste und bewundernswerteste Frau gewesen, die er jemals kennengelernt hatte. Mialan hatte ihm eine Chance gegeben, sich im Kontor zu beweisen, als er nur ein einfacher kleiner Schreiber unter vielen war. Und nur wenige Jahre später hatte er schon die Geschäfte geführt. Orlagan hatte es seiner Arbeitgeberin stets mit Fleiß und großem persönlichem Einsatz gedankt, und Mialan hatte sein Engagement immer zu schätzen gewusst.
Doch inzwischen war ihm klar geworden, dass es keinen Sinn hatte, Mialans Tochter Ratschläge zu erteilen. Und so befolgte Orlagan auch jetzt ihre Anweisungen ohne Widerworte. Dabei war ihm klar, dass in weniger als einer Stunde ein Schreiber der Albhions auftauchen würde, um nach der zugesagten Lieferung zu fragen. Und wenn sie großes Pech hatten, dann würde Marcian Albhion, der zwar nicht an den Königshof lieferte, bei dem jedoch der halbe Ältestenrat Kunde war, dieses Mal selbst im Kontor erscheinen. Und wie Orlagan den jähzornigen Tuchhändler kannte, würde es kein schönes Gespräch werden. Marcian würde Vilai mit hochrotem Kopf vor allen Arbeitern und Schreibern anbrüllen, während sich Vilai in Ausreden flüchtete. Wahrscheinlich würde Marcian die Geschäftsbeziehungen mit den Vecushmars auf der Stelle aufkündigen und sich in Zukunft von Crayenried beliefern lassen.
So in etwa war es jedenfalls erst vor drei Wochen mit dem Tuchhandel Redenwald passiert. Und Selinde Redenwald war immerhin noch eine alte Freundin von Mialan gewesen. Wie so viele hatte sie in den letzten Monaten über verspätete oder unvollständige Lieferungen des Kontors hinweggesehen, weil sie annahm, dass Vilai, die so überraschend das Erbe ihrer Mutter hatte antreten müssen, sich zunächst einmal in ihrer neuen Rolle zurechtfinden musste. Doch irgendwann hatte der schon geradezu sprichwörtliche Geschäftssinn der Havener Kaufherren vor alten freundschaftlichen Verbundenheiten Vorrang gewonnen. Erst recht jetzt, wo die Geschäfte aufgrund der Unabhängigkeit und des Kriegs im Osten des Landes schlechter liefen als je zuvor.
Orlagan nahm die Versandliste von Vilai entgegen, die nun die Arbeiter beobachtete. Wie sie so dastand, erinnerte die junge Frau ihn bisweilen an Mialan: Vilai hatte dieselben langen braunen Haare wie ihre Mutter, denselben stolzen Zug um ihren Mund. Nur die dunkelblauen Augen, deren eindringlichem Blick er selten standhalten konnte, störten das Bild. Vilai war hübsch, gutaussehend sogar, doch die einfache kaufmännische Kleidung, die sie bevorzugt trug, und der allerhöchstens geringe Aufwand, den sie betrieb, um ihr Aussehen zu unterstreichen, ließen diesen Eindruck schnell verblassen. Ihr Haar trug sie im Gegensatz zu ihrer Mutter zurückgebunden. Und wo Mialan ni Vecushmar bei aller Strenge und Härte immer ein aufmunterndes Wort für ihre Untergebenen hatte, da schwieg Vilai.
Nun fiel Orlagan eine blonde Frau ins Auge, die sich einen Weg durch die Warenpakete und Karren in der großen Lagerhalle bahnte. Er erkannte sie sogleich: Fiacha Gredero stand schon seit Jahren in Diensten der Familie Vecushmar, ebenso wie früher ihre Mutter und ihr Onkel. Fiacha war eine junge und zweifelsohne sehr begabte Schiffskapitänin, die aus einer alteingesessenen und sehr angesehenen Havener Seefahrerfamilie stammte. Die Vecushmars handelten bis Thorwal im Norden und Bethana im Süden, und Fiacha war diese Routen für das Kontor bereits Dutzende Male gefahren.
Fiacha trug auch an diesem Morgen eine blaue Jacke, die sie als Seeoffizierin auswies, die kurzen blonden Haare nach hinten gekämmt. Ihr schmales Gesicht war sonnengebräunt, der Blick fest. Wie immer versuchte Fiacha, älter zu erscheinen als sie tatsächlich war, nur zu oft wurde die Kompetenz der jungen Frau als Schiffsführerin angezweifelt. Orlagan wusste es besser – Fiacha führte ihr Schiff stets so sicher wie Kapitän Havena persönlich. Er war dankbar, dass Frauen wie Kapitänin Gredero weiter bereit waren, für das Kontor zu segeln. Tatsächlich war sie einen Tag früher hier als angenommen – eine gute Nachricht nach all den Verzögerungen und Lieferschwierigkeiten, mit denen sich Orlagan in den letzten Monaten hatte herumschlagen müssen.
Vilai begegnete der Kapitänin mit einem warmen Lächeln. »Efferd zum Gruße. Es ist schön, Euch zu sehen, Fiacha.«
Fiacha erwiderte das Lächeln und ergriff die ihr dargebotene Hand. »Ich freue mich auch, Euch wiederzusehen, Vilai.«
Orlagan trat hinzu und grüßte Fiacha ebenfalls. »Efferd zum Gruße, Kapitänin. Die Winde waren Euch gewogen, nehme ich an? Ihr seid früh dran.«
Fiacha wandte sich von Vilai ab. »Ganz recht. Das Schiff wird bereits entladen, und die Waren sollten bald hier eintreffen.«
»Ausgezeichnet. Und werdet Ihr bald wieder aufbrechen?«
»Nicht so bald, nein.« Fiachas Blick wanderte von Orlagan zu Vilai, die ruhig den Dialog der beiden verfolgte. »Das gibt mir Zeit, in der Stadt einige wichtige Angelegenheiten zu regeln.«
Orlagan nickte, dann ließ er die beiden Frauen stehen und machte sich auf den Weg zu der Stube, wo die Schreiber des Kontors die Versandlisten führten. Während er die Listen für die Lieferung zusammensuchte, die die Familie Gerstendiek in Auftrag gegeben hatte, musste er daran denken, dass früher er es gewesen war, der Schreiber anwies, ihm Dokumente zu bringen. Nun erledigte er Arbeiten, die ungelernten Kontorhelfern wesentlich besser zu Gesicht stehen würden.
Doch das alles würde schon bald vorbei sein. Er musste nur noch wenige Tage ausharren und solange noch seinen Unmut vor Vilai verbergen. Auf keinen Fall durfte sie jetzt schon herausfinden, was hinter ihrem Rücken vorging.