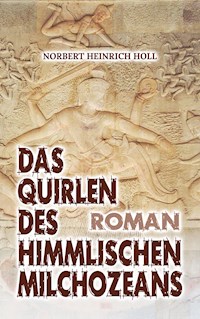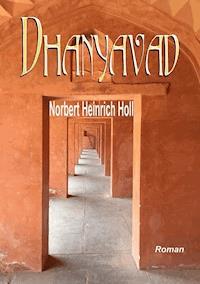Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn die Vergangenheit die Gegenwart beeinflusst: Maxim trifft nach 20 Jahren in Paris seine Freundin aus Studentenzeiten und ist bereit, für die neu entflammte Liebe seine Ehe, seine Kinder und sein bisheriges Leben aufzugeben. Da zeigt ihm Marylène Briefe, die sie bei den Unterlagen ihrer verstorbenen Mutter gefunden hat, und will mit ihm das Rätsel ihres eigenen Daseins lösen. Maxim taucht tief in die Vergangenheit seiner Geliebten ein, nicht ahnend, dass sich Geschichte wiederholen kann. Nichts ist, wie es scheint. Oder scheint es nur so? Norbert Heinrich Holl hat mit »Du und die polnischen Briefe« einen Roman geschaffen, der nicht nur seinen Helden auf eine harte Probe stellt. Er schickt auch den Leser immer wieder auf falsche Fährten und lässt ihn dort genüsslich ins Leere laufen, bis unerwartete Wendungen schließlich zu einem überraschenden Ende führen. »Du und die polnische Briefe« ist eine Erzählung vom allgegenwärtigen Zweifel und seiner Überwindung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
I
»Es ist doch …« Ihre Stimme schrillte etwas unangenehm. Sie klang wie eine zu straff gespannte Violinsaite. Marylène stockte. Sie schwieg und kratzte sich unschlüssig am Kinn. Ihre Nasenflügel zitterten. Sie setzte wieder zum Sprechen an.
»Es ist doch unsere Stunde, unsere Stunde Null. Hier und heute fängt alles an. Alles andere ist verlogen und nichts als Täuschung.« Geschmeidig wie eine Katze sprang sie zum Fenster, riss es auf und spitzte die Lippen, als wolle sie den Augusttag küssen. Dann spuckte sie ihre Stunde Null wie einen Kirschkern auf die Straße. Ich blieb auf der Ledercouch sitzen und umrundete mit dem Blick verliebt ihre Hüfte, die schmal war wie eine Sanduhr, und ihren Po, der sich wie der Körper einer Bassgeige nach unten weitete. Sie hatte mir stolz berichtet, dass sie zweimal die Woche ein Aerobicstudio besuche und kein überschüssiges Gramm Fett an den Hüften habe. Bis vor zehn Minuten hatten wir splitternackt in meinem breiten Ehebett gelegen und uns selbstvergessen der Lust hingegeben.
Nicht einmal war mir der Gedanke gekommen, dass uns jemand von Haus gegenüber beobachten könnte. Dabei lag unser Schlafzimmer zur Straße hin und hatte große Fenster. Ich hatte die Rollläden nicht heruntergelassen, das wäre meiner Geliebten spießig und verklemmt erschienen. Sogar die blicksicheren Vorhänge waren offengeblieben. Jemand, der auf der anderen Straßenseite wohnte, vielleicht ein Stockwerk oder eine Fensterreihe höher, hätte mit einem Fernglas interessante Beobachtungen anstellen können. Ich hatte mir nie Gedanken gemacht, ob man von der anderen Seite ein freies Blickfeld durch das Blattwerk der Platanen hätte, die vor dem Haus standen, und jetzt, als ich genauer hinsah, wurde mir klar, dass zwischen den Bäumen eine Lücke klaffte, die genau auf meine Wohnung zielte.
Mir und erst recht Marylène war es gleichgültig, ob die Äste einander überschnitten oder ein Loch übrig ließen. Doch plötzlich war ein Regenschauer über das Stadtviertel gebraust und hatte uns auf dem Bett so hastig auseinander gescheucht, als habe jemand an die Schlafzimmertür geklopft. Wieder hatte ich bemerkt, wie rasch und übergangslos ihre Stimmungen wechselten, einmal eine leidenschaftliche Hingabe, dann eine verstörende Verschlossenheit, mal eine kindliche Offenheit, mal eine Zurückhaltung, die ich fast als Zurückweisung empfand. Immer war eine Unausgewogenheit im Hintergrund ihres Wesens spürbar, deren Ursache ich herausfinden musste. Oder sollte ich es dabei belassen? Sollte etwas Verschlossenes für ewig verschlossen bleiben? Rätsel, die man am Wegrand auflas, sollte man nicht wie reife Nüsse knacken.
Genau so hatte Marylène es gesagt, auch im zweiten Anlauf. ›Die Stunde Null!‹ – sie sagte es mit fester Stimme, wandte sich zu mir um, noch immer nackt, und sah mir herausfordernd ins Gesicht. Sie hatte ein seltsames Leuchten in den Augen. Gab es so etwas wie brennendes Kristall? Mir kam ein romantischer Gedanke. Vielleicht sah so die Frau aus, mit der Flagge in der rechten Hand und dem Bajonett in der linken, die ein berühmter Maler als Verkörperung der Freiheit dargestellt hatte. Irgendwo in irgendeinem Museum hatte ich das Gemälde gesehen. Franzosen hatten es andächtig bestaunt. Bestimmt hatten die Augen seines Modells heller geleuchtet als die einer Frau, die auf dem Wochenmarkt Schnittblumen verkaufte. Allerdings schaute sie, wenn mich das Gedächtnis nicht trog, auf dem Gemälde über ihre Schulter zur Seite, so dass man, wenn man das Bild betrachtete, ihr nicht in die Augen sah. Ich zog meine nackte Geliebte vom Fenster fort. So gern ich mich an ihrem Anblick weidete, wollte ich in unserer ruhigen Wohnstraße doch Aufsehen vermeiden,
Derart feierliche Worte – ›Stunde Null‹, ›der Anfang von Allem‹, ›Alpha und das Omega‹ und dergleichen gab es eigentlich nur in Büchern oder auf dem Fernsehschirm. Vielleicht hatte Marylène sie dort aufgeschnappt und glaubte, mich damit zu beeindrucken. Aber an mir glitt ihre Beschwörung ab. Meistens ging es in den Büchern und Filmen um Abenteuer, die zu bestehen jedes Menschen Kräfte überstieg, es ging um das Ende des Römischen Reiches oder den Untergang des Universums oder eine häusliche Tragödie, bei der im Übermaß die Tränen flossen. An allen Übertreibungen lag mir nichts. Es ging mir gut, ich fühlte mich prächtig, ich genoss den Tag.
Affektiert hatte meine Geliebte eigentlich nicht gewirkt, dachte ich versöhnlich. Auch wenn sie in ihrer Ausdrucksweise manchmal pathetisch wirkte, mochte sie unter einem Gesichtspunkt, der mir entging, recht haben. Die Zirkularimpulse weiblicher Fantasie umkreisten wahrscheinlich den Mond und ferne Galaxien. So ließ ich Marylène schreien und spucken und widersprach ihr nicht. Zudem sah sie in ihrer Nacktheit so aufregend aus und lächelte so hübsch und schelmisch, wie ich es noch nie an einer anderen Frau beobachtet hatte.
Inzwischen saß sie neben mir auf der Ledercouch, entspannt, dem Tag und allem Geschäftigen enthoben. Das Zeitgefühl schien ihr abhanden gekommen. Sähe jemand tatsächlich von gegenüber zu uns hinüber, hielte er sie für eine attraktive Frau und mich für einen Allerweltstypen. Wir gingen beide auf die Vierzig zu, ich war näher dran als sie. Den Fernseher hatten wir ausgeschaltet. Die Mittagsnachrichten waren vorbei. Keine Schlagzeile hatte sich mir eingeprägt. Ich lebte außerhalb der Aktualität. Der Fluss hätte über die Ufer treten und die Rue Wilhem überschwemmen können, ich hätte es nicht gemerkt. Ich war in eine ruhige Wohnstraße gezogen. Die vielen Platanen mit ihrer fleckigen Rinde hatten Angelika, meine Frau, verzaubert, obwohl der Wohnblock, auf dessen zweiter Etage wir uns einrichteten, kühl und geschäftsmäßig aussah. Platanen schuppten Erlebniszeit ab, hatte sie gemeint, Sommermonate, Winterstürme. Fast wie eine Wetteruhr.
Statt das Fernsehprogramm wieder einzuschalten, wo um diese Zeit eine Talkshow lief, betrachtete ich Marylènes rosa lackierte Nägel und die weißen Spargelfinger, die mit weich gezogenen Umrissen auf ihren Knien lagen. Eigentlich rotierten Fragen in meinem Kopf wie mächtige Schwungräder. Meinte sie etwas Bestimmtes, wenn sie von der Stunde Null sprach? Ich hatte keine Ahnung, was sie mir damit sagen wollte. Wie in einem gedankenlosen Reflex blickte ich auf die Uhr. Es war ziemlich genau zwölf, das Gegenteil von Null.
Für einen Moment schien das Schwungrad in meinem Kopf still zu stehen. Ich blickte nicht auf die Platanen, dachte nicht an Angelika, sah nur die wiedergefundene Geliebte vor mir, sah sie erwartungsvoll an, erhoffte mir alles Unaussprechliche von ihr. Ich spürte, sie hatte etwas vor mit mir. Wenn sie so dramatisch begann, musste es mit einem Höhepunkt enden.
Stunde Null!
Spannender ging’s nicht.
Marylène und ich brauchten uns nicht zu belügen. Wir hatten es nicht nötig, uns etwas vorzumachen. Wenn wir uns aneinander satt liebten, so war es uns gleichgültig, dass wir im gegenseitigen Einvernehmen Ehebruch begingen. Vielleicht waren wir beide der Illusion verfallen, man könne die Zeit um zwanzig Jahre zurückdrehen. Wenn ich sie betrachtete, schien sie kaum verändert, sah kein bisschen älter aus als damals, und sogar das winzige Muttermal, nicht größer als eine verirrte Sommersprosse, neben dem Nasenflügel war mir vertraut. Schon damals, als ich sie an einem Januarmorgen getroffen hatte, eine zarthäutige, winterbleiche Studentin auf dem Bahnsteig einer Metrostation, hätte ich am liebsten den Schönheitsfleck verstohlen mit der Zunge berührt.
Als ich sie zwanzig Jahre später im Park wiedergesehen und mich heimlich mit ihr verabredet hatte, war anfangs ein Café an der Metrostation Argentine, wo niemand uns kannte, unser Treffpunkt gewesen. Die Unterhaltung war sehr bemüht und hatte sich schleppend hingezogen, als warte jeder von uns darauf, dass der andere mit einem ersten Zug das Schachspiel eröffnete. Beide rechneten wir mit einer entscheidenden Veränderung. Redepausen füllten sich mit vielsagendem Schweigen, stummen Handbewegungen, ins Leere gleitenden Blicken. Als wir uns plötzlich fest in die Augen sahen, erschien uns die baldige Aufnahme sexueller Beziehungen ebenso folgerichtig, wie zwei Menschen, die sich nie begegnet sind, bei strömendem Regen gemeinsam unter das Schutzdach einer Bushaltestelle flüchten. Die ersten Male trug sie eine übergroße Sonnenbrille à la Audrey Hepburn. Dafür gab es den triftigen Grund, dass sie auch in der Nachbarschaft der Metrostation eine Zufallsentdeckung fürchtete. Später nahm sie die Brille allerdings wieder ab und nannte mir den triftigen Grund, dass ihr die Augen weh taten vor Anstrengung, den Weg durch geschwärzte Brillengläser in mein Gesicht zu finden. Der Mann meiner Geliebten war zudem Augenarzt. Sie bezeichnete ihn als unauffällige Existenz mit geregeltem Einkommen, der ihr eine kleine Wohnung im begehrten sechzehnten Arrondissement bieten konnte. Wenn man in Paris leben durfte, so dachten die meisten Franzosen, dann hatte man es geschafft, und unter den zwanzig Stadtbezirken galt der sechzehnte als der angesehenste.
Sie wäre wunschlos glücklich gewesen, hätten nicht die Kinder gefehlt. Auch das hatte sie mir schon beim ersten Treffen erzählt, mir allerdings den Grund der Kinderlosigkeit verschwiegen. Nicht, dass mich ihr häuslicher Kummer besonders interessiert hätte. Im Gegenteil: Reflexartig hatte ich das Bild der drei gesunden Sprösslinge eingeblendet, die Angelika und mir geschenkt worden waren: ein pubertierender Junge, der über die Stränge zu schlagen begann, und zwei kleine Mädchen, die mir zwar ständig, wenn ich im Fernsehen die Spiele der Champions League verfolgte, die Ohren voll kreischten, sonst aber noch gehorsam waren. Jetzt saß also eine Kinderlose neben mir auf der Ledercouch, kuschelte sich an mich und knabberte mir am Ohr. Ich dachte zwar an meine drei Kinder, umarmte aber nicht sie, sondern meine wiedergefundene Geliebte, legte ihr meine Hand auf ihre Brust, und kurz darauf ging mir schon durch den Kopf, dass ich Marylène wahrscheinlich länger kannte als Bernard, ihr eigener Ehemann.
»Stunde Null.« Sie lachte, diesmal klang es verlegen. Ihre Knie waren spitz, aber sie lagen nicht bloß. Sie trug selten ein Kleid oder einen Rock, sondern meistens enge Jeans. Daher sah man die Knie nicht. Es war still um uns. Kein Hupen, kein Schreien drang von der Straße zu uns herein. Ich blickte auf ihre Füße. Sie trug Riemchensandalen mit Absätzen. Rot gefärbtes Leder, aus Italien, hatte sie mir erzählt. Seltsamerweise hatte sie die Sandalen im Bett anbehalten. Die Unterwäsche lag unordentlich über den Fußboden verstreut. Die kirschrote Leinenjacke hatte sie sorgfältig über die Stuhllehne gehängt. Ein starkes, ungewohntes Rot, das ich auf die Entfernung erkannte. Ein fruchtiges Rot, das mir beschied: In deinem Kopf setze ich mich fest.
Am Schnurren des Räderwerks und am Stillstand der Uhrmechanik konnte ein feines Ohr erraten, dass der silberne Glockenschlag folgen musste. Ich hob den Kopf und lauschte zum Sims hinüber, wo die Kaminuhr stand. Wenn das Wunder einträte und der Schlag ausbliebe, nahm ich mir vor, würde ich Marylènes Hand ergreifen, ihre Innenform nach oben drehen und ihre Fingerkuppen küssen. Dem heutigen, unserem ersten Treffen seit Angelikas Abreise sollte ein glückverheißendes Zeichen in unsere Zukunft deuten und nicht das Signal eines Unheils. Auf dem Kaminsims blieb es still. Auch ich regte mich nicht. Plötzlich musste ich an meine Kinder denken. Ihnen verdankte ich meine Geliebte.
»Bald ist das hier vorbei«, sagte Marylène.
»Was ist vorbei?« Ich wurde unruhig.
»Die Stunde Null. Dann sind wir bei Stunde eins und dann zwei. Und das geht immer weiter.« Sie lächelte vorwurfsvoll, weil ich sie nicht sofort verstand, und verdrehte ihre Füße, um die Sandalen von der Seite zu begutachten. Vielleicht würde sie mir den Rest ihrer Offenbarung später enthüllen.
Das stimmte doch nicht, dachte ich, oder setzte vielmehr dazu an, schaffte es aber nicht, weil mir zu viel im Kopf herumschwirrte. Ich versuchte, meine Logik auf die Reihe zu bekommen. Gewiss war es nicht unsere Stunde Null. Denn Marylène und ich kannten uns seit zwanzig Jahren. Da war es immerhin verständlich, dass ich mit dem Begriff nichts anfangen konnte. Vier Wochen war es her, seit wir uns wiederbegegnet waren. Da war es entschuldbar, wenn ich mit dem Wort im Dunkeln tappte. Dann sagte ich mir, sie wolle wissen, was ich von ihrem Problem hielt.
Natürlich ging es ihr nicht um die Kinderlosigkeit, sondern, wie von Anfang an befürchtet, um das Bündel Briefe, das sie mitgebracht und vorhin aus ihrer Handtasche gezogen hatte, deren Leder das gleiche, im Farbton abgestimmte Rot aufwies wie die Riemensandalen. Die verfluchten Briefe, dachte ich. Ja, ich hatte sie gerochen, sobald Marylène meine Wohnung betreten hatte. Ich besaß einen sechsten Sinn für altersmürbes Papier, für Zeugnisse aus gespenstischer Vergangenheit, mit der ich nichts zu tun haben wollte. Briefe erinnerten mich an Verwesungsprozesse, an tote Bruchstücke von Ereignissen, die sich im Gedächtnis längst aufgelöst hatten und durch einen Zufallsfund in einer Schublade, einem Pappkoffer oder zwischen verklebten Buchseiten aus dem Koma in ein künstliches Leben zurückgeholt wurden. Ich brauchte sie nur in die Hand zu nehmen, so spürte ich in den Fingern ein Kribbeln, als litte ich an einem Ekzem. Ich hatte einen Hautarzt konsultiert und ihm von meiner krankhaften Abscheu vor gelbem Schreibpapier berichtet. Er hatte das Phänomen als ›pathologische Inkompatibilität‹ bezeichnet, was wahrscheinlich auf das gleiche hinauslief, und mich mit gönnerhaftem Lächeln entlassen. Vielleicht solle ich besser den Kollegen von der Psychiatrie aufsuchen, riet er mir noch an der Tür und legte väterlich die Hand auf meine Schulter.
Natürlich wusste Marylène nichts von meiner Inkompatibilität. Sie sah in den alten Blättern ein Amulett gegen das Vergessen von Ereignissen, an die sich niemand mehr erinnerte. Aber ich erinnerte mich umso deutlicher an die Atembeklemmung, die Ohnmacht, die Nähe des Todes, in die mich Briefe gebracht hatten. Es verging kein Tag, keine Stunde, ohne dass die Erinnerung mich wie ein Alptraum überschattete. Ich brauchte nur das harmlose, dieses für viele Menschen noch immer liebenswerte Wort zu hören: Brief – und mein Puls begann zu rasen, als sei ich zum Tode verurteilt.
Was erwartete Marylène von mir? Wollte sie mir den vergilbten Kram so tief in den Rachen stoßen, dass ich daran erstickte? Sollte ich ihr die Briefe abnehmen und mir die Augen an unbekannten Schriftzügen wund lesen? Sie hatte aufgeregt und hastig gesprochen. Nichts war vom Klang in der Luft hängen geblieben. Ich schloss aus weiß Gott welchem Grund meine Augen, vielleicht war ich enttäuscht, weil ich sie gern wieder ins Bett gelotst hätte. In meinem Kopf flossen zu viele Gedanken zusammen. Ich war ins Grübeln versunken und sah und hörte nicht mal, was auf der Straße passierte, roch nur das Veilchenparfüm, das sie verströmte, während sie neben mir kauerte und auf meine Antwort wartete.
Wieder sprang sie auf, rannte zum Fenster, das offen stand, um einen Kirschkern auf die Straße zu spucken oder sich Luft zu verschaffen. Ich versuchte, sie festzuhalten und krallte meinen Mittelfinger ungeschickt in den Verschluss ihres Büstenhalters, so dass er beinahe zerriss. Marylène lachte. Mein Widerstand bereitete ihr Vergnügen, sie ließ sich mit glucksendem Lachen zurück auf die Ledercouch plumpsen.
»Nicht so eilig«, raunte ich ihr ins Ohr und schloss sie wieder in die Arme. Sie zerrte sich ungeduldig los. Der Spaß war vorbei. »Nun, wenn du unbedingt willst. Aber ein bisschen Tempo, wenn ich bitten darf! Ich habe nicht viel Zeit.« Marylène hatte die Muschel meines linkes Ohrs spielerisch nach vorn geklappt, damit mir kein Wort entginge. Sie übertrieb die Vorsicht und tat so geheimnisvoll, als belausche uns der Oberst durch die Wohnzimmertür. Diesmal brauchte sie den Namen nicht zu nennen. Ich wusste, von wem sie sprach, von Madame Blondin, ihrer Mutter, an die ich keine guten Erinnerungen bewahrte.
»Ich kann ihr nachempfinden«, fuhr Marylène fort, »dass sie die Briefe aufbewahrt hat. Jeder Mensch hängt an seiner Vergangenheit, und Frauen träumen sich noch inniger in sie hinein als Männer, weil oft die glücklichsten Jahre hinter ihnen liegen. Manchmal beneide ich meine Mutter, weil sie noch die Zeit erlebt hat, als sich die Leute Briefe schrieben, richtige Liebesbriefe. Ja, ich weiß, das klingt altmodisch im Zeitalter des Internet, des Handy, des iPad. Das geht heute hundert Mal fixer, und oft geht es mit vorformulierten Redewendungen, die man irgendwo abkupfert. Aber damals, vermutlich vor vierzig Jahren, scheint sie eine heimliche Liebesaffäre gehabt zu haben. Später hat sie die Briefe sorgfältig versteckt. Mein Vater durfte sie natürlich nicht finden. Aber sie wollte die kostbaren Briefe auch nicht einfach wegwerfen. Sie wollte sie nicht preisgeben. Eines Tages würde sie die Briefe wieder lesen und die schöne Zeit zurückholen, als sie die Briefe geschrieben hatte. Durch Zufall habe ich sie entdeckt, als ich nach ihrem Tod das Zimmer aufgeräumt habe. Sie steckten unter einem Stapel alter Kleider. Vielleicht hat sie die für die Emmaus-Brüder gesammelt oder den Müllcontainer.«
Wieder stiegen unangenehmen Erinnerungen in mir hoch. Vor zwanzig Jahren hatte Madame Blondin mich auf eine Weise gedemütigt und der Lächerlichkeit preisgegeben, die selbst heute noch ein wenig schmerzte, wenn ich die Erinnerungsnarbe berührte, und während die Stimme meiner Geliebten weiterklang und mir von Briefen erzählte, die mir eine starke Abneigung einflößten, musste ich mir geduldig anhören, dass sie von der Frau geschrieben waren, die mich aus der Wohnung gewiesen hatte.
Nur dunkel erinnerte ich mich an das Haus der Familie Blondin. Es hatte in einer der zwölf stattlichen Avenuen gelegen, die den Triumphbogen wie ein Strahlenkranz umgaben. Ich musste das Zählwerk der Jahre ein gutes Stück hochwinden, um zu dem bitter kalten Winter zurückzufinden, in dem ich mein Studium begann. Die Universitätsverwaltung residierte fürstlich in einem Barockgebäude vor dem Pantheon. Doch sie war in stickigen Kabuffs untergebracht, die früher als Toiletten und Garderoben gedient haben mochten. Dort standen in langen Warteschlangen die Studenten an, um die Einschreibegebühr zu bezahlen und den Ausweis zu erhalten, der preiswerte Mahlzeiten in der Studentenkantine gewährte. Die Vorlesungen fanden zwei Kilometer entfernt in einem Gebäude statt, wo eigentlich die Medizinstudenten zuhause waren, die ihren Vorlesungssaal jedoch vorübergehend an die Juristen abgetreten hatten. Das bisschen Taschengeld, die kärgliche Wegzehrung, mit der ich von Hause aus versorgt war, reichte kaum zum Leben. Selbst in der Studentenkantine konnte ich mir nur eine Mahlzeit am Tag leisten, weil ich jeden Franc, den ich mir am Munde absparte, in die Konzertsäle trug und mir die Mahler-Sinfonien anhörte, die gerade von der Event-Industrie wiederentdeckt worden waren.
Die Wohnung ihrer Eltern lag auf der zweiten Etage eines vom Alter geschwärzten Hauses in der Avenue Victor Hugo, die ein Stück weiter am Triumphbogen endete. Als Student durchquerte ich das mächtige Kutschertor, das von der Straße ins Treppenhaus führte, mit Ehrfurcht, um meine demnächst achtzehnjährige Studienfreundin, Tochter aus gutem Hause, zu einer Vorlesung abzuholen. Marylène führte mich lässig durch die Wohnung. Ich bewunderte den alten Wandteppich, dann stellten wir uns auf den Balkon, von dem man in einiger Entfernung eine Schmalseite des Triumphbogens sah. Schon damals liebte ich meine Kommilitonin heimlich und hätte die von röhrenden, hupenden, unter uns dahinkriechenden Autos verschmutzte Luft in alle Ewigkeit einatmen mögen, um Marylènes Nähe zu genießen. Doch Madame Blondin trat hinzu, um mich zu begrüßen. Die Hausherrin war eine schlanke, fast magersüchtige Erscheinung, die mir aus der Distanz liebenswürdig die Hand reichte, nach meinen Berufsplänen fragte und mit meinem Auftreten zufrieden schien. Eine gewisse Kühle und Zurückhaltung war allerdings bis zum Ende meines Besuchs spürbar. Dieser Eindruck blieb an mir hängen.
Mein zweiter Besuch fand einen Monat später statt und verlief sehr unglücklich. Schon als ich die gewundene Marmortreppe hinaufstieg, zitterten mir die Beine. Ich war auf einen Zusammenstoß gefasst. Denn inzwischen hatten die Blondins begriffen, dass ihre Tochter und mich mehr verband als eine platonische Studienfreundschaft. Die Aussprache mit der Hausherrin dauerte nach meiner Erinnerung knapp fünf Minuten, die wir, ohne uns die Hand zu reichen, vor dem Gobelin stehen blieben. Marylènes Vater hatte wie ein bleicher Schatten am Ende des Korridors gewartet und stumm zugehört.
Während ich Marylènes Hand streichelte und auf die Briefe starrte, kamen viele Einzelheiten zurück wie fahnenflüchtige Halunken, die sich mit hängenden Köpfen beim Kommandanten zur Truppe zurückmeldeten. Als ich vor neunzehn oder zwanzig Jahren die Treppe hinaufstieg, die den Aufzugkäfig wie eine Schleppe umwand, wollte ich mit der Frau sprechen, deren Briefe Marylène jetzt in der Hand hielt. Als mich das Dienstmädchen zu ihr führte und ich der in Eiseskälte erstarrten Madame Blondin die Hand geben wollte, war mir schwer vorstellbar, dass sie liebevoll ihre Tochter umarmen könne, wenn sie sich morgens am Frühstückstisch träfen. Ich empfand keinen Funken Warmherzigkeit, als sie mich mit wortlosem Kopfnicken begrüßte, und sobald ich, vor Aufregung ein wenig stotternd, mein Anliegen vorgebracht hatte, war sie einen Schritt zurückgetreten und hatte mich mit einer Kühle abgekanzelt, die mir kaum Luft zum Antworten, kaum zum Atmen ließ.
Gertenschlank und in seitlich ausgestellten Breeches war sie mir entgegengetreten, als treffe sie Vorbereitungen, um im nahe gelegenen Bois de Boulogne auszureiten und werde durch meinen Besuch an ihrem Vergnügen gehindert. Es war später Morgen, etwa elf Uhr. Zur gleichen Zeit schrieb Marylène im Amphitheater, dem halbkreisförmigen Vorlesungssaal mit seinen umlaufenden unbequemen Holzbänken und Klapppulten aus der Steinzeit, eine Klausur über römisches Recht, und der in Strenge ergraute Ordinarius, Professor Boulanger, gab sich kapriziös, wenn es um weibliche Studenten ging, die bei ihm von vorn herein in die Kategorie von Nervensägen eingeordnet wurden.
Von meinem Treffen mit ihrer Mutter hatte ich Marylène nichts erzählt. Sie wäre in Panik geraten, obwohl wir uns nichts hatten zuschulden kommen lassen. Wenn Madame Blondin bei meinem frostigen Gespräch überhaupt in einem Punkt einlenkte, war es nur, mir darin zuzustimmen, dass ihre Tochter von meinem Besuch nichts erfahren solle. Ein bitteres Lächeln war über ihr Gesicht gehuscht. Widerwillig hatte sie in mir einen Bittsteller mit halbwegs guter Erziehung erkennen müssen.
Bei dem Treffen hatte ich Madame Blondin um Erlaubnis bitten wollen, dass die achtzehnjährige Tochter, nein, diesbezüglich musste ich mich korrigieren, an dem Tag war sie noch siebzehn gewesen, aber ihr Geburtstag stand irgendwann bevor, zu einem Tanzabend der Jurastudenten mitzunehmen. Die Fête wurde im Club Royal organisiert, in einer Straße hinter dem Triumphbogen. Entgegen seinem anspruchsvollen Namen residierte der Club in einer Turnhalle, wo an anderen Abenden geboxt oder Tischtennis gespielt wurde.
In Marylènes Familie galt ein klösterlicher Verhaltenskodex. Zum Beispiel musste meine Freundin ihre Eltern mit einem altmodischen ›Sie‹ anreden und ihrem Großvater, der einmal monatlich zum Mittagessen kam, zur Begrüßung die Hand küssen, was in meinen Augen eine unglaubliche Demütigung meiner Freundin war. Um mich in den Club Royal zu begleiten, benötigte sie die Erlaubnis der Eltern. In meiner Überheblichkeit hatte ich die Erlaubnis für eine Formalität gehalten, doch Madame Blondin belehrte mich eines besseren. Sie war in ihrer Ablehnung unerbittlich. Sie könne dem Gedanken nichts abgewinnen, mir ihre Tochter für einen Tanzabend anzuvertrauen, der womöglich bis Mitternacht dauere, verkündete sie vor dem Wandteppich stehend. Die charakterliche Festigung ihrer Tochter dürfe nicht durch Ausgänge in mehr oder weniger unerprobter Begleitung gefährdet werden, obwohl sie – wie sie herablassend bemerkte – selbstverständlich nicht gegen Deutsche eingenommen sei. Im Gegenteil, sie sei überzeugt, fügte sie mit unüberhörbarem Sarkasmus hinzu, dass mir in meiner Heimat eine glänzende Zukunft bevorstehe.
Nachdem sie mich abgefertigt hatte, stand ich wie ein begossener Pudel auf der Straße. Der Verkehr lärmte an mir vorüber. Die Sonne spendete im Januar noch keine Wärme. Sie gloste zwischen Schneewolken hindurch, als habe sich in einem Wintermantel ein Ritz aufgetan. Erst am nächsten Tag hatte ich den Mut, Marylène von meiner Abfuhr zu berichten. Sie war fassungslos. Vor Entrüstung zitternd ließ sie sich Wort für Wort wiederholen, was ihre Mutter gesagt hatte, und wollte solche Rücksichtslosigkeit kaum glauben. Ihr sanftes Mädchengesicht wurde schuldbewusst, weil sie mich in diese peinliche Situation gebracht hatte.
Wenige Tage vor diesem Ereignis, in der letzten Januarwoche, war ich selbst zwanzig geworden. Eigentlich war ich noch ein halbes Kind, und drückte mich in Marylènes Schlepptau scheu und verletzlich durch die Straßen des Quartier Latin, obwohl ich mich forsch, stark und unsterblich gab. Doch mein Selbstbewusstsein war voll entwickelt, und die Niederlage in der Avenue Victor Hugo hatte sich mir wie eine Schandnarbe eingebrannt. Der Gedanke, dass sich hinter Madame Blondins Haltung die Abwehr eigener Verletzungen verbergen könne, war mir nicht in den Sinn gekommen. Egoismus hinderte mich, neben meiner eigenen Kränkung auch über die Beweggründe dieser Frau nachzudenken. In den folgenden Jahren war es mir zum Glück gelungen, die Einzelheiten des schmählichen Treffens zu vergessen und das Gefühl der Blamage zu verdrängen. Umso mehr wurmte mich, dass die Erinnerung in dem Moment zurückkehrte, als Marylène mir die Briefe zeigte, die sie im Sterbezimmer ihrer Mutter gefunden hatte.
Ich hob den Kopf, der halb auf Marylènes Schulter ruhte, und lauschte zum Fenster hinüber. Zunächst glaubte ich, auf der Straße die hydraulische Presse eines Müllwagens zu hören. Dann fiel mir die pneumatische Glastür ein, die unten im Foyer auf einer Metallschiene glitt, wenn jemand das Haus betrat oder verließ, und deren leises Geräusch durch den Fußboden an mein empfindliches Ohr drang. Da an die fünfzig Parteien hier wohnten, war es ein ständiges Hin und Herrauschen, an das ich mich nicht gewöhnen konnte.
»Bist du sicher, die Briefe stammen von deiner Mutter?«, fragte ich ziemlich teilnahmslos. »Kennst du ihre Handschrift? Und weshalb sollte sie ihre eigenen Briefe bei sich daheim aufbewahren? Wurden sie nie abgeschickt?“ Marylène rückte von mir ab und blickte mir strafend in die Augen.
»Hältst du meine Mutter für verrückt? Du denkst, sie schreibt aus Langweile Briefe, die sie nicht aufgibt? Was für ein Unsinn ist das?«
Ich unternahm einen neuen Vorstoß: »Vielleicht hat dein Vater sie geschrieben.« Ich versuchte, mir den Fünfzigjährigen vorzustellen, den ich damals wie einen Schatten am Ende des Korridors wahrgenommen hatte. Ihr Vater, der Augenarzt Dr. Blondin, war auffallend schlank gewesen, wie ja auch seine Frau. Fast abgemagert hatte er ausgesehen, wie ein Asket. Bei meinem Besuch hatte er sich in das Gespräch nicht eingemischt und das Feld seiner Frau überlassen.
»Mein Vater! Dieser Idiot!« Marylène zischte das so verächtlich hervor, als sei der Ophthalmologe ein Auswurf der Pariser Ärzteschaft gewesen. Bei den Abschiedsworten von Madame Blondin – nein, eigentlich erst als ich deprimiert zur Metro wanderte – hatte ich langsam begriffen, dass die Frau im Reitdress sich nicht um ihre Tochter sorgte, sondern ihre eigenen Zukunftspläne gefährdet sah. Der gesellschaftliche Werdegang ihrer Tochter mochte zwar noch nicht in allen Einzelheiten geplant worden sein, doch sobald Marylène volljährig würde, und das wäre in ein paar Monaten, würde sie in die gehobenen Kreise eingeführt und so lange die Tanzpartys gut situierter junger Leute besuchen, bis sie auf einen akzeptablen Heiratskandidaten träfe, den Absolventen einer der Großen Schulen, zum Beispiel der École Polytechnique oder der Nationalen Verwaltungsschule, mit Glück sogar einen Adligen, dem im Leben alle Türen offen ständen, mit dem Marylène sich nach Wahrung einer Schicklichkeitsfrist verloben würde. In Madame Blondins Strategie fand ein ausländischer Student mit ungewisser Lebensperspektive, zumal jemand, der aus Deutschland kam, keinen Platz. Aber vielleicht hatte sie mit ihrer Befürchtung Recht, dass ich trotz meiner angeblich glänzenden Zukunftsaussichten ihrer Tochter kein angenehmes Leben und schon gar nicht eine erfolgverwöhnte Karriere bieten könne. Nie hatte ich mich bedrückter und einsamer gefühlt als an jenem Mittag, als vom Himmel die ersten Schneeflocken rieselten und mir die Ergebnislosigkeit meines Besuchs vor Augen zu führen schienen. Während ich zur Metro schlich, wollte mir nicht aus dem Kopf gehen, was Marylènes Mutter gesagt hatte.
»Es wäre mir wichtig, wenn du sie liest, nur mal zur Gegenkontrolle.« Sie hielt mir die Briefe hin. Ich ahnte, wenn ich zugriff, war das Unglück unausweichlich. »Du bist quasi der einzige Unparteiische, dem ich sie zeigen kann. Aber bitte geh vorsichtig mit ihnen um. Achte auf alle Einzelheiten, auf versteckte Worte, Anspielungen. Wer weiß, ob sie wichtig sind.«
Versteckte Worte!
Wie sollte ausgerechnet ich sie aufspüren!
Ich nahm die Briefe mit spitzen Fingern entgegen und merkte, dass mir schon beim Geruch des Büttenpapiers schwindelig wurde. Aber ich durfte nicht ablehnen, durfte keine Gleichgültigkeit zeigen. Da ich mein Verlangen, sie in die Arme zu nehmen und noch einmal vorsichtig in mein Schlafzimmer zu bugsieren, kaum noch zu beherrschen vermochte, hätte ich ihr alles versprochen. Natürlich witterte sie mein sexuelles Begehren mit dem Instinkt einer Frau, die sich ihrer Ausstrahlung bewusst ist, und nutzte meine Gefügigkeit aus.
Erst vor kurzem war ich mit meiner Familie in Paris eingetroffen und hatte bisher hauptsächlich die Metroverbindung zwischen der Rue Wilhem, wo wir ein hübsches Appartement mit Balkon und Blick auf mächtige Platanen gemietet hatten, und dem Bürobezirk mit der kriegerischen Namen ›La Défense‹ am Westrand der Stadt genutzt. Dort waren in wenigen Jahrzehnten futuristische Wolkenkratzer wie Pilze aus dem Boden geschossen, die sich um die hundert Meter hohe ›Große Arche‹ gruppierten, einen auf Kante gestellten, leeren Fensterrahmen aus Marmor, Beton und Glas. Auch unser aufstrebendes Frankfurter Pharmaunternehmen hatte seine ›Frankreichantenne‹ in einem der Bürotürme eingerichtet, bei dessen Betreten mir jedes Mal der kühle Hauch einer angestrengten Modernität über den Rücken rieselte.
Die ersten Wochenenden hatte ich damit verbracht, Umzugskartons auszuräumen und mit Hilfe eines Schreiners den Bücherschrank und meine Stereoanlage einzudübeln. Einmal war ich mit Angelika und den Kindern auf die Champs-Élysées gefahren und hatte in einem China-Restaurant, dem Élysées Mandarin, sehr schmackhaft zu Abend gegessen. Ein überdurchschnittlich schlanker, überdurchschnittlich kluger, überdurchschnittlich zartgliedriger Kellner hatte uns mit nahezu durchsichtigen Fingern bedient. Alles an ihm war uns überdurchschnittlich vorgekommen, wahrscheinlich weil er der erste Chinese war, den wir ausführlich aus der Nähe betrachten konnten. Er hatte uns so sehr beeindruckt, dass wir fast die knusprige Peking-Ente vergaßen und nur seine zarten Hände betrachteten. Ausgerechnet jetzt, da ich mit Marylène auf dem Sofa saß – oder hatten wir nicht doch wieder mein eheliches Schlafzimmer betreten und lagen auf dem Bett, das ich bisher nur mit Angelika geteilt hatte – musste ich an den Kellner denken. Glichen meine treulosen Gefühle, die ich zwischen meiner Geliebten und dem mir völlig unbekannten Chinesen aufteilte, nicht den willkürlichen Entscheidungen eines Glücksspielers, der abergläubig auf die Würfel spuckt, bevor er sie über den Rouletttisch wirft?
Meine Gedanken ließen vom Kellner ab. Ich nickte verständnisvoll, hob die paar Bögen unter die Nase und fragte Marylène, nicht eigentlich aus einem triftigen Grund, sondern eher auf gut Glück, ob uns das Büttenpapier einen Hinweis böte, wer die Briefe geschrieben hätte. Ob es vielleicht ein markantes Wasserzeichen aufweise oder den fernen Duft eines Parfüms. Auf solche Einzelheiten müssten wir achten, um das Rätsel zu lösen. Ich bombardierte sie mit Detailfragen zur Tintenfarbe und Federbreite des Schreibinstruments, denen sie bisher keine Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Sie schüttelte den Kopf und bezeichnete mich als einen Pedanten.
Leider funktioniert mein Gedächtnis nicht besser als das anderer Menschen. Manchmal entfallen mir ausgerechnet die wichtigen Einzelheiten, während sich mir Nebensächlichkeiten so tief einprägen, als hinge mein Glück an ihnen. Um mich gegen die Gefahren der Vergesslichkeit zu wappnen, hatte ich schon als Schüler begonnen, ein Tagebuch zu führen, in das ich mit hybrider Gewissenhaftigkeit eintrug, was mir wichtig erschien, selbst wenn es sich im Rückblick als unwichtig herausstellte. Wie detailsüchtig ich manche Eindrücke in mich aufnahm, die sich hinterher als Wegwerfprodukte erwiesen, hatte ich gemerkt, als sich auf dem Weg zur Metro Bilder in mein Gedächtnis frästen, die heute nur wie Schneegestöber in meinem Kopf wirbelten. Widerwärtig und ekelerregend – ich fand kein milderes Wort – war mir eine verwahrloste Frau vorgekommen, eine aus allen Fugen geratene, vielleicht alkoholkranke Bettlerin, die auf der Eingangstreppe zum Bahnsteig stand, eine Hand auf das Geländer gestützt, ungeniert die nackten Schenkel spreizte und sich mit der anderen Hand den Urin abwischte. Kein Polizist, kein Notarzt oder Sanitäter bequemte sich herbei, um die Streunerin abzuführen oder zu einer Ambulanz zu bringen. Wie aus einer anderen Welt gefallen säuberte sie sich umständlich das Gesäß und babbelte wirres Zeug, während Fahrgäste an ihr vorbeiliefen und sich wegdrehten.
Nur ein makellos gekleidetes Bürschlein blieb vor der Verwahrlosten stehen, starrte ihr zwischen die Beine und raunzte sie an. Ich verstand nicht genau, was der Rotzlöffel schrie. Hatte er eben tatsächlich gestichelt: ›Wisch dir den Arsch mit dem Pinsel der Gleichgültigkeit‹? Der Satz entsprang keiner kartesischen Logik, doch hatte er den Vorteil, so mitleidlos und grausam zu klingen, dass er sich meinem nach Absonderlichkeiten gierenden Gedächtnis einprägte.
Mitleidlos war auch ich. Im Egoismus einer Kreatur befangen, die nur auf ihr punktuelles Weiterleben bedacht war, kam mir nicht in den Sinn, dass die Frau das Zerrbild eigenen Unglücks sein mochte, das eines Tages mich selbst in die Zange nähme. Wer kurz vor seinem zwanzigsten Geburtstag stand, dachte nicht an seinen Tod! Viele glückliche Jahrzehnte lagen vor mir. Doch vielleicht waren sie tonnenschwer wie Granitblöcke, die ich beiseiteschieben musste, um irgendwo das Ende zu erreichen, das hoffentlich nicht so armselig war wie das der Bettlerin. Als der Metrowagen aus der Station rollte, sah ich gedankenlos auf die gekachelte Wölbung des Tunnels und auf die jungen Frauen der Werbeplakate, die niemals ihr sorgloses Lächeln verloren und deren platinblonde Dauerwelle niemals nachdunkelte.
Während die Reklamebilder hinter einer Kurve verschwanden, fragte ich mich, ob Marylène von den Plänen ihrer Mutter wusste und sich ihnen gehorsam fügte. Noch war sie nicht volljährig, stand unter der Fuchtel ihrer Eltern, war ihrer Erziehung ausgeliefert und trotz ihres gefestigt wirkenden Äußeren im Inneren formbar. Wie verhielte sie sich, wenn sie in einem oder zwei Jahren auf einer dieser hinterhältigen Partys, die ihre Mutter eingeplant hatte und die in meinen Augen nichts anderes waren als ein Hochzeitsmarkt, mit einem uniformierten Kadetten der Polytechnik tanzte und sich in ihn verliebte, weil er sie fabelhaft herumwirbelte, wäre sie dann für mich verloren? Sollte ich sie ihrer Familie entreißen, sie mit auf einem Drahtseiltanz entführen? Verzweifelte Pläne schmiedete ich, während die Tunnelwände vorbeihuschten.
»Kann ich dir die Briefe noch einmal anvertrauen?«, flüsterte Marylène. Ihre Stimme klang rau und mutlos. »Bei dir sind sie sicherer aufgehoben als bei mir. Ich möchte nicht, dass Bernard sie in die Hände bekommt. Das käme mir wie ein Vertrauensbruch an meiner Mutter vor.«
Ich nickte zwar und lächelte, blieb innerlich jedoch gleichgültig. Was gingen mich die Briefe von Madame Blondin an? Ich spürte Beklemmung, leichte Atemnot. Ich dachte an Angelika, die mit den Kindern in der Normandie Ferien machte. Bis zu ihrer Rückkehr bestand keine Gefahr, dass jemand die Briefe entdeckte.
Und wenn schon! Was machte es aus, wenn in meinem Schreibtisch ein paar vergilbte Büttenbriefe schmorten? Meine Frau, die schlecht Französisch sprach, würde sich nicht dafür interessieren. Höchstens riskierte ich, dass unsere algerische Putzfrau sie aus Sorglosigkeit in den Mülleimer warf.
Ich erwachte aus meinen Überlegungen. Für Marylènes Flüstern bestand kein Anlass. In meinem Schlafzimmer beobachtete uns niemand, auch nicht der grauhaarige Herr, der manchmal auf dem Balkon des gegenübergelegenen Hauses stand und mit dem Feldstecher den Flug der Singvögel verfolgte. Meine Frau verbrachte noch drei Wochen in der malerischen Stadt Verneuil-sur-Avre, die mit einer spätgotischen, der heiligen Magdalena geweihten Kathedrale prunkte. Auch der Respekt vor Madame Blondin forderte uns kein Flüstern ab. Denn sie war seit zehn Jahren tot und konnte uns nicht mehr für unser Tun und Lassen zur Rechenschaft ziehen. Da war es egal, ob wir ihre Liebesbriefe wie Teppichhändler zwischen uns austauschten.
»Ich habe erst lange nachgedacht«, meine Freundin drückte mir das mit einem verblassten Seidenband kreuzförmig umwickelte Bündel in die Hand, »ob ich ein Recht habe, die Briefe zu lesen. Schließlich gilt das Gebot der Verschwiegenheit über den Tod hinaus. Doch dann habe ich mir gesagt, dass Mama sie aufgehoben hat, weil sie ihr Vermächtnis waren und weil ich sie eines Tages läse und nachempfände, was sie durchgemacht hat. Jetzt glaube ich, es ist sogar meine Pflicht, dass ich sie mir ansehe.«
Angelika sagte mir einen Hang zur Besserwisserei nach, sogar eine Veranlagung zum Zynismus. Auch jetzt reizte es mich, der Geliebten in die Parade zu fahren. Am liebsten hätte ich eingewandt, Madame Blondin (auch in Gedanken beharrte ich auf einer distanzierten Anrede) habe die Briefe vielleicht in ihrem Versteck einfach vergessen. Doch damit hätte ich Marylène gekränkt und die gefühlvolle Stimmung getrübt, die sie in mein Schlafzimmer geführt hatte.
Also überwand ich meine Spottlust. Aber mir war klar: Wenn ich die Briefe bei mir aufbewahrte, machte sie es mir zur unausgesprochenen Pflicht, sie auch zu lesen, und zwar gewissenhaft, jeden Satz, jedes Wort, jede Anspielung. Ich legte die Kuverts beiseite und blickte wieder zum Haus gegenüber, wo vielleicht der Birdwatcher lauerte. Es war nicht zu sehen.
Dann fiel mir wieder die algerische Putzfrau ein, die unsere Wohnung versorgte. Das verschwieg ich lieber vor meiner Geliebten. Mit letzter Sicherheit konnte ich ihr nicht garantieren, dass die Briefe vor neugierigen Blicken geschützt wären. Aber verstaubte Blätter wären für eine orientalische Späherin eine magere Ausbeute. Bestimmt hatten die Geschichten, die Madame Blondins Briefe erzählte, längst auf irgend einem Friedhof geendet. Oder gab es etwas darin, was heute noch von Bedeutung war?
Marylène hatte mir einmal, als wir im Café an der Metrostation Argentine gesessen hatten, mit unverkennbarem Stolz erzählt, ihr Großvater, der ja auch Arzt gewesen sei, habe als blutjunger Medizinstudent zur Zeit der Cagoule in einem Pariser Arbeiterviertel gewohnt. Ich hatte den Ausdruck noch nie gehört.
»Was soll das sein, die Cagoule. Bedeutet das nicht eine Haube?«, fragte ich. »Eine Art Gesichtsmaske?«
Das sei eine politische Geheimgesellschaft vor dem Zweiten Weltkrieg gewesen, erklärte sie mir. Damals hätten die faschistischen Schwarzhemden gegen die Rothemden der Volksfront gekämpft. Ihr Großvater sei zwar nie Mitglied der Cagoule gewesen, habe jedoch ihrer Gesinnung nahe gestanden und ihre bei Schlägereien verletzten Streithähne in einer Garage, notdürftig zusammengeflickt. Da war es allerdings nicht ganz ausgeschlossen, dass einer der Briefe darauf Bezug nahm und auf Personen verwies, deren Söhne oder Enkel heute in Amt und Würden standen. Selbst eine entfernte Verbindung zur Cagoule brächte sie womöglich in Verlegenheit. Ich hielt solche Befürchtungen für weit hergeholt. Vermutlich war den Franzosen inzwischen herzlich gleichgültig, was sich zur Zeit der Volksfrontregierung abgespielt hatte.
Marylène wurde unruhig. Sie wandte mir den Rücken zu und stand schon an der Tür. Alles Erforderliche war gesagt. Sie hauchte mir über die Schulter einen Abschiedskuss zu. Sie müsse leider fort. Als sie die Klinke in der Hand hielt, sagte sie noch, vorhin habe sie sich unseren Hausmeister mal genau angesehen. Vor solchen Leuten müsse man sich in Acht nehmen, und der hier sei ein besonders gefährlicher Aufpasser. Er säße stumm hinter seinem Pult, als höre und sehe er niemanden, und dabei beobachte er jeden, der das Haus betrete, so misstrauisch, als sei er ein Einbrecher.
Ich gab ihr Recht. Auch mir war der Typ nicht geheuer. Wir Hausbewohner nannten ihn ehrerbietig ›Monsieur le Colonel‹. Vielleicht war er früher bei der Polizei gewesen oder in der Fremdenlegion. Niemand wagte, sich mit ihm anzulegen, sondern versuchte, sich mit ihm gut zu stellen.
»Fremdenlegion. Auch das noch«, schimpfte Marylène los, als ich ihr meinen Verdacht mitteilte. »Dann wäre er ja nicht mal gebürtiger Franzose!« Sie grinste schief, weil sie selbst soeben einen Mann umarmt und sich ihm hingegeben hatte, der kein gebürtiger Franzose war. Sie wurde wütend. »Wenn ich jetzt an dem unverschämten Kerl vorbeigehe, und der sitzt wieder da mit seinem kahlen Schildkrötenkopf und führt Selbstgespräche … nein, heute werde ich absichtlich ganz lässig an ihm vorbeischlendern. Aber andererseits, weißt du, jedes Mal empfinde ich eine Art Entzauberung. Die Gefühle, die ich in deinen Armen gespürt habe, verfliegen im Nu. Wenn ich an dem üblen Aufpasser vorbeigehe, brennt sein Blick auf meinem Nacken. Manchmal bin ich verunsichert wie ein ertapptes Kind. Dann schaut er mir so durchbohrend nach, als sei ich ihm schon einmal irgendwo begegnet.«
Ich schloss sie noch einmal tröstend in meine Arme und begleitete sie zur Sicherheit die Treppe hinunter. Auch diesmal saß der Colonel stumm hinter seinem Pult, gab sich keine Mühe, uns zu grüßen, sondern schaute starr auf die Straße. Ich warf ihm einen feindseligen Blick zu, um ihm klarzumachen, dass ich mich von ihm nicht einschüchtern ließ und dass meine Besucherin eine Respektsperson sei. Liebevoll blickte ich Marylène nach, als sie betont aufrecht zum Flussufer hinunterschritt. Die Briefe hatte sie in meiner Wohnung zurückgelassen. Doch jetzt lagen sie deutlich sichtbar auf dem Beistelltisch vor dem Wandspiegel, wo sie es deponiert hatte, damit ich nicht vergaß, mich mit ihnen zu beschäftigen. Es schien ihre Art zu sein, mir wie selbstverständlich etwas aufzutragen, wozu ich eigentlich wenig Lust verspürte.
Doch nun trieb mich etwas an, sie gründlicher durchzulesen. Während ich Abschied nehmend noch einmal auf den Balkon trat und den grünen Blättervorhang der Platanen mit dem Blick zu durchdringen versuchte, nahm ich mir vor, mit der Lektüre später anzufangen und das kleine Päckchen vorläufig in der Schreibtischschublade aufzubewahren. Wenn der Anblick der Briefe keine Neugier in mir weckte, kein Verlangen, mich näher mit ihnen anzufreunden, gab es dafür nämlich gewisse Gründe, die in meiner Vergangenheit lagen. Dass Briefe das Werkzeug einer geplanten Betrugs sein konnten, ahnte ich nicht.
Nicht einmal ein Anflug von Unwohlsein überkam mich. Noch immer schaute ich Marylène vom Balkon aus nach, obwohl ich sie inzwischen nicht mehr sah. In meiner Vorstellung beobachtete ich sie allerdings, wie sie zielstrebig zum Fluss eilte. Wie weit war sie schon entfernt, wie unerreichbar, und doch wie begehrenswert war sie geblieben. Sie hatte mir versprochen, zu mir zurückzukehren. Eine leichte Sommerbrise wehte mir ins Gesicht. Glutrot glomm die Sonne im Dunst. Geräuschlos strömte die Seine zwischen den Kaimauern aus schwarzem Basalt. Ich wandte mich zurück und trat ins Wohnzimmer. Ein neuer Gedanke kam mir, ein Gedanke, der mich an allen Gesetzen der Wahrscheinlichkeit zweifeln ließ. Denn wie war alles gekommen?
Seit ich Angelika geheiratet hatte, lebte sie in ständiger Furcht, von mir betrogen zu werden, obwohl es dafür keinen Anlass gab. Nur der Fatalität des Schicksals war es zu verdanken, dass ich vor einem Monat mit meinen Kindern durch den schönen Park vor den Toren der Stadt spazieren ging, den Bois de Boulogne, um die hoheitsvoll dahingleitenden Schwäne und grün schillernden Stockenten sowie die beiden höckernasigen Neuzugänge zu füttern. Julia, meine Jüngste, hatte ein Kätzchen aufgegriffen das sich offenbar verlaufen hatte, und presste das Tierchen gegen seine Brust. Es guckte uns ängstlich an, war abgemagert und kratzte meine Kleine am nackten Arm, so dass sie das Tierchen herunter ließ und dieses wie im Wirbelwind davon stob.
Bisher war mein Leben in ruhigen Bahnen verlaufen, doch binnen weniger Augenblicke wurde die Welt auf den Kopf gestellt Denn als wir am Ufer des von Wasservögeln bevölkerten Teichs standen, schlenderte uns eine Dame entgegen, eine Unbekannte, die keine besonders elegante Kleidung trug und auch nicht besonders hübsch war. Sie besaß ein eher unauffälliges Gesicht und war nur wenig geschminkt. Nur das blonde Haar zog meinen Blick auf sich. Es war im Nacken zu einer altmodisch wirkende Nackenrolle gewunden, in Frankreich nannte man das einen Chignon, der plötzlich in mir etwas in Bewegung setzte, eine Erinnerung, die nie ganz verblasst war.
Die Frau war vorbeigegangen, ohne uns Beachtung zu schenken. Wenigstens schien es so. Doch dann blieb sie mit einem Ruck stehen und drehte sich zu uns um. Ich hatte ihr nachgerufen, hastig, überlaut, eine Spur ängstlich, weil ich fürchtete, sie sei schon zu weit entfernt, um mich zu hören. Wie ein Vogelschatten war die Erinnerung über mich hinweggehuscht, und im Bruchteil einer Sekunde hatten sich die Ganglien im Hirn zu einem Bild zusammengefügt. Jetzt war ich mir sicher, in der Spaziergängerin die ehemalige Kommilitonin zu erkennen, mit der ich vor befreundet gewesen war. Fast zwanzig Jahren war es her.
Meine Kinder schauten mit offenem Mund zu, wie ich die Unbekannte zunächst noch zögernd begrüßte (»Sind Sie – bist du es wirklich?«), dann aber herzlich umarmte und auf die Wangen küsste. »Ich bin Maximilian, ich bin der Maxim, erinnere dich! Wir kennen uns doch noch von der Uni«, hatte ich meinen altmodischen Namen ausgepackt, den ich auf zahllosen Urkunden verewigt hatte und mich jedes Mal ärgerte, dass meine Eltern mir so ein ellenlanges, verstaubt wirkendes, schwer auf dere Zunge liegendes Ungetüm mit auf den Weg gegeben hatten. Und »Nein, aber ja! Du bist Maxim«, hatte mich die junge Frau, und es war natürlich die Marylène von damals, kurz und bündig zurechtgestutzt. »Ich habe dich immer einfach Maxim genannt.« Ich hatte die Umbenennung hingenommen, obwohl mir Maxim noch geschäftsmäßiger und grauenhafter vorkam als Maximilian, der wenigstens früher eine gewisse noble Gewichtigkeit hatte anklingen lassen. Gab es nicht in der Rue Royale ein Restaurant, das Maxim’s hieß?
»Ach, und das sind deine Sprösslinge«, hatte sie gesagt und der vierjährigen Julia über das blonde Haar gestreichelt, während die achtjährige Paula sich linkisch beiseite gestellt und der zwölfjährige Felix misstrauisch die Arme vor der Brust verschränkt hatte. Als Marylène es sagte, klang es ein wenig eifersüchtig oder wehmütig. Der Gedanke drängte sich mir auf, wurde aber in mein Bewusstsein nicht so virulent, dass ich sie nach ihren eigenen Kinder befragt hatte. Natürlich hatte Paula daheim sofort ausgeplaudert, dass Papi im Park eine wunderschöne Dame sehr, sehr eng umarmt habe, und die vierjährige Julia war kichernd auf einem Bein im Kreis durch die Wohnung gehüpft, als wollte sie das Ereignis gebührend feiern.
Meine Frau sah sich in allen ihren Ängsten bestätigt, und, obwohl sie sich selbstsicher gab, hätte sie vor Empörung beinahe eine Blumenvase fallen lassen. Um ihre Eifersucht zu beschwichtigen, hatte ich ihr versprochen, sie und die Kinder noch am selben Abend in ein China-Restaurant, das auf den Champs-Élysées lag, schick auszuführen. Wahrscheinlich hatte mein Vorschlag jedoch hauptsächlich die Wirkung, Angelikas Misstrauen gegen die ›wunderschöne Dame im Bois de Boulogne‹ noch zu vertiefen.
Als ich meine Kommilitonin wiedergesehen hatte, und zwar dank eines absurden Zufalls, der jeder Wahrscheinlichkeitsrechnung widersprach und das Gefüge der Mathematik nahezu außer Kraft setzte, war mir schlagartig klar geworden, dass ich sie seit der Zeit, als wir uns gekannt hatten, eigentlich nie ganz vergessen hatte. An manchen Tagen oder auf Reisen, in Hotelzimmern, Museen und Kirchen hatte die Erinnerung mich begleitet, unbemerkt von meiner Frau, und auch von meinem eigenen Bewusstsein kaum wahrgenommen. Gott sei Dank hatte ihr Name mir nicht so heiß auf der Zunge gebrannt, dass er mir aus Unachtsamkeit herausgerutscht war. Was wäre passiert, wenn ich Angelika oder eine meiner Töchter versehentlich mit Marylène angeredet hätte! Nicht auszudenken! Aber in einer tieferen Schicht meines Gedächtnisses hatte die Studienfreundin Wurzeln geschlagen, die nichts herausreißen konnte. Wenn ich nachts schlaflos im Bett lag, hatte manchmal ihre Stimme in meinem Ohr vibriert und ich hatte mir einmal sogar eingebildet, auf meiner Wange die Berührung ihrer Haare zu spüren. Soweit ich mich erinnerte, war es in einer Pension in Verona passiert. Schleunigst hatte ich die Bettlampe angeknipst, um mich vom Reiseführer ›Nördliches Italien‹ ablenken zu lassen. Als ich die ehemalige Studienfreundin dann infolge eines Wunders leibhaftig wiedersah, in einem öffentlichen Park, den Tausende Menschen besuchten, hatte auch sie sich so spontan, so freudig und wiedersehensbereit zu mir umgedreht, als werde eine in ihr schlummernde Erinnerung lebendig. Liebenswürdig und ohne die geringste Spur von Überraschung hatte sie gefragt: »Haben du mich gemeint, Maxim?« Zumindest bildete ich mir ein, das seien ihre ersten Worte gewesen. Nein, diesbezüglich muss ich mich berichtigen. Denn auf der Membran meines Gedächtnisses war ihre Stimme bereits erklungen, bevor sich ihre Lippen zum Sprechen geöffnet hatten. Und wie liebevoll hatte sie der Jüngsten über den Kopf gestrichen, gerade so, als sei sie ihr eigenes, unser eigenes. Und gefragt hatte sie noch: »Sind das deine Sprösslinge?« – Was für ein Glück, dass Angelika nicht dabei gewesen war! Jedes Mal überkam mich bei dieser Vorstellung der kalte Schreck.
»Ach, und das sind nun deine.«
So hatte sie gesagt, während sie Julia an sich zog. Sie hatte ihr unnachahmliches Lächeln von damals aufgesetzt, vielleicht, wie ich erst später begriff, ein wenig eifersüchtig oder traurig.
Mit gezwungener Vertraulichkeit hatten wir uns umarmt und einen flüchtigen Wangenkuss getauscht, die Accolade, der man in Frankreich wenig Bedeutung beimaß. Doch Gott sei Dank hatte sie die Kaltblütigkeit besessen, ihre E-Mail-Adresse auf einen Zettel zu schreiben und mir zuzustecken („Für alle Fälle!). Mit leichtem Zögern hatte ich ihn entgegen genommen. Noch hatte sich das Unbehagen nicht zum schlechten Gewissen entfaltet, als ich mit den Kindern von unserem Spaziergang zurückgekehrt war und meiner Frau erklärte, wer die ›wunderschöne Dame‹ gewesen sei. Allerdings hatte ich ihr verschwiegen, dass schon drei Monate zuvor, als mein Chef in Frankfurt mich in sein Büro gerufen und mir mitgeteilt hatte, er beabsichtige, mich zur ›Frankreichantenne‹ zu entsenden, mich ein Freudenstrahl durchzuckt hatte und mir die Erinnerung an die Kommilitonin wie ein Komet durch den Kopf geschossen war. Fragen hatten in mir wie Sternschnuppen geglüht. Was mochte aus ihr geworden sein? War sie längst verheiratet? Hatte sie Kinder? War sie Rechtsanwältin geworden?
Gewiss war ich nicht mit waghalsigen Hoffnungen nach Paris abgedampft. Wie könnte ich sie unter zehn Millionen Einwohnern finden? Unter welchem Vorwand dürfte ich sie aufsuchen? Aber hatte es nicht wie ein Wetterleuchten geblitzt beim Gedanken, sie vielleicht eines Tages wiederzusehen? Vor Übermut machte meine Fantasie Überstunden. Wäre es nicht wunderbar, malte ich mir aus, wenn sie bei meiner Ankunft unter der riesigen Halle des Nordbahnhofs stände und auf mich wartete? Oder wenn ich ihr am Ufer der Seine oder in einer der malerischen Gassen des Quartier Latin begegnen würde? Aber nein. Wahrscheinlich, so dämpfte ich meinen Enthusiasmus, hatte sie mich vergessen. Wozu sollte ich sie überhaupt suchen, da ich sie in meiner Erinnerung nie verloren hatte? Dass mich der Zufall tatsächlich zu ihr führte, war eine Draufgabe des Schicksals, mit der ich nicht rechnen konnte, ein unverdienter Extra-Bonus. Hinzu kam ein weiterer unglaublicher Zufall. Als Angelika und ich die Wohnung in der Rue Wilhem einrichteten und ich mit einem Eifer, als würden wir von jetzt an bis an unser Lebensende in dieser schönen Stadt bleiben, Möbel, Bücher, Kleiderkartons in die Einbauschränke räumten und meine Stereoanlage montierte, ahnten wir nicht, dass eine gewisse Marylène Walter, geborene Blondin, ein paar Nachbarstraßen von uns entfernt wohnte.
Mit schlechtem Gewissen zog ich jetzt die Schreibtischschublade auf, um doch noch einen genaueren Blick auf die Briefe zu werden, die meine Freundin hinterlassen hatte. Zu meinem Schreck fand ich sie nicht. Plötzlich waren sie verschwunden, wie ein Wassertropfen verdunstet, obwohl ich mich zweifelsfrei erinnerte, sie dort sie dort hineingelegt zu haben. Der Schweiß brach mir aus.
Hatte jemand sie an sich genommen?
Wer zum Teufel sollte das gewesen sein?
Außer mir befand sich niemand in der Wohnung. Ich durchsuchte fieberhaft das Schlafzimmer. Hatte ein Windstoß, ein Erdbeben, von dem ich nichts gemerkt hatte, das Päckchen aus der Schublade geworfen? Das war unmöglich. Auf keinen Fall dürften es verloren gehen. Noch grässlicher war der Gedanke, dass Angelika oder eins der Kinder sie zufällig entdecken würde. Behauptete man nicht, Kinder machten die verrücktesten Sachen und fänden alles, was versteckt herumlag oder in den fernsten Winkel gerutscht war?
Trotz der Hitze, die sich in der Wohnung staute, fröstelte mir. Mein Herz schlug mir zum Hals heraus. Schließlich bemerkte ich zu meiner Verblüffung, doch auch mit ungeheurer Erleichterung, dass die Briefe wie ein Kartenspiel verstreut auf der Bettdecke lagen. Wie waren sie dorthin gelangt? Hatten sie sich aus geheimer Kraft selbständig bewegt? Ich dachte an den Ausdruck ›Fliegende Blätter‹, der Titel einer alten humoristischen Zeitschrift. Ich griff mir an den Kopf. Wurde ich verrückt? Hatte der Verleger damals festgestellt, dass manche verfängliche Briefe sich ohne äußeres Zutun von einem Ort zum anderen bewegten? Ich sammelte die verstreuten Blätter auf und legte sie in meine rotlederne Schreibmappe, die ich vorsichtshalber verschloss. Nun können sie nicht mehr fortfliegen, dachte ich leicht belustigt.
Das Telefon schrillte.
Bei verbotenen Gedanken ertappt, zuckte ich zusammen, ein Reflex meines schlechten Gewissens. Behutsam nahm ich den Hörer ab. Angelikas muntere Ferienstimme schreckte mich auf.
»Wir waren auf dem Butterturm«, verkündete sie.
»Butterturm?« Ein verständnisloses Echo. Sie hätte mir ebenso gut erzählen können, sie sei mit Marco Polo nach China gereist. Ich starrte auf die rotlederne Schreibmappe, die vor mir auf dem Tisch lag. Sie hypnotisierte mich. Sie erschreckte mich, als werde sie sich in mein Telefonat einmischen und Angelika von Marylènes Aufenthalt im Schlafzimmer berichten. Ich schob die Mappe beiseite, so dass sie mir nicht in die Quere kam.
»Aber ja, der berühmte Turm der Sainte Madeleine. So nennen ihn hier die Einheimischen.«
»Butterturm?« Ich wiederholte es verwirrt. Die Einheimischen – wer waren die? Angelika sprach aus einer anderen Welt. Ich dachte noch immer an die Briefe, die ich in die Schreibmappe gesperrt hatte, und konnte mir auf eine Kathedrale keinen Reim machen.
»Papi, stell dir vor«, schrie Paula dazwischen, »weil die Leute keine Butter essen.«
»Mami sagt, in der … in der …« krähte nun Julia begeistert.
Ich musste kapitulieren. »Also ehrlich, jetzt verstehe ich gar nichts …«
»In der Fastenzeit, Dummchen«, schrie wieder Paula.
»Ja, mein Lieber.«, schaltete meine Frau sich ein. »Also es ist so: Stell dir vor, im Mittelalter haben die Gläubigen ernst gemacht mit der Enthaltsamkeit und während der Fastenzeit keine Butter auf die Baguette gestrichen. Und das Geld, das sie sich so vom Munde abgespart haben, wurde der Kirche gespendet. Angeblich hat der Bischof die Baukosten des Turms damit finanziert. Ich weiß ja auch nicht, ob es stimmt. Aber ist doch ‘ne nette Legende. Findest du nicht? – Hörst du mir zu? Du wirkst so abwesend.«
Ich nickte friedfertig ins Telefon. »Ja. Ob es stimmt oder nicht«, wiederholte ich, »ist ‘ne gute Legende.« Gleichzeitig fiel mir allerdings ein, dass ich die Stadt Verneuil zuerst von Marylène hatte nennen hören und daraufhin Angelika den Ferienort empfohlen hatte. Als junges Mädchen hatte meine Freundin mit ihren Eltern dort öfter die Ferien verbracht. Wenn ich Angelika verriete, dass der Tipp von der ›wunderschönen Dame‹ stammte, würde sie mich noch jetzt über zweihundert Kilometer Entfernung mit der Telefonschnur erdrosseln!
Angst überflutete mich plötzlich. Zu viel Widersprüchliches staute sich in meinem Kopf. Sogar die Telefonmuschel starrte ich verstört an und wusste nicht, wie sie in meine Hand geraten war. Ich hörte ein Gurgeln. Angelikas Stimme war verstummt, technisch abgeschaltet, irgendwie zerhackt. So hörte sich Leitungswasser an, das einen kreisenden Trichter bildete und schlürfend in den Gully floss. Ich blickte zum Fenster hinaus mit der besten Absicht, die Umrisse des Butterturms im Dunst wahrzunehmen. Umsonst.
II
Unruhe hatte mich erfasst, seit Marylène fortgegangen war, als befände ich mich in einem Raum ohne geregelte Zeitabfolge, als werde erst heute geschehen, was sich gestern bereits ereignet hatte. Plötzlich war ich mir ihrer Zuneigung nicht mehr sicher. Wusste ich, ob die Frau, die ich morgen oder übermorgen wiedersähe, dieselbe wäre, von der ich mich verabschiedet hatte? Beim letzten Mal, als wir vor dem Haus auf der Straße gestanden hatten, waren wir behutsam miteinander umgegangen. Wir hatten darauf geachtet, ob der Hausmeister, der an seinem Pult saß und in einer Sportzeitung zu blättern vorgab, seinen argwöhnischen Blick nicht in Wirklichkeit in unseren Rücken bohrte. Daher hatten wir uns beim Abschied auch nicht leidenschaftlich umarmt, sondern nur freundschaftlich die Hand geschüttelt.
Auch am nächsten Montag, grübelte ich, was sie daheim erwartet habe. Einen misstrauischen Ehemann, der als erstes wissen wollte, wo sie her käme, wo sie so lange gewesen sei? Der ihr verbot, noch einmal den halben Tag fortzubleiben und eigene Wege zu gehen? Musste sie sich mit Lügen herausreden? Nervös saß ich abends neben dem Telefon, blätterte lustlos in Geschäftsakten, ging nicht einmal ins Bad, weil ich dort den Apparat nicht läuten hörte, verließ erst recht nicht die Wohnung, um mir auf einem kurzen Spaziergang die Beine zu vertreten, Gedankenlos starrte ich zum Fenster hinaus, ohne etwas wahrzunehmen, ließ aber zugleich – ich weiß nicht, wie ich es schaffte – mein Handy, das auf dem Tisch lag, nicht eine Sekunde aus den Augen. Noch immer hatte ich keine Lust, mich mit den Briefen zu beschäftigen, die mir ein sonderbares Unbehagen bereiteten. Ich brachte es nicht fertig, die Ledermappe aus der Schubladen zu holen und zu öffnen.
Plötzlich klingelte es, jedoch nicht in meiner Wunschvorstellung, sondern tatsächlich. Es war auch nicht das Telefon, sondern die Schelle an der Wohnungstür. Unwillig öffnete ich, weil ich keinen Menschen um mich ertrug und beim Warten und Lauschen von niemandem gestört werden wollte. Doch draußen stand die wunderschöne Frau, auf deren Anruf ich seit Stunden gehofft hatte. Diesmal trug sie auf dem Haar ein dunkelblaues Seidentuch, dazu ein orangefarbenes T-Shirt, eine weiße Leinenhose, und heute waren es keine roten, sondern vergoldete Ledersandalen.
»Wie wunderbar! Was für eine Überraschung! Das ist, als schlüge der Blitz ein. Oder ein Meteor knallt aufs Dach!« Aufregung durchwirbelte mein Sprachzentrum. Ich brachte kaum ein mehrsilbiges Wort hervor, zog sie in die Wohnung, warf die Tür mit dem Fuß ins Schloss, riss meine Geliebte ungestüm in die Arme und drückte sie an mich.