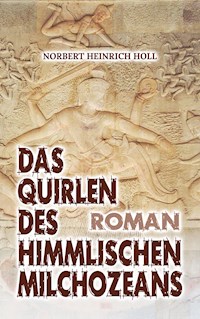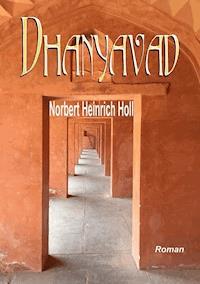Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Zwei Abende darauf sah ich das blau lackierte Damenfahrrad mit dem hohen Ledersitz und der Dreigangschaltung wieder, das gegen die Friedhofsmauer gelehnt gewesen war. An jedem Ort der Welt hätte ich es erkannt. Jetzt stand es vor der Hauswand meiner Nachbarn. Ich spürte, wie die Neugier in mir explodierte, und es war mehr als simple Neugier. Ich hatte mich sozusagen in den Radspeichen verfangen. Die hübsche Kleine musste ich unbedingt kennenlernen ..." Darf sich ein gestandener Mann im besten Alter in einen Teenager verlieben? Diese Frage schwirrt Marc im Kopf, seit er die achtzehnjährige Nichte der Nachbarn kennengelernt hat. Er legt es trotz Bedenken darauf an und muss erleben, wie sich Lage für Lage ein Geheimnis entblättert, dem er nicht gewachsen zu sein scheint. Norbert Heinrich Holl entführt in "Melanie oder die Primzahl" die Leser in ein surreales Geflecht aus Fakten, Gefühlen, Täuschungen und Wünschen, das sich erst am Ende zu einem Ganzen zusammensetzt - mit einer für den Protagonisten wie auch die Leser überraschenden Erkenntnis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
I
»Natt–tür–lich«, schleuderte Brigitte, meine spröde Nachbarin, mir über die Schulter zu. »Natt–turr–rell–le–ment. Die Primzahlen kennt doch jedes Schulkind.«
Ich war mir da nicht sicher. Denn sie bedachte Gilles, ihren Mann, mit einem Blick, der vielerlei Züchtigungen bedeuten mochte: Gehässigkeit, Verachtung, Überheblichkeit. Gilles ließ sich nicht beirren, rauchte bedächtig seine Pfeife, blätterte die Zeitung Ouest France durch und rückte sich bequem im Ledersessel zurecht, ohne zu zeigen, dass er seiner Frau oder mir zuhörte. »Nicht wahr, da weißt du doch blendend Bescheid?«, fragte Brigitte diesmal mit scharfer Stimme und drehte sich zu ihrem Mann. Gilles war ein korpulenter Brocken aus Fleisch, der nicht leicht aus der Ruhe zu bringen war. Ich hatte beobachtet, dass er ständig eine Whiskyflasche in Reichweite hatte. Allmählich hatte ich den Eindruck, dass er mehr Whiskydunst einatmete als Sauerstoff. Er hatte sich in eine Dampfmaschine verwandelt, die nicht mehr abkühlte. Hingegen hing die glimmende Pfeife schlaff zwischen seinen Lippen. Träge Rauchspiralen stiegen zur Decke. Ich war überzeugt, dass er nicht einmal den französischen Namen der Primzahlen wusste. Ich war mir sogar sicher, dass mein Nachbar, der massige Monsieur Faure, sich mit den Primzahlen nie beschäftigt und auch niemals ein Buch des Mathematikers Euler in die Hand genommen hatte. Wahrscheinlich war ihm sogar der Name des Autors fremd, obwohl er sich in seinem wissenschaftlichen Rang mit Blaise Pascal messen lassen konnte. Gilles setzte ein abweisendes Trägheitsgesicht auf und las in der Zeitung Ouest France Sport – angeblich hatte er in seiner Jugend Rugby gespielt –, Kreuzworträtsel und Aktien. Nicht einmal den heftig umstrittenen Schriftsteller Michel Houellebecq, von dem die Feuilletons voll waren, hatte Gilles gekannt, als ich vor einer Woche mit Brigitte über Bücher gefachsimpelt hatte. Und meine Nachbarin selbst? Hatte sie tatsächlich die Primzahlen durchdekliniert? Ich zweifelte. Mir jedenfalls war es schwergefallen, die unendliche Zahlenreihe in den Griff zu bekommen.
Wie oft hatte ich die Biografie von Leonhard Euler oder eines seiner Lehrbücher aus der Phalanx meiner alexandrinischen Bibliothek genommen, die so unbezwingbar wie die große chinesische Mauer vor mir stand. Ich hatte in Eulers wissenschaftlichen Ausführungen wie in einem Krimi geschmökert und mich bald in seinem mathematischen Universum wohlgefühlt. Wie ein Wasserfall waren jedes Mal neue Erkenntnisse, wunderbare Überraschungen, vereinzelt auch Widerlegungen von Irrtümern über mich geflutet, wenn ich mich in seinem Gedankenlabyrinth verirrt hatte. Dann hatte ich mich in eines der Lehrbücher vertieft, mit denen er sich verewigt hatte, um seine Schlussfolgerungen zu den Primzahlen zu verstehen. Mich tröstete der Gedanke, dass die Nachbarn mir bei Euler nicht in die Quere kamen. Die Biografie hatte in meinem Bücherschrank einen Ehrenplatz. Doch den nahm nur wahr, dem der Name Euler schon begegnet war.
Wie waren wir nur auf die verfluchten Primzahlen verfallen, von denen sich die wenigsten einen Begriff machten? Kein Mensch brauchte sie. Dabei war ich alles andere als ein mathematisches Genie. Offenbar trieb mich die schiere Unwissenheit Euler in die Arme. Bei unseren abendlichen Sitzungen brachte jeder sein Gesprächsthema mit im Gepäck. Brigitte, die trotz ihrer Launen in Bezug auf die gefiederte Tierwelt ein weiches Herz hatte, schimpfte über die Vogeljagd, die zwei Mal die Woche betrieben werden durfte. Wie oft hatte ich unbekannte, in feldgrauem Kriegsdrillich gekleidete Jagdgesellen beobachtet? Sie fuhren in kleinen Kastenwagen vor, in denen Hunde erwartungsvoll jaulten. Von meinem Gelände hatte ich die Bande verjagt. Es bestand aus einer frei zugänglichen Wiese, dessen kurz geschnittenes Gras den Vögeln keinen Schutz bot. Im Restaurant des Sports wurden die armen Tierchen zum Verzehr angeboten.
Gilles wiederum hatte ausnahmsweise die Zeitung auf seine Knie sinken lassen und sich über die Verkehrsführung geärgert, weil das Rathaus sich nicht darum kümmere, dass auf der Hauptstraße die schweren Lastwagen ungebremst über die Einmündung unserer Landstraße wegbrausten, ohne auf den durch Verkehrszeichen vorgeschriebenen Kreisverkehr zu achten. Bei innenpolitischen Debatten hielt ich mich abseits. Als Ausländer musste ich den Kürzeren ziehen. Gilles prahlte damit, dass Brigitte vor Jahren die Sozialistin Ségolène Royal als Präsidentschaftskandidatin unterstützt habe, die in den Meinungsumfragen hoffnungslos zurücklag, während Gilles von vornherein zum Lager der Sarkozy-Anhänger gezählt habe, der später das Rennen gemacht habe und Staatspräsident geworden sei. Brigitte konterte mit dem Hinweis, dass sie inzwischen beim Golfspiel ein besseres Handicap besaß als ihr Mann. Und Gilles bemäntelte seinen Tabak- und Whiskykonsum mit der Behauptung, dass er an Schwindelanfällen und Migräne leide, die er mit Alkohol und Nikotin ersticke. Sonst würden die Schmerzen in seinen Adern eines Tages implodieren.
Eine Weile hatten wir stumm dagesessen und dem Trommelwirbel des Regens auf das Schieferdach gelauscht. Gilles‘ verkniffene Augen waren hinter einem Schleier aus blauem Tabakqualm verborgen. Erneut hatte ich mir Mühe gegeben, meinen Nachbarn die Wunderwelt der Primzahlen schmackhaft zu machen, die mich von Jugend an fasziniert hatte, doch rasch an ihrem Gähnen gemerkt, dass sie nicht einmal wussten, was Primzahlen waren. Wie sollte es mir gelingen, sie für dieses Wunderwerk des mathematischen Geistes zu begeistern, an welchem sich schon Euklid die Zähne ausgebissen hatte? Dabei schlich ich nicht heimlich in ein Casino, betrieb kein Glücksspiel, huldigte nicht dem Lotto, setzte nicht auf Rennpferde, suchte keine magische Zahl, die alle Probleme der Welt löste. Zu nichts waren die Primzahlen zu gebrauchen. Es war eine selbstlose Sucht, die keinem Ziel diente, kein Vergnügen war und keine Befriedigung. Fast möchte ich sie ein mönchisches Verlangen nach Wissen und Geborgenheit nennen. Ein selbstloses Behagen, das ich mit Algebraikern zu teilen versuchte, von denen die meisten vor Jahrhunderten gelebt und geforscht hatten und mit deren Genie ich mich selbst in den kühnsten Träumen nicht messen konnte. Vielleicht hatte mich eine Krankheit befallen. Vielleicht hatte sich der Virus des Wahnsinns in meinem Hirn eingenistet?
Noch vor hundert Jahren hatten die klügsten Astronomen geglaubt, mit unserer Milchstraße allein im Universum zu schweben und den Andromeda-Nebel als eine Art Wurmfortsatz unserer Heimatgalaxie betrachtet. Heute hatten sie mit ihren Wunderteleskopen hoch über der Erde beobachtet, dass die Zahl der Galaxien mit jedem neuen Messgerät ins Unendliche wuchs. Euklid hatte die Unendlichkeit der Primzahlen schon vor fast dreitausend Jahren errechnet. Allein in den ersten hundert Zahlen gab es deren fünfundzwanzig. Doch je weiter man ging, hörten sie nie mehr auf. Ihre Unendlichkeit faszinierte mich desto mehr, wie ich keine algebraische Leuchte war. Die schiere Ignoranz war jedenfalls betäubender als Gilles‘ Whisky, dachte ich. Denn wie konnte das menschliche Gehirn Dinge ersinnen, die kein Ende hatten? Ich wagte nicht, die Frage laut vor Gilles zu äußern. Denn er starrte mich in diesem Moment mit glasigem Unverständnis an, als dringe sein Blick widerstandslos durch mich hindurch.
Wie spannend war dagegen die Lebensgeschichte von Leopold Euler zwischen Berlin und Sankt Petersburg verlaufen! Über die unaufhörliche Berechnung der Primzahlen und anderer algebraischer Rätsel hatte er sein Augenlicht eingebüßt. Während ich seine Bücher las und las, ahnte ich nicht, dass schon bald an der Unendlichkeit der Zahlenreihe meine eigene algebraische Endlichkeit scheitern sollte.
Als ich die sechste Klasse besuchte, hatte Doktor Vergau, unser Mathematiklehrer, den wir Schüler im Flüsterton wegen seines schneeweißen Eierkopfes respektvoll den Eisbären nannten, den grausamen Einfall, uns eine Klassenarbeit aufzuerlegen, die darin bestand, die Primzahlen von eins bis tausend zu errechnen. Als wir ihn hilflos anstarrten, tröstete er uns mit der Bemerkung, er sehe davon ab, uns schon jetzt die Serie der Primzahlen bis zu einer Million abzuverlangen, was der große Mathematiker Gaus als Schüler in fünf Minuten geschafft habe. Diese Aufgabe käme erst in der siebten Klasse an die Reihe. Ich saß vor meinem orangefarbenen Blatt Millimeterpapier, schrieb die Drei, die Fünf und die Sieben auf und wusste nicht mehr weiter. Erwin, mein Sitznachbar und bester Freund, war ein begabter Rechenkünstler und wollte später Atomphysiker werden. Da ich sozusagen an algebraischen Atembeschwerden litt, nahm ich bei Klassenarbeiten gern von ihm ›ärztliche‹ Ratschläge entgegen, die allerdings nicht immer ins Schwarze trafen.
Auch damals, als es um die Primzahlen von eins bis tausend ging, hatte er den linken Arm leicht vom Schreibpult gehoben, so dass ich mit einem Gesicht gekränkter Unschuld und dem Lächeln einer Katze auf sein Blatt linsen konnte. Erwin verdankte ich, dass ich meine Zahlenreihe auf dem Millimeterpapier bis Zweihundertneunzehn verlängert hatte. Doch dann sank sein Arm wieder auf den Tisch. Der gefürchtete Eisbär, der im Kontrollgang die Bankreihen abschritt, näherte sich uns. Daher endeten meine Primzahlen bei der verfluchten Zweihundertneunzehn. Das Ergebnis verfehlte nicht nur die Messlatte tausend, die uns Doktor Vergau gesetzt hatte, sondern war auch falsch. Die Zahl zweihundertneunzehn war nicht nur durch die Eins und sich selbst teilbar, sondern auch durch die dämliche Drei. So wurde die falsche Primzahl zweihundertneunzehn für mich nicht nur zum ewigen Erinnerungsposten des Misserfolgs, der Blamage und der Demütigung, sondern sie besiegelte auch meinen Ruf als mathematische Niete. Denn da oft ein kleines, unwichtiges Verhängnis ein viel Größeres, Schicksalhaftes nach sich zieht, blieb ich wegen meiner Rechenschwäche – Doktor Vergau bewertete sie in meinem Zeugnis als frühzeitig ausgebrochene algebraische Legasthenie – am Ende des Schuljahres sitzen. Es war die erste Schlappe in meinem an Niederlagen reichen Schulleben. Als ich an diesem Abend vor meinem universalen Bücherschrank stand und die Biografie von Leopold Euler zur Hand nahm, fiel mir die verpatzte Algebra-Aufgabe wieder ein.
Zwei Wochen später, es war ein angenehmer Sommerabend, besuchte ich abermals meine Nachbarn und traf dort eine schweizerische Musiklehrerin. Welch’ ein glücklicher Zufall, dachte ich. Die Dame war aus Genf angereist und übernachtete bei den Faures. Auf den ersten Blick fiel mir auf, dass sie wie alle großen Künstler Anis trank. Das halbvolle Glas Pastis, wie man das Getränk in Frankreich nannte, stand vor ihr. Sein Aroma durchzog den Raum und mischte sich mit Gilles‘ Whiskyduft. Ich hatte die Schweizerin kaum begrüßt, da ließ Brigitte mich wissen, ihr Gast sei in ihrer Heimat eine anerkannte Pianistin, und wie zum Beweis ihrer Fähigkeit streckte mir die Schweizerin ihre fleischigen Finger entgegen. An solchen Gliedmaßen könne man einen geübten Klavierspieler erkennen, stimmte auch Gilles zu. Zwischen zwei Schluck Whisky lachte er hinterhältig. Seine Augen waren glasig. Wenn Madame konzertiere, lodere Feuer in den Adern der Zuhörer und sprenge die Leidenschaft alles Bewusstsein in die Luft. Er tauchte den Blick in sein leeres Whiskyglas und gluckste ironisch.
Auch Brigitte wirkte verkrampft, seit ich ins Haus getreten war. Die bei meinen früheren Besuchen nichtssagend höfliche Atmosphäre war verflogen. Niemand hatte, als ich an die Fenstertür klopfte und die Faures mich erkennen konnten, begeistert gerufen: »Herein, Marc! Nur hereinspaziert!« Ein entspanntes Lachen wollte sich nicht einstellen. Der deutsche Nachbar war nicht erwünscht. Um das Gespräch von der Klaviermusik fortzubringen, von der ich nichts verstand, wand ich mich mit meinem gewinnendsten Lächeln der Pianistin zu und fragte, ob sie den Name Leopold Euler kenne. Schließlich sei er ihr berühmter Landsmann gewesen.
Die Dame war zwar auf eigenen Ruhm erpicht, wusste jedoch mit dem Ruhm eines anderen nichts anzufangen. »Ach, vielleicht ein Revolutionär«, antwortete sie spöttisch. Mir zuliebe sprach sie die paar Worte auf Schwyzerdütsch und legte anschließend eine Kunstpause ein, um sich von der Anstrengung zu erholen. »Wir friedlichen Schweizer erzeugen ja nur noch Revolutionäre.« Damit kehrte sie zum Französischen zurück. »Denken Sie nur an Lenin. Ohne die Schweiz hätte es die Oktoberrevolution nicht gegeben. Und denken Sie an die großen Reformatoren Zwingli oder Calvin, die mit der katholischen Kirche aufgeräumt haben. Dabei bin ich als Genferin ja schon mit meinem Landsmann Rousseau, Jean-Jacques gesegnet«, schüttete sie einen Sack voll Gelehrsamkeit vor mir aus. »Denn der kommt auch aus Genf, auch wenn hierzulande die Leute behaupten, er sei Franzose gewesen.« Gilles lächelte unerschütterlich und wartete, bis ihr der Atem ausging. Dann goss er hinterhältig ihr Pastis-Gläschen wieder voll.
Ich konnte mich im Nachhinein nicht erinnern und durfte von mir keine genaue Rechenschaft über den weiteren Verlauf des hin und her verlaufenden Gesprächs erwarten. Ich schaute noch immer auf das Gläschen Pastis in der leicht bebenden Hand der Schweizerin. Wie konnte sie mit ihrem Zittern eine begnadete Pianistin sein? Immer noch betrachtete ich ihre Hände. Wie sonderbar, ging mir durch den Kopf, da saß ich mit der unzugänglichen Schweizerin an einem Tisch und wusste im Voraus, mit welcher vorsichtigen Bewegung sie das Pastisglas zu den Lippen hob. Obwohl ich nichts von ihr wusste, konnte ich getrost die kleine Vorhersage treffen. Die Frage verfolgte mich noch im weiteren Verlauf des trockenen Wortwechsels. Ich beschränkte mich auf Redensarten, die mir rasch zur Hand waren, auch wenn die Erwähnung Schweizer Religionsstifter mich von der Primzahl weggebracht hatten. »Sie haben recht«, ließ ich mich herab, reumütig zu bekennen. »Euler kommt aus Basel, und er hat später die Ungehörigkeit besessen, die Schweiz zu verlassen und lange in Berlin zu leben, bevor er nach Sankt Petersburg ging.«
»Aus Basel! Und in Russland. Also ein Trotzkist!«
Sie rümpfte die Nase. »Aber wie Sie den Namen der Stadt Basel aussprechen, klingt er lächerlich.« Sie sprach mir das Wort Basel einige Male in betontem Schweizerdeutsch vor. »Und übrigens, es gibt Dinge, über die zu sprechen es sich verbietet.« Giftig in meine Richtung lächelnd stand sie auf und ging hinaus. Ihre herabgewinkelten Lippen zeigten mir, dass ihr Bedarf an Gesprächen mit mir gedeckt war. Ihre Schritte verklangen auf der Treppe zum ersten Stockwerk. Als sie auf ihr Zimmer gestiegen war, wollte ich das schleppende Gespräch in schnellere Gangart bringen, warf alle Behutsamkeit über Bord und stellte Gilles einige Fragen zum Rugby-Spiel: woher der seltsame Name stamme, weshalb man mit einem Rotationsellipsoid spiele, wann man ihn tragen müsse und wann man ihn auf keinen Fall tragen dürfe? Mir fielen einige sinnlose Fragen ein, die mir geeignet schienen, unser Abendgespräch in Schwung zu bringen. Doch Gilles, der Einzige, der, wie er behauptete, praktische Erfahrungen besaß, hörte mir zu, ohne sich in seiner Regungslosigkeit stören zu lassen. Seine Augen waren halb geschlossen. Ein unbehagliches Schweigen breitete sich zwischen uns. Brigitte stocherte im Kaminfeuer. Fast hoffte ich, dass die Pianistin aus Genf sich wieder zu uns geselle. Denn ich merkte, dass nach Gilles‘ Ansicht nur ein Dummkopf wie ich das Thema Rugby anschneiden konnte, von dem ich ebenso wenig verstand wie von Klaviermusik. Er zog einen Bronzemörser heran, der ihm als Massengrab für seine Pfeifenstummel herhielt. Alles an ihm strahlte Verachtung aus.
Immerhin stand er hinterher mit übellaunigem Nicken auf, um mir aus dem Stuhl zu helfen. Auf eine Krücke gestützt – ich hatte mir vor einigen Tagen aus tölpelhafter Unachtsamkeit den rechten Fuß verstaucht, als ich die Wendeltreppe in meinem Haus hinaufstieg –, gab ich Brigitte den üblichen nichtssagenden Wangenkuss, öffnete die Tür und überquerte humpelnd den Vorgarten. Gilles hatte die Außenbeleuchtung eingeschaltet. Auf der Türschwelle flüsterte er mir spöttisch zu: »Les nombres premiers. Da soll mich keiner für dumm verkaufen.« Ich sah ihm an, wie stolz er war, dass ich ihn unterschätzt hatte. Oder hatte er soeben die Primzahlen von meinen Augen oder meiner Stirn abgelesen?
»Bonsoir, Marc!«, rief Brigitte mir nach. Gilles hielt mich am Rockärmel fest. Sein Whiskyatem wehte mir in die Nase. Wir standen in seinem Vorgarten. Der Weg ins Haus war mit Kies bestreut. Die Jahre hatten den Boden zu einer glatten, hellen Fläche werden lassen. »Manchmal frage ich mich, Marc, ob ich mit Ihnen als Nachbar nicht ehrlich sein müsste«, murmelte er kaum verständlich. Ich blieb steif stehen. »In welcher Beziehung?« Aber schon winkte er ab und ließ einen Moment verstreichen. Der Gedanke schien ihm zu entgleiten. Als ich ihm direkt in die Augen schaute, wusste ich, dass aller Whisky oder Pastis nicht dieses Bekenntnis aus ihm herausbrächte, womit er ehrlich sein sollte. »Im Winter müssen wir Sägemehl oder Salz auf den Gehweg streuen«, sagte er zusammenhanglos und ging zurück in sein Haus.
Ich blickte nach links und rechts, bevor ich die Straße überquerte. Weit und breit war kein Auto, kein Traktor zu sehen. Doch wie immer, wenn ich das schmale Asphaltband betrat, befiel mich das seltsame Gefühl, von einer Welt in eine andere zu treten. Meine Empfindungen schienen sich auf sonderbare Weise zu verformen und sich in ihr Gegenteil zu verkehren. Nicht nur die Sprache, in der ich dachte und mich ausdrückte, änderte sich, wenn ich die französischen Nachbarn verließ und mein Haus betrat, wo das Fernsehen dank der Parabolantenne aus deutschen Sendern gespeist wurde und mein großer Bücherschrank fast nur deutschsprachige Werke umfasste. Nicht nur die lästigen Akzente über den Vokalen konnte ich abwerfen; ich brauchte auch bei jedem Substantiv, das ich aussprach, nicht zu erforschen, ob es als Maskulinum oder Femininum in die Unterhaltung eingeführt werden dürfe. Im Gegenteil: Ich glaubte, in meine Heimat zurückzukehren, wo ein Wort mich innerlich ausleuchtete, wo ich mich wieder meinen Tagfantasien überlassen durfte, ohne den kühlen Fragen von Brigitte oder dem ironischen Grinsen von Gilles standhalten zu müssen. Immer fanden die Besserwisser etwas an dem, was ich bemerkte, zu beanstanden und zu belächeln. Immer mussten sie das letzte Wort haben. Das Belehren steckte ihnen im Blut. Anfangs hatte ich meinem Unbehagen keine Bedeutung beigemessen. Schließlich war ich als Ausländer auf französischem Boden ja nur geduldet. Ich sprach schlecht Französisch, musste mir oft mit Englisch behelfen und hatte von französischer Politik nur verschwommene Vorstellungen. Doch in den letzten Wochen war es mir immer schwerer gefallen, zu den Faures hinüberzugehen und freundschaftliche Wärme in meine Worte zu legen. Eines Abends, vielleicht war es dem Whisky zuzuschreiben, war Gilles mir sogar mit einem wölfischen Lachen entgegengetreten und hatte die Arme vor der Brust verschränkt, als wolle er mir den Zutritt zu seinem Haus verwehren. Im letzten Augenblick war er zur Seite getreten.
Anfänglich waren meine wöchentlichen Besuche nur eine Art Ritual. Doch seit einigen Wochen zog mich eine glimmende Neugier zu den Nachbarn hinüber. Noch zögerte ich, es einen ›stillen Wunsch‹ oder gar ein ›verschwiegenes Verlangen‹ zu nennen. Von Sehnsucht konnte keine Rede sein. Was immer der leise innere Zwang sein mochte, er drängte mich, mein Widerstreben zu überwinden und zu den Nachbarn zu gehen, sobald ich das Damenfahrrad gegen die Hauswand der Faures gelehnt sah. Dann war das junge Mädchen zu Besuch gekommen, von dem ich nicht mehr wusste, als dass sie Melanie hieß. Gilles hatte den Namen einmal laut aus dem Wohnzimmer gerufen und die rätselhaften Worte hinzugefügt: »Also heute musst du es machen, Brigitte ist nicht da. Sonst ist es ein und allemal vorbei.« Es waren Worte, die ich zunächst nicht verstand oder nicht glauben wollte. Doch sie prägten sich mir ein, und abends, als ich im Bett lag und die Schlafbrille über die Augen zog, war ich noch damit beschäftigt, ihre Bedeutung zu ergrübeln. Sollte Melanie während Brigittes Abwesenheit das Abendessen zubereiten oder war sie Gilles‘ verbotene Geliebte und sollte ihm mit ihrem Körper das Bett anwärmen? Vor meinem inneren Auge zogen aufwühlende Bilder vorbei, bevor ich einschlief.
Ich konnte nicht bestreiten, dass der Eingang zu meinem Grundstück wild zugewachsen war. Er sah nicht so gepflegt aus wie der kiesbestreute Weg zum Haus der Nachbarn. Es war mir gleichgültig. Ich überließ es der Natur, sich unbekümmert über mein Grundstück herzumachen. Blumen wuchsen bei mir nicht. Der Rosenstock vor dem Haus war verwildert und ein Ceanothus-Strauch, der mit seinen blauen Blüten die Bienen angelockt hatte, war eingegangen. Nur ein paar Osterglocken hatte der Wind willkürlich über die Wiese gestreut, wo sie im Frühjahr aus dem Boden wuchsen, und hinter dem Haus, dem Auge verborgen, kämpfte ein Hortensienbusch gegen den Niedergang. Der verrostete Briefkasten, den ein früherer Bewohner an das Gartenportal geschraubt hatte, sah inzwischen aus wie eine Ruine aus der Eisenzeit. Der Lehmboden war glitschig und ausgetreten. Fast wäre ich ausgerutscht und gefallen. Ich verfluchte mich, weil ich für den kurzen Heimweg keine Taschenlampe mitgenommen und auf meinen Orientierungssinn vertraut hatte.
Es hatte stundenlang genieselt. Das Gras war von Nässe durchtränkt und von regensattem Grün. Im Licht der Abendlampen, das von den Nachbarn zu mir herüberschimmerte, konnte ich zwei Maulwurfshügel erkennen. Standen sie nicht durch ein Tunnelsystem miteinander in Verbindung? Ich stellte mir vor, mich wie ein blindes Pelztierchen durch die enge Röhre zu schieben. Ein gruseliger Gedanke! Der Regen überfiel unsere Gegend – sie lag nahe am Meer – oft so unerwartet wie ein Blitzschlag. Nicht einmal der Wetterbericht kam schnell genug hinterher. Wenn der Nachrichtensprecher den Regen ankündigte, prasselte er bereits aus den niedrig hängenden Wolken auf die Schieferdächer. Im Dorf wurden Heerscharen von grauen Regenmänteln aus den Kleiderschränken gerissen. Einmal hatte es laut Meteo an einem Tag so stark geregnet wie sonst in zwei Monaten.
Als ich den Eingang zum Haus öffnete, quietschte der verrostete Türgriff, als sei er seit Jahren nicht mehr benutzt worden. Die Wolkendecke kündigte elektrische Entladungen an. Ich beschleunigte meine Schritte, um dem drohenden Platzregen zu entkommen. Gott sei Dank war heute Catherine gekommen, die Zugehfrau, und hatte das Bett gemacht, das Bad geputzt und den Tisch aus Palisanderholz gewienert. Sogar einen Topf mit Boeuf Bourguignon hatte sie mir heute hinterlassen. Sie kam zwei Mal die Woche für eine Stunde, eine wortkarge Person, die alles erledigte, worum ich sie bat. Sie verwandelte mein bescheidenes Bruchsteinhaus in eine Stätte der Behaglichkeit. Manchmal schnitt sie mir sogar im Garten die Haare. Ein Segen, dass ich sie gefunden hatte, sagte ich mir jedes Mal. Das Einzige, was mich an ihr störte, waren ihre titanischen Gesäßbacken und ihr Körpergeruch. Vielleicht war sie deshalb unverheiratet geblieben.
Die durch den Gartenzaun hängenden Efeuschlingen mussten unbedingt weggestutzt werden. Das Außenlicht vor der Fassade hatte ich brennen lassen, als ich meine Nachbarn besuchte, die selbst in den vergangenen zwei Jahren keinen Schritt über die Tür hinaus zu mir hingetan hatten. Dabei waren sie jünger als ich und auch später vom Nachbardorf hier in unseren Weiler gezogen. Doch einmal den Schritt zu mir herüberzutun, kam ihnen nicht in den Sinn. Vielleicht war es gut so. Im Licht der spärlichen Außenlampen wirkten die Lianen, die durch den weitmaschigen Draht gewachsen waren, wie traurige Missbildungen der Natur, verkümmerte Arme und Beine, manche auch beinahe wie die zusammengewachsenen Köpfe siamesischer Zwillinge. Ich überwand meinen Schauder, öffnete das Gartentor und trat ins Haus. Seine zweihundert Jahre alten Granitmauern hielten jeden Schrecken ab. Wärme empfing mich (die Ölheizung lief) und helles Licht. Ich ging ins Wohnzimmer und überprüfte die Bücherreihen. Richtig! Da stand er, der umstrittene Houellebecq. Doch auch diesmal spürte ich wenig Verlangen, ihn in die Hand zu nehmen und ein paar Absätze darin zu lesen. Einen Augenblick hatte ich den Verdacht, als hätten die nebenan stehenden Romane den Wunsch, von dem literarischen Scharlatan, wie Brigitte ihn genannt hatte, ein Stück wegzurücken.
Ich riss das Fenster auf. Im Garten strich eine unbekannte Katze ums Haus. Sie war weiß-braun gefleckt. Zwischen den Zähnen trug sie eine Beute, eine Maus oder ein Vogel. Im schwachen Licht der Außenbeleuchtung konnte ich es nicht erkennen. Ich klopfte kräftig gegen den Fensterrahmen. Doch die Katze sah nur kurz zu mir hin, ließ sich aber in ihrem mörderischen Schleichgang nicht stören. In einer Regenlache spiegelte sich die dünne Sichel des Mondes, der soeben einen Spalt zwischen den Wolken gefunden und Hunderttausende von Kilometern entfernt von unserem Dorf einen Sonnenstrahl aufgefangen hatte.
Im Dämmerlicht löste sich ein Fahrrad aus den unbewegten Konturen der Pappeln, die im Vorgarten meiner Nachbarn wuchsen. Die Fahrradlampe warf einen dunstigen Lichtkreis auf die kiesbestreute Einfahrt. Bestimmt war es Melanie. Brigitte hatte ihrer Putzfrau erzählt, es sei ihre Nichte, und die brave Reinemacherin hatte nichts Eiligeres zu tun gehabt, als es Catherine anzuvertrauen. So war das kostbare Wissen in meinen Besitz gelang. Die echte oder angebliche Nichte war achtzehn, stand, wie ich eine Woche später beiläufig von Catherine gehört hatte, kurz vor dem Baccalaureat und arbeitete am Wochenende als Kellnerin und munterer Augenfang in der Pizzeria gegenüber dem Friedhof, die den seltsamen Namen Le Seize trug, vielleicht die Hausnummer, und eine Menükarte mit verschiedenen Pizzasorten, aber auch mit echt bretonischen Sahnemuscheln aus Cancale anbot, den Moules Royales à la Crème mit Fritten.
Ich schäme mich gehörig, zu gestehen, dass ich, der fast vierzigjährige Ruheständler, das junge Mädchen attraktiv fand. Sollte ich sagen, sie sei eine aufreizende junge Frau? Melanie war unbestreitbar in unserem grauen Dorf eine Augenweide. Ein zufällig vorbeikommender Filmregisseur aus Amerika hätte sie vielleicht nach Hollywood abgeschleppt, überlegte ich, wenn ich sie von weitem sah. Es war doch bekannt, dass junge Mädchen in den Händen eines Filmmanagers weich wie Wachs wurden und sich schon als künftige Diva in Beverly Hills sahen. Es blieb nicht aus, dass ich dem jungen Mädchen mehr Aufmerksamkeit und Tagträume widmete, als ich mir auf Grund meines fortgeschrittenen Alters erlauben durfte. Doch was sollte mich daran hindern, meine Fantasie an der langen Leine laufen zu lassen, Hollywood hin oder her? Etwa die lächerliche Tatsache, dass ich um die zwanzig Jahre älter war als die muntere Kleine und ihr Vater sein könnte?
Man mochte sich wundern, dass ich mich bereits als Ruheständler bezeichnete. Nur zeitweilig durfte ich die Bezeichnung beanspruchen. Mein oberster Chef, der über den Wolken im Nimbus der Allmacht thronende Vorstandsvorsitzende der Reiseagentur ›Nur recht weit! A.G.‹, der meines Wissens am Tegernsee residierte, hatte festgestellt, dass unsere Agentur in Delhi keinen Gewinn abwarf. Zuvor war ich in Amerika und Ägypten als Urlaubsvertretung eingesetzt gewesen und hatte mir den Ruf erworben, besser mit Primzahlen vertraut zu sein als mit Fluglinien und Wellness-Hotels. Ein Genossenschaftsarzt, der es gut mit mir meinte, hatte mir ein Burn-out-Syndrom attestiert und mich für ein Genesungsjahr oder auch zwei in die friedliche Bretagne geschickt. Nach dem von der Gewerkschaft in einem langen Streik erkämpften Arbeitsrecht ließen sich solche Abweichungen von der Norm offenbar drehen, wenden und deichseln, und so richtete ich mich für meine Rekonvaleszenz in dem alten Granithaus ein, in dem ich schon zwei Mal gewohnt hatte, das erste Mal mit meinem Großvater, dem damals das Haus gehörte, das zweite Mal nach dem Abschluss der Lateinschule Sankt Bartholomäus, als ich auf der Suche nach einem Beruf, der mich nicht ständig gähnen ließe, zwei Jahre vertrödelt hatte. Die saubere Luft, die Nähe des Meeres, der Glockenklang der Kirche, die Bescheidenheit der Dorfbewohner, das alles gefiel mir.
Um zu Melanie zurückzukehren, so hatte ich ihretwegen mein Unbehagen unterdrückt und im Le Seize zwei Mal zu Mittag gegessen. Sie war ein hübsches Mädchen mit flinken Augen und gertenschlank. Das fand ich bestätigt. Unter ihrer grünen Schürze lugten die nahtengen Jeanswaden hervor. Unauffällig beugte ich mich vor. Ja, die ausgefransten Ränder der Hose gaben ihren Waden das Aussehen schmaler, entrindeter Baumstämmchen. Ich schaute auch noch mehrmals zu der Kellnerin hin, um mir ihr Gesicht einzuprägen. Von Brigitte hatte ich erfahren, dass die angebliche Kellnerin in Wahrheit eine strebsame Abiturientin war. Gilles hatte hämisch hinzugefügt: »Und ein zukünftiger Hollywood-Star.« Als sie mir den Aprikosensaft servierte, glaubte ich, ihr dezentes Parfüm zu riechen. Als ich den Blick hob, um ihr in die Augen zu schauen, erschrak ich beinahe. Denn sie verrieten eine Unregelmäßigkeit, die ich zwar sogleich spürte, doch nicht in Worte fassen konnte. Insgesamt leuchteten sie in einem sonderbaren Grünblau. Ein Sachverständiger für Edelsteine hätte vielleicht gesagt, er wolle sich nicht festlegen, doch die Iris changiere vermutlich zwischen smaragd- und saphirfarben. Ich senkte den Blick erst auf die Menükarte, dann auf ihre gepflegten Hände, die auch eine Augenweide waren. Erneut in ihr Gesicht zu schauen, traute ich mich nicht.
Nach dem Essen erlaubte ich mir nicht etwa die Dreistigkeit, dem künftigen Filmstar ein grandioses Trinkgeld zu hinterlassen. Denn ich spürte, dass eine so feinfühlige junge Person wie sie in einem auf der Tischplatte errichteten Haufen von Münzen eine plumpe Anbiederung gesehen hätte, wenn nicht sogar eine Unverschämtheit. Schon stellte ich mir vor, dass sie die Nase rümpfte, mir den Rücken kehrte und in die Pizzaküche eilte.
Stattdessen überlegte ich, ob es, abgesehen von der hilfsbereiten Catherine, noch andere Möglichkeiten gab, Näheres über das aparte junge Mädchen zu erfahren. Denn ich spürte, dass mich die Neugier mächtig erwischt hatte. Erwin, mein ältester Jugendfreund, der mir schon bei den Primzahlen eine zweifelhafte Hilfe gewesen war, heute ein nüchtern die Guthaben seiner Kunden durchleuchtender Sparkassendirektor, hätte spöttisch gesagt: ›Auf diesen Flankenangriff weiblicher Schönheit waren deine Verteidigungstruppen wohl nicht vorbereitet.‹ Ich hätte beim Lesen seiner hämischen E-Mail fast widerwillig genickt. Denn Erwin hätte ziemlich ins Schwarze getroffen. Doch die Buchstaben schienen sich zu bewegen. Sie lachten mich aus. Sie rissen sich vom Bildschirm los. Sie rannten mir einfach davon.
Zum ersten Mal hatte ich Melanie am Friedhof unseres Dorfes gesehen, dessen verrostetes Gittertor eine alte Frau mit lederartigem Gesicht bewachte. Melanie stand mit meiner Nachbarin Brigitte an der Friedhofsmauer. Es sah so aus, als warteten die beiden auf mich. Melanie trug weiße Kniestrümpfe, winkelte das linke Bein in der Kniekehle ab, machte ein mürrisches Gesicht und runzelte die Stirn. Es war ein Sonntagmorgen gewesen, soweit ich mich erinnerte, gegen zehn Uhr. An einem Grab begann man zu singen, und die letzten zwei Schaufeln polterten auf den Sarg. Dann blieb es vollkommen still, so dass ich fast erschrak, so ruhig war es. Dann näherten sich mehrere Leute dem Ausgang, hinterher kamen zwei Schuljungen mit blanken Augen angelaufen, wie man sie nur bekam, wenn man heimlich über einen Witz lachte, während die Erwachsenen am Grab eine Trauermiene aufsetzten.
Von der Greisin mit dem Ledergesicht konnte ich den Blick nicht abwenden. Sie war eine Sehenswürdigkeit. Sie stach jedem ins Auge. Sie saß regungslos in einer grün-hölzernen Pförtnerloge, flankiert von zwei steinernen Engeln, deren Gewandfalten vom Mooswuchs befallen war. Hinter ihrem Häuschen ragte ein roter Obelisk hervor, der das Grab eines Präfekten schmückte. Wie ich hörte, war er ein Kind dieser Gemeinde gewesen, und die Nachwelt schrieb ihm unendliche Wohltaten zu. Die Greisin schien den Präfekten zu bewachen. Sie starrte jeden, der sich dem Friedhof näherte, mit Augen an, die kalt wie Murmeln waren. Aus ihrem Mund rann ein dünner Speichelfaden. Die weißen Haare hatte sie im Nacken geknotet. Ihre Hände waren von der Gicht verschrumpelt, und wenn man ihre aufgequollenen Knöchel anschaute, schmerzte es einen selbst in den Beinen. Sie trug zwar wattierte Pantoffeln und fleischfarbene Kniestrümpfe, jedoch ließen sie am Fuß einen Ring entzündeter Haut offen, als müsse die Schwellung selbst im Winter an der frischen Luft kühlen.
Trotz ihrer Hinfälligkeit hatte sie das Gesicht eines Raubvogels. Unter ihrem dunklen Kopftuch schauten zwei Locken-wickler hervor. Unergründlich heftete sie ihre weißen Augen auf jeden, der das Tor aufstieß, und mit einer Stimme, die trocken wie rieselnder Sand in einer Eieruhr klang, fragte sie, sobald sie mit ihren aufgestellten Eulenohren versuchte, den leisesten, heimlichsten Schritt aufzufangen: »Qui là là? Qui là là?« Wenn ein verwunderter Friedhofsbesucher sie fragte: »Und wer sind Sie, Madame?«, pflegte sie zu antworten: »Ich gebe acht, dass niemand eins von den Grabkreuzen stiehlt.« Aber die gleiche Antwort gab sie, egal was man sie fragte. Denn sie war stocktaub. Wenn man ihr versicherte, niemand denke daran, den Grabschmuck zu rauben, und der stattliche Obelisk hinter ihr sei eine wahre Augenweide, hellte sich ihr Gesicht auf. Dann krächzte sie leise: »Sie machen mir eine Freude.« Aber auch das war auswendig gelernt und bewies nicht, dass sie ein Wort verstanden hatte, sondern sie rasselte die Worte wie von einer verstaubten Schellackplatte ab.
Die arme Frau mit den Murmelaugen streifte an manchen Tagen ihre selbstgewählte Einsamkeit ab und sprach zutraulich die Besucher des Friedhofs an. Wie Brigitte mir erzählte, hatte sie einmal sogar den Pfarrer des Dorfes, der soeben eine Trauergesellschaft zum Grab begleitet hatte und mit zwei Ministranten im weißen Chorhemd zur Kirche zurückeilte, am Talar gezupft. Mit behutsam ausweichendem, nach allen Seiten spähendem Blick hatte sie dem Geistlichen zugeflüstert: »Mein Herr, ich kann Sie riechen. Sind Sie vor Gottes Altar getreten und verheiratet?« Der Priester war weder empört noch verdattert gewesen, sondern hatte ihr lächelnd die Hand getätschelt. Er wusste, dass die greise Frau blind und taub war wie ein Maulwurf. Mir war etwas Ähnliches passiert. Als ich zum ersten Mal auf dem Friedhof gewesen war, hatte ich unwillkürlich beim Anblick der Wächterin die Hand zum Gruß gehoben, um nicht für einen Grabräuber gehalten zu werden. Ich konnte nicht wissen, dass sie mich weder sah noch hörte. Als ich mich wieder in mein Auto setzte, dachte ich noch an das Mädchen mit den weißen Kniestrümpfen und dem angewinkelten Bein. Mit einem Mal erfüllte mich ein helles Behagen. Da mir die Worte fehlten, fing ich unwillkürlich an leise zu singen.
Die arme Frau sei von Kindheit an nicht nur ohne Gehör, sondern auch blind. Sie habe nie die Vögel singen hören oder die Farben der Impressionisten zu erkennen vermocht. Nicht einmal zwischen laut und leise oder schwarz und weiß könne sie unterscheiden, hatte Brigitte, meine Nachbarin, mir am selben Abend noch einmal anvertraut und sich bemüht, ihrer Stimme den Klang von Mitgefühl zu geben, als sei auch sie als Kind schwerhörig und farbenblind gewesen. Doch von Mitleid verstand sie wenig, und in meinen Ohren hatte ihre Empathie so unecht und oberflächlich geklungen, als poliere sie daheim einen Holztisch mit Nussöl. Dass sie eine volle Salve von Vogelstimmen und Impressionisten auf die blinde Frau abfeuerte, war starker Tobak!
Neben Brigitte hatte Melanie, die ich noch nicht kannte, an der Friedhofsmauer gewartet. Sie stand linkisch da, ein Bein im Knie angewinkelt, und gefiel sich darin, aller Welt zu zeigen, wie sehr sie sich langweilte. Eine Hand lag lässig auf dem Lenker ihres blau lackierten Fahrrads. Der alten Frau schenkte sie ebenso wenig Aufmerksamkeit wie mir. Abgesehen von ihrem abgewinkelten Bein und den weißen Kniestrümpfen maß ich schon bei der ersten Begegnung jeden Zentimeter am Körper der unbekannten jungen Dame ab. Insgeheim beanstandete ich, dass Brigitte dem hübschen Fräulein ein unpassendes schwarzes Hütchen auf ihr blondes Haar gedrückt hatte, vielleicht aus unbewusster Eifersucht. Das Hütchen, eine Pillbox à la Jacqueline Kennedy, sah aus wie ein umgestülptes Vogelnest. Außerdem waren Melanies Augen, Wangen und Lippen hinter einem feinen Schleier verborgen, als müsse sie bei einer Beerdigung ihre Jugend und Schönheit hinter einem Spinnennetz begraben. Ich hatte den beiden kurz zugenickt, keineswegs nur meiner Nachbarin, sondern auch dem jungen Mädchen, das stumm und reglos neben ihr stand und in der freien Hand eine weiße Lilie wie eine Totenblume achtlos an der Hüfte herunterhängen ließ und mit der anderen Hand immerzu den Lenker des Fahrrads streichelte, das wie ein Lebewesen, ein Hund, gegen die Friedhofsmauer lehnte.
Den Tag, an dem ich die alte Frau und das verrostete Tor des Friedhofs zum ersten Mal wahrgenommen hatte, würde ich nie vergessen. Es war der Tag, an dem ein seltenes Erdbeben den Erdboden im selben Augenblick erzittern ließ, als ich aus dem Auto stieg und den Fuß auf den Bürgersteig setzte. Ich beabsichtigte nicht, den Friedhof zu betreten und an einer Bestattung teilzunehmen. Denn ich kannte im Dorf noch keinen Menschen, der mich um Teilnahme an einer Bestattung bitten würde. Vielmehr wollte ich nur einen Straßenpassanten fragen, wohinaus es zum berühmten Cap Fréhel gehe. Ich hatte mich verirrt. Ein Navigationsgerät gab es in meinem alten Volkswagen nicht. Doch niemand fand sich, der einem Ausländer Auskunft erteilen wollte. Stattdessen begann die Erde zu beben, und der Himmel überzog sich mit einem Theatervorhang aus aschfarbenem Fahl. Das Sonnenlicht, das mich eben noch geblendet hatte, wurde jetzt durch dunstigen Nebel gefiltert.
Für bretonische Verhältnisse war es ein starkes Erdbeben gewesen, auch wenn man mit 3,5 auf der Richterskala nicht prunken konnte. Doch es genügte, um alle Passanten wie aufgescheuchte Hühner in sichere Unterkünfte zu jagen. Die Bretagne ruhte auf einem uralten Felssockel, beruhigte uns Ouest France. Tektonische Erschütterungen waren sehr selten, ebenso selten wie dichtes Schneetreiben im Winter. Dafür regnete es manchmal den ganzen Tag und die ganze Nacht grau wie Asche, so dass ich den Ausflug zum dreißig Kilometer entfernten Leuchtturm von Cap Fréhel und dem berühmten Vogelfelsen, auf dem die Kormorane brüteten, auf ein anderes Mal verschieben musste.
Zwei Monate später glitzerte im Dorf bereits die Weihnachtsbeleuchtung, und aus einem Lautsprecher am Kirchturm scholl melancholische Orgelmusik. Für mich vertropften die Tage wie Sirup. Anfang des Jahres war ich meinen Job losgeworden, und es gab nichts, überhaupt nichts in diesem armseligen Dorf, das meine Lebensgeister zum Vibrieren gebracht hätte. Nur die Kleine mit den weißen Kniestrümpfen hatte mein inneres Schwungrad ein wenig angestoßen.
II
Zwei Abende darauf sah ich das blau lackierte Damenfahrrad mit dem hohen Ledersitz und der Dreigangschaltung wieder, das gegen die Friedhofsmauer gelehnt gewesen war. An jedem Ort der Welt hätte ich es erkannt. Jetzt stand es vor der Hauswand meiner Nachbarn. Ich spürte, wie die Neugier in mir explodierte, und es war mehr als simple Neugier. Ich hatte mich sozusagen in den Radspeichen verfangen. Die hübsche Kleine musste ich unbedingt kennenlernen. Im Eilschritt überquerte ich die Straße und betrat den Vorgarten. Sie braucht neue Reifen, war mein erster Gedanke, als ich das Velo aus der Nähe betrachtete. Mit väterlichem Tadel das Gespräch mit dem Mädchen zu eröffnen, schien mir eine unverfängliche Vorgehensweise zu sein. Also fasste ich mir ein Herz – was konnte mir schon passieren? – und ging zur Tür. Wie ein Luchs hatte ich das Haus beobachtet und wusste, dass Gilles und Brigitte vor zwanzig Minuten mit ihrem Auto zum Bridgespiel in das drei Kilometer entfernte Nachbardorf Lancieux gefahren waren. Ihre Nichte musste also einen Schlüssel zum Haus besitzen. Durch das Fenster sah ich das junge Fräulein vor dem flackernden Kaminfeuer in einer Illustrierten blättern. Ich klopfte an die Haustür. Nach einer kurzen Wartezeit öffnete sie. Im matten Schein der Gartenbeleuchtung stand sie vor mir, hielt sich am Türrahmen fest, lächelte zurückhaltend und deutete mit dem Kinn einen Gruß an. Ich versuchte, die Verlegenheit zu brechen und sah mich unternehmungslustig um, dass ihr klar sein musste, wie vertraut mir das Haus sei. Ich nickte dem jungen Mädchen forsch zu.
»Sie halten mich bestimmt für einen Narren …«
Ich wusste nicht, welcher Hinterwäldler mir den albernen Satz in den Mund gelegt hatte. Die Bereifung ihres Fahrrads hatte ich vor Aufregung vergessen. Dass sie mich für einen Narren hielte, war das Zweitbeste, das mir einfiel. Das junge Mädchen, fast noch ein Kind, ein unerzogenes Ding, war nicht auf den Mund gefallen. Es maß mich von Kopf bis Fuß. Jetzt, da es in meiner verqueren Gesprächseröffnung die Unsicherheit spürte, fühlte es sich auf sicherem Terrain.
»Sie sind doch der von gegenüber, der Nachbar. Brigitte hat Sie mal erwähnt, so beiläufig«, sagte sie spöttisch und drückte die Illustrierte gegen ihre Brust. Ich nickte und bemühte mich um mein erprobtes Alltagslächeln, obwohl mir eine unerklärliche Hitze in die Wangen stieg.
»Sie sind doch Ausländer«, fuhr die Kleine herablassend fort, fast im Ton einer Anklage. »Ich tippe mal auf Engländer.« Das sagte sie mit Bestimmtheit. »Man hört es am Akzent. Die machen jetzt die ganze Bretagne unsicher. Überall kaufen sie Grundstücke auf.«
»Nein, no British, ich bin Deutscher.«
»Ach ja? Und … haben Sie auch einen Namen, Mister No-British?«
»Der Name ist das Wenigste, um mich zu durchschauen«, sagte ich, um Worte bemüht, die zum Grübeln anregten.
»Sie machen ein großes Geheimnis daraus. Aber ich wette, Sie haben einen kurzen Namen. Heißen Sie nicht Marc, Mon-sieur No-British?«
»Ach, Sie kennen meinen Namen? Ja, ich heiße Markus, also Marc, und das ist kein kurzer, dürftiger Name. Er ist durch das Evangelium geadelt.« Ich hätte gerade so gut Johannes oder Lukas sagen können. Beide Namen gefielen mir nicht weniger als Markus, und wäre ich bei meiner Taufe gefragt worden, hätte ich sie mir ohne weiteres verleihen können.
»Ach je. Ich merke, Sie sind kompliziert. Quasi ein französischer und ein deutscher Name im Doppelpack. Aber wir könnten Freunde sein. Sind wir hier in der Nachbarschaft nicht alle gute Freunde?« Bestimmt war es ironisch gemeint. Sie wusste von Brigitte, dass ich nur gelegentlich zu einem Höflichkeitsbesuch die Straße überquerte und die Nachbarn besuchte, die mir ihrerseits, wie schon erwähnt, noch nie die Ehre eines Gegenbesuchs erwiesen hatten. Ich ging an ihr vorbei ins Haus und setzte mich auf einen Stuhl, um klarzumachen, dass ich auch in Abwesenheit der Hausherren zu bleiben gedachte. »Und wie heißen Sie, Sie hübsche Klapperschlange?«
»Die Klapperschlange heißt Melanie. Und sie kann mit ihren Giftzähnen beißen. Und sie ist schon achtzehn.«
Lachend klopfte sie mit der Zeitschrift auf meine Hand. »Meine Tante meint, Sie seien ziemlich in der Welt herumgekommen. Da müssten Sie doch eigentlich ein Herr mit grauen Schläfen sein. Aber so sehen Sie gar nicht aus. Ich sage das so unverblümt. Aber auf mich machen Sie einen unverwelkten Eindruck. Bestimmt sind Sie noch keine fünfzig wie Gilles.«
»Na, da danke ich aber. Noch keine fünfzig …«
Die süße Droge Eitelkeit ließ mein Herz schneller pulsieren. Warum sollte ich einem netten, vorlauten Mädchen widersprechen, wenn es mir ein halbes Kompliment machte? Dass ich sogar zehn Jahre unter ihrer Messlatte lag, wen interessierte das?
»Das brachte der Beruf mit sich. Ich habe für eine Fluggesellschaft gearbeitet und habe deren Agenturen geleitet, zuerst in Kalifornien …« Ich versuchte, den überlegenen Globetrotter zu spielen.
»Wo die Mammutbäume wachsen«, unterbrach sie mich.
Ich hob erstaunt die Augenbrauen und nickte. Was sie nicht alles an Wissen in ihrem jungen Kopf untergebracht hatte! Dann fügte ich gedehnt hinzu: »Auch in Ägypten und Indien.«