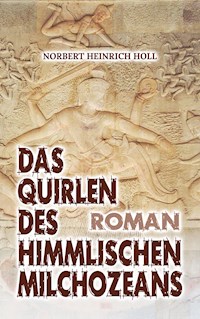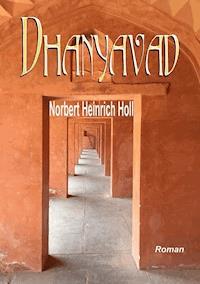7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jonas war mein bester Freund, obwohl ich ihn nur selten mit diesem Allerweltsnamen anredete, der sich in unserer Schulklasse eingebürgert hatte. Irgendwann hatte ich begonnen, ihn mit Johannes anzusprechen, seinem ins Taufregister und ins Buch des Standesamts eingetragenen Vornamen, und er hatte nicht abgewunken. Dazu war er wohl viel zu intelligent, ja ich möchte sogar behaupten, dass er mir in Bezug auf die menschliche Reife turmhoch überlegen war. Schulfreundschaften halten nicht immer ewig - das muss auch der Erzähler dieses Romans erkennen; und wenn sich eine Frau zwischen zwei Schulfreunde drängt, verschieben sich Prioritäten. Wege trennen sich, aber Erinnerungen bleiben. Doch sie verändern sich: Der, der sich in seiner Jugend unterlegen fühlte, meistert - wenn der Vergleich unwichtig wird - die Unwägbarkeiten des Lebens manchmal besser als jener, der damals überlegen schien. Doch das unsichtbare Band der Freundschaft fragt nicht nach Über- oder Unterlegenheit, nach Schuld und Vergebung. Es ist einfach da, auch wenn es verloren scheint ... Norbert Heinrich Holl beschreibt in "Johannes, der Ire" eine Coming-of-Age-Geschichte über das Hohe Lied der Freundschaft, die auch dann Bestand hat, wenn man glaubt, sie verspielt zu haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
I
Jonas war mein bester Freund, obwohl ich ihn nur selten bei diesem Allerweltsnamen nannte, der sich in unserer Schulklasse eingebürgert hatte. Irgendwann hatte ich begonnen, ihn mit Johannes anzusprechen, seinem ins Taufregister und ins Buch des Standesamts eingetragenen Vornamen, und er hatte nicht abgewunken. Dazu war er wohl viel zu intelligent – ja, ich möchte sogar behaupten, dass er mir in Bezug auf menschliche Reife turmhoch überlegen war. Ein Blick in seine ironisch blitzenden Augen genügte. Heute hatten wir uns verabredet und waren gemeinsam nach der Schule zu meinem Elternhaus geradelt. Als er sein Fahrrad gegen unsere Hauswand lehnte, sah ich zufällig, dass er zweimal nachgreifen musste, weil der Lenker immer wieder am glatten Verputz abrutschte. Die schöne Jugendstilfassade war vor zwei Wochen von Maurern verschandelt worden. Diese arbeiteten für ein Unternehmen, das von sich behauptete, sich auf die Modernisierung alter Häuser zu verstehen. In Wirklichkeit aber maßen sie den architektonischen Kunstwerken, die den Krieg überstanden hatten, keinerlei Bedeutung zu.
Die mit mythologischen Figuren, meist barbusigen Frauen übersäte Fassade hatten sie gefühllos abgeschlagen und durch nichtssagenden Rauputz ersetzt. Leider hatte ich vergeblich bei meinem Vater gegen den Kahlschlag protestiert, hatte ihn sogar eine Barbarei genannt. Doch mein Vater hielt Rauputz seiner kargen Nachkriegszeit für angemessener als den verspielten Jugendstil, der ihn, wie er nicht müde wurde zu behaupten, an seine düstere Kriegsgefangenschaft erinnerte. Wir hatten den zwanzigsten März, und die Uhr am Kirchturm schlug halb zwei. Das Schuljahr dämmerte seinem Ende entgegen. Ausnahmsweise schien die Sonne. Vom ständigen Frühlingsregen und dem rötlichen Nebel, der an anderen Tagen aus dem Schornstein einer nahegelegenen Fabrik aufstieg, blieben wir verschont. Zwei Nachbarinnen liefen mit klappernden Absätzen vorbei, die Arme mit Tüten voller Lebensmittel beladen.
Noch einmal griff mein Freund nach dem Lenker. Ich sah ihm zu. Jonas‘ Hände waren für mich durchsichtig. Hatte er Zauberhände? Denn einen Moment bildete ich mir ein, ich könnte durch sie hindurch noch immer die Kringel und Rosetten der altmodischen Stuckverzierung zählen, die inzwischen verschwunden waren. Vor undenklicher Zeit, in den Gründerjahren, hatten sie als modern gegolten, als Zeichen gediegenen Wohlstands. Jetzt waren sie beim Zerstörungswerk auf dem Schuttberg gelandet. Da schadete es nicht, wenn der Fahrradlenker dem Rauputz einen Kratzer zufügte. Mein Blick blieb an der Spitze von Jonas‘ Kinn hängen, die eine Vertiefung, ein Grübchen schmückte, wie früher bei Kirk Douglas, für den mein Vater geschwärmt hatte. Dann glitten meine Augen zu seinen Händen. Denn an seinen kräftigen Händen erkannte ich Jonas oder Johannes, ohne in sein Gesicht sehen zu müssen.
Mit seinen gespreizten Händen, wahren Pranken, vollführte er Kunststücke, die ihm keiner in der Klasse nachmachte. Jonas war der beste Turner in der Schule und konnte auf beiden Händen laufen und gleichzeitig aus den Kniegelenken mit den Beinen wedeln, und es sah aus, als gehe er auf dem Kopf. »Unser Kopffüßler tanzt seine Giraffenkür«, hatte unser Sportlehrer, der zufällig vorbeikam, anerkennend geschmunzelt. Jonas beherrschte die Rolle vorwärts und rückwärts. Er stand dreißig Sekunden auf einer Hand. Dann ließ er sich auf die Füße zurückgleiten, bewahrte Schweigen und blickte mit unentzifferbaren Augen um sich, als müsse er sich in der Welt erst wieder zurechtfinden. Wir Klassenkameraden schauten ihm bei seinen Kunststücken mit unverhohlener Begeisterung zu. In der Fußballmannschaft war Jonas unser begnadeter Linksaußen. Wenn wir gegen die Elf des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums antraten, das wir verachteten, weil es keine Altsprachler waren wie wir, sondern geistig unterbemittelte Neusprachler, erzielte er aus einer Körperdrehung heraus einen Treffer nach dem anderen. Jedes Mal rieb er sich zufrieden die Hände wie ein Bauarbeiter, der abends erleichtert nach der Arbeit heimkam.
Zudem war er in meiner Schulklasse derjenige, und das war in meinen Augen seine eigentliche Glanzleistung, der die besten Deutschaufsätze schrieb. Unser Deutschlehrer ließ sie sogar in der Parallelklasse herumgehen, damit jeder von den Blödmännern sich ein Beispiel nehmen konnte. Ich wunderte mich, wie alle diese Fähigkeiten in einen einzigen Kopf passten. Es war, als sei sein Hirn aus zwei Teilen zusammengesetzt, die nicht miteinander verbunden waren. Es musste wie der Kern einer Walnuss aussehen, deren Frucht durch ein dünnes Häutchen getrennt war. Hatte ich nicht mal eine Erzählung gelesen, die von Dr. Jekyll und Mr. Hyde handelte, von zwei unterschiedlichen Menschen in einem Körper?
Einmal hatte ich sogar gerüchteweise gehört, dass Johannes Gedichte schrieb, die er aber nur unserem Deutschlehrer zeigte. Vor allen anderen hielt er sie geheim. Nicht einmal darüber gesprochen hatte er, auch mir hatte er nichts erzählt. So standen solche Dinge zwischen ihm und mir, zwischen doch eigentlich unzertrennlichen Kumpanen.
»He da, ihr zwei!«
Vorgestern hatte der bissige Wolfshund geknurrt und die gelben Raubtierzähne gefletscht. Jetzt stand er da, mit tauben Kiefern, so hörte es sich an. Er hatte Angst vor uns. Er wirkte wie gelähmt und hielt den Kopf gesenkt, als verneige er sich ehrerbietig vor uns. Der Speichelfluss in seinem Mund war ausgetrocknet. Das Untier hatte die Gestalt des Büroleiters Kemmerling angenommen. Das war der Büroleiter des Notars Dr. Custodis, der das Erdgeschoss unseres Hauses gemietet hatte. In den beiden Räumen, unserem ehemaligen Wohnzimmer, dessen Fenster auf die Straße gingen, und dem früheren Esszimmer mit Blick auf den Hinterhof und in den Garten, hatte der griesgrämige Weißbart seine Amtsstube eingerichtet. Dr. Custodis wurde von seinen Klienten hinter vorgehaltener Hand ›Gott Sohn‹ genannt. Den Titel ›Gott Vater‹ hatte dreißig Jahre zuvor sein Vater getragen, auch er war Notar gewesen. Den Griesgram hatte ich einmal am Schreibtisch sitzen sehen. Er hatte sich ein samtenes Kissen untergeschoben, so dass er trotz seiner Kleinwüchsigkeit wie ein König auf seinem dunkelbraunen Lehnstuhl thronte. Sein Gesicht war schmal, dünn und blass wie Löschpapier. Er hatte stechende Augen. Es wunderte mich, woher sein ausgemergelter Körper die Kraft nahm, einen so giftigen Blick hervorzuwerfen.
Vorgestern also war der verdammte Wolfshund aus dem Haus gestürzt und hatte sich verbeten, dass wir den Fahrradlenker gegen das Haus lehnten und die Fassade zerkratzten. Johannes hatte ihn ein ›gesichtsloses Untier‹ genannt, weil er uns beim Schimpfen und Heulen nicht in die Augen zu sehen wagte. Er hatte vor dem Giftzwerg keine Angst.
Während der Jahre, seit sich das Notariat bei uns eingenistet hatte, war die Stimme des Wolfshunds immer böswilliger und rechthaberischer geworden, immer schriller. Manchmal klang er wie eine Kreissäge, als habe er es, wenn er uns anfauchte, mit halbtauben Schwachsinnigen zu tun oder müsse auch auf der Straße alle übertönen, die ihm nicht respektvoll zuhörten. Sein freudloses Schimpfen verrate ihn, meinte Jonas. Er sei doch bloß ein armes Schwein. Wenn er uns auf den Fahrrädern sähe, so jung, so mutvoll – tatsächlich, Johannes sagte ›mutvoll‹ und nicht ›mutig‹, was im Vergleich zu seiner Eigenschöpfung matt und farblos geklungen hätte –, dann werde Kemmerling bewusst, dass er seinen eigenen Lebensmut im Staub von Custodis‘ Büro vergeudet habe.
Wir fuhren fort, uns über den Kopf des Wolfshunds hinweg über ihn zu unterhalten. Mit geiferndem Maul hörte Herr Kemmerling uns zu. »Wer ist er denn?«, fragte mich Jonas. Ich merkte ihm an, dass er fast wie Kaiser Nero seinen Daumen nach unten gesenkt hätte. »Wenn wir ihm keine Bedeutung geben, hat er keine.« Ich fand es nobel, dass mein Freund, ohne es hörbar auszusprechen, den Plural benutzte und sagte: ›Wenn wir ihm keine Bedeutung geben‹, weil er mich mit dem Plural in seinen Schutz einbezog und den Büroleiter auch in meinem Namen in die Schranken wies.
»Den Lenker rammen wir heute aber nicht gegen die Hauswand.« Wieder hatte der zahnlose Wolfshund geknurrt.
Er hatte uns keinen Befehl erteilt, der ihm erstens nicht zustand, und über den wir zweitens lachen konnten. Es war etwas viel Schlimmeres, eine Feststellung, gegen die niemand einen Einwand erheben durfte. Er erteilte uns keine offene oder verschleierte Weisung. Er ersparte sich den Imperativ, der aus seinen wurmstichigen Zahnreihen lächerlich geklungen hätte. Er vermied den gezielten Singular, denn nur Johannes hatte den Fahrradlenker gegen die Hauswand gestützt, sondern benutzte den Plural, hinter dem sich alle feigen Übeltäter versteckten. Allein das eingestreute ›aber‹ ließ die imperative Zunge heraushängen. Es stellte das Geforderte als Tatsache hin, als etwas Unabänderliches.
Doch die Worte legten eine falsche Fährte. Der Mann machte sich wichtig, er wollte uns Angst einjagen. In Wirklichkeit machte er sich lächerlich. Sein Befehlston kam schlecht bei uns an. Solange mein Freund bei mir war, fühlte ich mich geschützt. Wenn er bei mir war, wurde das Wolfsgeheul zu einem Ereignis verkleinert, das keine anderen Spuren in mir hinterließ, als dass ich mich noch ein paar Tage daran erinnern würde.
Es war eine der Fähigkeiten meines Freundes, Geschehnisse zwar nicht zu verklären, doch ihnen Markierungen einzuhämmern, die sich dem Gedächtnis einprägten oder ihm entglitten. Johannes beherrschte mein Gedächtnis. Er belebte es und er löschte es aus. Auch diesen Kemmerling hatte er in meiner Fantasie verwandelt. So hatte ich ihn mir vorgestern im Bademantel vorgestellt, in einem Ding aus blassblauer Wolle mit kurzen Ärmeln, so dass man seine behaarten Affenhaare sah, die herrschsüchtig vor der Brust verschränkt waren. Aber auch diese Pose half ihm nicht. Er merkte, dass er keinen Vorwand hatte, sich länger auf der Straße herumzudrücken, und unternahm noch einmal einen Versuch, sich wichtig zu machen. Aber man konnte ihm ansehen, in welche Bedrängnis er außerhalb seiner Schreibstube geraten war. Im Büro konnte er nach Lust und Laune die Sekretärin des Notariats, das arme Fräulein Schütz, herunterputzen. Doch auf der Straße fühlte er sich zu schwach, um die brenzlige Lage zu meistern, in die er sich selbst gebracht hatte.
»Und du hast gar nix zu sagen? Du bist doch der Sohn unseres Vermieters«, giftete er mich mit letzter Kraft an. Dann gab Herr Kemmerling auf, streckte uns, es sollte wohl ein Zeichen seiner Friedfertigkeit sein, die leere Handfläche entgegen und trat den Rückzug an. Aber vorher, und um uns von seiner Niederlage abzulenken, schaute er besorgt zum Himmel auf und prüfte mit dem befeuchteten Zeigefinger die Windrichtung. Bald würde es wieder regnen, hoffte der Bürovorsteher, und mit der Dunkelheit würde sich die Kälte verschärfen. Auf Märzwetter war kein Verlass, zumindest schien er sich das zu wünschen. Denn bei Regen würden wir nicht im Freien stehenbleiben, die Fahrradlenker gegen die Hauswand lehnen und den frischen Rauputz zerkratzen!
»Verfluchter März«, murmelte er. »Verfluchter März.«
Als er zum Himmel schaute und seine Augen mit der Hand beschattete, sah ich, dass er die Armbanduhr am rechten Handgelenk trug. O Gott, auch das noch! Wahrscheinlich war der Kerl zu allen sonstigen charakterlichen Widerwärtigkeiten auch noch Linkshänder! Mit seiner verschleierten Drohung, seinem unangemessenen Imperativ, hatte er sich bei uns nicht durchsetzen können. Auch die Raummiete, die Dr. Custodis pünktlich an meinen Vater überwies, gab seinem Büroleiter nicht das Recht, die hechelnde Befehlszunge heraushängen zu lassen. Geschlagen zog er ab und knallte die geschnörkelte Haustür ins Schloss. Wenigstens die ins Eichenholz geschnitzten Figürchen hatten die Schändung unserer Hausfassade überlebt. Das Zugeständnis hatte ich meinem Vater abgetrotzt.
»Aber ich schlafe nicht mit ihr, nur um den Orgasmus zu bekommen«, hörte ich auf einmal meinen Klassenkameraden sagen. »Ich habe sie noch nie nackt gesehen. Wir haben nie darüber geredet, uns voreinander zu entkleiden. Ich glaube, das meiste ist erlogen, was man in Büchern liest und in Filmen sieht. Die Nacktheit ist nur vorgetäuscht oder erfunden, damit der Leser oder Zuschauer atemlos wartet und denkt: Jetzt kommt es zum Orgasmus. Ohne Orgasmus geht nichts in Plots. Literarisch gesehen ist der Orgasmus nichts weiter als eine Stimulanz, eine Droge, um den Kunden zum Konsum anzuregen.«
Was war in Johannes gefahren? Seine Stimme, sonst sonor und klangvoll wie die Stimme eines Wüstenpredigers, war plötzlich vorwurfsvoll getunt. Aber ich hatte ihm doch gar nicht widersprochen, auch wenn mir während seines Monologs der irische Engel im blauweißen Bademantel durch den Kopf geschwebt war. Wie hätte ich mich gegenüber dem erfahrenen Johannes äußern können, ohne seine Freundin jemals gesehen oder ihr die Hand gegeben zu haben? Nur aus seinen knappen Bemerkungen wusste ich, dass sie eine rothaarige Irin war. Ich glaubte, gehört zu haben, dass alle irischen Mädchen und jungen Frauen fuchsiges Haar hätten, wie wir in unserer derben Mundart sagten. Angeblich war sie bildschön, zartgliedrig und in Gälisch, einer mir unbekannten Sprache, die ebenso tot und schrottreif wie Latein war, überaus gewandt. Aber leider hatte ich sie niemals zu Gesicht bekommen. Jonas warf mir einen scharfen Blick zu, der mich traf wie ein Blitz, und mich entwaffnete, als hätte ich mich angemaßt, ihm oder der Irin den Orgasmus abzusprechen! Dabei erinnerte ich mich nicht, das verbotene Wort in den Mund genommen zu haben. War ich jetzt noch sein Freund, auch wenn ich dem zartgliedrigen Engel unbeabsichtigt zu nahe getreten war, mit einem Wort, das ich gar nicht über die Lippen brächte? Hielt mein bester Freund mich jetzt für einen Hurensohn, dem er nichts mehr anvertrauen konnte?
Damals war ich erst achtzehn Jahre alt, ging in die Oberprima unserer Lateinschule und war nach meiner Überzeugung als Mann voll erwachsen und ausgereift. Niemand war mir über, nicht meine Lehrer, nicht einmal mein Vater. Niemand – nur eben Johannes.
Ich hatte gehofft, dass er mir beim nächsten Mal an unserer Haustür noch weiter von der Rot- oder Fuchsfarbenen erzählen würde, von ihrer sexuellen Enthaltsamkeit, die dazu führte, dass er nicht den Orgasmus mit ihr teilte, sie nicht einmal entkleidet gesehen hatte, was immerhin weniger brutal klang, als wenn er sie als ›nackt‹ bezeichnete. Doch er schnitt das Thema nicht mehr an. Vielleicht misstraute er mir und hatte sich vorgenommen, nie mehr von der geheimnisvollen Irin zu erzählen, von der ich nicht wusste, ob es sie überhaupt gab, oder ob Johannes sie erfunden hatte, um mir zu imponieren. Oder er bedauerte inzwischen, dass ihm beim letzten Mal die Gäule durchgegangen waren, als er sie in allen Einzelheiten beschrieben hatte. Auch ich sprach ihn auf die Gälistin nicht mehr an. Denn mir war klar, er sähe darin einen Vertrauensbruch, der unsere Freundschaft ins Wanken brächte.
Nur Jonas gegenüber war ich bereit, mich geistig zu unterwerfen, obwohl er infolge des Krieges oder infolge anderer Unglücksfälle, über die er sich nicht ausließ, drei Schuljahre verloren hatte und schon einundzwanzig Jahre auf die Schultern gepackt hatte. Er war mir, wie ich spürte, weit überlegen. Drei Jahre waren wie ein Abgrund an Erfahrung, die er mir voraushatte. Du hast keine Ahnung, wovon du redest, besagte sein Blick, mit dem er mich von oben bis unten maß. Wage nicht von meiner rot- oder fuchshaarigen Irin zu reden. Du hast keine Ahnung, wie ihre Stimme klingt, wie die Schwingungen einer Stimmgabel, und von ihrem Geruch, ja, ich spreche von ihrem natürlichen Geruch, denn sie parfümiert sich nicht. Du hast keine Ahnung, wie perfekt sie Gälisch spricht.
Im selben Moment fiel mir ein, dass Johannes mir erzählt hatte, dass er neuerdings an einem Jahrhundertwerk mitarbeite, einem Wörterbuch für Gälisch. Ein irischer Priester, der Father Brown, hatte es vor hundert Jahren begonnen und bis zu seinem Tod den Buchstaben A zu Ende gebracht. Doch vielleicht war der ehrwürdige Vater einem Irrtum erlegen, wenn er die Erforschung des gälischen Anfangsbuchstaben A für beendet hielt. Johannes hatte abschätzig erklärt, jede Sprache sei ein Ozean der Ozeane, den kein Mensch mit dem Suppenlöffel seines Hirns ausschöpfen könne. Jetzt also war die irische Freundin an der Reihe, das Unmögliche zu bewältigen, die zarte Studentin, die sich nicht parfümierte und es aus Stolz ablehnte, sich wegen blöder Männer die Lippen anzumalen, als sei sie süchtig nach Küssen. Denn nun arbeitete sie seit zwei Jahren am Buchstaben B. Jonas hatte ihr zuliebe das C geschultert und stöhnte manchmal wie Sisyphus, wenn er den Stein bergauf wälzte.
Dass der mir turmhoch überlegene Sprachkünstler Johannes mich auf dem Heimweg von der Schule bis zu unserem Haus begleitete, an der Haustür stets etwa zwanzig Minuten für ein Philosophengespräch stehenblieb und dann weiter zu seiner eigenen Wohnung radelte, rechnete ich mir als Ehre an. Sie erfüllte mich mit Stolz, doch zugleich wunderte sie mich, weil ich den Grund meiner Vorzugsbehandlung nicht verstand. Das Gespräch mit ihm, sein gelegentlicher Hinweis auf die zartgliedrige Irin, sein Beistand, wenn der Wolfshund auf mich losschoss, gaben mir die Gewissheit, dass Jonas mich als Freund betrachtete. Ich schien ihm halbwegs ebenbürtig. Ohne blinzeln zu müssen, begegneten wir uns anscheinend auf Augenhöhe.
An diesem Mittag, als Johannes sein Fahrrad gegen unsere Hausfassade lehnte, diesem Meisterwerk der Gründerjahre, das mein Vater gefühllos dem Untergang geweiht hatte, wurde die unbekannte Irin, die Herrscherin und Siegelbewahrerin des Buchstabens B des gälischen Alphabets, erstmals unser Gesprächsthema. Dass sie in meiner Vorstellung sofort Gestalt annahm, obwohl ich sie nie gesehen hatte, war angesichts meiner Neugier kein Wunder. Zu sehr erregte alles, was mit meinem Kameraden zu tun hatte, meine Anteilnahme und Wissbegier.
Wir hatten beide, wie die Verhältnisse damals lagen, noch nie mit einem Mädchen geschlafen, obwohl wir uns aus biologischen Gründen, auf dem Höhepunkt der Testosteron-Produktion, ständig danach sehnten. Ich jedenfalls hatte keine Erfahrung und hatte noch nicht einmal ein Mädchen ohne BH umarmt oder geküsst. Ich hatte auch bei ihm meine Zweifel, als Johannes mir zum ersten Mal von seiner irischen Angebeteten erzählte, mit der er keinen Orgasmus erleben wollte. Nicht einmal ihren wahrscheinlich altkeltischen Namen hatte er mir verraten, obwohl ich glaubte, sein engster Vertrauter zu sein. Daher hielt ich es, wenn mich Zweifel überkamen, bei einem fantasievollen Menschen wie ihm nicht für ausgeschlossen, dass er mir etwas vormachte oder sich selbst, wenn er behauptete, die Irin sei seine Geliebte und künftige Ehefrau.
Dank der guten Beziehungen meines Vaters zur Postverwaltung, die eher in der Nähe von kleinen Bestechungen lagen, war es ihm gelungen, eine der raren und begehrten Telefonleitungen in unser Haus gelegt zu bekommen. Notar Custodis, unser gottähnlicher Untermieter, war natürlich auch mit einem Telefon versorgt. Aber das durfte unter Strafe niemand außer ihm und dem Büroleiter benutzen. Auch das Telefon meines Vaters war durch ein Vorhängeschloss gesichert. Doch manchmal vergaß er das Telefon, und das Schloss blieb auf dem Tisch liegen. Was für ein Tag der Freude! Nichts war befreiender, als zu telefonieren. Ich hätte Jonas anrufen können, um mich wie eine eifersüchtige Ehefrau von der Ernsthaftigkeit unserer Freundschaft zu überzeugen. Am besten würde ich ihn spät abends anläuten, wenn meine Eltern zu Bett gegangen waren. Aber alle Überlegungen scheiterten daran, dass das Haus, in dem Jonas wohnte, noch nicht ans Netz angeschlossen und mein Freund Jonas selbst um Mitternacht so unerreichbar war, als lebte er auf dem Mond. Wenn er infolge eines Wunders ein Telefon gehabt hätte, und wenn infolge einer weiteren überirdischen Intervention mein Vater vergäße, das Vorhängeschloss an die Drehscheibe zu heften, was hätte ich meinem Freund sagen können? Bestimmt wäre ich nicht mit der Tür ins Haus gefallen und hätte nach der Rothaarigen gefragt. Nicht einmal nach ihrem Make-up oder Körperduft hätte ich mich erkundigt. Aber hätte ich wenigstens, ohne seinen Argwohn zu wecken, fragen dürfen, ob er beim gälischen Buchstaben C Fortschritte mache?
Solche Überlegungen, Ausdruck meines Schwachsinns und meines Unterlegenheitsbewusstseins, wanderten nachts, wenn ich im Bett lag, durch meinen Kopf. Mein vom Halbschlaf zerknautschtes Gesicht spiegelte sich auf Jonas‘ dunklen Pupillen. Von Gälisch verstand ich rein gar nichts. Von Johannes wusste ich, dass man die Sprache vor zweitausend Jahren in Irland gesprochen hatte. Es war offenbar eine Vorform von Keltisch, eine total kaputte Sprache wie das Latein, das uns auf dem Gymnasium eingebläut wurde, ein Leichnam, der von Altphilologen künstlich am Leben gehalten wurde, um auf hochdotierten Lehrstühlen ein behagliches Leben zu führen.
Um die Irin in meine Erzählung einzufügen und sie zu einem fassbaren Wesen zu machen, muss ich wiederum mit Jonas beginnen, der allerdings in seiner Vielseitigkeit, seinen Fähigkeiten ebenso wie mit seinen Schwächen kaum fassbar war. Obwohl er soeben sein Fahrrad gegen unsere Hauswand gelehnt hatte und in Lebensgröße neben mir stand, bereitete mir allein das Wort ›Lebensgröße‹ Unbehagen. Denn Jonas war, was wir in der Klasse als ›abgebrochenen Riesen‹ bezeichneten, nicht über ein Meter siebzig hoch, stämmig, krummbeinig. Mit einundzwanzig Jahren hatte er noch glattes, dunkles Haar. Doch Geheimratsecken zeichneten sich über den Schläfen ab. Er trug Brille, beim Sport setzte er sie ab. Nur von mir wurde er mit seinem echten, biblischen Vornamen Johannes angeredet. Trotz der Merkmale, mit denen man sein Erscheinungsbild einkreisen konnte, bekam man ihn nicht zu fassen. Man hatte nur ein Stück von ihm in der Hand. Er entzog sich auch mir, als hielte ich einen nassen, schuppigen Fisch in der Hand, der plötzlich lebendig wurde und mir entglitt.
Ich weiß nicht, wie mein Freund an seinen Namen gekommen war, der in seiner Klangvollendung einem König oder Papst angestanden hätte. Denn von der Abstammung meines Idols wusste ich nichts. Seine Eltern erwähnte er nie, als sei er wie der biblische Joseph elternlos in einem Schilfbündel geborgen worden. Wenn ihn seine ärmliche Herkunft bekümmerte, zeigte er es nie und erinnerte so an Menschen, die an einer Krankheit leiden und nicht darüber sprechen wollen, da niemand ihnen helfen kann. Nur einmal hatte er mir achselzuckend und mit den Händen wedelnd zu verstehen gegeben, er wohne bei seinem Schwager, einem Gerichtsvollzieher. Die meiste Zeit fuhren wir freihändig, auch wenn wir die belebte Zülpicher Straße überquerten und die Palanterstraße erreichten, wo der berühmte Boxer Peter Müller wohnte. Den Boxer nannten alle wegen seiner krumm geschlagenen Nase ›de Aap‹. Manchmal stand er in Hemdsärmeln auf der Straße und winkte unbekannten Hausfrauen und jungen Mädchen zu und erbot sich, ihnen die Einkaufstüte zu tragen oder einen platten Fahrradreifen aufzupumpen. Einen Kilometer weiter kamen wir zur Nikolauskirche und dann zu unserer Lateinschule. An der Ecke zur Gustavstraße war es gewesen, da hatte Johannes mir achselzuckend und mit den Händen wedelnd gesagt, sein Schwager sei Gerichtsvollzieher. Oder hatte er Briefträger gesagt? Ich konnte mich nicht mehr erinnern. Die Tätigkeit des Schwagers war mir gleichgültig.
Der Name meines Freundes war mir hingegen keineswegs gleichgültig. Er war mir im doppelten Sinn wichtig. Denn nicht nur der Papstname Johannes erstrahlte für mich in Glanz, sondern auch Jonas, die alberne, im Klassenbetrieb geläufige Verkürzung, war ein würdevoller biblischer Name. Mein Freund hatte es gut getroffen. Jonas war der Prophet des Alten Testaments, der sich drei Tage im Bauch eines Wals ausgeruht hatte! Hatten gesalbte Häupter die Legende gestrickt, ohne zu wissen, dass der Walfisch mit seinem riesigen Maul nur winzige Meeresbewohner vertilgt, doch nie einen Menschen frisst? Meine Gedanken wurden träge. Die Frage schlief mit mir ein.
Seine schulischen Schwächen waren grenzenlos. In Latein und Griechisch, den Herausstellungsfächern unserer Erziehungsanstalt, war er eine Null. Seine Übersetzungen, ein hilfloses Stochern in der Brühe vage erinnerter Vokabeln, wurden vom Lateinlehrer zur Belustigung an die Tafel geheftet oder als Musterbeispiel der Unfähigkeit herumgereicht. Mathematik und Physik waren für Johannes Teufelsbücher mit sieben Siegeln. Es war ein Wunder, dass er es bis zur Prima geschafft hatte. Johannes verdankte es seiner einmaligen Begabung für moderne Sprachen. Er drückte sich nicht nur in einem flüssigen, fehlerfreien Englisch aus, sondern sprach auch ein geschliffenes Italienisch. Kein Mensch wusste, weshalb er auf Italienisch verfallen war, und nur ich wusste, dass er sich neuerdings die Zähne an der keltischen Ursprache, dem Gälisch, die Zähne ausbiss. Welcher Satan trieb ihn an?
Nur die Götter, die über die Reinhaltung der irdischen Sprachen wachten, mochten wissen, wie ihm die Sprachen im Haus des Gerichtsvollziehers zugewachsen waren. Weshalb sollte ich ihn fragen? Die Sprachen kamen und gingen. Sie entwickelten sich und verkümmerten wieder. Das Latein, das einmal die Welt beherrscht hatte, war zu einem Sprachkadaver geschrumpft, mit dem man sich abgab, um an unserem Gymnasium das Abitur zu bestehen. Andere Schulen gaben sich mit dem alten Kram nicht ab. Unsere Konkurrenz, das Friedrich-Wilhelm, begann mit Englisch. Dann konnte man zwischen Französisch und Spanisch wählen. Moderne Sprachen garantierten den beruflichen Erfolg, hieß es. Altsprachler würden bald auf den Totenacker eingestampft.
Manchmal nahm ich mir vor, meinen Fahrradbegleiter zu fragen, wie er an den Namen Johannes gekommen sei. Ich hätte ihm die Antwort schmackhaft machen können, dass auf unserem Gymnasium mit seinen fünfhundert Schülern nur er so heiße, dass er vielleicht sogar in der ganzen Stadt der einzige sei, der diesen großartigen Bibelnamen trage. Was hätte er wohl gesagt? Ich wusste es nicht. Denn ich wagte nicht, ihn zu fragen. Wenn ich neben ihm nach Hause radelte, gab es wichtigere Dinge zu besprechen. Neuerdings die Irin und das gälische Jahrhundertwerk. Ich schob die Frage auf die lange Bank. Und so blieb nicht aus, dass ich nach einiger Zeit eine seltsame Beobachtung machte: Je länger ich mit der Frage wartete – sie war nicht dringend, aber aufgeben wollte ich sie nicht –, desto mehr zweifelte ich, ob Johannes sie nicht längst beantwortet hatte und mir seine Antwort nur entfallen war.
Denn wichtiger als der Ursprung seines Apostelnamens war etwas anderes: Johannes, der mich täglich auf dem Heimweg nach der Schule seiner Begleitung und seiner philosophischen Eingebungen würdigte und mehrmals die fuchshaarige irische Fee erwähnt hatte, sprach und schrieb in seinen Schulaufsätzen ein so kraftvolles, leidenschaftliches Deutsch, dass unser Deutsch-Studienrat als Einziger im Lehrerkolleg die schützende Hand über den ungebärdigen Primaner mit den dicken Fußballwaden hielt. Im Griechisch-Unterricht verstieg sich Jonas einmal zu der Forderung – der Griechisch-Lehrer hatte den Gedanken gegenüber unserem Schuldirektor als ›ketzerische Anmaßung› bezeichnet –, die Erforschungen dorischer und ionischer Dialekte als nutzlose Zeitverschwendung über Bord zu werfen, Sapphos Gedichte in die Mülltonne zu kippen und den Trümmerhaufen Aischylos gleich hinterher. Der sinnlose Griechisch-Unterricht solle durch Hebräisch ersetzt werden, nicht weil der Feuer speiende Johannes zum Judentum übergetreten war, sondern weil es die Sprache des Erasmus von Rotterdam gewesen war, von dem wir eine Menge lernen könnten.
Für unseren Gymnasialdirektor Dr. Gernhold, einen starrsinnigen Westfalen, waren solche Forderungen Anathema. »Wer die Axt gegen Homer und Sophokles zu schwingen wagt, begeht pädagogischen Terrorismus«, wetterte er in seiner Neujahrsansprache, zu der sich alle Schüler, angefangen von den gutgläubigen Sextanern bis zu den aufmüpfigen Primanern, in der Aula versammelt hatten. Unser Musiklehrer schmetterte die Arie des Max aus dem »Freischütz« an die hallenden Wände, um der Warnung des Direktors weiteren Nachdruck zu verleihen.
Wie haben wir auf dem Heimweg über unseren armseligen Schuldirektor gewitzelt! Johannes meinte, Gerhold habe über der Stirn zwei Löcher, weil er sich beim Dozieren ständig an den Schädel greife. Gerhold war fanatischer Altsprachler. Wie hätte er sonst Direktor unseres Gymnasiums werden können? Der Umweg über den Schulleiter und die alten Sprachen eröffnete dennoch Zugang zu der rothaarigen Irin, mit der Johannes keinen Orgasmus erleben wollte. »Aileen hat mehr zu geben. Man muss sie lieben«, sagte er und blitzte mich herausfordernd an, obwohl ich Unsicherheit in seiner Stimme zu hören glaubte. Aileen? Aileen? Hatte ich mich da etwa verhört? War das der Name der Irin, die ich nie kennenlernen würde, weil Jonas mir eifersüchtig ihre Bekanntschaft vorenthielt?
»Sie hat mir gestern erzählt, demnächst fange sie mit dem Buchstaben D an«, sagte Johannes triumphierend. »Und dessen Wortbestand ist doppelt so lang wie mein kümmerliches C, mit dem ich nicht fertig werde.« Auch das hielt Jonas für nötig hinzuzufügen, um die Ehre seines Idols zu verteidigen.
»Tàirngidh mi thu«, hat sie gesagt.
»Taigid was …? Also nee!«, fragte ich zurück.
»Nein, sie hat es nicht zu mir gesagt, auch nicht zu irgendeinem Dreckskerl. Sie weiß gar nicht, wie sehr sie mich interessiert. Ihr Sprachwissen, meine ich. Sie hat es auf einer Sitzung unseres Redaktionsausschusses gesagt. Ach, davon habe ich dir noch gar nicht erzählt. Wir sind vier Leute. Zwei irische Studenten, Mathe und Chemie, ein englischer Studienrat und ich. ›Ich werde dich umarmen‹, heißt das auf Gälisch. Aber sie hat keinen von uns drei Männern gemeint, sondern den Buchstaben D.« Johannes räusperte sich, bevor er einen neuen Anlauf nahm. »Sie hat also nicht zu mir gesagt oder angedeutet: ›Ich will dich ficken‹.« Erneut kramte er in seinem Wortschatz. »Sie hat nicht gesagt: ›I want to fuck you‹.« Ich merkte, er wusste nicht, wie das unanständige Wort auf Gälisch hieß. Doch er hatte mir, als wir in die Josef-Stelzmann-Straße einbogen, Wörter zugerufen, teils auf Deutsch, teils auf Englisch, unanständige, verbotene Wörter, die ich zwar oft gedacht, aber nie laut ausgesprochen oder zu jemandem gesagt hatte, nicht einmal im Halbschlaf zu der Irin, die Johannes am besten mal übers Knie legen sollte, um ihr die Keuschheit auszutreiben. Als wir die Gleueler Straße erreichten, stellte ich mir vor, Aileen hätte im Redaktionsausschuss, ohne das Gesicht zu verziehen und jemand Bestimmten anzusehen, tatsächlich gesagt, deutlich verständlich, lässig, lasziv, ihrer selbst sicher: ›I want to fuck you‹. Und nicht nur das, sie hätte plötzlich einen grün-weiß-orange gestreiften Bademantel getragen. Einer schönen Irin waren die Worte unwürdig. Es waren Ausdrücke aus der Gosse. Ich hatte sie noch nie in den Mund genommen, weder wenn ich auf der Straße mit Nachbarsjungen Fußball spielte, und erst recht nicht zuhause, wo mein Vater mich sofort verprügelt hätte. Doch zugleich, inzwischen hatten wir mein Elternhaus erreicht, hatte ich die weiße Haut ihres mit kaum sichtbaren Sommersprossen übersäten Körpers zu berühren geglaubt, nur für eine Sekunde oder auch zwei (in meiner Fantasie waren zwei oder sogar zehn Sekunden ein und dasselbe).
Oder log er mich an, wenn er von ihr schwärmte? Wieder kehrte der Verdacht zu mir zurück. Vielleicht kannte er Aileen gar nicht. Er beschrieb ein Phantom, wenn er von ihrer hellen Haut erzählte und ihre espenfeine Zartgliedrigkeit rühmte, ihre klangvolle Stimme, die, wenn sie Gälisch sprach, den Tönen einer keltischen Harfe glich. War diese überirdische Erscheinung in Wirklichkeit ebenso unansehnlich wie Johannes? Kleinwüchsig, krummbeinig, flachbrüstig? Hatte er sich an sie herangetraut, weil sie keinen anderen Freund gefunden hatte? Verblasste das feurige Rot ihrer Haare, bei Licht besehen, zu fuchsiger Blässe? Ich wollte mir keine weiteren Grausamkeiten ausdenken wie zum Beispiel: Aileen leide an einem körperlichen Gebrechen. Sie hinkte, stotterte oder lispelte. Auch in Irland musste es solche Menschen geben, und junge Frauen waren nicht dagegen gefeit, von der Kinderlähmung zum Krüppel gemacht zu werden oder an einem Sprachfehler zu leiden. Ja, jetzt war ich überzeugt, dass Johannes mir den Makel aus Feingefühl verschwieg. Armer Freund! Fast wäre ich in Tränen des Mitgefühls ausgebrochen.
Diesmal hatte Jonas seinen Fahrradlenker nicht gegen unsere Hauswand oder die verschnörkelte Tür gelehnt, sondern in der Hand behalten, so dass der Notar, der trotz seines Alters noch über ein messerscharfes Gehör verfügte, kein kratzendes Geräusch wahrnahm und seinen bissigen Kettenhund, den Bürovorsteher, nicht hinauszuschicken brauchte. Da mein Freund an diesem Tag das gälische Wörterbuch emphatisch pries, war ich meistens zum bloßen Zuhören verurteilt. Abermals begannen meine Gedanken zu schlingern. Allmählich formte sich die Idee in meinem Kopf, ich könne Johannes heimlich zum nächsten Treffen des Redaktionskomitees folgen. Ich würde draußen warten, vielleicht im Schutz oder Schatten eines Baumes oder eines Mauervorsprungs.
Wie lange würde ich aushalten? Da meine Neugier stieg, wie die Quecksilbersäule im Thermometer bei einem Fieberanfall, würde ich notfalls zwei Stunden warten, bis das Komitee sich auflöste. Nicht nur die Studenten, der Studienrat und Johannes kämen heraus, sondern auch die zartgliedrige Irin. Im gelben Schein einer Straßenlaterne oder im blauen Glanz einer Neonröhre würde ich sie sofort erkennen, weil ich sie im Halbschlaf oft gesehen hatte. Die wöchentliche Sitzung des Redaktionskomitees war der schwache Punkt in ihrer Abwehr, die bröcklige Stelle in der Verteidigungsmauer ihrer Anonymität. Dort könnte ich ansetzen, wenn es stimmte, dass Aileen sich demnächst in den Buchstaben D verbiss. Ich könnte ihr in kurzem Abstand folgen. Sie wäre arglos, hätte nur gälische Vokabeln, die mit dem Buchstaben D begännen, im Kopf. Sie ginge zügig vor mir her, bliebe nur an roten Ampeln stehen. Ich könnte endlich feststellen, ob sie an einem Beinschaden litte, humpelte oder hinkte. Vielleicht würde sie unterwegs von einer Passantin angesprochen. Diese Frau fragte Aileen nach einer Straße. Wenn ich unauffällig heranträte, wäre es leicht, festzustellen, ob die Irin stotterte oder lispelte. Schließlich kam mir der Gedanke, es könne regnen. Aileen nähme ein Taxi oder einer der beiden Studenten, immerhin ihre Landsleute, würden sie in ihrem wackligen Citroen mitnehmen. Ich bliebe resigniert zurück.
Ich erwachte aus meiner Trance. »Was hast du gesagt?«
Johannes sah mich erstaunt an. »Mensch, ich rede seit zehn Minuten auf dich ein, und du hörst mir nicht zu.«
Es klang beleidigt.
Ich zog ein idiotisches Gesicht.
»Ich sagte: Jede Beziehung zwischen zwei Menschen, auch zwischen uns beiden, aber natürlich vor allem, wenn es um eine Frau geht, eine komplexe Frau wie die Irin, hat eine Probezeit, eine Testphase, voll von Zweifeln, Selbstzweifeln. Vielleicht haben beide Furcht vor Zurückweisung. Jeder zwingt sich dem anderen auf, ohne ihm wehtun zu wollen. Es liegt in der Natur. Man kann es nicht ändern, nicht per Knopfdruck abschalten. Es ist unser genetisches Erbe. Wie kann man sich sonst einem Menschen annähern, ohne ihn zu bedrängen, ohne Dinge von ihm zu erbitten, die er sonst nicht täte? Die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau beschränkt sich nicht darauf, die Frau ins Bett zu bekommen und mit ihr zu schlafen. Es geht nicht allein um die Arm-Schenkel-Schlinge, so erregend sie ist!«
Ein Speicheltropfen trat aus seinem Mundwinkel. Ich konnte es nicht glauben. Die Arm-Schenkel-Schlinge. Donnerwetter! Den Ausdruck hatte ich noch nie gehört. Ich ahnte, was Johannes damit sagen wollte, aber er hatte übereifrig gesprochen. Bestimmt hatte er an seine gälische Geliebte oder Nicht-Geliebte gedacht, mit der er keinen Orgasmus teilen wollte. Nun war der Ausdruck in der Welt. Nun war die Arm-Schenkel-Schlinge in mein Bewusstsein gepflanzt. Ich wurde sie nicht mehr los. Sie ließ sich nicht mehr beseitigen, nicht widerrufen oder ausreißen. Sie hatte Lebensrecht wie jedes andere Wort.
Selbst üble Schimpfworte wie ›Scheißkerl‹ oder ›Superarschloch‹ hatten ein Lebensrecht, auch wenn feine Leute sie nicht in den Mund nahmen. Jeder kannte die Ausdrücke, selbst Bischöfe und Notenbanker gebrauchten sie, wenn sie sicher waren, dass niemand ihnen zuhörte. Nur von einem Menschen wusste ich, dass er nie im Leben eine Obszönität von sich gegeben hatte. Es war Dr. Custodis. Doch selbst die feenhafte Aileen musste die Obszönitäten kennen, auf Englisch oder Keltisch. Ob das Wort ›Scheißkerl‹ schon den Weg ins gälische Wörterbuch gefunden hatte, das einstweilen nur aus zwei, drei Anfangsbuchstaben bestand? Eine wichtige Frage. Im Duden würde ich vergeblich die Arm-Schenkel-Schlinge suchen. Der Ausdruck weckte meinen Appetit. Ein mutiges, gewagtes, ein die Seele enthüllendes Wort.
Wer unter meinen Klassenkameraden hätte sich erkühnt, solch einen Ausdruck zu prägen? Gewiss, man konnte ihn mit einem höhnischen Lachen abfertigen. Aber ihn laut auszusprechen, nein, nicht nur auszusprechen, sondern ihn zu erfinden, zu erzeugen und neugeboren in die Welt zu entlassen, das konnte nur Johannes. Ich hatte in Vaters Brockhaus geblättert. Aber weder das deutsche Universallexikon noch die weltberühmte Encyclopedia Britannica, die ich mir in der Schulbibliothek ausleihen konnte, hatte die Arm-Schenkel-Schlinge entdeckt. Alle Wörterbücher der Welt strichen hier die Flagge.
Nur Johannes, mein bewunderter Freund, hatte einen funkelnden Gedanken in den Schmelztiegel geworfen und ihn als neue Wortprägung wie einen Goldklumpen aus dem kochenden Sud gezogen. Ich träumte mit offenen Augen.
Wie hypnotisiert starrte ich meinen Freund an. Statt auf sein neues Wort einzugehen, oder nach Aileen zu fragen, oder nach dem Jahrhundertwerk, dem gälischen Wörterbuch, rutschte mir heraus: »Johannes, also mal echt, du solltest Gedichte schreiben!«
II
Ich weiß nicht, ob es sich tatsächlich so abgespielt hat. Ich hatte nicht einmal zu hoffen gewagt, dass es überhaupt passierte, obwohl ich es mir herbeigewünscht und eigentlich fest damit gerechnet hatte. Aber so war es mir erzählt worden, und etwas Erzählen ist ein anderes Ding als die Wirklichkeit. Daher ließ mich anfangs angeborenes Misstrauen an der Verlässlichkeit der Informationsquelle zweifeln. Sie war mir suspekt. Ich wusste ja, denn Johannes hatte es oft behauptet, dass eine Erzählung stets das erzählte Ereignis verfälschte. Ganze Kriminalfilme waren über die Unzuverlässigkeit von Augenzeugen gedreht worden. Jeder erzählte etwas anderes. Weshalb sollte es diesmal nicht so gewesen sein? Jedes Mal fügte der Erzähler, der Berichterstatter, der lamentierende Minister dem Geschehnis erfundene Einzelheiten hinzu, bewusst oder unbewusst, willkürlich oder zwanghaft. Alles, was zum Ereignis zu passen schien, war dem Erzähler recht.
Wagte es aber ein Zuhörer, eine Frage einzuwerfen: »Aber, Herr Minister Soundso … aber Exzellenz Hochwürden … warum hat der Unglückselige denn nicht ...?«, war die Panne passiert. Schon war die Erzählung auf eine Fahrspur geglitten, die in die falsche Richtung führte. Wie auf Rückfragen zu antworten sei, dazu enthielt der Spickzettel keine Empfehlung. Dem Zuhörer, dem Zeitungsleser, dem Empfänger der Nachricht fiel es oft schwer, die Tatsachen von den Schlacken farbiger Ausschmückungen zu befreien.
Obwohl ich mir also immer vorgestellt hatte, dass es sich nur so oder nur ein wenig anders ereignen möge, konnte ich es kaum glauben, als das unfassbare Wunder eintrat: Johannes, mein bester Freund, aber auch der miserabelste Schüler der Klasse, bestand das Abitur, zwar äußerst knapp, sozusagen mit Schwefelgestank an den Fersen, aber immerhinque, wie der Lateinlehrer motzte. Die Klasse trampelte mit den Füßen Beifall.
Nachdem ich fast die ganze Nacht mit Überlegungen vertrödelt hatte, kam es mir morgens klüger vor, noch ein zweites Mal mit Albert, dem Großen, zu sprechen. Denn der war meine Informationsquelle. Er hatte es lauthals ausposaunt. Ich wusste, an ihm war alles falsch. Sogar sein Beiname. Denn er war nur mittelgroß, und das einzige Große an ihm war seine Klappe. Wir nannten ihn nur groß, weil es in der Klasse noch einen zweiten Albert gab, unser kleinwüchsiges Mathematikgenie, während der Große, eigentlich nur Mittelgroße, ein Dummkopf war.
Aber Albert der Große, der Nichtsnutz und Tollpatsch, durfte sich rühmen, mit Norbert, dem Sohn unseres Schuldirektors Dr. Gernhold, befreundet zu sein. Wir konnten die Echtheit dieser Freundschaft nicht überprüfen. Denn der junge Gernhold war drei Klassen unter uns, und wer von uns Oberprimanern hätte sich mit einem Untersekundaner abgegeben, außer unserem mittellangen Albert, der aus der Verbindung, angeblich war es eine vertrauensvolle Freundschaft, so viel Honig saugte wie möglich. Jetzt seine anzweifelbare Erzählung, warum Jonas das Abitur geschafft hatte. Als es mir nicht Albert selbst, sondern ein Zwischenträger weitererzählte, äußerte ich kein Wort. Ich gab nicht zu erkennen, dass der Bericht mich brennend interessierte, als verbrenne mein Gaumen, wenn ich nicht den appetitlichen Köder schluckte. Denn auch ich wusste, dass jede Neuigkeit, egal ob erfreulich oder entsetzlich, ein Köder war, den der Erzähler dem Zuhörer zuwarf, in der Erwartung, dass dieser ihn so gierig schluckte, als sei es ein Leckerbissen. Auch jetzt starrte mich der Zwischenträger fast lauernd an, als wolle er testen, ob er meine Wissbegierde richtig angebohrt hatte. Er wartete auf eine starke Reaktion, auf die gierig hervorschnellende, nach Hundeart hechelnde Frage: »Woher weißt du das?«, weil mir das, was er erzählte und wahrscheinlich mit einer Girlande von Lügen schmückte, das Wasser im Mund oder in den Ohren zusammenlaufen ließ. Ich machte ihm nicht die Freude, mir übertriebenes Interesse anmerken zu lassen, so wenig wie ich meine Zweifel zu erkennen gab. Doch der Zwischenträger wusste, dass ich mit Johannes eng befreundet war, jedenfalls enger, als die Freundschaft des mittelgroßen Albert mit dem unwürdigen Untersekundaner Gernhold sein mochte.