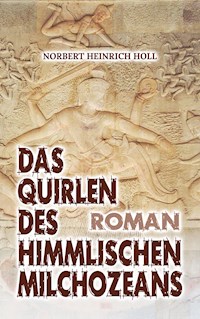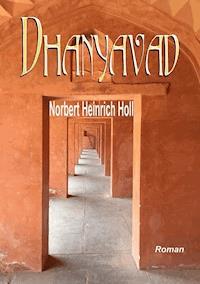6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der weiße Weg: Für den kleinen Jungen, der bei seinem Onkel aufwächst und den alle »Topert« - den Tollpatsch - nennen, ist es ein Sehnsuchtsort, der ihn aus der Enge des Moseltals in ein spannendes Abenteuer führen soll. Und so hofft er, an seinem achten Geburtstag diesen Weg gemeinsam mit seinem Onkel und seiner Lieblingscousine gehen zu können. Doch das Leben geht einen anderen Weg; die Familie wird von Schicksalsschlägen tief erschüttert - nichts bleibt so, wie es soll. Je mehr sich der Junge von der Familiengeschichte lösen will, umso tiefer wird er darin verstrickt. Auch Internat und Studium können nichts ändern. Erst die Begegnung mit der ebenso schönen wie rätselhaften Veronika öffnet ihm die Augen - auch wenn ihm nicht alles gefällt, was er zu sehen bekommt ... »Der weiße Weg« ist als Coming of Age-Roman eine Parabel auf unerfüllte Sehnsüchte und ihren Einfluss auf den Lebensweg eines jungen Menschen. Nicht umsonst hat Norbert Heinrich Holl das beschauliche Moseltal als Ort der Handlung gewählt. Es scheint seine Bewohner mit einem unsichtbaren Band festzuhalten: Viele Versuche, auszubrechen, enden doch mit der Besinnung auf die Heimat. Denn: Nicht alle Träume können wahr werden --- und manchmal ist das auch besser so ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
Kapitel XXII
I
Erst eine Kanonenkugel. Dann ein Trompetenstoß. Dann der Böllerschuss. Vom Dorf dröhnte es über den Fluss zu uns herüber, gefolgt vom feierlichen Bronzeton der Kirchenglocke. Umständlich wurde ein neuer Tag angemeldet. Es war Punkt acht Uhr morgens.
Ich hauchte mir auf die Fingerspitzen, die zu Eiszapfen gefroren waren. »Aber wann gehen wir denn endlich?«, fragte ich ungeduldig die Frau, die neben mir auf dem Schieferboden kniete. Es war meine Tante Charlotte, die ihre Schuhspitzen in den Schotter aus Splitt und Erde gegraben hatte, um am lockeren Hang nicht abzurutschen. Unermüdlich schob sie den grünen Blecheimer vor sich her, bis an den nächsthöheren Weinstock, grub ihn mit der Kante in den Boden, damit er waagrecht stand, und pflückte mit beiden Händen. Gleichmäßig griff sie zu, um die prallen, von Nieselregen oder Reif bedeckten Trauben vom Stock zu klauben.
»Wann gehe ich wohin?« Sie fragte unwirsch zurück. Sie tat wahrhaftig, als sei sie von der Schufterei schwerhörig geworden. »Aber doch den weißen Weg«, sagte ich patzig. Beim besten Willen konnte ich mir nicht vorstellen, dass meine Tante sich nicht mehr an ihr Versprechen erinnerte. Der weiße Weg war keine leere Schotterpiste und keine pockennarbige Asphaltstraße. Er war etwas Besonderes. Man konnte ihn deutlich von unserem Berg aus sehen. Irgendwie schimmerte er so weiß wie die Milliarden Kirschblüten, die im Frühling die Landstraße nach Bernkastel säumten. Natürlich dachte ich auch an das geblümte Leinenkleid, das Isolde mir zuliebe trüge, wenn sie mit mir meinen Geburtstagsweg wandern würde.
»Aber da gibt es nix zu sehen«, wies Tante Charlotte mich zurecht und richtete den steifen Rücken auf. »Was der Junge nur an dem Weg gefressen hat …«
»Hinter dem Berg das Riesenrad. Und wenn man ganz oben sitzt, kann man die Porta Nigra sehen.«
»Ein Riesenrad? Die Porta Nigra? Willst du von da oben bis nach Trier gucken?« lachte sie verächtlich. »Wie kommst du auf den Unsinn?«
»Ist kein Unsinn«, verteidigte ich mich. »Isolde hat es mir erzählt, und weil ich die Porta Nigra noch nie besucht habe, und überhaupt … ein Riesenrad! So ein gewaltiges Rad, da hinter dem Berg. Da führt er hin, der weiße Weg.«
»Unsinn«, schaltete sich Marianne ein, unser Herbstmädchen. »Die Isolde ist noch nie da drüben gewesen.«
»Bin ich doch«, rief meine hübsche Cousine von dem Weinstock über mir. »Das Fräulein Krings hat uns in der Klasse davon erzählt.«
Ich gab nicht länger Acht auf das Hin und Her. Damals befand ich mich im Alter der Gutgläubigkeit, und Wünsche beherrschten die Welt der Vorstellungen. Wunsch und Wirklichkeit waren zwei Seiten einer Medaille. Ich brauchte mir nur etwas heftig herbeizuwünschen, so war es schon da. Seit Isolde mir von dem Riesenrad erzählt hatte, war ich felsenfest überzeugt, dass ich am nächsten Geburtstag mit Onkel Andreas und meiner Lieblingscousine den Weg wandern würde. Wie ein weißes Band war er am anderen Ufer der Mosel um den Berg gespannt, hinter dem das Riesenrad stand und vielleicht noch anderer Kirmeskram. Außerdem wünschte ich es mir so heftig, dass er einfach wahr sein musste.
Nebenan arbeitete der Winzer Jacobi in seinem Weinberg. Ein hartherziger Mann mit grauem Stoppelhaar und buschigen Augenbrauen, die so stark wuchsen, dass er wie ein finsterer Bösewicht aussah. Stets hatte ich mich vor ihm gefürchtet. Auch jetzt fletschte er die Zähne, wenn er zu mir herüber blickte. Niemand mochte ihn. Niemand aus unserer Familie sprach mit ihm. Niemand sagte ihm guten Tag oder gab ihm die Uhrzeit heraus. Seit langem lag Onkel Andreas mit ihm überkreuz.
Auch der Winzer Jacobi hatte für die Traubenlese ein Herbstmädchen gedungen. Selbst wenn der Nebel in dichten Schwaden hing, wusste ich stets, wo sie arbeitete. Denn der Nachbar bestand darauf, dass sie beim Pflücken ein Lied summte, damit sie die Trauben nicht heimlich in den Mund steckte.
Tage und Wochen unmarkierten Glücks. Ein punktförmiges Leben. Von morgens bis abends ein geräuschloses Gleiten auf der Zeitachse. Das wohlige Daseinsgefühl der Ereignislosigkeit. Für mich, den siebenjährigen Schüler der zweiten Klasse, gab es noch kein Gestern und kein Morgen. Noch ertrank jeder Tag in unerschöpflicher Gegenwart. Zeit war wie süßer Sirup. Mein Bewusstsein ertrank darin. Keiner ahnte, dass über uns eine Drohung hing, gewaltig wie der Felsen der Geierslay, dem wir auf den Knien entgegenrutschten. Auch Onkel Andreas spürte es nicht in seinen grauen Haarspitzen, obwohl er sich im gesamten Weltall auskannte.
Früh am Morgen, kaum war ich ausgeschlafen, hatte zuerst der Böllerschuss und dann das Glockengeläute vom Turm der Pfarrkirche die Traubenlese eröffnet. Vor den Weinbergen warteten die Lastwagen mit den Bottichen und der Traubenmühle, um die Beeren zu Most und Maische zu zerquetschen. Um zu verhindern, dass Diebe unter dem Schutz der Dunkelheit die Reben abernteten, durfte vor dem Böller und Geläute bei Geldstrafe niemand den eigenen Weingarten aufsuchen. Jeder beobachtete den anderen mit Argwohn, damit niemand zu früh seinen eigenen Grund und Boden betrat. Auch Onkel Andreas hatte mit uns in der Kälte ausgeharrt. Erst als uns die Kanonenkugel um die Ohren flog, kletterten wir die Stützmauer hinauf, die Onkel Andreas’ Besitz vom Weg trennte. Auf halber Höhe konnte man den weißen Weg auf der anderen Seite der Mosel erkennen. Immer sah er blitzblank und sauber aus. Kein Auto, kein Fußgänger war zu sehen, als warteten alle darauf, dass ich den Weg an meinem Geburtstag mit Onkel und Cousine einweihte.
»Den weißen Weg da drüben.« Ich wies mit meinem Arm, der viel zu kurz war, um große Entfernungen abzugreifen, zum gegenüberliegenden Ufer. Dort drüben war der Berg noch höher als der, auf dem wir knieten, aber er trug keinen Namen. Er säumte die Mosel wie unserer auch, und so nannte ich ihn den Kestener Berg nach dem Dorf, das in der Nähe lag.
»Du hast es mir versprochen«, begehrte ich auf. »Und genau an meinem Geburtstag.«
»Ja, haben wir«, beschwichtigte mich Onkel Andreas, der ungern eine Gelegenheit ausließ, Tante Charlotte zu widersprechen. »Recht hat er, unser Topert, wir haben’s ihm versprochen.« Er nahm die Pfeife aus dem Mund und tastete die Hosentaschen nach Streichhölzern ab. Da ich mich in hoffnungsvoller Stimmung befand und vage Aussichten schon für Gewissheiten hielt, bedeutete das Versprechen meines Onkels nichts anderes als die nie in die Irre gehende Weissagung, dass wir alle an meinem nächsten Geburtstag den Ausflug unternähmen, auf den ich mich seit langem freute.
»Er ist ein Träumer«, versuchte mich in rührender Arglosigkeit meine Cousine Elisabeth zu trösten, die älteste Tochter meines Onkels, die mir den Verdruss auf der Stirn ablas. Dabei sah sie selbst so traurig und missmutig aus wie ein Pferd, das auf den Hafer wartet und dem sich eine leere Hand des Stallknechts entgegenstreckt. »Er hat doch so einen schönen Singsang in der Stimme.« Sie streichelte mir über den Kopf, als sei ich drei Jahre alt, und ich wusste nicht, ob es ehrenvoller war, als Träumer abgeschrieben zu werden oder als Tollpatsch. In meinen Augen waren beides ziemlich ehrenrührige Eigenschaften.
»Nächsten Januar regnet es bestimmt«, fuhr eine nörgelnde Stimme dazwischen. Meine Tante drückte ihren schmerzenden Rücken durch. »Um die Jahreszeit regnet es doch immer, und wenn die Eisheiligen pünktlich kommen, schneit es sogar.«
Am liebsten hätte ich Tante Charlotte wegen ihrer Grausamkeit meine Traubenschere in die Hand gestoßen. Mit ihrem Zwischenruf hatte sie meine ganze Zuversicht wieder zum Einsturz gebracht und mich daran erinnert, dass die Wünsche eines Siebenjährigen am Wetter und sonstigen Naturgewalten nichts ändern konnten. Die Einsicht, dass sie mit ihrer Gehässigkeit Recht haben mochte, verstärkte meine Wut. Nichts empörte mich mehr als das, wogegen ich nichts auszurichten vermochte.
Mir ging durch den Kopf, dass Tante Charlottes schlechte Laune nicht nur auf Böswilligkeit beruhte, sondern auf Kopfschmerzen oder irgendwelchen Zerrungen in ihren Armen und Beinen. Aber an ihrer Dauermigräne war ich doch nicht schuld! Statt am Ausflug teilzunehmen, sollte sie lieber zu Hause bleiben, sich eine Wärmeflasche auf den Bauch legen und ein Nickerchen halten.
Ich schob meinen Blecheimer ein Stück weiter. Obwohl er erst halbvoll war, wog er schwer wie Blei, weil alles nass war. In der Nacht zuvor hatte es Sturzbäche geregnet. Es hatte auf das Blechdach über meinem Zimmer getrommelt. Die Trauben fühlten sich noch immer wässerig an. »Regen hat uns noch gefehlt«, schimpfte Onkel Andreas. »Macht ein Grad Öchsle weniger.« Ich wusste, dass mit dem Öchsle nicht ein junger Ochse gemeint war, sondern das Mostgewicht, der Zuckergehalt oder etwas in der Art. Meine Gedanken verflüchtigten sich.
Ich schaute zu meinem Onkel auf. Er stand neben mir und hantierte an der Pfeife. Ich bewunderte den großen Mann. Zu ihm hatte ich mehr Vertrauen als zu Tante Charlotte, die mit ihrer quengelnden Stimme immer auf Streit aus war. Dass ich sie ständig an Zusagen erinnern musste, die sie mir in die Hand versprochen hatte, konnte ich ihr nicht verzeihen. Sie war bei der Arbeit dicht herangerückt. Ich merkte, dass sie unter ihrer alten Joppe und dem Wollpullover streng roch, nach Kuhstall oder ähnlichem. Dass Onkel Andreas – oder Andres, wie ich ihn gern nannte – mich als Topert bezeichnete, weckte allerdings gemischte Gefühle. Einerseits spielte er darauf an, dass ich ungeschickt war, mit den Händen oft in die falsche Richtung fuhrwerkte und als Tollpatsch galt, andererseits gab mir die Anrede ein Gefühl von Vertrautheit. Nur in Onkel Andreas’ Familie wurde ich so gerufen. Im Übrigen: Zwei Wochen zuvor war ich mit dem Herbstzeugnis nach Hause gekommen. Darauf bescheinigte mir unser Lehrer, der Herr Nikolaus Stauber, eine schöne Handschrift, brave Kenntnisse im Katechismus und leichte Fortschritte im Schönschreiben. Das hatte alle beeindruckt.
Der Lehrer ging am Stock. In seiner Jugend war er noch Soldat gewesen und am Knie verwundet worden. Seitdem humpelte er. Wir Schüler der ersten Klasse saßen ihm im Schulzimmer genau gegenüber und fanden ihn im Kopf ziemlich wirr. Oft kam er unrasiert zum Unterricht. Verheiratet war er ja nicht. Das war keiner von den Lehrern. Niemand passte daher privat auf ihn auf. Isolde, die über alles Bescheid wusste, äußerte mit spitzen Lippen, dem Lehrer Stauber sei es beschwerlich, sich mit zitternden Händen zu rasieren. Sich ein elektrisches Gerät anzuschaffen, halte er für reine Geldverschwendung. Das sei im ganzen Dorf bekannt, trumpfte sie auf.
Meine zweite Cousine, die sanftmütige Elisabeth, erzählte mir allerdings, der Lehrer sei noch kurz vor Kriegsende als Fünfzehnjähriger eingezogen und in Berlin verheizt worden. Ich verstand zunächst nicht, was sie mit Verheizen meinte. Es musste etwas Schlimmes gewesen sein. »Da wurde er zur Verteidigung der Hauptstadt abkommandiert«, erklärte sie, »ein Winzerjunge, gerade von der Volksschule entlassen. In Berlin haben sie diesen Kindern eine Panzerfaust in die Hand gedrückt. Damit hat der junge Niklas tatsächlich an einer Straßenecke einen russischen Tank erledigt.«
Ich hatte nur noch gestaunt. Dann hatte sich Isolde eingemischt. »Er hat vom Hitler noch persönlich das Eiserne Kreuz bekommen. – He, sag doch mal was!«, hatte sie sich an Onkel Andreas gewandt. Bewundernd hatte ich sie angestarrt. Von Hitler persönlich. Im Fernsehen hatte ich den nur einmal in einer Dokumentation gesehen, wie er kurz vor dem Ende die Wache inspizierte. Wehrpflichtige, die wie Schulkinder aussahen. Denen hatte dieser Hitler mit zitternder Hand den Kopf getätschelt, als sei er ihr Vater. Vielleicht war unser Lehrer unter ihnen gewesen, im allerletzten Aufgebot. Auf dem Bildschirm hatte ich ihn nicht wiedererkannt.
Außerdem war Isolde, von der Geschichte mit der Panzerfaust ganz abgesehen, nicht nur unheimlich klug, sondern in meinen Augen auch wunderschön, unberührbar und unnahbar in ihrer Makellosigkeit mit ihrem glatten, schulterlangen dunklen Haar und der hellen, fast weißen Haut. Wenn sie ihre haselnussbraunen Augen auf mich lenkte, wurde ich von Entzücken überflutet, auch wenn ich spürte, dass ihrem Blick eine Portion Spottsucht beigemischt war. Irgendwie wirkte sie mir entrückt, auch jetzt, als sie zum anderen Ufer hinüberschaute.
»Ja, ja«, stimmte Onkel Andreas unwillig zu. »Der Stauber ist zehn Jahre älter als ich. Den haben sie von der Schule aus zur Wehrmacht eingezogen. Das arme Schwein. Durfte wegen dem russischen Panzer noch für fünf Jahre im Kusnezker Becken nach Steinkohle graben. Dann haben die Russen ihn laufen lassen. War aber nur noch Haut und Knochen, als er im Dorf ankam. Das mit dem Diktator ist eben so eine Legende geworden. Aber ob die stimmt …?«
Ob die Legende stimmte oder nicht, war mir egal. Es genügte schon, dass sie überhaupt entstanden war, um den Lehrer auszuzeichnen. Doch Isolde runzelte die Stirn, weil ihre Behauptung angezweifelt wurde. »Jedenfalls trägt er einen Ring mit dem Eisernen Kreuz«, verteidigte sie sich. »Am linken kleinen Finger. Das habe ich selbst gesehen.«
»Also deshalb haben die Russen ihn nach Sibirien verschleppt, in ihre Bergwerke, in die Eiseskälte … das wusste ich nicht«, lenkte Elisabeth die Erzählung zurück in gesicherte Fahrwasser. »Kein Wunder, dass er wirr im Kopf geworden ist«, ergänzte Tante Charlotte schadenfroh, weil ihr eigener Mann nicht mehr eingezogen worden war.
Seitdem staunte ich den alten Stauber bewundernd an, selbst wenn er morgens unrasiert am Aborthäuschen wartete, wo es echt nach Scheiße stank, und den Schulhof beaufsichtigte. Sein Rücken war, wie ich jetzt wusste, vom Schleppen der Panzerfaust krumm gebogen. Den Straßenkampf konnte ich mir vorstellen. Denn im Fernsehen wurde oft eine Doku über die letzten Tage gezeigt. In der Schulklasse war ein Apparat mit Breitleinwand aufgebaut, den wir bei Onkel Andres nicht besaßen. Der Stauber hatte ihn angeschleppt, damit wir wüssten, wie es in Deutschland zugegangen sei. Er könne es ja selbst kaum glauben, hatte er geseufzt.
Es gab noch mehr Geheimnisse, sogar in unserer Familie. Isolde hatte sich einmal verplappert und es mir verraten. Top secret hatte sie gesagt. Ihr Vater hatte nach dem Wunsch seiner gottesfrommen Mutter nämlich Theologie studieren sollen. Er hatte das Priesterseminar in Trier besucht und dort tausend langweilige Vorlesungen, Frühmessen, Bußübungen und Exerzitien mitgemacht. Eines Morgens war er durch die Altstadt gebummelt und hatte ausnahmsweise ein Café vor dem Roten Haus am Markt besucht. Und da war er beim Anblick einiger wie die Gänse schnatternder Mädchen vom Blitz getroffen worden.
»Vom Blitz getroffen?« Ich erschrak.
»Na ja, so eine Redensart.«
Und dann erfuhr ich, dass Onkel Andres noch rechtzeitig vor dem ersten Profess dem Seminarleiter, dem Regens, gebeichtet hatte. Es habe ihn überkommen, so hatte er angeblich gesagt, gerade in dem Moment, als er im Café ein Vanilleeis gelöffelt habe. Der Regens saß, auf ärztlichen Rat, in einem mit gefilterter Luft beströmtem Büro. Denn er war um die sechzig Jahre alt, hatte ein durchgeistigtes Gesicht, litt an Gastritis und wurde von den Seminaristen gemieden, weil er schlechten Atem verströmte. (Isolde drückte sich salopper aus.) Mit Hochzeiten, Beerdigungen, Taufen und Katechismus-Unterricht gab er sich nicht ab. Er meißelte am Charakter seiner Theologiestudenten. Wenn er auf der Kanzel stand, mit seinem asketischem Intellektuellengesicht, fand manch einer, dass er hochwohlgeboren aussah, ein Fürst des Geistes. Was Andreas jetzt dem Regens beichtete, hörte er nicht gern. Draußen vor dem Fenster stürzte unerwartet ein Regenguss herab, als müsse die Sünde des Seminaristen vom Erdboden gewaschen werden. Der Regens wollte es nicht für wahr halten und fragte, was ein Seminarist mit dem Bürgercafé und dem Vanilleeis zu tun habe. Als der Regen schlagartig aufhörte und brennender Sonne Platz machte, wurde der Genuss von Speiseeis allerdings verständlicher.
Es sei das ungewohnte Kitzeln, antwortete der Seminarist, ohne auf die Frage direkt einzugehen. An dieser Stelle geriet das Sündenbekenntnis ins Straucheln. Er habe das junge Mädchen als ein Nachbarskind aus dem eigenen Dorf erkannt. Aber ein Kind sei sie nicht mehr gewesen, sondern, er hatte nach Worten gesucht, eher eine erwachsene Frau. Vor dem Roten Haus habe sie eine Schnute gezogen und auch ihn wiedererkannt, und dann sei sie auf hohen Absätzen davon geklackt.
Der Regens habe da gesessen wie vom Donner gerührt, lachte Isolde. Erst habe er nichts gesagt, nur zum Fenster raus gesonnen, ohne am Himmel ein Zeichen des Trostes zu finden. Dann habe er sich dem Beichtkind zugewandt.
Das folgende, betonte Isolde, wusste sie aber von ihrer Mutter. Er sei bereit, die schmückenden Beiwörter zu überhören, die im Seminar keinen Platz hätten, hätte er erklärt. Er wisse auch nicht, was mit klackenden Absätzen gemeint sei. ›Das sind ganz und gar falsche Töne, mein junger Freund‹, hätte der alte Bock gewettert und den Seminaristen daran erinnert, dass schon im Alten Testament von Frauen verächtlich gesprochen werde, eigentlich wie von Wegwerfware.
»Das ist es ja, die schreiende Ungerechtigkeit«, wäre ihr Vater explodiert. Die Frauenfeindlichkeit alter Schriftgelehrter sei schuld an dem unverdaulichen Prophetendeutsch, das denjenigen, der nach der Wahrheit suche, an ihren Weissagungen zweifeln lasse. ›Hat unser Herrgott nicht beide Geschlechter zu gleichen Körperhälften geschaffen? Hat er den Männern nicht Kraft und Schneid verliehen, und den Frauen die Schönheit, mit der sie Männer in den Wahnsinn treiben?‹ Der Regens hätte über den kühnen Zirkelschluss lange gegrübelt und nur Rätselworte gefunden: ›Das Alpha und das Omega reichen tiefer als jedes menschliche Gefühl.‹ Trauer sei aus seinem Mund gequollen, wie dunkles Harz aus einer Baumwunde, hätte ihr Vater ihrer Mutter erzählt, und die hätte es ihr anvertraut. ›Des Menschen Zweifel sind Brosamen vom Tisch des Herrn‹, hätte er hinzugefügt und neue Dunkelheit der vorausgegangenen aufgeladen.
Der Seminarist sei verstummt, nicht aus Unterwürfigkeit, sondern voll Erstaunens. Denn die Lippen des Regens hätten sich tonlos bewegt, wie die Kiemen eines Fischs. Bei diesem verstörenden Anblick hätte es ihn nicht länger in der Studierstube gehalten. Ohne das Urteil abzuwarten, sei er wie benommen hinaus ins Sonnenlicht getaumelt und hätte die Theologie in den Staub der Straße geschmissen. Seiner Mutter, also ihrer Großmutter, der Bäckersfrau, hätte die Enttäuschung ja glatt das Herz gebrochen.
Aber das war nicht das ganze Geheimnis, das auf unserer Familie lastete. Onkel Andreas stand ein schwieriges Leben bevor. Wie sollte er ahnen, dass aus seiner zarten Braut Charlotte im Lauf von dreißig Jahren und nach drei Kindsgeburten meine grantige Tante entstehen würde? Bewundernd blickte ich jetzt zu ihm auf, wie er da im Weinberg stand und die Pfeife stopfte. Und zum ersten Mal merkte ich, dass seine Finger steif von der Gicht wurden. Was für ein mutiger Mann!, dachte ich. Wie freundlich hatte er mich in seiner Familie aufgenommen. Noch einmal streichelte er mir über den Kopf und sagte mir eine glänzende Zukunft voraus.
Abermals dröhnte ein Böller durch das Tal. Es war genau zwölf Uhr. Wir mussten den Weinberg räumen.
II
Mit Onkel Andreas und seiner Familie hatte ich wirklich Glück gehabt.
»Lehrer oder Finanzbeamter.« Wir saßen beim Mittagessen. Er schöpfte Linsensuppe aus der Terrine. »Oder sogar Häär hier im Dorf«, womit er den Pfarrer meinte. Aber gleichzeitig lachte er mir schief über den Tisch zu, als traue er seiner eigenen Weissagung nicht. Sein Blick irrte zur Tür. Nebenan lag das Gelehrtenzimmer, wo seine Sünden begraben waren. Vielleicht erinnerte ihn mein unschuldiger Blick an die Vergangenheit, an den Verrat, den er an Gott und seiner Mutter verübt hatte. Ich kannte das Zimmer und hatte es oft betreten. Bücherregale aus dunkel gebeizter Eiche hingen an den Wänden. In einer Vitrine prangten ledergebundene Wälzer in Latein, Griechisch und sogar Hebräisch. Als Seminarist hatte er sie auswendig lernen müssen. Als er das Studium aufgab, wagte er nicht, sie wegzuwerfen. Jetzt dämmerten sie als Relikt einer glücklosen Lebensphase vor sich hin. Ich liebte den säuerlichen Geruch der Lederrücken. Die abgestandene Luft, in der Staubkörner wie Goldpunkte tanzten, störte mich nicht. Manchmal dachte ich, sie dufte nach geheimnisvollen Städten, nach Babylon und Mesopotamien. Der Geruch entführte mich in Galaxien, von denen sogar der weltberühmte Kepler noch nichts geahnt hatte. In meines Onkels Gelehrtenstube schnupperte ich Wissenschaften, die ich später studieren könnte. Alles Unbekannte und Untergegangene erschien mir erreichbar, wenn ich vor den in Gold betitelten Buchrücken stand.
Dass Onkel Andreas alles hinter sich gelassen hatte, nur wegen Tante Charlotte, imponierte mir. Ich sagte nichts und hielt den Blick auf den Teller gesenkt. Isolde hatte mir manches anvertraut. Daher kam mir, als Onkel Andres mir jetzt gönnerhaft weissagte, aus dem Topert werde mal was Großes, ein Steuerberater oder Lehrer, was ich auf keinen Fall werden wollte, oder sogar Pfarrer im Dorf, kam es mir wie eine Blasphemie vor. Während ich brav die Suppe aß, maulte Tante Charlotte: »Setz dem Jung’ nur keine Flausen in den Kopf.« Vielleicht dachte sie nicht an mich, sondern an ihre Tochter Isolde. Schwarzhaarig und braunäugig wie die Haselnuss saß sie mir gegenüber und zwinkerte mir zu. Seit langem keimte in ihr die Hoffnung, dass sie eines Tages einen steinreichen Winzersohn als Verlobten ins Haus brächte. Das wusste ich. Dann müsste sie nicht jeden Morgen in Herrgottsfrühe aufstehen. Denn mit der Moseltalbahn, deren Dampflokomotive heulend und pfeifend am eintönigen grünen Teppich der Weingärten entlang schaukelte, fuhr Isolde täglich nach Bullay, wo sie als Bürolehrling bei der Zentralverwaltung der Bahngesellschaft eingestellt worden war. Aber ich wusste es. Mir allein, dem als Topert belächelten Vetter, hatte sie anvertraut und überlegen dazu gelächelt, weil sie es für beschlossene Sache hielt. Denn während der Zugfahrt schwelgte sie in sehnsüchtigen Vorstellungen, was sie aus ihrem Leben machen würde. Eine gute Partie aus dem Dorf genügte ihr nicht. Entweder würde sie in zwei oder drei Jahren in Bernkastel zur Weinkönigin gekürt und führe im Festwagen durch die Stadt oder träte als Karaoke-Sängerin in Trier auf oder – und das war die beste Option – sie würde einen Sohn der von Schorlemers heiraten. Die besaßen in Lieser ein hochherrschaftliches Schloss, in dem angeblich vor hundert Jahren der Kaiser abgestiegen war. Als künftige von Schorlemer führe sie in einer weißen, mit Nelken geschmückten Kutsche zur Basilika von Sankt Paulin, wo sie vom Trierer Bischof getraut würden.
Mein Onkel gebot seiner Frau Einhalt. »Hack nicht auf dem armen Bub herum«, gebot er. So sehr ich mich freute, dass er für mich Partei ergriff, verstand ich nicht, warum er mich einen armen Bub nannte. Vielleicht hatte er an meine Mutter gedacht. Vor langer Zeit – ich war erst drei Jahre alt – war sie fortgegangen, wie mein Vater mir erklärte. Sie war eine kränkliche Frau gewesen, an die ich mich kaum noch erinnerte. In der Waschküche hatte sie mir mit zittriger Stimme Gedichte aufgesagt, Balladen von Schiller und Uhland. Die hatten sich mir eingeprägt. Inzwischen wusste ich, dass die Mutter nicht fortgegangen, sondern eines natürlichen Todes gestorben war, an Lungenentzündung oder Krebs oder so etwas, gegen das kein Kraut gewachsen war.
Mein Vater arbeitete seitdem als Auslandskorrespondent bei einer Zeitung und wohnte in einer Stadt, wo es nur gelbe und braune Menschen gab. Isolde hatte grinsend hinzugefügt, die Frauen seien üppig gebaut und ziemlich sittenlos. Es war kein Wunder, dass er mich Onkel Andreas, seinem Bruder, in Obhut gab. Wie lange die Obhut dauerte, wusste niemand, nicht einmal Tante Charlotte, die überall das Gras wachsen hörte und sich bezüglich meines Bleibens nur in Mutmaßungen erging.
Mit zittriger Stimme bat ich Isolde, mir das Salzfass herüberzuschieben. Ich fragte sie hoffnungsvoll und zugleich eingeschüchtert. Die Cousine war in meinen Augen der Inbegriff aller Schönheit und mit vierzehn schon doppelt so alt wie ich. Elisabeth, die ältere Schwester, hielt sie für ein verzogenes, schnippisches Wesen, das sie mit seiner Sprunghaftigkeit oft zur Verzweiflung brachte. Onkel Andreas hielt inne, das Streichholzflämmchen für seine geliebte Pfeife zu entzünden, weil ich noch nicht zu Ende gegessen hatte. »Weiß Gott, was der Jung’ mit so viel Salz anfängt!« Isolde lachte anzüglich, und Tante Charlotte reckte ihren krummen Rücken und ließ sich hundert Dinge einfallen, um einen Nichtsnutz wie mich zurechtzuweisen.
Missmut kochte in mir hoch. Wenn ich die Augen senkte und nichts anderes vor mir sah als den weißen Tellerrand, dachte ich an das Tal, wo sich der Morgennebel längst gelichtet hatte. Dort konnte ich den Blick über den schönen Fluss schweifen lassen. Obwohl ich den Salzstreuer regungslos in der Hand hielt, waren mir plötzlich Flügel gewachsen Ich fühlte mich wie ein Greifvogel, ein Falke oder Adler, der in die Luft aufstieg und zum anderen Flussufer rauschte. Alle hier am Tisch würden Augen machen!
Doch sogar der Berg, in dessen Schiefersplitt Tante Charlotte ihre schmerzenden Knie und Onkel Andreas seine Nagelschuhe ab acht Uhr morgens gebohrt hatte, war etwas Besonderes. Das war die Geierslay. Unterhalb des Fichtenhains lag eine gewaltige Höhle, die Hunderte Meter tief durch Basaltgestein führte. Während der letzten Kriegstage hatten Leute aus dem Dorf dort Schutz gefunden. Das erzählte mir Onkel Andreas, der als Kind mit seinen Eltern hineingeflohen war. Nach dem Krieg hätte sogar eine Suchmannschaft erkundet, wie die Grotte tektonisch entstanden sei. Vielleicht hatten die Geologen auch gehofft, nebenbei einen Schatz zu entdecken. War nicht oft von Nazigold die Rede, nach dem die Amerikaner überall geforscht hatten? Angeblich hatte die Wehrmacht Gemälde, Schmuck und gefälschte Banknoten versteckt. Warum nicht hier in der Höhle? Doch statt Kostbarkeiten zu entdecken, sei man auf menschliche Skelette und die Reste von Arbeitskleidung gestoßen, Überbleibsel von Kriegsgefangenen, denen die Flucht gelungen war und in der Höhle ihr Ende durch Hunger und Durst gefunden hatten. Niemand hatte den Fund untersucht. Der Krieg war endlich vorbei. Er hatte die Deutschen Millionen Opfer gekostet. Da kam es auf zwei Ausländer nicht an. In den Wirren der Nachkriegszeit raffte sich niemand auf, die Gebeine zu bergen und mit Würde zu bestatten. Niemand kam auf den Gedanken, die Kleidung zu untersuchen, um die Identität der Toten festzustellen, auch die französische Besatzungsmacht nicht, die später die Amerikaner ablöste und ins Dorf einrückte. Onkel Andreas zuckte jedes Mal, wenn er von Franzosen sprach, verächtlich die Achseln, als könne man von ihnen nichts anderes erwarten als Schlamperei. Wahrscheinlich geisterten die Toten seitdem als unerlöste Seelen durch die Höhle, hatte er mit hintergründigem Lachen gemeint.
Einmal war er mit mir in die Höhle gestiegen. Die Öffnung war schwer zugänglich, weil manchmal von der Wölbung Felsbrocken herabstürzten und den Weg versperrten. Die Ausmaße des Erdlochs hatten mir Angst eingeflößt. ›Ja, da hast du recht‹, hatte mein Onkel gesagt. ›Angst hat uns damals hineingetrieben, und sie ist nicht von uns gewichen, weil wir den Fels über uns hängen sahen.‹ Erleichtert war ich zurück ins Freie getreten. Wie von selbst hatte sich mein Blick auf den weißen Weg gerichtet, der auf dem anderen Ufer sichtbar war. Ich brauchte es nicht laut auszusprechen. Mein feinfühliger Onkel wusste, was er für mich bedeutete.
›Aber wo führt er hin?‹, hatte ich ihn gefragt, um von den unerlösten Geistern wegzukommen. Durch dünne Nebelschwaden war zu erkennen, dass der Weg erst am Flussufer entlangführte, dann im rechten Winkel abzweigte und in einer Kurve hinter dem Berg verschwand, wo angeblich das Riesenrad auf mich wartete. Zwei Kilometer flussabwärts kam er wieder zum Vorschein und schmiegte sich so eng an die Krümmungen und Buchten des Flusses, als hätte er sich nie von ihm getrennt. Was sich wirklich hinter dem Berg verbarg – an das Märchen vom Riesenrad glaubte ich nicht –, schien niemanden zu interessieren. Selbst mein stattlicher Onkel Andreas hatte nie den Berg umrundet. Streng hatte er auf mich herabgeschaut, weil ich einfach keine Ruhe gab. Sein Blick hatte mich eingeschüchtert.
Auch jetzt, da wir am Esstisch saßen, war ich mir der Wankelmütigkeit seiner Wertschätzung bewusst. Wie konnte er mich abwechselnd einen Tollpatsch nennen und mir gleichzeitig den künftigen Pfarrer bescheinigen? Da er dicht bei mir saß und noch immer mit der Pfeife hantierte, gab ich einer verzweifelten Regung nach und umklammerte seine linke Hand, als müsste ich mir seine Liebe erhalten. Über die Suppenterrine hinweg roch ich das Tabakaroma, das an seiner Pfeife hing. Es war mir vertraut, auch der beizende Geruch des abgebrannten Streichholzes. Beides prägte mir das Gefühl ein, mich für alle Zeit auf diesen Mann verlassen zu können.
»Der Bub ist ja rappeldoll«, sagte Tante Charlotte verächtlich und begann, die Teller abzuräumen. Isolde half ihr dabei und zog heimlich ihren Schmollmund.
Sah der Weg nicht aus, als sei er mit Puderzucker bestäubt?, überlegte ich. Wahrscheinlich bedeckte feiner Staub die Fahrbahn. Im Sommer sah der Weg wie ein helles Band aus. Jetzt im Spätherbst lag er unter grauem Himmel wie ein schmiedeeiserner Gürtel um den Bergkegel. »Da auf der anderen Seite liegt Kesten«, sagte ich zu Onkel Andreas, während ich aufstand, um in mein Zimmer zu gehen. Als wüsste er das nicht selbst! Ich sagte es ja auch nur, um mir seine Wertschätzung zu erhalten.
»Vielleicht werde ich später Landvermesser oder Kartograph!«, sagte ich unverhofft zu meinem Onkel. Er war mir auf meinen Gedankenwegen nicht gefolgt, und vor Überraschung rutschte ihm beinahe die Pfeife aus der Hand. Dann tätschelte er mir begütigend den Kopf. »Ja, ja, das ist auch eine Option. Aber jetzt rauf in dein Zimmer und lern’ den Katechismus.« Damit wandte er sich zu seiner Frau, und während ich die Treppe hinaufstieg, hörte ich ihn sagen: »Aus dem Jung wird mal was.«
»Woher hat er nur so eine Verrücktheit?«, rief sie hinter mir her und schüttelte den Kopf.
III
Onkel Andreas und Tante Charlotte bewohnten ein kleines Haus in der Pützstraße, deren Name ich mir nicht erklären konnte. Denn weit und breit war kein Pütz, kein Brunnen, kein Wasserlauf zu sehen … sieht man mal von den Sturzbächen ab, die bei jedem Wolkenbruch wie wild die Straße herabschossen und mit Gurgeln im Gully verschwanden. Das Haus lag am Ende eines Hofes, der sich in einem sehr spitzen Winkel verengte. Die Pflasterung bestand aus einfachen Kieselsteinen, die der Regen blank poliert hatte.
Fast die Hälfte des Erdgeschosses wurde durch die Gelehrtenstube meines Onkels beansprucht. Daneben lag als einziger Raum, der gewinnbringend genutzt wurde, nur noch ein kleines Putzwarengeschäft. Da wurden Stoffballen, Nähnadeln verschiedener Größe, Zwirnrollen, harte Schneiderkreide und ähnliche Dinge über den Ladentisch verkauft, entweder von Tante Charlotte oder Elisabeth, die, wie schon erwähnt, ein bescheidenes Wesen mit aschfarbener Haut war. Mit schüchternem Lächeln stand sie hinter dem Ladentisch und bediente die Kundschaft. Onkel Andreas war zu stolz, sich von Bauersfrauen begaffen zu lassen. Seit er das Theologiestudium an den Nagel gehängt hatte, wühlte ein inneres Feuer in ihm, eine Art Dauerempörung. Schon während der Zeit als Seminarist war ihm die Politik zuwider gewesen. Einmal hatte er sich im schwarzen Talar und fiebrig entflammten Wangen auf die Brotstraße gestellt und Handzettel verteilt, auf denen er gegen das schlechte Deutsch, die fehlerhafte Syntax, die Wortstereotype – kurzum gegen das hilflose Gestammel dieser Leute im Parlament das Schwert zückte. Ihm war egal, wer in Bonn oder Mainz regierte, die Schwarzen oder die Roten in böswilliger Verschworenheit mit den Grünen. Doch er merkte, dass selbst gutwillige Passanten am Deutsch der Politiker nichts auszusetzen hatten und die Zettel ungelesen wegwarfen. Um sich Gehör zu verschaffen, nahm er Aufstellung vor dem Geburtshaus des berühmtesten Bürgers von Trier, und das war nicht der Apostel Matthias in seiner antiken Gruft, sondern Karl Marx. Durch ein selbstgebasteltes Megaphon teilte er jedem Spaziergänger mit, dass alle Macht die deutsche Sprache verhunze. Er schrie so lange, bis der Regens herbeistürzte und ihn beinahe aus dem Priesterseminar geworfen hätte. Doch als er Gott verraten und das Fräulein Lambach geheiratet hatte, hielt ihn nichts mehr zurück. Ohne Zögern hatte er seine junge Frau nach Berlin begleitet. Und was machte er da? Bar jeder Kenntnis vom Zeitungswesen und ein leichtes Opfer betrügerischer Ratgeber hatten sie sich gemeinsam ins Unglück gestürzt und eine Zeitung gegründet.
Im Priesterseminar war dem Seminaristen kein Einblick in die Geschäftswelt gewährt worden. Sein Vater, der Bäckermeister, galt im Dorf als wohlhabend. Er hatte sein Vermögen und das seiner Frau der Sparkasse Trier anvertraut. Der bedächtige Direktor Amann verteilte das Guthaben auf risikoarme Papiere. Einzelinvestitionen in Kohleförderung und Münchner Bierbrauereien standen hoch im Kurs und versprachen sicheren Zinsgewinn. Vor einer überstürzten Auflösung der Geldanlagen warnte der Direktor. Doch vergeblich. Fünftausend Mark, eine erkleckliche Summe, wurden dem Seminaristen auf Treu und Glauben ausgezahlt.
Im Nu hatte der unerfahrene Zeitungsgründer das Guthaben durchgebracht. Beim waghalsigen Versuch, in der weltläufigen Hauptstadt, einem Zentrum des Zeitungswesens, ein Sozialistenblatt aus dem Boden zu stampfen, hatte Onkel Andreas sich verspekuliert. Er war keine dreißig Jahre alt und spielte doch Herausgeber, Chefredakteur und Reporter in einer Person. Er schrieb rachsüchtige Leitartikel über die Ausbeutung der Arbeiter wie auch Kommentare zu Fußballspielen in den Vororten. Währenddessen sortierte seine junge Frau in einer Visitenkarten-Druckerei die Buchstaben im Setzkasten zu flammenden Überschriften. Die Zeitung wurde anfangs in Lebensmittelgeschäften, Friseurläden und Buchhandlungen ausgelegt. Horch war der Titel, einer achtzylindrigen Automarke trotzend, die ebenso hieß.
Doch die klassenkämpferischen Artikel befremdeten und stießen auf Ablehnung. Denn darin wurde behauptet, auch wenn die sozialen Verhältnisse in Deutschland noch nicht den Zustand lateinamerikanischer Despotenregime erreichten, glitten sie auf der Rutschbahn des Verfalls bergab. Niemand wollte den Unsinn lesen. Nach drei Monaten war das Startkapital aufgebraucht. Das Heer der Gläubiger nahm mit feiner Witterung den Duft einer baldigen Pleite auf. Geprellte Kreditgeber belagerten den Eingang zum Zeitungsverlag. Banken versuchten zu holen, was noch zu holen war. Die Polizei schritt ein, weil beim Ansturm der Geldeintreiber der Straßenverkehr ins Stocken geriet. Als die Eingangstür zersplitterte, musste der Weltverbesserer aus den Fängen seiner Geldgeber gerettet werden. In höchster Not gelang es ihm, mit seiner Ehefrau zurück an die Mosel zu fliehen, unter Zurücklassung unbezahlter Schulden und eines für immer beschädigten Rufes.
Aber ein Mann vom Durchhaltevermögen meines Onkels gab sich nicht von banalen Widrigkeiten geschlagen. Als nächstes beschwatzte er seine gutgläubige Frau, auch sie solle sich ihr Erbe vorzeitig auszahlen lassen. Mit ihrem Geld wiederholte er das Experiment in Trier, wo er in der Nähe des Geburtshauses von Karl Max ein Revolutionsblatt gründete. Diesmal nannte er es Hört! Hört!. Wie vermutet, wurde es vom ersten Tag an von der Polizei überwacht. In der konservativen Stadt weckte die neue Zeitung zunächst einige Neugier in intellektuellen Zirkeln. Auch Seminaristen, die sich an den rebellischen Kommilitonen erinnerten, strömten herbei, weil die Lehrsätze der Theologie nach Thomas von Aquin bei der Bewältigung der Gegenwart nicht weiterhalfen. Ebenso Archäologiestudenten, die alle Ruinen der römischen Vergangenheit durchwühlt hatten und nun die Ruinen politischer Ideologien erforschen wollten. Schließlich kamen pensionierte Amtsrichter, die trotz eigenen Ruhestandes noch immer davon träumten, die Welt zu einer besseren zu machen.
Doch auf die Dauer war die Zahl der Kunden zu gering, um das Unternehmen zur Blüte zu tragen. Bald widerfuhr dem Herausgeber das gleiche Schicksal, das ihn schon in Berlin zu Fall gebracht hatte. Diesmal hielt er drei Monate durch. Dann packte Tante Charlotte entschlossen Reiseschreibmaschine, Setzgerät und Papierbogen zusammen und teilte dem Ehemann mit: »Das war’s dann, Andreas. Ab jetzt bin ich wieder im Dorf.« Er nickte beklommen und sah sich geschlagen.
Wenn er jetzt, dreißig Jahre später, das Haus verließ, geschah es aufrechten Ganges und den Spazierstock schwenkend. Dann richtete er den Schritt zu einem Bauwerk, das er anmaßend seine Festspielhalle nannte, ein ausgemusterter Traktorschuppen mit Wellblechdach, der hinter dem Bahnhof der Moseltalbahn im Feuchtsumpf stand. Onkel Andres hatte sich vorgenommen, mit Jugendlichen Theaterspiele zu proben. Im Augenblick war ein Stück von Calderon de la Barca angesagt. In einem Dorf, wo die Schulkinder während der jährlichen Läusewelle das Haar kahl geschoren bekamen, um den Kopf von Grind und Nissen zu säubern, und keiner die Möglichkeit hatte, das Gymnasium in Bernkastel zu besuchen, geschweige denn an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz Literatur zu studieren, hätte es einem Wunder geglichen, wenn auch nur einer der Laienspieler jemals von diesem Dichter gehört hätte. Gleichwohl wurde sein Name in allen Enzyklopädien und Anthologien gerühmt. Auf dem Programm stand ein trauriges Drama, das den Regisseur oft an seine Seminarzeit erinnerte. Es hieß: »Das Leben ein Traum.«
IV
Wie oft hatte uns der Böllerschuss in den Weinberg gescheucht! Ich war nicht der fleißigste Traubenleser. Lieber blickte ich trotzig von unserem Berg, der Geierslay, auf die Mosel, die damals, Jahre vor der Begradigung – jeder im Dorf wusste, dass die Franzosen sie dem alten Adenauer abgeschwatzt hatten –, breit das Tal durchfloss. Keine Bucht ließ sie aus, keine der Klippen, die in die Fahrrinne ragten. Unendlich wie ein See sah sie an Herbsttagen aus. Geradewegs vor unserer Haustür gelegen! Im Ufergehölz, zwischen gelben Grasbüscheln, vergrub ich im Sommer die nackten Füße. Bis zu den Knöcheln stemmte ich sie in den glitschigen Morast. Neben mir hatte oft Edgar, mein Klassenkamerad, gesessen und mit mir hinüber zum weißen Weg geschaut. Auch er kannte ihn nicht. Immer warteten wir darauf, dass sich dort etwas Großartiges ereignete. Nie passierte etwas. »Nur am Geburtstag.« Darauf hatte ich mich schon damals versteift. »Wir gehen an meinem Geburtstag!«
»Ja, ja, zum Riesenrad«, weckte mich eine Stimme. Natürlich war es Marianne, die den Unsinn verzapfte. Nicht mal einen Schimpansen konnte sie mit der plumpen Lüge aus dem Affenkäfig locken. An der ganzen Mosel gab es kein Riesenrad. Das hatte ich in Erfahrung gebracht. Und von uns aus über hundert Weinberge, die dazwischen lagen, bis zur Porta Nigra schauen, war ein Ding der Unmöglichkeit! Wieder kniete Marianne, unser dralles Herbstmädchen, neben mir und ein Strom dummer Redensarten ergoss sich über mich. In knallroten Kniestrümpfen war sie Onkel Andreas vom Hunsrück zugelaufen. Mit vollem Namen Marianne Pelzer. Angeblich wollte sie uns fleißig im Weinberg helfen. Doch in Wirklichkeit war sie ja nur darauf aus, sich einen Kerl aus dem Dorf zu krallen, behauptete Isolde. Jetzt stand sie mit ihren opulenten Brüsten vor mir – dick, faul und rund wie eine Tonne, in Jogginghose und Wolldecke gewickelt, und mischte sich ein! Obwohl ich erst sieben war, konnte niemand mir ein X für ein U vormachen, eine dumme Kuh wie Marianne bestimmt nicht. Dass sie mir ein Riesenrad anpries, das es nirgendwo gab, machte mich wütend. Jetzt hielt sie es für angebracht, mit unerträglicher Gehässigkeit hinzuzufügen: »Für dich zählt doch nur der Kirmeskram!«
»Kirmeskram! Dumme Gans!«, schleuderte ich zurück.
»Du und die schöne Isolde«, stichelte sie weiter.
»Ja, und? Die heirate ich mal«, schrie ich herausfordernd.
»O je, deine Cousine, und ich werde euer Trauzeuge! Das Pelztierchen.«
Tante Charlotte hielt im Pflücken inne, warf Marianne einen bösen Blick zu, weil sie etwas Unanständiges gesagt hatte.