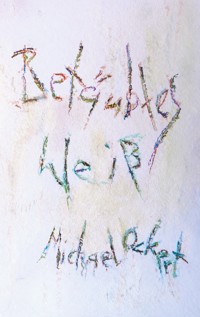Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es ist nicht das Laub. Es sind die Zwischenräume, die sich aus den Himmeln nähren und dem, was aus der Erde aufsteigt. Sie sind erfüllt von Braun, Gelb und Verfallendem. Sie stecken voller Leben, das sich anschmiegt und sich sucht. Und in diesen Begegnungen entsteht das Unvorhergesehene, das Neue, das schon immer da war.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 80
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
für Rosie
Inhalt
Das Anthrazit der Gespräche
Wasser, in sich widerspenstig
Aus dem Reich des Vergessens
Der Schorf der Steine
Das Anthrazit der Gespräche
Rezept
Solveig braucht es heute noch, dringend. Hier im Wagen ist es zu eng, da hilft auch die Notbeleuchtung nicht. Dann noch der durchgesessene Beifahrersitz, echt unbequem. Die Oberflächen des Innenraums verströmen sich porös und braun, als die Kiste losfährt, stockend, bevor sie ins Rollen kommt. Keine Ahnung, wen ich da am Ohr habe. Die Stimme am anderen Ende der Leitung spannt einen unendlichen Raum auf. Es fühlt sich kalt darin an, zu unbehaglich, um seinen Begehrlichkeiten nachzugeben. Wie auch die schwarze Oberfläche des Handys.
Eine Verbindung ohne Rauschen, so unmittelbar, so glasklar. So klar, dass die Bewegungen seiner Finger vor meinem inneren Auge auftauchen. Sie wischen ungeschickt über die leuchtenden Buchstaben. Er will nur helfen. Nur er kann uns den Weg zum Arzt weisen, ausgerechnet er. Und wie soll das gehen ohne Map-App?
„Bist du schon im App-Store?“
„Ja. Aber welche soll ich runterladen?“
Ich hatte von Anfang an kein gutes Gefühl. Dann findet er unsere Position wie durch ein Wunder.
„Noch zwei Straßen, dann links“, murmelt er vor sich hin. Er ist noch von sich selbst fasziniert.
Der Fahrer neben mir fährt schusselig, kein Wunder bei der schlaksigen Gestalt. Die zu große Brille verrutscht ihm auf der Nase. Er riecht muffig, als ob er seit Wochen nicht ausgelüftet worden sei. Die vergilbte Innenlampe kann sich nur mühsam der Dunkelheit erwehren, ebenso wie das Tempo.
Der Mann am Handy hat unsere Position verloren. Er ist, soweit ich weiß, Pfarrer und noch umständlicher, als ich dachte. Keine Ahnung, wie ich an den geraten bin. Die App scheint genauso veraltet wie er. Das weiße Viereck am Halskragen erdrückt den Adamsapfel. Es ist ungewaschen und schimmert gelblich. Die schwarzen Klamotten riechen nach Bratkartoffeln. Ich merke, dass er am liebsten auflegen würde.
„Ruf morgen nochmal an!“ Er will mich abwimmeln, unerhört.
„Meine Güte, es ist eilig! Wir brauchen das Rezept heute noch. Jetzt mach schon!“ Ich hasse es, mich echauffieren zu müssen.
Er hat unsere Position wiedergefunden.
„Jetzt Fahrlachstraße weiterfahren, dann die nächste oder übernächste links.“
Die Straße dehnt sich doppelspurig vor uns aus. Ich sehe ihn vor meinem geistigen Auge, den Pfarrer. Er streicht die zu langen und zu wenigen Strähnen über der verschwitzten Stirn zur Seite. Es strengt ihn zu arg an. Wenn Katinka nur bei ihm wäre, er könnte ihr den Hörer weiterreichen. Sie ist immer so klar in ihrem Denken, sie würde mich nicht abwiegeln. Sie ist nicht weit entfernt, das spüre ich, schade! Der Fahrer im Fiat 500 spinnt wieder. Ich habe ihn noch weniger unter Kontrolle als den Pfarrer.
„Halt!“ schreie ich. Er fährt tatsächlich an unserer Abzweigung vorbei. Dabei hatte ich das Gespräch auf Lautsprecher gestellt. Jetzt führt die Straße direkt auf die Autobahn ohne Wendemöglichkeiten. Er erschrickt selbst und reckt die Arme in die Luft, ich greife unwillkürlich ins Lenkrad. Da wirft er den Wagen links herum und wir biegen in eine enge Einfahrt ein, die mir vorher noch nie aufgefallen war. Sie führt auf einen Parkplatz, hinter Hecken verborgen. Das Auto holpert über den Schotter, Endstation. Wir steigen aus.
Am anderen Ende des Parkplatzes steht eine Menschenmenge, ihre Rücken zu uns gewandt. Sie schaut in die Ebene, die sich vor ihr ausbreitet. Sie sieht aus wie eine Elefantenherde von hinten, das meiste graue Mäntel. Wir nähern uns. Dort unten ziehen sich die Ausläufer der riesigen Stadt bis in die Ferne. Die Häuserschluchten verzweigen sich in Gassen, alte Mietshäuser, die sich zu hoch für ihr Alter auftürmen, sie wirken baufällig.
Ich habe keine Ahnung, in welcher der Straßen der Arzt praktiziert. Der Fahrer ist auch keine Hilfe. Er reckt den Kopf in die Höhe, um besser zu sehen. Dabei überragt er schon alle. Seine Brillengläser sind abgefingert. Es hilft alles nichts, wir müssen unser Glück versuchen. Ich schiebe mich langsam auf der lockeren Erde den Hang hinunter. So steil sah es von oben nicht aus. Und ich merke, dass mich die Leute wie eine Tierherde begleiten. Sie schauen mich freundlich von der Seite an wie Schafe, zwischen denen man vorsichtig mit dem Auto hindurchfährt.
Die Fensterflügel des ersten Hauses da unten stehen offen. Jetzt bitte keine weiteren Komplikationen mehr! An den Wänden des Innenraums sehe ich Werkzeug hängen. Eine Werkstatt wie vor fünfzig Jahren, abgenutztes Metallwerkzeug mit Holzgriffen. Die ersten der Herde drängen in den Eingang des Hauses hinein. Ich lasse mich mit hineintreiben. Ich habe auch keine bessere Idee. Hauptsache, weiter! Der Fahrer bleibt an meiner Seite. Ein Teil der Leute schiebt sich in die Flure im Erdgeschoss, der andere in das Treppenhaus. Eine Zimmertür auf der rechten Seite steht offen. Der Raum wird von einer Platte auf Tischhöhe ausgefüllt, auf der sich eine Modelleisenbahn ausbreitet.
„Hier hat sich aber jemand ausgelebt“, murmele ich zu meinem Begleiter.
Die Platte und alles, was darauf steht, ist von einer Staubschicht überzogen wie alle Modelleisenbahnen. Mein Blick fällt auf die Chronologie, die gegenüber an der Wand hängt, Hungerwinter 1947. So sieht der Streckenabschnitt auch aus, ausgezehrter Untergrund und gebrochene Schienen. Es hilft alles nichts, wir werden durch den Gang geschoben und am Hinterausgang liegen die Mauertrümmer vom Krieg.
„Der Arzt ist kein Orthopäde“, erklärt mir der Fahrer jetzt frei heraus. Er steht locker neben mir.
„Ich kenne die Ärzte hier. Ich bin selber Arzt.“
Ich starre ihn an. „Was? Das sagst du mir jetzt erst?“
„Ein Allgemeinmediziner müsste auch reichen für das Rezept.“ Er legt die Hand auf meine Schulter. Es soll vertrauenserweckend wirken. Währenddessen redet er umständlich in seiner stockenden Art weiter und lehnt sich dabei an die Ruinenwände. Ich verscheuche seine Hand. Es beruhigt mich überhaupt nicht.
„Ich dachte, wir brauchen für dieses Rezept einen Facharzt!“ Ich versuche, die Welt wieder für mich zurechtzurücken, aber mein Hirn ist blockiert.
„Es ist nicht mehr weit bis zur Praxis.“ Er zieht ein abgegriffenes, zu dickes hellgelbes Wörterbuch aus dem Trümmerhaufen und blättert es auf, als ob er nicht wüsste, was er mit der Zeit anfangen soll. Als ob sie grenzenlos zur Verfügung stünde. Er pfeift kaum hörbar zwischen den Zähnen, eher ein Zischen.
„Insgeheim sind sie alle spezialisiert“, zwinkert er mir zu. „Oder sie meinen es zumindest. Also kein Problem.“
Meine Güte! Mir fällt ein Stein vom Herzen.
Auf Nebenwegen
Der Heimweg ist leicht. Das Dunkle, eingepudert in die Luft, stört mich nicht und auch nicht, dass sie dicker und schwerer zu atmen ist, als sie sein sollte. Ich kenne die Wege der Vorstadt, auch wenn sie provisorisch angelegt sind. Denn alles hier ist Baustelle und im Entstehen. Ein glücklicher Zufall, wenn die Festigkeit von Grasresten eine Brücke über den aufgeweichten Boden bildet, so dass das Rad darüberrollen kann. Es ist mir vertraut wie ein Pferd, mit dem ich jahrelang zärtlich umgegangen bin. Vielleicht zu vertraut, und sein Metall und der Fahrtwind führen ein verwirbeltes Gespräch.
Meine Füße treten die Pedale und meine Umrisse saugen die Düsternis auf, widerspenstig und belustigt, während die Pneus ohne Gewicht über die Holzplanken gleiten, nebeneinander liegende schmale Holzlatten mit aufgestellten Fasern, jede so lang, als wolle sie niemals enden. Wahrscheinlich Abfallholz von Scheunentoren, nur eine Hand breit. Die Schwärze des Verfalls ist in ihre Substanz eingeschrieben und führt dort ein eigenwilliges Dasein. Sie wirken wie achtlos hingeworfen und schließen in stumpfen Winkeln aneinander an, manchmal zu stumpfen Winkeln. Sie geben die Richtung vor. Denn der Boden darum herum besteht nur aus Matsch. Das Fahrrad holpert über die Enden. Ein Stoß, eine Welle, die den Körper durcheilt. Sie fühlt sich gut an und ich lasse sie in mir nachhallen.
Plötzlich taucht hinter mir eine Gestalt auf, eine Frau, ebenfalls auf dem Rad. Oder nur eine Erscheinung im Nebel? Ich versuche, über die Schulter nach hinten zu schauen, kurz, denn ich muss mich auf die enge Bahn konzentrieren. Ein unscharfes Bild, mit dem ich weiterfahre, seine Oberfläche aus grober Wolle, Rot- und Grüntöne. Den Kopf umkränzt eine Kappe, die kaum etwas vom Gesicht preisgibt.
Die vagen Konturen, das Weiterrollen auf den Bohlen, dem Verlauf folgen, kaum merkliche Richtungsänderungen. Das Rad rollt unbekümmert, als sei ich der Störfaktor. Sie wird mich nicht einholen. Sie kommt näher, obwohl ich ein guter Fahrer bin. Trotzdem kann ich es nicht zulassen. Vor uns die Wasserlache, wir müssen absteigen. Und setzen im nächsten Augenblick die wilde Fahrt fort. Ich möchte immer so weiterfahren.
Ein Holzgerüst baut sich als Silhouette im weißen Nebel vor uns auf. Es wirkt, als würde es aus dem Nichts hervorwachsen. Ich kenne das Gerüst. Es wird von nur einem Mann gebaut und sein einziges Baumaterial sind die Holzbohlen, auf denen die Räder dahinrollen. Ihre Einfachheit überträgt sich auf mich, je näher ich komme.
Der Mann baut das Gerüst mitten über den Weg hinweg. An seiner Körperhaltung merke ich, dass ich unerwünscht für ihn bin. Doch ich muss weiter, immer weiter. Das Rad rollen lassen, denn ich kenne nur dieses Dasein. Wir haben das Gerüst erreicht. Das Rad verbindet sich mit mir und lässt mich die Holzstangen hinaufklettern, auch wenn ich keine Kraft dazu habe. In der Schwere verbinde ich mich mit dem Holz. Ich spüre sein Braun in meine Adern einfließen und lasse mich mit ihm weiterfließen nach oben und nach unten ohne Kontrolle.