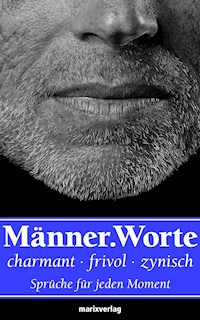30,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mami Staffel
- Sprache: Deutsch
Die Familie ist ein Hort der Liebe, Geborgenheit und Zärtlichkeit. Wir alle sehnen uns nach diesem Flucht- und Orientierungspunkt, der unsere persönliche Welt zusammenhält und schön macht. Das wichtigste Bindeglied der Familie ist Mami. In diesen herzenswarmen Romanen wird davon mit meisterhafter Einfühlung erzählt. Die Romanreihe Mami setzt einen unerschütterlichen Wert der Liebe, begeistert die Menschen und lässt sie in unruhigen Zeiten Mut und Hoffnung schöpfen. Kinderglück und Elternfreuden sind durch nichts auf der Welt zu ersetzen. Genau davon kündet Mami. E-Book 1759: Wie Felix ein glücklicher Junge wurde E-Book 1760: Gibt es eine Rettung für Silvie? E-Book 1761: Liebe heißt, gemeinsam gehen E-Book 1762: Sophies ganz große Liebe E-Book 1763: Zwei, die sich nicht mögen E-Book 1764: Über die Kinder zu deinem Herzen E-Book 1765: Meine berühmte Mami E-Book 1766: Der geliehene Vater E-Book 1767: Unser Papi darf nicht heiraten E-Book 1768: Lebe wohl, kleiner Jannis! E-Book 1: Wie Felix ein glücklicher Junge wurde E-Book 2: E-Book 3: Gibt es eine Rettung für Silvie? E-Book 4: E-Book 5: Liebe heißt, gemeinsam gehen E-Book 6: E-Book 7: Sophies ganz große Liebe E-Book 8: E-Book 9: Zwei, die sich nicht mögen E-Book 10: E-Book 11: Über die Kinder zu deinem Herzen E-Book 12: E-Book 13: Meine berühmte Mami E-Book 14: E-Book 15: Der geliehene Vater E-Book 16: E-Book 17: Unser Papi darf nicht heiraten E-Book 18: E-Book 19: Lebe wohl, kleiner Jannis! E-Book 20:
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1222
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Wie Felix ein glücklicher Junge wurde
Gibt es eine Rettung für Silvie?
Liebe heißt, gemeinsam gehen
Sophies ganz große Liebe
Zwei, die sich nicht mögen
Über die Kinder zu deinem Herzen
Meine berühmte Mami
Der geliehene Vater
Unser Papi darf nicht heiraten
Lebe wohl, kleiner Jannis!
Mami –4–
Staffel
Diverse Autoren
Wie Felix ein glücklicher Junge wurde
Roman von Gisela Reutling
Sandra schlich ins Schlafzimmer und betrachtete ihre schlafende Mutter.
»Mamas Konzert war anstrengend«, hatte Papa erklärt. »Du mußt verstehen, daß sie Ruhe braucht.«
Wie schön sie aussah! Das lange rotblonde Haar breitete sich wie Seide auf dem Kissen aus, und ihre Haut war so zart und weiß wie niemandes sonst.
Sandra wartete, bis sie die Augen aufschlug. »Mama, gehst du heute mit mir in den Zoo?«
»Oh, Kind«, seufzte die Mutter nur und streckte sich ein wenig.
»Du hast es aber gesagt…«
»Hab ich das?« fragte Bianca zerstreut.
»Ja. Bitte, Mama.« Die kleine Hand schob sich in ihre.
»Nein, Sandra, es geht wirklich nicht. Ich muß doch noch üben.«
Sandra ließ den Kopf hängen. »Darf ich mit dir üben?« wisperte sie nach einer Pause. Mit ihr üben, das hieß, still neben ihr zu sitzen und ihr manchmal Noten zureichen.
»Heute nicht.« Es klang ein wenig gereizt. »Geh nach draußen spielen.«
Sie sah ihrem Töchterchen nach, wie es, langsam einen Fuß vor den anderen setzend, das Zimmer verließ. Für einen Moment hatte sie ein schlechtes Gewissen. Nun habe ich sie schon wieder enttäuscht, dachte sie. Sie sagte so manches Mal etwas, nur um Sandra zu vertrösten. In den Zoo gehen! Als ob es nichts Wichtigeres gäbe.
Chopin stand als nächstes auf dem Programm, ein selten gespieltes Werk von ihm. Da mußte sie sich hineinknien. Ja, alles wollte sie wieder geben, um das Publikum
zu Begeisterungsstürmen hinzureißen.
Mit allen Gedanken schon bei der Musik, schlug Bianca Fabrizius die seidene Decke zurück und lief ins angrenzende Bad, wo Frau Scholl schon das Wasser einlaufen ließ.
Sandra wußte wieder einmal nicht, was sie mit sich anfangen sollte. Nun war ihre schöne, berühmte Mama mal zu Hause, und sie hatte doch keine Zeit für sie. Aber das war ja meistens so.
Sie sah sich in ihrem Zimmer um. Es war groß, und es gab eine Unmenge Spielsachen darin. Auch Puppen in allen Größen, mit goldlockigen Haaren und langbewimperten Augen. Die sahen alle wie Filmstars aus und waren auch so angezogen. Aber sie waren starr und steif, wenn man sie in den Arm nahm. Wie sollte man sie da liebhaben?
Der Papa hatte ihr schon mal versprochen, ihr eine zum Kuscheln zu kaufen. Das hatte er natürlich längst vergessen. Er hatte ja auch so viel zu tun in seiner Klinik. Da konnte er doch nicht an Puppen denken.
Sie sollte draußen spielen, hatte die Mama gesagt. Also ging Sandra hinaus in den Garten, wo die Sonne schien und die Bäume und Sträucher zu grünen begannen. Sie ging über den Rasen zu »ihrer« Ecke, wo die Schaukel stand und das Klettergerüst mit einer Rutsche. Auch ein Sandkasten war da, aber darüber war sie längst hinaus, mit Förmchen im Sand »Kuchen zu backen«! Das war nur etwas für kleine Kinder, und sie war doch schon fünf.
Sandra setzte sich auf die Schaukel, sie stieß sich mit den Füßen ab, aber, lustlos, wie sie war, kam sie nicht richtig in Schwung. Am Zaun, der das Grundstück begrenzte, sah sie einen Jungen stehen, der durch das Spalier neugierig zu ihr herübersah.
Sie schaute zurück, da lachte er und winkte ihr zu.
Sandra hatte ihn noch nie hier gesehen. Es gab überhaupt kaum Kinder in dieser Straße. Höchstens mal zu Besuch in den umliegenden Häusern.
Schließlich rutschte sie von der Schaukel herunter und ging zu ihm hin. Er war blond, hatte kurz geschnittenes Haar, das gerade in die Luft stand, und ein rundes, rotwangiges Gesicht.
»Hey«, machte er, als sie sich ihm näherte.
»Wo kommst du her?« fragte Sandra.
»Von dort.« Der fremde Junge zeigte auf ein neuerbautes, etwas zurückliegendes Haus. Es hatte zwei Etagen und eine Dachwohnung. »Wir sind neu eingezogen. Da oben wohnen wir, wo die Blumenkästen sind. Wie heißt du?«
»Sandra. Und du?«
»Felix.« Er betrachtete sie ungeniert nach Kinderart, und er fand sie hübsch. Dann ging sein Blick zu dem Haus hin. »Gehört euch das schöne Haus?« wollte er wissen.
»Ja. Da wohne ich mit meinen Eltern drin.«
»Super.« Er hätte gerne noch länger mit ihr geredet, aber er wußte nun nichts mehr. Sie war auch so zierlich, so fein, nicht wie jemand, mit dem man herumtollen und spielen konnte.
Auch Sandra stand unschlüssig. Plötzlich sagte sie: »Wenn du magst, kannst du rüberkommen und mich auf der Schaukel anschubsen. Allein geht die Schaukel schwer.«
Sie hatte es noch nicht ganz ausgesprochen, da kletterte er schon über den Zaun. Verblüfft lachte Sandra auf. Und wie er da heruntersprang, als wäre das nichts. »Du hättest vorn durch die Gartentür kommen können!«
»Pah, wozu denn. Ist doch nicht hoch.« Er streifte sich die Hände an seinen Jeans ab und marschierte geradewegs auf die Schaukel zu. Sandra bewunderte ihn heimlich. Er war bald einen halben Kopf größer als sie, und er hatte
Kraft.
Das zeigte sich auch, als er ihre Schaukel in schwindelnde Höhen trieb. »Jetzt ist es aber genug«, rief Sandra ängstlich. »Sonst flieg ich noch runter.«
»Du mußt dich festhalten«, lachte Felix übermütig. Aber sie war eben nur ein Mädchen und leicht wie eine Feder dazu. Deshalb ließ er die Schaukel sacht ausschwingen.
»Möchtet du jetzt mal?« fragte Sandra.
Er nickte eifrig, und im Nu schwang er hoch hinauf. Dann wollte er mal auf das Klettergerüst. »Da können wir uns vorstellen, wir wären Jäger auf ’nem Hochstand«, meinte er. »Dann kommt eine Wildsau, und wir machen peng-peng!« Er tat, als hielte er ein Gewehr im Arm.
»Wir machen doch kein Tier tot«, sagte Sandra vorwurfsvoll. Überhaupt, was dieser Felix für eine Phantasie hatte!
»Neee«, dehnte der Junge das Wörtchen, »wir doch nicht. Aber so im Wald, wenn es zu viele werden, und manche richten ja auch Schäden an, dann muß schon mal eins dran glauben. So ist das eben.«
»Du gehst wohl schon in die Schule«, vermutete Sandra, als er so daherredete. Felix schüttelte den Kopf. »Erst im Herbst, wenn ich sechs geworden bin.«
Er sauste ein paarmal die Rutsche hinab, dann setzte er sich auf das Gerüst zu Sandra. Plötzlich merkte er auf. »Wer spielt denn da Klavier?«
»Das ist meine Mutter«, antwortete Sandra nicht ohne Stolz. »Es ist ein Flügel, kein Klavier.«
»Ach so.« Felix kannte den Unterschied nicht so genau. Eine Weile hörten sie zu. »Sie kann das aber gut, nicht?«
»Ha«, Sandra warf das Köpfchen in den Nacken, »meine Mutter ist doch auch eine berühmte Pianistin und gibt Konzerte in allen großen Städten.«
»Echt?« Beeindruckt sah der Junge sie an. Dann blickte er auf seine Sandalen. »Meine Mutter«, sagte er, als müßte er dem etwas entgegensetzen, »kann Englisch und Französisch. Sie übersetzt Bücher. Da steht dann vorne drin: Ins Deutsche übersetzt von Beate Herder. So heißt meine Mama nämlich. Die werd’ ich alle mal lesen.«
Sandra dachte darüber nach, wie das wohl ging, Bücher übersetzen. »Muß sie dann gar nicht weg?« fragte sie schließlich.
»Wie, weg?« fragte Felix etwas verwundert zurück.
»Ich meine, ist deine Mutter da immer zu Hause?«
»Ja, klar«, antwortete er eifrig, »wo soll sie denn sonst sein. In unserer neuen Wohnung hat sie jetzt auch Platz für ihren Schreibtisch. Vorher hatten wir es ziemlich eng.«
Eine Mutter, die immer da war… Sandras Gesichtchen nahm einen sehnsüchtigen Ausdruck an. Sie horchte auf die Töne, die herüberklangen. Es waren jetzt immer dieselben Läufe, die Mama übte.
»Da geht deine Mutter wohl auch mal mit dir in den Zoo«, meinte sie.
»Hm, da wollen wir jetzt bald mal hin, da gibt’s jetzt Junge.« Plötzlich sprang er auf. »Ich muß jetzt nach Hause, meiner Mama beim Kochen helfen.«
Das fand Sandra komisch. »Kann sie denn kochen?«
Verdutzt sah Felix sie an. »Pff, du kannst aber fragen«, platzte er heraus. »Das können Mütter doch.«
Sandra nickte etwas geniert. Bei ihnen machte das Frau Scholl. Sie hatte ihre Mama noch nie in der Küche gesehen. Aber dafür war sie ja auch eine große Künstlerin.
»Also tschüs, Sandra!« Auf halbem Wege vom Klettergerüst herab fragte er noch: »Kann ich mal wiederkommen, wenn du draußen bist?«
Sandra nickte. Sie sah ihm nach, wie er sich über den Zaun schwang und hinüberlief zu dem Haus, in dem seine Mutter immer da war.
Sie mußte an diesem Mittag allein mit Frau Scholl essen. Die Mama blieb im Musikzimmer, sie wollte nicht gestört werden, und der Papa war noch in der Klinik.
Von seinem Vater hatte Felix gar nichts gesagt. Was der wohl machte? Sandra nahm sich vor, ihn
das nächste Mal danach zu fragen. Wenn sie schon keinen Bruder bekam, wie sie sich das immer gewünscht hatte, dann konnte Felix vielleicht ihr Freund werden.
*
»Ich hab’ ein Mädchen kennengelernt«, berichtete Felix seiner Mutter. »Sie heißt Sandra. Sie ist ziemlich klein und dünn, aber sonst hübsch.«
»Soso.« Beate schmunzelte in sich hinein. Ihr Sohn fing ja gut an. Sie hackte die Petersilie für die Gemüsesuppe, indessen Felix zwei Teller auf den Tisch stellte und die Löffel danebenlegte. Dann durfte er den Obstsalat mischen und in Glasschalen füllen.
»Sie wohnt in dem großen weißen Haus dahinten«, erzählte er weiter. »Im Garten hat sie einen Spielplatz ganz für sich allein. Ich bin über den Zaun geklettert…« Mit einem Lausbubenlächeln sah er schräg zu seiner Mutter.
»Das solltest du aber besser nicht tun«, meinte sie.
»Warum, hat doch keiner gesehen, und Sandra wollte doch, daß ich sie schaukelte. Ihre Mutter spielt Klavier und reist damit herum. Sie soll berühmt sein. Aber vielleicht hat Sandra auch nur ’n bißchen angegeben. Was denkst du, Mama?«
»Keine Ahnung. Ich kenne die Leute doch nicht. – Bringst du mir noch den Müll weg, Felix?«
Schon flitzte er los zu den Tonnen unten im Hof. Zwei Minuten später war er wieder da. »Wenn wir mal in den Zoo gehen, könnten wir die Sandra vielleicht mitnehmen«, sagte er.
»Sie scheint dich ja sehr zu beschäftigen«, lächelte Beate. »Aber wieso sollte sie mit uns gehen wollen? Wir wissen doch weiter gar nichts von den Nachbarn in der Villa dort.«
»Hm…« Sie hatten sich inzwischen zum Essen niedergesetzt. »Sie ist ein komisches kleines Mädchen«, bemerkte er zwischen zwei Löffeln Suppe.
»Wieso ist sie komisch?«
Felix zuckte die Achseln. »Irgendwie – anders.« Er vermochte es nicht näher auszudrücken.
»Nachher kommt Tante Ingeborg mit Uli«, sagte Beate, um ihren Sohn vom Thema »Sandra« abzubringen. »Da könnt ihr zusammen spielen.«
Ingeborg Basler war Beates Freundin. Sie war Zahnarzthelferin, Mittwochs nachmittags hatte sie frei. Ihr Sohn Ulrich war sieben und auch gut Freund mit dem jüngeren Felix.
Als die beiden kamen, hatte Felix schon die Federbälle bereitgelegt. Die Buben gingen hinunter zum Spielen.
»Und wir machen uns ein gemütliches Kaffeestündchen«, sagte Beate und wollte sich in die Küche begeben, um ihn aufzubrühen. Aber Ingeborg hielt sie zurück.
»Du, ich habe nicht soviel Zeit«, sagte sie etwas hastig. »Kann Uli bei euch bleiben, bis ich ihn abhole, so gegen sechs?«
»Natürlich. Das ist aber schade, daß du schon wieder gehen willst. Hast du Besorgungen zu machen?« Sie verstand schon, daß die Freundin den freien Nachmittag nutzen mußte.
Ingeborg sah beiseite. »Ich bin verabredet…«
Es klang bedeutungsvoll, so daß Beate in scherzhaftem Ton äußerte: »Und mit wem, wenn man fragen darf?«
Ingeborg wandte ihr langsam das Gesicht wieder zu. »Dreimal darfst du raten…« Ein kleines Lächeln hob ihre Mundwinkel.
Betroffen sah Beate ihre Freundin an, in deren Augen ein seltsamer Glanz war. Ingeborg war eine aparte, attraktive Frau, mit ihrem dunklen Pagenkopf, den hohen Wangenknochen und dem etwas großen, schöngeschwungenen Mund. »Du wirst doch keine Dummheiten machen«, sagte sie.
Nur ein Achselzucken war die Antwort. Beate senkte die Lider. Also doch. Sie würde sich wieder mit Torsten Fendrich treffen, ihrem jungen Chef. Seit dieser die Praxis von dem betagten Dr. Müller übernommen hatte, war sie wie ausgewechselt. Sie kaufte sich neue Sachen und beklagte sich nicht mehr über verlängerte Sprechstunden.
»Der Neue ist tatsächlich zum Verlieben«, hatte sie vor einiger Zeit gesagt, »aufmerksam und charmant, wo gibt’s denn heute so was noch.«
Beate hatte das nicht ernstgenommen – bis sie die beiden eines Tages zusammen gesehen hatte. Sie gingen vor ihr her, plaudernd, lachend und scherzend, mit einem rasch gewechselten Kuß auf offener Straße. Ingeborgs schwärmerischer Beschreibung nach konnte der gutaussehende Mann nur Dr. Fendrich sein. Wer denn auch sonst?
Sie hatte die Freundin zur Rede gestellt. Aber Ingeborg lächelte nur. So, wie sie auch jetzt lächelte, verträumt und wissend.
»Wie weit geht eure Beziehung denn schon?« fragte sie.
»Darauf erwartest du wohl keine Antwort von mir, Beate«, erwiderte Ingeborg mit leisem Spott.
Aber Beate war das Antwort genug. »Du hast einen guten Mann, wie kannst du ihn betrügen!« warf sie der anderen heftig vor.
»Gut, aber zum Sterben langweilig«, erwiderte Ingeborg. »Mir ist, als hätte ich jahrelang geschlafen und wäre erst jetzt wieder zum Leben erwacht.
»Werde doch nur nicht so pathetisch. Wohin verrennst du dich? Was denkst du, was daraus werden soll?«
»Danach frag ich jetzt noch nicht. Ich will glücklich sein, auch wenn es vorläufig nur ein gestohlenes Glück sein kann.« Sie griff nach ihrer Handtasche. »Und jetzt gehe ich, bevor du mir weitere Moralpredigten hältst. Ich weiß ja, du meinst es gut. Aber das hier geht nur Torsten und mich etwas an. Bis später, Beate.«
Es geht auch Bertold und Uli sehr viel an, dachte Beate unwillig, während sie nun für sich allein eine Tasse Kaffee bereitete. Wollte Ingeborg die ganze Familie unglücklich machen? Ihre Ehe war sicher nicht besser und nicht schlechter als Millionen andere auch. Nach zehn gemeinsamen Jahren mochte sich der Alltag eingeschlichen haben. Bertold war, zugegeben, weniger temperamentvoll als seine Frau. Er ging seiner Arbeit nach als Angestellter in einem Elektrogeschäft, und abends machte er es sich gern gemütlich zu Hause. Ingeborg hatte sich auch nie besonders beklagt, nur über seine »Pomadigkeit«, wie sie es nannte, hin und wieder eine spöttische Bemerkung gemacht.
Aber sollte sie nicht dennoch zufrieden sein! Es gab keinen wirklichen Streit, keine tiefgreifenden Auseinandersetzungen, Bertold war dem Sohn ein liebevoller Vater.
Mit einem Aufseufzer setzte sich Beate an das Manuskript, das sie zu einem bestimmten Termin dem Verlag abliefern wollte.
War es am Ende doch besser, allein zu sein. Sie hatte wenigstens ihren Seelenfrieden. Wunden waren verheilt, und allein würde sie vermutlich auch bleiben, weil sie ihre einzige große Liebe nicht vergessen konnte. Aber die Erinnerung schmerzte nicht mehr. Sie hatte ihren Felix. Das war aller Dankbarkeit wert.
*
Dr. Clemens Fabrizius war Chirurg in der Rosenberg-Klinik. An diesem Tag hatte er vier Stunden operiert. Es war eine komplizierte Operation gewesen, die ihm und seinem Team höchste Konzentration abverlangte. Die Nervenanspannung ließ erst nach, als er nach Hause fuhr. Das gute Gefühl überwog, ein Leben gerettet zu haben.
Es war erst halb fünf. Clemens freute sich auf die vor ihm liegenden Stunden mit Bianca und mit seinem Töchterchen. Familienleben wurde ja nicht gerade großgeschrieben bei ihnen. Um so kostbarer war es, wenn sie Zeit füreinander hatten.
»Ihre Frau ist in ihrem Schlafzimmer, Herr Doktor«, sagte Frau Scholl, als er Bianca weder im Musikzimmer, noch im Wohnraum oder im Salon fand.
Clemens ging hinauf. Sie hatten getrennte Schlafzimmer. Bianca hatte es von Anbeginn so gewollt, da sie eine sehr unregelmäßige Tageseinteilung hatte. Er hatte es akzeptiert, denn auch bei ihm wurde es manchmal spät, wenn etwas Unvorhergesehenes vorlag.
Überrascht blieb er an der Schwelle stehen. An den breiten Schrankwänden standen die Türen offen, Biancas große Koffer waren zur Hälfte gepackt, über dem Bett lagen Abendkleider und Kostüme hingeworfen.
»Ist es denn schon soweit?« fragte er betroffen. »Ich denke, die Tournée beginnt erst Ende nächster Woche.«
»Ich brauche unbedingt noch ein paar neue Abendkleider, deshalb habe ich mich entschlossen, morgen schon nach Berlin zu fliegen«, sagte Bianca, ohne sich in ihrem Tun stören zu lassen.
Clemens trat näher. Seine Augen hatten sich verdunkelt. »Ich dachte, wir würden uns einen schönen Abend machen. Dieses Wochenende sollte noch uns gehören«, sprach er vor sich hin.
»Geht leider nicht, Clemens. Mir tut es ja auch leid.«
»Tut es dir wirklich leid? Manchmal habe ich das Gefühl, daß dir alles andere wichtiger ist als ich, als unsere Sandra und als dieses Haus.«
»Müssen wir wieder davon anfangen? Ich bin an meine Verträge gebunden, mein Lieber. Es gehört nun einmal dieses und jenes dazu. In diesen Fetzen da hat man mich schon gesehen, und für neue muß ich erst noch die passenden Acessoires auftreiben.«
Geistesabwesend sah Clemens auf die schillernden »Fetzen«, von denen jedes einzelne mehr kostete als manch einer in wochenlanger Arbeit verdiente. Dann sah er auf seine Frau. Sie war ungeschminkt, das lange Haar hatte sie lose aufgesteckt, ein paar Strähnen fielen an ihren Wangen herab. Sie sah sehr jung aus in den schmalgeschnittenen Hosen und dem lose darüberfallenden Pulli mit den hochgeschoppten Ärmeln.
Eine heftige Sehnsucht nach ihr überfiel ihn, sie jetzt in die Arme zu nehmen. Er umfaßte sie und preßte sie an sich, suchte ihren Mund. »Laß das alles jetzt«, raunte er.
»Oh, du riechst nach Krankenhaus!« rief Bianca aus und wandte ihr Gesicht ab.
Ernüchtert ließ er sie los. »Wieso bist du überhaupt schon da?« fragte sie.
Clemens trat einen Schritt zurück. »Ich hatte einen harten Tag, und es lag weiter nichts vor«, antwortete er.
»Na fein. Aber du siehst ja, was ich noch alles zu tun habe. Frau Scholl soll mir nachher noch helfen. Und dann«, ein Lächeln huschte um ihren Mund, ihre Stimme klang weicher, als sie hinzufügte: »Dann haben wir schon noch Zeit füreinander, Clemens.«
Der Mann nickte und wandte sich zum Gehen. Schon an der Tür, fragte er: »Wo ist eigentlich Sandra? In ihrem Zimmer war sie nicht.«
»Sie ist noch im Garten, mit so einem kleinen Jungen aus der Nachbarschaft, der manchmal kommt. Sie spielen zusammen.«
Clemens überlegte, ob er zuerst duschen oder nach seiner Kleinen sehen sollte. Er entschied sich für letzteres. Sandra würde es nicht stören, wenn er noch Krankenhausgeruch mit sich trug.
War das ein hübsches Bild, die beiden Kinder da dicht nebeneinander auf dem Rand des Sandplatzes hockend, seine Sandra mit dem leichtgelockten dunkelblonden Haar und der Junge mit dem ährenblonden Stoppelhaar. Sie schafften an einem turmartigen Gebilde aus Sand, das sie vor sich aufgebaut hatten. So vertieft waren sie, daß sie ihn nicht sogleich bemerkten.
»Hallo«, lächelte Clemens. »Du mochtest doch gar nicht mehr im Sand spielen, Sandra.«
»Papa. Papi!« Sie sprang auf. »Wir haben einen Schloßturm gebaut, guck nur mal, da sind Zinnsoldaten drauf, die bewachen den.«
Ihr Vater sah auf die kleinen Figürchen. »Hoi, wo habt ihr die denn her?«
»Der Felix ist rasch rübergelaufen und hat sie geholt«, berichtete Sandra eifrig. »Er wohnt nicht weit, nämlich da drüben. Und er meinte, die gehörten noch dahin.«
Felix war auch aufgestanden, denn das gehörte sich wohl so. »Guten Tag«, sagte er. »Ich heiße Felix Herder.«
»Guten Tag, mein Junge.« Clemens gab ihm die Hand. »Das ist aber nett, daß du Sandra Gesellschaft leistest.«
»Er kennt ganz viele Geschichten, Papa, von Rittern und so –«
»Sagen nennt man die«, warf Felix ein.
»Die erzählt ihm seine Mama«, fuhr Sandra fort. »Die schreibt Bücher.«
»Übersetzt Bücher«, verbesserte Felix seine kleine Freundin.
»Aha. – Und, ist er jetzt fertig, euer schöner Burgturm?«
»Ne, da links muß er noch befestigt werden.« Schon hockte sich Felix wieder nieder und griff zu der kleinen Schaufel.
Sandra zögerte. »Ich mag aber jetzt nicht mehr, wenn mein Papa da ist.«
»Ja, vielleicht macht ihr das besser erst morgen fertig«, meinte auch ihr Vater. »Es wird doch jetzt kühl, wenn die Sonne fort ist. Noch ist kein Sommer.«
Felix blickte enttäuscht, aber er gehorchte. Er sammelte seine Zinnfiguren ein und steckte sie in die große Tasche seiner Latzhose. »Also dann, tschüs, Sandra. – Auf Wiedersehen, Herr Doktor.« Es klang ausgesucht höflich. Er wußte nämlich inzwischen, daß Sandras Vater ein Doktor war und Bäuche und Brustkörbe aufschnitt und wieder zunähte. Das imponierte ihm mächtig.
»Auf Wiedersehen, Felix. Du kannst durch das Gartentor, das ist offen.«
Sandra kicherte. »Er klettert immer über den Zaun!«
»Hmhm.« Clemens schmunzelte. »Was so ein richtiger Junge ist, nicht?«
Felix sah zu dem hochgewachsenen Mann auf, verschmitzt lachte er zurück. Und fixer denn je sprang er hinüber.
Sandra sagte: »Ich muß mir noch den Sand abklopfen, und in den Schuhen hab ich auch welchen. Sonst macht Frau Scholl ein Gesicht, wenn ich so ins Haus komm.«
Clemens half seinem Töchterchen, sich zu säubern. Wie rosig und belebt ihr oft so stilles Gesichtchen war! Er war ja schon immer der Meinung gewesen, daß sie mehr Umgang mit Kindern haben müßte. Aber in dieser Gegend war kein Kindergarten, und woanders gab es keine Plätze. Vielleicht haben wir uns auch zu wenig darum bemüht, dachte er reuig.
Er nahm die kleine Hand, und so spazierten sie durch den großzügig angelegten Garten. Hier und da verweilte Clemens, er besah sich die vom Gärtner sorgfältig gestutzten Hecken, die angelegten Blumenbeete mit den Tulpen und Narzissen.
Sandra schmiegte sich an ihn. »Papa?«
»Ja, mein Liebling?«
»Mama packt schon wieder Koffer.« Ihr Stimmchen klang dünn.
»Ja, ich weiß«, sagte Clemens gepreßt.
»Mama sagt, sie braucht neue Kleider, darum will sie schon morgen fliegen. Aber sie hat doch so viele schöne Kleider.«
»Ihr Publikum will sie eben immer wieder anders sehen, Sandra. Das muß man verstehen.«
Wie vage sich das anhörte. Er unterdrückte einen Seufzer. Dann, in einer plötzlichen Aufwallung, hob er sein Kind zu sich empor. »Aber wir beide, wir bleiben zusammen, und die Zeit wird auch vorübergehen, bis die Mama wieder da ist.«
Am Abend machte er eine Flasche Champagner auf, um mit seiner Frau auf eine erfolgreiche Tournée anzustoßen. Aber auch das prickelnde Getränk vermochte seine Stimmung nicht aufzuheitern.
»Du bist so ernst, mein Lieber«, sagte Bianca.
»Soll ich es nicht sein, wenn ich weiß, daß wir uns nun wieder viele Wochen nicht sehen werden?« hielt er ihr entgegen.
»Wir können uns doch mal treffen, hier oder da«, schlug sie vor. »Ich werde dich wissen lassen, wo ich gerade bin, und dann kommst du.«
Clemens nahm einen großen Schluck aus seinem Glas, wie um einen bitteren Geschmack hinunterzuspülen. »Und Sandra?« fragte er rauh.
Ein erstaunter Ausdruck trat in Biancas helle graugrüne Augen. »Sandra ist bei Frau Scholl gut aufgehoben. Wo siehst du da ein Problem?«
Der Mann preßte die Lippen zusammen und schwieg. Frau Scholl war eine exzellente Haushälterin, und sie ging auch freundlich und fürsorglich mit Sandra um. Aber konnte das Mutterliebe ersetzen?
»Du bist so sehr mit dir und deiner Musik beschäftigt, daß du gar nicht weißt, was in Sandra vorgeht. Sie ist kein wirklich glückliches Kind. Mir tut das weh.«
Biancas Lider zuckten. »Aber was soll ich denn machen? Soll ich mich in Schuldgefühle hineinsteigern, meine Begabung verfluchen, die es nicht zuläßt, ihr genügend Zeit und Wärme und Zuwendung zu geben?«
»Das erkennst du also immerhin, daß du es ihr daran fehlen läßt«, stellte Clemens fest.
»Ja«, gab sie zu. »Daß ich sie trotzdem liebe, muß sie doch spüren. Ich bitte dich, Clemens, hör auf, mir Vorhaltungen zu machen. Du hast schließlich gewußt, wen du geheiratet hast.«
Clemens nickte vor sich hin. Bianca war ihm wie ein wundervolles Wesen aus einer anderen Welt erschienen. Gemessen an seinem harten Beruf war das ja auch eine andere Welt: Die Kunst, die Musik, soviel unvergängliche Schönheit. Daß er diese Frau hatte für sich gewinnen können, war ihm als ein fast unfaßbares Glück erschienen. Erst im Laufe der Jahre hatte er erkennen müssen, daß er auch Opfer bringen mußte für ihre Kunst. Er, und nicht weniger das Kind.
»Du könntest«, sagte er nach einer Pause schleppend, »dich etwas rarer machen in deinem Beruf. Mußt du dich denn von deinem Agenten von einem Konzert zum anderen jagen lassen? Du hast es doch nicht nötig.«
»Nicht nötig«, wiederholte sie ungeduldig. »Du verstehst überhaupt nichts, Clemens.« Sie streckte ihre Hände von sich und betrachtete ihre langen, schlanken Finger. »Ich muß spielen. Sonst bin ich nur ein halber Mensch. In die Tasten greifen und die Töne über mich hinstürmen lassen… Das ist das Leben für mich.«
»Ja, dann mußt du wohl gehen«, brachte Clemens mit schwerer Stimme hervor.
Sein Verhalten reizte Bianca. Es war doch nicht das erste Mal, daß sie auf eine größere Tournée ging. Wieso machte er heute geradezu ein Drama daraus. Sie brauchte ihre Nerven für die Aufgabe, die vor ihr lag.
»Wenn dir das nicht mehr paßt«, sagte sie mit ungewöhnlicher Schroffheit, »dann mußt du dir eben eine andere Frau suchen, eine Hausfrau, eine Glucke, die jeden Abend auf dich wartet und ihr Kind zu Bett bringt.«
Clemens stand auf, als wäre ihm plötzlich alles zu eng. Waren sie schon so weit gekommen, daß sie solche Worte für ihn fand. Er trat an die Terrassentür und starrte in den dunklen Garten hinaus, lange. Bis Bianca sich hinter ihm rührte, zu ihm kam und ihm die Hand auf die Schulter legte.
»So sollten wir nicht miteinander reden, Bianca«, sagte er leise und schmerzlich.
»Ich habe es nicht so gemeint, Clemens. Wirklich nicht. Ich liebe dich doch. Komm sei gut.«
»Ich liebe dich auch.« Mit einem großen, ernsten Blick umfaßte er ihr schönes Gesicht. Mit ihr zu leben war nicht einfach. Aber ohne sie wäre alles nichts.
Sie bot ihm ihren Mund, er küßte sie. Ihr Körper wurde weich und nachgiebig in seinen Armen, sie drängten zueinander. Versinken, vergessen… Nichts anderes sollte es mehr für sie geben in dieser Nacht.
*
»Darf ich mit Frau Herder in den Zoo gehen, Frau Scholl? Sie will mich mitnehmen«, fragte Sandra etwas atemlos.
»Wer ist Frau Herder?« fragte die Haushälterin.
»Die Mutter von meinem Freund Felix. Er hat gesagt, ich könnte mitkommen.«
»Da hättest du deinen Vater fragen müssen, Sandra.«
»Ich weiß es doch erst seit eben«, verteidigte sich das Kind. »Mein Papa hätte bestimmt nichts dagegen.«
»Kennt er denn diese Frau Herder?«
»Nein, aber er kennt den Felix«, sagte Sandra ein wenig trotzig. Wenn Frau Scholl sie nicht gehen ließ, dann würde sie weinen.
»Ich weiß nicht«, zögerte die Haushälterin, eine gepflegte, etwas streng aussehende Frau um die Fünfzig. Sie trug die Verantwortung für das Kind. Nur ungern wollte sie es einer ihr unbekannten Nachbarin überlassen. Den Jungen hatte sie schon gesehen, er war ihr ziemlich wild vorgekommen, wie er da herumturnte. Wohl kaum der richtige Umgang für die zarte Sandra.
»Ich werde versuchen, deinen Vater in der Klinik zu erreichen«, entschied sie nach einer kurzen Pause, währenddessen Sandras Blick flehend an ihr hing. »Ohne seine Einwilligung kann ich dich nicht fortlassen.« Aber von dort teilte ihr eine freundliche junge Stimme mit, daß der Herr Doktor in einer Besprechung sei und nicht gestört werden wollte. »Oder ist es eine wichtige Privatsache?« fragte sie noch.
»Nein, nein, es ist nicht so wichtig«, antwortete Frau Scholl und legte auf.
Sandra wurde rot. »Es ist wohl wichtig!« rief sie aufschluchzend und lief davon in ihr Zimmer.
Dort schob sie sich einen Stuhl ans Fenster, stützte die Arme auf und sah hinaus auf die Straße. Die Tränen liefen ihr über das Gesicht. Nichts durfte sie, nichts!
Dann sah sie Felix angesaust kommen. Er kündigte sich mit einem schrillen Pfiff an. Dafür steckte er drei Finger in den Mund, und es gellte einem in den Ohren. Aber lustig war es trotzdem. Der ganze Junge sah lustig aus, mit den stracks nach oben stehenden kurzen Haaren und den Sommersprossen auf der Nase, die ihm, wie er sagte, jedes Frühjahr kamen.
Nur hatte Sandra in dieser Minute keinen Sinn dafür.
»Komm runter!« rief er und winkte ihr mit einer weitausholenden Armbewegung zu. »Meine Mutter kommt auch gleich, sie hatte grad noch ’n Anruf.«
Verschämt wischte sich Sandra über die Wangen. »Ich darf nicht mit«, sagte sie betrübt hinunter.
Verblüfft, mit zurückgelegtem Kopf, starrte er sie an. Dann sah er die Straße entlang. »Sie darf nicht mit!« rief er seiner Mutter schon von weitem zu, die leichten Schrittes daherkam.
»Hallo, Sandra, guten Tag!« Die schlanke, mittelgroße Frau im weiten bunten Rock und kurzer Leinenjacke lächelte dem Kind am Fenster zu. »Felix hat mir schon viel von dir erzählt. Kannst du nicht mit uns in den Zoo?«
Daß Felix so eine nette, lieb aussehende Mama hatte, machte es Sandra nur noch schwerer. Sie schüttelte den Kopf. »Weil Frau Scholl Sie nicht kennt, und weil mein Papa Sie auch nicht kennt«, teilte sie mit.
Beate stutzte. »Ach ja, natürlich. Aber dem kann man ja abhelfen.« Sie klingelte an der Tür.
Sandra schöpfte wieder Hoffnung. Sie verließ ihr Zimmer und hörte auf halber Treppe zu, wie Felix’ Mutter und Frau Scholl miteinander redeten.
»Ich verstehe das sehr gut«, sagte Frau Herder. »Ich werde mich demnächst auch mit Herrn Dr. Fabrizius bekanntmachen, wenn unsere Kinder sich nun einmal angefreundet haben.«
Sie durfte mit, sie durfte mit! Sandras Herz hüpfte.
»Ist die Olle so schlimm?« fragte Felix, als sie zur Straßenbahn gingen.
»Nein, schlimm ist Frau Scholl nicht, bestimmt nicht«, antwortete Sandra gerechterweise. »Sie hat nur immer Angst, daß mir was passiert.«
»Mit uns passiert dir nix«, sagte Felix burschikos und kickte einen Stein vor sich her.
An diesem Abend hatte Sandra ihrem Papa unendlich viel zu erzählen. Sie wußte gar nicht, wo sie anfangen sollte, und es geriet ihr auch alles ein bißchen durcheinander, so erlebnisreich und lustig war der Nachmittag bei den vielen Tieren gewesen.
»Und dann ist die Mama von Felix noch mit uns ins Café gegangen. Die ist ganz süß. Papa. Die mußt du auch mal sehen.«
»Hat er eigentlich keinen Vater?« fragte Clemens eher nebenbei.
»Nein. Der ist ganz früh gestorben. Ein Seemann war das. Das Schiff ist untergegangen, hat Felix mir erzählt.«
»Das ist sehr traurig«, bedauerte Clemens.
»Hmhm. Aber Felix ist trotzdem nicht immerzu traurig. Vielleicht, weil er ihn gar nicht gekannt hat. Und sicher auch wegen seiner Mutter«, sagte Sandra altklug. »Du, Papa?« Schmeichelnd nahm sie seine Hand. »Ich hab sie eingeladen, am Sonntag mal zu uns zu kommen. Das durfte ich doch?«
Lächelnd sah Clemens auf sein Töchterchen hinab. »So, meine kleine Maus gibt schon Einladungen. Nun, dann laß sie mal kommen.«
Er wollte Frau Herder anrufen, aber sie kam ihm zuvor.
»Ich hoffe, es war Ihnen recht, daß ich Ihre Sandra für einen Nachmittag mitgenommen habe, Herr Dr. Fabrizius«, sagte sie in liebenswürdigem Ton.
»Ja, selbstverständlich. Es hat ihr viel Freude gemacht«, gab Clemens ebenso zurück. »Mich würde es freuen, wenn wir uns einmal persönlich kennenlernen würden, Frau Herder. Darf ich Sie am Sonntag nachmittag zum Tee erwarten?«
»Auf einen kurzen Nachbarschaftsbesuch, sehr gern«, antwortete Beate.
Sie konnten den Tee draußen auf der Terrasse nehmen. Für die Kinder stellte Frau Scholl Eisbecher mit Papierschirmchen hin. Felix benahm sich mustergültig, und Sandra war ganz glücklich, daß sie ihren Papa mit der so lieben Frau Herder zusammengebracht hatte. Es sah aus, als würde er sie gut leiden mögen. Sie hatte es nicht anders erwartet.
Tatsächlich empfand Clemens eine spontane Sympathie für Beate Herder. Sie sah reizend aus in ihrem rosenholzfarbenen Hemdblusenkleid, das braune Haar lag glänzend in leichten Wellen um den Kopf, auch ihre Augen waren braun und hatten einen warmen Glanz. Die ganze Person strahlte eine Herzenswärme aus, die ihn nicht unberührt ließ.
Dazu war sie eine angenehme, kluge Gesprächspartnerin, wie er alsbald feststellen konnte. Zuerst war es nur eine leichte Unterhaltung über alltägliche Dinge gewesen, an der auch die Kinder teilnehmen konnten, aber dann kamen sie auf Beates Tätigkeit zu sprechen. Ein interessanter Beruf, befand der Hausherr. Bücher und ihre Autoren, das war ein weites Feld.
»Dürfen wir spielen gehen?« fragte Sandra, denn davon verstanden sie doch noch nichts. Felix rutschte auch schon auf seinem Stuhl hin und her.
»Ich komme leider zu wenig zum Lesen«, sagte Clemens, als die beiden davongesprungen waren. »Abends bin ich oft sehr abgespannt. Was tut man da, wenn man allein ist? Man setzt sich vor den Fernseher und läßt sich berieseln, was eigentlich falsch ist.«
»Das tun auch viele, die nicht allein sind«, warf Beate ein.
Clemens nickte. »Die Gespräche verstummen mehr und mehr. Das ist keine gute Entwicklung. – Wie wäre es«, unterbrach er sich, »trinken wir noch ein Glas Wein zusammen, Frau Herder?«
»Ich habe nichts dagegen«, lächelte sie, »obwohl –«
»Es nur ein kurzer Nachbarschaftsbesuch sein sollte, ich weiß. Aber eine angenehme Stunde sollte man nicht beschränken.«
Frau Scholl räumte den Teetisch ab, und er holte eine Flasche Wein und zwei Gläser herbei. Er fühlte sich ausgesprochen wohl in Beate Herders Gesellschaft. Ihre ungezwungene, natürliche Art gefiel ihm sehr.
»Auf gute Nachbarschaft!« sagte er, als er eingeschenkt hatte, und er ließ sein Glas gegen das ihre klingen. Dann kam er auf das vorhin angesprochene Thema zurück.
»Ein englischer Roman, von dem ich gehört habe, würde mich sehr interessieren.« Er nannte ihr Namen und Autor. »Leider reichen meine Sprachkenntnisse nicht aus, um ihn im Original zu lesen.«
Ihr hübsches Gesicht zeigte plötzlich einen verschmitzten Ausdruck. »Er ist soeben in deutscher Sprache erschienen, Herr Fabrizius. Es war ein schönes Stück Arbeit«, nickte sie vor sich hin.
»Oh – haben Sie ihn übersetzt?« entfuhr es Clemens überrascht.
»Ja, der Roman wird bald in allen Buchhandlungen zu haben sein. Die Auslieferung hat begonnen. Aber Sie können ihn auch von mir haben. Der Verlag hat mir bereits einige Exemplare zugeschickt.«
»Da müssen Sie mir aber etwas hineinschreiben«, sagte Clemens mit einem heiteren Lächeln. Doch er meinte es nicht so ernst. »Nein, nein, ich werde ihn mir schon kaufen«, fügte er hinzu.
Zwei Tage später aber überreichte ihm Frau Scholl ein Päckchen. »Das hat der Junge für Sie abgegeben, Herr Doktor.«
Es war das Buch. Mit nachbarschaftlichen Grüßen, Beate Herder hatte sie hineingeschrieben.
*
Manchmal rief Bianca an. Das Gespräch verlief immer in ungefähr gleicher Weise. Sie erkundigte sich, wie es um die Familie bestellt war, doch noch bevor ihr Mann recht Antwort geben konnte, berichtete sie schon von ihren Erfolgen, von den Kritiken, die des Lobes voll waren.
Natürlich war es auch ein Streß, räumte sie ein, alle paar Tage in einem anderen Hotel und nur aus dem Koffer zu leben.
»Du willst es ja nicht anders«, bemerkte Clemens.
»Der Applaus meines Publikums entschädigt mich für alles«, versicherte sie. Dann verlangte auch Sandra nach dem Hörer, und ihre Frage war auch stets dieselbe: »Kommst du bald wieder, Mami?«
»Noch nicht so bald, Schätzchen. Ich habe noch ein großes Programm.«
Als mehr als vier Wochen vergangen waren, verabredeten sie endlich ein Treffen. Clemens hatte Sehnsucht nach ihr.
»Aber wir sehen uns erst nach dem Konzert, ja, bitte«, sagte Bianca. »Es ist ausverkauft, du wirst deinen Platz in der Loge des Musikdirektors haben. Ich wohne im Sheraton-Hotel und werde dir dort ein Zimmer bestellen.«
Sandras Augen bettelten und flehten, daß er sie mitnehmen sollte. Sie träumte doch schon lange davon, ihre berühmte Mama auch einmal bei einem öffentlichen Auftritt zu erleben. Davon, daß sie sie zärtlich umarmen würde, bevor sie zur Bühne eilte.
Daraus wurde freilich nichts, auch wenn der Papa schließlich nachgegeben hatte und sie mitfahren durfte. Man ließ sie nicht vor. Es gab strikte Anweisung, die Künstlerin nicht zu stören.
Aber als Sandra dann mit ihrem Vater in der Loge saß, war diese erste Enttäuschung schnell vergessen. Staunend, mit großen Augen, beobachtete sie, was für eine Menschenmenge da in den großen Saal strömte. Die kamen nun alle, um das Klavierspiel ihrer Mama zu hören, und alle waren angezogen wie zu einem Fest. Ihr Papa hatte ja auch einen dunklen Anzug an, und sie das feine neue Kleidchen, das Frau Scholl extra für diesen Abend mit ihr gekauft hatte.
»Ich bin so aufgeregt, Papa«, flüsterte sie. »Kommt sie jetzt bald?«
Aber erst nach dem dritten Klingelzeichen, als jeder, aber auch jeder Platz besetzt war, wurde es still im Saal.
Und dann erschien sie auf der Bühne – Bianca Fabrizius – ihre Mutter!
Sandra hielt den Atem an. Wie wunderschön sie aussah in ihrem bodenlangen Kleid, wie eine Königin. Das Publikum empfing sie mit Applaus, aber als sie sich an den großen schwarzen Flügel setzte, war es wieder mucksmäuschenstill.
Und sie griff in die Tasten, zauberte Mozartklänge von unsagbarer Zartheit aus dem kostbaren Instrument, und mehr und mehr erfüllte die Musik den hohen Raum, manchmal leidenschaftlich und aufwühlend, dann wieder schwebend und träumerisch verhallend.
Ja, wie aus einem Traum erwachte das Kind, als das Konzert zu Ende war.
»Ist sie nicht wunderbar, Papa?« wisperte sie zu ihm empor.
»Ja, das ist sie.« Seine Stimme klang bewegt. »Komm«, er nahm sie bei der Hand und zog sie von ihrem Platz, »wir gehen jetzt zu ihr in die Garderobe.« Der Applaus verhallte hinter ihnen, als sie sich den Weg dorthin bahnten, aber noch verstummte er nicht.
Blumen über Blumen standen da in der Garderobe, und sie waren es nicht allein, die auf die Künstlerin warten mußten, denn wieder und wieder mußte sie sich ihrem dankbaren Publikum zeigen.
Endlich kam sie, erhitzt, strahlend, glücklich, leicht aufgelöst das goldrote Haar.
»Mami, Mami!« Sandra stürzte auf sie zu.
»Ja, mein Liebling, du hier?!« Weit breiteten sich Biancas Arme aus, um ihr Kind zu umfangen. Und dieser Moment war für Sandra nun noch schöner als alle Träume.
Dann begrüßte sie ihren Mann: »Clemens, schön, daß du gekommen bist.«
Er zog ihre Hand an die Lippen. »Du warst wieder großartig, Bianca.«
Schon umringten alle möglichen Leute die Künstlerin, um sie zu beglückwünschen. Sie waren laut, sie waren überschwenglich, Bianca genoß es und vergaß im allgemeinen Freudentaumel ihr Töchterchen. Bis ihr Blick wieder auf das Kind fiel, das da klein und verwirrt stand und sich an die Hand ihres Vaters klammerte.
»Clemens, bitte«, wandte sie sich an ihn, »fahr doch voraus und bring Sandra schon ins Bett. Wir sehen uns später im Hotel.« Und sie ließ sich, huldvoll lächelnd, von ihrem nächsten Bewunderer die Hand küssen. »Folgen Sie mir tatsächlich von Stadt zu Stadt, Baron?« hörte Clemens sie noch sagen, als er sein kleines Mädchen mit sich nahm.
Sandra sagte nicht mehr viel. Sie war nun sehr müde, so lange war sie noch nie aufgewesen. Sie schlief bald ein in dem breiten Bett, darin sie ganz winzig aussah.
Clemens ging wieder hinunter. Bianca war noch nicht da. Als sie nach etwa einer halben Stunde kam, war sie umgezogen, mit Blumen im Arm, und von einem ganzen Troß umgeben.
»Wer sind diese Menschen?« raunte er ihr zu. »Schick sie weg.«
»Unmöglich, Clemens, es sind die Veranstalter und Honoratioren der Stadt.« Sie wurden ihm vorgestellt. Man ging in den Speisesaal, wo die Tafel gedeckt war. Bianca pflegte immer erst nach dem Konzert zu speisen. Es gab diverse Köstlichkeiten, Champagnerpfropfen knallten dazu. Sie war auch hier strahlender Mittelpunkt, zeigte keine Anzeichen von Müdigkeit.
Es war lange nach Mitternacht, als die Gesellschaft, etwas angeheitert, auseinanderging.
Bianca verabschiedete ihren Mann vor ihrer Tür.
»Ich hatte mir das ja etwas anders gedacht«, sagte Clemens.
»Tut mir leid. Aber so geht das immer zu an einem solchen Abend. Ich gehöre nicht mir allein. Du bleibst doch bis übermorgen, und morgen bin ich frei. Ich werde schon mit euch frühstücken, aber bitte nicht vor zehn.« Sie gab ihm einen flüchtigen Kuß und verschwand in ihrem Zimmer.
Bianca war reizend am nächsten Tag, zärtlich zu dem Kind, ganz liebevolle Gattin zu Clemens. Um
die Mittagszeit unternahmen sie einen Spaziergang, eine glückliche Sandra zwischen sich. Den Nachmittag verbrachten sie in ihrem Appartement, zu dem ein Salon gehörte.
»Ich streiche jeden Tag durch, bis du wiederkommst, Mama«, sagte Sandra. »Es sind noch vierzig Tage, hat Felix gesagt. Der kann schon rechnen.«
»Es werden noch ein paar Tage mehr sein, Schätzchen. In einigen Städten wiederhole ich den Abend, weil nicht alle Platz bekommen haben.«
»Du beabsichtigst die Tournée zu verlängern?« fragte Clemens betroffen.
Als sie nur knapp bejahte, sagte er langsam: »Du nimmst dir sehr viel Freiheit, Bianca.«
»Ich brauche sie, Clemens«, sagte sie kühn. Dabei sahen sie sich ernst und gerade in die Augen.
»Ich habe meinen Urlaub geplant, wir wollten zusammen verreisen…«
»Verschieb ihn«, sagte Bianca leichthin.
»So einfach ist das nicht. Ich habe mich mit meinem Kollegen abgesprochen«, erwiderte Clemens mit gerunzelter Stirn.
Seine Frau zuckte die Achseln. Sie sah auf Sandra, die mit ängstlichen Augen von einem zum anderen blickte.
»Geh nach nebenan, Liebling, da steht ein Fernseher. Nachmittags sind doch Sendungen für Kinder, schau dir ein bißchen was an.«
Sandra gehorchte. Das empfindsame Kind merkte wohl, daß da eine Mißstimmung aufkam. Bisher war alles so schön gewesen. Aber jetzt ärgerte sich der Papa, daß die Mama noch länger von zuhause fortbleiben wollte. Auch sie betrübte das sehr. Natürlich war sie sehr stolz auf ihre Mutter, zumal nach dem gestrigen Abend. Aber waren ihr all die vielen Leute denn wichtiger als sie und ihr Papa? Ein paar Tage länger… Aber wenn nun wieder Wochen daraus wurden?
»Ich habe die Absicht«, begann Bianca, als sie allein waren, »mir von meinen Gagen ein Haus in Südfrankreich zu kaufen. Es ist ein äußerst günstiges Angebot, in traumhafter Lage.«
Clemens glaubte nicht richtig gehört zu haben. »Was willst du mit einem Haus in Südfrankreich?« fragte er fassungslos.
»Mich von Zeit zu Zeit dort erholen. Süden, Sonne, das Meer… Ich habe diese Gegend immer sehr geliebt.«
»Wir haben doch ein schönes Haus«, hielt er ihr entgegen. »Kannst du dich dort nicht erholen zwischen deinen Konzerten? Genügt dir das auf einmal nicht mehr? Soll ich, soll Sandra, noch öfter auf dich verzichten als wir das ohnehin schon müssen?«
»Ich höre schon wieder einen versteckten Vorwurf aus deinen Worten«, behauptete Bianca gereizt.
»Der wohl nicht ganz unberechtigt ist«, sagte Clemens bitter.
»Ihr könnt doch kommen, sooft ihr wollt. Es wird euch als Ferienhaus ebenso gehören wie mir«, erklärte sie, ohne seinen Einwurf zu beachten.
»Das sind doch leere Worte. Ich habe meinen Beruf.«
»Eben«, fiel sie ihm heftig ins Wort, »der dir genauso wichtig ist wie mir der meine. Warum versuchst du immer wieder, mich darin einzuschränken?«
»Das tue ich doch gar nicht.« Clemens schüttelte den Kopf. Sie redeten im Kreis. Das wurde zermürbend wie schon so oft. Und nun auch noch dies: Ein Haus wollte sie kaufen, in dem sie sich »erholen« konnte. Ohne ihn. Ohne ihr Kind.
»Vielleicht willst du ganz deine Freiheit haben.« Seine Stimme schwankte ein wenig. »Manchmal hört es sich fast so an, als würden wir dir allmählich zu einer Last. – Oder«, der Gedanke durchzuckte ihn jäh, »ist da vielleicht ein anderer Mann? An Verehrern fehlt es dir ja nicht.«
»Es gibt keinen anderen Mann, und es wird auch nie einen anderen geben«, widersprach sie erregt. »Ich gehöre meiner Musik und dir. Ich hasse es nur, wenn du mir Vorschriften machen willst. Warum soll ich mir nicht ein Haus in Südfrankreich kaufen, wenn es mir gerade so gefällt.« Herausfordernd sah sie ihn an.
In diesem Augenblick kam Sandra von nebenan. »Ich mag nicht fernsehen«, klagte sie. »Ich möchte bei euch sein.« Und sie lehnte sich gegen ihre Mutter, die im Sessel saß.
»Ja, Schätzchen, ist ja gut.« Bianca streichelte das kleine Gesicht. »Ist ja alles gut…«
Mit einem dunklen Blick sah Clemens auf die beiden, die ihm das Liebste auf der Welt waren. Nichts war gut. Sie entfernten sich voneinander, und er wußte nicht, wie er das aufhalten sollte.
*
»Ingeborg ist zu ihrer Tante nach Karlsruhe gefahren«, sagte Bertold Basler. »Die ist nach ihrer Operation noch nicht so recht auf dem Posten, da will sie sich ein bißchen um sie kümmern an diesem Wochenende. Morgen abend kommt sie wieder. Gibt es einen besonderen Grund für deinen Anruf?«
»Nein, ich wollte mich nur mal wieder melden, weil ich länger nichts von dir gehört habe«, gab Beate zurück. Eine Alarmglocke hatte bei ihr angeschlagen. War Ingeborg wirklich bei ihrer Tante? Sie erinnerte sich nicht, daß da jemals ein besonders herzliches Verhältnis bestanden hatte.
»Ja, in der Praxis ist immer viel zu tun, manchmal kommt sie sehr spät nach Hause«, hörte sie den Mann ihrer Freundin sagen.
Oh, du ahnungsloser Engel, dachte sie.
Aber möglichst leichthin bemerkte sie: »Dann müßt ihr also sehen, wie ihr allein zurechtkommt, ihr beiden Männer. Ich wollte heute nachmittag mit Felix ins Freibad fahren. Es ist ja heute schon fast sommerlich warm.«
»Das ist eigentlich eine gute Idee«, stimmte Bertold ihr zu. »Da könnte ich mich doch mit Uli anschließen.«
»Natürlich, wenn ihr Lust habt«, sagte Beate lebhaft. »Felix wird sich freuen, wenn er Gesellschaft hat.«
»Ich hole euch ab. Um zwei, paßt das?«
Es paßte. Sie verstauten ihre Badesachen in Bertolds Wagen, die Söhne hatten sich gleich viel zu erzählen.
Es herrschte viel Betrieb da draußen, was kein Wunder war bei dem schönen Wetter an diesem Samstag. Zum Glück fanden sie doch noch einen angenehmen Platz auf der großen Wiese im Halbschatten eines Baumes.
Dort lagerten Beate und Bertold nach dem Schwimmen, während die Jungs sich weiter am Wasser vergnügten.
»Hat Ingeborg sich eigentlich bei dir mal über irgend etwas beklagt?« fragte der Mann nach einem längeren Schweigen.
Das kam so unvermutet, daß Beate aufhorchte. »Worüber sollte sie sich denn beklagen?«
»Ich weiß ja nicht.« Er zupfte ein paar Grashalme neben der Matte aus. »Ihr seid doch gute Freundinnen, und einer Freundin vertraut sich eine Frau vielleicht eher an als dem eigenen Mann…« Ein nachdenklicher Ausdruck stand in seinem Gesicht.
Beate, die ausgestreckt lag, die Arme unter dem Nacken verschränkt, sah in das Laubdach über ihr. War er am Ende doch nicht so ahnungslos, wie sie dachte? »Ich habe Ingeborg seit zwei, drei Wochen nicht mehr gesehen, Bertold«, sagte sie ausweichend.
»Hmhm.« Wiederum zögerte er. »Es mag ja sein, daß ich es mir nur einbilde, daß ihr manches nicht mehr paßt. Sie ist launisch geworden, so wechselnd in ihren Stimmungen. Vielleicht ist sie auch nur überarbeitet. Ich habe ihr schon vorgeschlagen, daß sie nur noch halbtags in die Praxis gehen soll, wenn dieser Dr. Fendrich sie über Gebühr in Anspruch nimmt. Dann soll er eben noch eine Kraft einstellen.«
»Aber das will sie wohl nicht«, bemerkte Beate, um Zeit zu gewinnen. Was sollte sie dazu sagen. Sollte sie sagen: Deine Frau betrügt dich. Wüßte sie doch nur nichts davon!
Bertold seufzte auf. »Nein, sie will es nicht. Dabei wäre es auch besser für Uli, wenn seine Mutter ab mittags zu Hause sein könnte.«
»Was ist mit Uli?« Sein Sohn Ulrich hatte sich von hinten angeschlichen und sprang ihm auf den Rücken. Er hatte nur gerade seinen Namen gehört.
»Du Räuber!« Auflachend duckte sich der Vater. »Wo hast du denn Felix gelassen?« Aber da kam er auch schon, warf sich neben seiner Mutter auf die Matte. »Da ist so ein großer Junge, der ärgert uns immer, aber ich hab ihn zurückgeärgert«, berichtete er.
»Das ist so ein Blödian, der ist bei uns in der Schule«, warf Uli ein.
Zu Beates Erleichterung waren sie damit von dem heiklen Thema abgekommen. Sie nahm sich vor, Ingeborg nochmals ins Gewissen zu reden. Ihr Groll richtete sich aber auch gegen diesen Dr. Fendrich, der leichtfertig und skrupellos mit seiner verheirateten Assistentin eine Liaison anfing. Ja, wirklich, sie mußte alles tun, um die Freundin vor dem Abgrund zurückzureißen, auf den sie zusteuerte.
Doch dazu sollte es nicht mehr kommen.
Am Abend, als sein Sohn schon schlief, griff Bertold spontan zum Hörer und wählte die Nummer der Tante Hannelore Milster in Karlsruhe.
»Bertold«, sagte die ältere Dame erstaunt, nachdem er sich gemeldet hatte, »daß du mich mal anrufst!«
»Wie geht es dir?« erkundigte er sich. »Ich hoffe, du bist auf dem Wege der Besserung.«
»Ja, ja, es geht schon wieder, danke der Nachfrage. Es muß ja gehen.«
»Und, macht ihr es euch gemütlich zusammen?« fragte Bertold angeregt.
»Wer – wir? Ich bin doch allein. Mein einziger Freund ist der Fernseher«, kam es trocken zurück.
Bertold stutzte. »Aber Ingeborg ist doch bei dir?«
»Ingeborg?« Das klang mehr als verwundert. »Wann hätte Ingeborg mich mal besucht. Ich verstehe das ja auch, daß sie dafür gar keine Zeit hat. Mit Beruf und Familie ist sie eingespannt genug.«
Bertold war es, als würde ihm der Boden unter den Füßen weggezogen. Sekundenlang war er keines Wortes fähig.
»Wieso kommst du denn darauf, Bertold?« fragte Hannelore Milster in verändertem Ton. »Wollte sie denn zu mir?«
»Ja… Sie ist heute vormittag losgefahren… Mein Gott, da muß doch etwas passiert sein!« stieß er hervor.
»Ist sie mit dem Wagen gefahren?« fragte die Tante nun auch aufgeregt.
»Nein, mit dem Zug. Sie wollte zum Bahnhof.«
»Aber da kann doch eigentlich nichts passiert sein. Und wenn,
hättest du Nachricht bekommen. Sie hat doch einen Ausweis bei sich.«
»Aber was sollte denn sonst sein?« Der Mann atmete schwer.
Ratlos schwiegen sie beide. Bis Bertold sagte: »Entschuldige, daß ich dich angerufen und auch in Aufregung versetzt habe, Tante Hannelore.«
»Aber ich bitte dich, Bertold.« Sie räusperte sich. »Vielleicht«, fuhr sie zögernd fort, »ist sie statt zu der alten Tante lieber zu einer Freundin gefahren, und alles wird sich ganz harmlos aufklären.«
»Das möchte ich gern glauben. Aber ich wüßte nicht, wo
sie noch eine Freundin hätte. Und daß Ingeborg es sich so plötzlich anders überlegt haben sollte, erscheint mir auch unwahrscheinlich.«
»Ruf mich bitte an, wenn du etwas erfährst, denn natürlich mache ich mir jetzt auch Sorgen.«
Bertold versprach es. – Und was jetzt? Alles in ihm war in Aufruhr. Es erschien ihm undenkbar, tatenlos in der stillen Wohnung zu sitzen, die Minuten zu Stunden vergehen zu lassen und von schrecklichen Bildern bedrängt zu werden. Frauen wurden verschleppt, vergewaltigt…
Aber doch nicht an einem hellichten Frühlingstag, versuchte sich sein Verstand gegen solche Horrorvorstellungen zu wehren, nicht bei einer so harmlosen Reise von Stadt zu Stadt.
Mitten in seine wirren Überlegungen hinein läutete das Telefon. Er riß den Hörer an sich.
»Hallo, guten Abend«, sagte die muntere Stimme seiner Frau, »ich wollte mich mal erkundigen, wie es bei euch läuft. Ward ihr beim Italiener zum Essen, wie wir es besprochen hatten?«
»Wo bist du, Ingeborg?« Bertold begriff jetzt überhaupt nichts mehr.
»Wo soll ich sein? Tante Hannelore geht doch abends nicht mehr weg. Wir sitzen hier zusammen. Sie läßt dich grüßen.«
»Danke«, sagte er mechanisch und starrte gegen die Wand.
»Ist Uli schon im Bett? Was habt ihr denn heute getan?«
»Ja, Uli schläft schon. Wir waren den ganzen Nachmittag mit Beate und Felix im Freibad.« Bertold war es, als stünde ein anderer neben ihm und antwortete an seiner Stelle.
»Wie nett. Also, dann macht’s gut, ihr beiden. Bis morgen.«
Eine Nacht lag dazwischen, in der Bertold Basler begreifen mußte, daß seine Frau ihn betrog. Aus welchem Grund sollte sie sonst ein solches Lügennetz um ihn spinnen.
War seine Ehe denn auf Sand gebaut gewesen? Zehn Jahre waren sie verheiratet. Es waren gute Jahre gewesen. So hatte er es zumindest empfunden. Was war mit Ingeborg geschehen, daß sie ihr auf einmal nichts mehr gelten sollten?
Bereits am frühen Sonntagmorgen rief Hannelore Milster an. »Hast du denn noch nichts von Ingeborg gehört?« fragte sie unruhig.
Ach Gott, daß er sie vergessen hatte, nach diesem Schlag, der ihn niedergeschmettert hatte!
»Doch, es hat sich aufgeklärt, Tante Hannelore. Ingeborg soll es dir selber erzählen, warum sie ihre Absicht geändert hatte.«
Ihr würde schon irgend etwas einfallen. Auf eine Lüge mehr oder weniger kam es ihr sicher nicht an.
»Gut, daß du wieder da bist, Mama«, empfing Uli seine Mutter, als sie gegen abend heimkam. »Mit Papa war heute nicht richtig was anzufangen. Er hat mich dann zu Tante Beate gebracht. Da hab ich mit Felix Federball gespielt und so.«
Sein Vater legte ihm die Hand auf die Schulter. »Solltest du nicht noch mal in deine Bücher sehen, wegen der Klassenarbeit, die ihr morgen schreibt?«
»Ooch«, machte Uli. Aber er zog es doch vor, zu gehorchen, und ging in sein Zimmer. Sein Vater war wirklich nicht gut drauf. Es war eben nix, wenn die Mutti nicht da war.
Mit einem düsteren Blick wandte sich Bertold an seine Frau.
»Bevor du mir erzählst, wie nett es bei deiner Tante war, sollst du wissen, daß ich gestern bei ihr angerufen habe. Es war eine peinliche Sache, wie du dir denken kannst. Dein ganzes Lügengebäude ist also haltlos geworden.«
Glühende Röte stieg in Ingeborgs Gesicht. Mit einer schroffen Bewegung kehrte sie sich von ihm ab.
»Es liegt wohl auf der Hand, daß du mich betrügst«, sprach Bertold weiter. »Wer ist der Mann?«
»Dr. Fendrich«, sagte Ingeborg tonlos.
Bertold nickte, als habe er es geahnt. Diese merkwürdigen Überstunden, zu denen sie sich so bereitwillig hergab, ihr verändertes Wesen…
»Jetzt weiß ich doch, wie einem Mann zumute ist, dem Hörner aufgesetzt werden. Schämst du dich eigentlich nicht?« Neben aller Bitterkeit klang Verachtung in seiner Stimme auf.
Ingeborg fuhr herum. Ihre Augen flackerten, ihr Atem ging rasch. »Wir lieben uns, Bertold«, stieß sie hervor. »Ich hätte es dir vielleicht schon früher sagen sollen. Aber«, sie schluckte hart, »ich weiß auch, was ich damit aufs Spiel setze.«
»Unsere Ehe. Willst du dich scheiden lassen?«
Sie wandte den Kopf und sah zu Boden.
»Es ist wohl bequemer zu lügen und zu denken, der Trottel von einem Ehemann merkte nichts…«
»Bequemer ist es nicht, wenn man nicht den Mut hat, klare Verhältnisse zu schaffen. Ich habe auch mit Torsten noch nicht darüber gesprochen.« Ihre Stimme erhob sich. »Du mußt nicht denken, daß ich es mir so leicht mache, Bertold! Es geht ja auch um den Jungen.«
»Der Junge bleibt bei mir, wie es auch kommen mag, das muß dir klar sein«, sagte Bertold mit Härte.
Sie maßen sich mit Blicken wie zwei Fremde.
Daß sich doch zwischen zwei Menschen, die jahrelang unverbrüchlich zusammengehörten, ein solcher Abgrund auftun konnte!
»Wir wollen später weiter reden, Ingeborg. Unserem Sohn wollen wir doch so lange wie möglich seine Unbefangenheit bewahren.«
Aber im Grunde genommen gab es gar nichts zu reden an diesem Abend. Noch nicht. Die quälenden Auseinandersetzungen würden erst später kommen, wenn die Starre wich. Ihre Worte »Wir lieben uns«, dröhnten noch in Bertolds Ohren. Einfach so: Wir lieben uns, hatte sie gesagt. Daß ihr das Ungeheuerliche über die Lippen gekommen war.
Ingeborg suchte auch nicht nach Erklärungen. Er würde es doch nicht verstehen. Sie dachte an Torsten, und was er dazu sagen würde, daß ihr Mann es nun wußte. Sie spürte seine Küsse noch auf ihrem Mund, und sie zitterte dem nächsten Tag entgegen.
Die anderen Helferinnen in der Praxis hatten es längst gemerkt, daß zwischen dem Doktor und Ingeborg Basler etwas spielte, auch wenn diese den Schein zu wahren suchten und bei der Arbeit betont offiziell miteinander umgingen.
Sie sahen sich denn auch nur bedeutsam an, als sie nach beendeter Sprechstunde die Kollegin etwas abseits vor dem Haus auf und ab gehend bemerkten. Anscheinend hatten die beiden wieder ein Rendezvous.
»Daß sie sich nicht schämt, wo Mann und Kind zu Hause auf sie warten«, sagte Beatrix zu Anja, mit der sie zur Straßenbahn ging. »Ich hätte das nie von ihr gedacht. Als unser Dr. Müller noch da war, haben wir uns immer prima verstanden. Jetzt sehe ich sie in einem anderen Licht.«
Anja zuckte die Achseln. »Soll ja oft genug vorkommen, daß verheiratete Frauen Seitensprünge machen. Der Fendrich hat ihr den Kopf verdreht.«
Als er kam und mit raschen Schritten auf seinen Wagen zugehen wollte, stellte sich Ingeborg ihm in den Weg.
»Aber heute doch nicht«, sagte der Mann, noch bevor sie den Mund auftun konnte. »Ich habe etwas vor.«
»Doch, bitte«, versetzte sie mit blasser Stimme. »Ich muß mit dir reden.« Auch ihr Gesicht war blaß, sie hatte Schatten unter den Augen.
»Was ist denn los? Du warst unaufmerksam heute, Ingeborg.«
»Entschuldige.« Ihre Lider zuckten. »Du wirst es mir nachsehen, wenn ich dir sage, was passiert ist.«
Mit einem langen Blick sah er sie an. »Dann komm, steig ein«, sagte er kurz und ging ihr voraus.
»Fahren wir zu dir«, bat sie, als sie nebeneinander im Wagen saßen.
»Ich sage dir doch, daß ich heute keine Zeit habe«, kam es etwas ungeduldig zurück. »Hatten wir nicht das ganze Wochenende zusammen?«
Da hatte er andere Töne für sie gehabt. Da war sie sein Ingelein gewesen. Ihre Hände krampften sich um ihre Tasche. Am liebsten wäre sie davongelaufen. Aber das ging nun nicht mehr.
»Also sag schon, was du auf dem Herzen hast«, drängte Torsten Fendrich.
»Mein Mann weiß alles«, preßte Ingeborg hervor. »Er hat bei meiner Tante angerufen, und so ist die Sache aufgeflogen.«
»Ach herrje! Was hast du ihm denn gesagt, hast du dich herausreden können?« Dabei warf er einen raschen Blick auf die Uhr.
»Ich habe ihm die Wahrheit gesagt, Torsten. Daß wir uns lieben… Aber ich weiß nicht, wie es jetzt weitergehen soll«, fügte sie beinahe flüsternd hinzu, während ihr Kopf ihr auf die Brust sank.
»Ja, Ingeborg, aber was soll ich denn dabei tun?« Es schien ihn nicht einmal sonderlich zu berühren. »Du mußt schon allein sehen, wie du jetzt aus dieser dummen Geschichte wieder herauskommst.«
Ingeborg zuckte zusammen. Eine dumme Geschichte nannte er es! War das noch der Mann, der ihre Beziehung für eine zauberhafte Romanze gehalten hatte und sich wünschte, daß es nicht nur eine Episode bleiben möge?
»Irgendwie wirst du deinen Mann schon wieder versöhnen können«, fuhr er fort. »Du hast ihn mir doch als einen ruhigen, gutmütigen Typ hingestellt. Er wird sich nicht gerade mit mir duellieren wollen. Wir werden eben in Zukunft vorsichtiger sein.«
So elend fühlte sich Ingeborg, daß sie keines weiteren Wortes fähig war. Was hatte sie sich denn nur vorgestellt? Daß Torsten sie tröstend in den Arm nehmen würde, ihr am Ende sagen würde: Es sollte wohl so sein, nun dürfen wir uns zueinander bekennen.
Törin, die sie gewesen war! Er wollte sie ja gar nicht für immer, wie er im Rausch der Sinne vorgegeben hatte.
Illusionen, nichts als Illusionen!
Torstens Finger trommelten auf das Steuerrad. Richtig, er hatte es ja eilig, fortzukommen. »Entschuldige, daß ich dich aufgehalten habe«, sagte sie tonlos, stieg aus und lief wie mit frierend hochgezogenen Schultern davon.
*
»Okay, wenn du unbedingt meinst, daß ich neue Schuhe brauche, dann gehn wir eben, Mama«, sagte Felix zu seiner Mutter. Er hatte eine merkwürdige Abneigung dagegen, in Geschäfte zu gehen und etwas anzuprobieren.
»Wenn wir unsere Einkäufe erledigt haben, besuchen wir auf dem Rückweg Tante Ingeborg, da kannst du mit Uli spielen.«
Beate machte sich Sorgen um die Familie, seit Bertold ihr am Samstag überraschenderweise den Sohn gebracht hatte. Wie versteinert war sein Gesicht gewesen, aber er hatte nur gesagt: »Frag mich nichts.«
Sie hatte es danach nicht gewagt, dort anzurufen, und Ingeborg rührte sich auch nicht. Jetzt verlangte es sie aber doch zu wissen, wie es um die Menschen stand, mit denen sie seit langem freundschaftlich verbunden war.
Uli spielte mit einem anderen Jungen vor dem Haus, als Beate, mit einer Einkaufstüte und an der linken Hand ihr Söhnchen, die Straße entlangkam. Sie ließen ein ferngesteuertes Spielzeugauto dort herumsausen. Als Uli sie entdeckte, lief er auf sie zu.
»Ich muß dir was sagen, Tante Beate!« Er winkte sie zu sich herab, sie beugte sich über ihn. »Bei uns ist es gar nicht mehr schön«, tuschelte er ihr ins Ohr. »Meine Eltern reden fast nichts mehr zusammen, und sie schlafen auch nicht mehr zusammen. Papa nimmt immer sein Bettzeug und schläft auf der Couch.«
»Was flüsterst du denn?« entrüstete sich Felix. »Mich siehst du wohl überhaupt nicht.«
Beate strich Uli über das Haar. »Ist deine Mutti denn jetzt da?«
»Ja, ist doch Mittwoch. Sie ist überhaupt nicht mehr so oft weg. Möcht nur wissen, warum sie sich denn böse sind. Vielleicht kriegst du das raus, Tante Beate.«
Beate nickte ungewiß. »Ich geh erst mal allein hinein. Laßt Felix mit euch spielen.« Der war schon bei dem anderen Jungen und ließ sich mit ihm wichtig über das Auto aus.
Mit einem halben und nur gezwungenen Lächeln begrüßten sich die Freundinnen. Ingeborg war beim Bügeln. »Laß dich nicht stören«, sagte Beate. »Ich setze mich da hin und schau dir zu.«
Ein paar Minuten lang plauderten sie über völlig alltägliche Dinge, das Wetter, die neuen Schuhe von Felix und wie teuer Kindersachen doch waren.
Dann schaltete Ingeborg das Bügeleisen ab. »Ich glaube, wir brauchen uns nichts vorzumachen, Beate. Du wirst schon wissen, was los ist.«
»Ich ahne es nur, Inge. Du warst gar nicht bei deiner Tante, und Bertold muß irgendwie dahintergekommen sein. Er sah schrecklich aus, als er neulich sonntags zu mir kam und Uli brachte.«
Mit müder Miene wandte sich Ingeborg zum Schrank. »Trinkst du einen Kognak mit mir?«