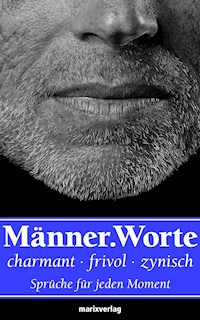30,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mami
- Sprache: Deutsch
Die Familie ist ein Hort der Liebe, Geborgenheit und Zärtlichkeit. Wir alle sehnen uns nach diesem Flucht- und Orientierungspunkt, der unsere persönliche Welt zusammenhält und schön macht. Das wichtigste Bindeglied der Familie ist Mami. In diesen herzenswarmen Romanen wird davon mit meisterhafter Einfühlung erzählt. Die Romanreihe Mami setzt einen unerschütterlichen Wert der Liebe, begeistert die Menschen und lässt sie in unruhigen Zeiten Mut und Hoffnung schöpfen. Kinderglück und Elternfreuden sind durch nichts auf der Welt zu ersetzen. Genau davon kündet Mami. E-Book 1: Was wirklich wichtig ist … E-Book 2: Ein Mädchen, das niemand will? E-Book 3: Was geht in Erics Köpfchen vor? E-Book 4: Sie gewann die Herzen der Kinder E-Book 5: Wenn du mein Papa wärst … E-Book 6: Unsere Suse macht das schon E-Book 7: Uns wird niemand mehr trennen E-Book 8: Die Schönste im ganzen Land … E-Book 9: Ich bin doch deine Mama! E-Book 10: Rasant ins Familienglück
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1205
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Was wirklich wichtig ist …
Ein Mädchen, das niemand will?
Was geht in Erics Köpfchen vor?
Sie gewann die Herzen der Kinder
Wenn du mein Papa wärst …
Unsere Suse macht das schon
Uns wird niemand mehr trennen
Die Schönste im ganzen Land …
Ich bin doch deine Mama!
Rasant ins Familienglück
Mami – Staffel 34 –
E-Book 2058-2067
Diverse Autoren
Was wirklich wichtig ist …
Unveröffentlichter Roman
Roman von von Marlenhorst, Rita
Viola schloss die Augen und atmete tief ein: der Geruch von schmelzender Schokolade war berauschend!
Ihre Mutter war dabei, ein neues Rezept auszuprobieren und hatte Viola um Hilfe bei der Zubereitung der Sauce gebeten. Es war ein ganz besonderes Rezept, das ihr ein befreundeter Koch aus Mexiko geschickt hatte. Er behauptete, es handle sich um eine typische Speise seines Landes. Das sollte man sich nur mal vorstellen: Truthahnfleisch mit pikanter Schokoladensauce!
Obwohl ihr persönlich eine warme Schokosauce zu Vanilleeis besser gefallen hätte, half Viola gern. Bedächtig und ausdauernd in großen Töpfen zu rühren, das war ihr immer ein Vergnügen, und im Grunde war es ihr sogar herzlich egal, was sich darin befand. Für eine Dreizehnjährige mochte das eine ungewöhnliche Freizeitbeschäftigung sein, aber eigentlich war ihre Vorliebe naheliegend: schließlich drehte sich im Leben der Kühners fast alles um gutes Essen. Nur das ganze geschäftige Drumherum beim Kochen war Viola immer ziemlich lästig. Je eintöniger die Tätigkeit, desto ausgezeichneter konnte sie sich dabei entspannen. Mama verbreitete oft so einen Stress!
»Cara mia! Jetzt musst du deine Sauce zu meiner Sauce geben, und zwar hurtig!«
Prompt! Schon fing der Stress an! Viola öffnete die Augen, seufzte tief auf und begann unter dem kritischen Blick ihrer Mutter, mit einer Kelle die flüssige Schokolade in den riesigen Kochtopf zu schöpfen, in dem Sophia Kühner, geborene Carlucci, eifrig rührte.
»Nicht zu schnell!«, warnte sie, als sich ein Schwall Schokolade in den Saucentopf ergoss. Viola musste lächeln, denn sie wusste schon, welcher Spruch als nächstes kam. Und richtig: »Zügig, aber nicht hektisch!«
»Stopp!«, tönte es da vom riesigen quadratischen Tisch her, der die Raummitte beherrschte, und fast wäre Viola die Schöpfkelle aus der Hand gefallen.
Am Tisch saß Marita, die noch ein paar Augenblicke zuvor voll und ganz mit ihren Hausaufgaben beschäftigt gewesen war, doch nun starrte sie entgeistert auf ihre große Schwester und ihre Mutter. »Hört auf, ihr habt euch vertan!«
»Marita, du bringst uns ganz durcheinander!«, sagte Sophia, und ihre Augenbrauen zogen sich ärgerlich zusammen.
»Ihr seid schon durcheinander! Ihr gießt ja Schokosauce ans Essen!«, rief Marita mit weit aufgerissenen Augen.
»Carissima, wir wissen, was wir tun, kümmere dich um deine Hausaufgaben, wir kümmern uns ums Essen!«
»Aber –!«
»Das gehört so, wirklich!«, sagte Viola schlichtend, »lass uns nur machen. – Und was ist da nun alles drin?«, fragte sie ihre Mutter leise.
»Chilischoten, Tomaten, Zwiebeln und Knoblauch, Hühnerbrühe, Mandeln, Rosinen und Erdnüsse«, zählte Sophia fröhlich auf. Sie hatte sich wieder ganz den Töpfen zugewandt und rührte leidenschaftlich, so dass sich die beiden Saucen zu einer sämigen, dickflüssigen Einheit vermischten. Maritas entsetztes Gesicht konnte sie nicht sehen. »Dann noch Nelke, Zimt und Anis zum Würzen, Pfeffer natürlich …« Sie überlegte. »Ich glaube, das war’s.«
»Und Schokolade«, fügte Viola hinzu.
»Und Schokolade!«, nickte Sophia zufrieden und schnupperte. »Das riecht doch wunderbar …«
Abrupt verschwand ihr Lächeln: »Jetzt weg!«, kam ihre plötzliche Anweisung. Viola wusste: dann hatte man gleich Folge zu leisten. Sie trat mit ihrem inzwischen leeren Topf einen Schritt beiseite, und ihre Mutter zog die frisch vermengte Sauce von der Herdplatte und stellte sie auf ein großes Holzbrett.
»Soll ja nicht unten ansetzen«, murmelte sie, bevor sie nach einem Löffel griff und ihn in die noch sanft brodelnde Mischung tauchte. Sie pustete und kostete vorsichtig. Dann nickte sie zufrieden. »Nicht zu süß, auch nicht zu
scharf …, perfekt!«
Sie warf den Löffel in die Spüle und wandte sich so schnell zur Tür, dass sie beinahe mit ihrem Ehemann, der eben hereinkam, zusammengestoßen wäre, und im ersten Schreck laut aufschrie.
Thomas Kühner zog seine Frau an sich: »Immer so stürmisch und temperamentvoll! So hab’ ich’s gern …« Er neigte seinen Kopf und küsste sie aufs Ohr. Obwohl Sophia eine recht große und kräftige Frau war, wirkte sie neben ihrem Mann beinahe zart. Thomas war groß und breitschultrig und alles andere als schlank, doch hätte man ihn auch nie als dick bezeichnen können. Muskeln und gut verteilter Speck machten ihn zu einem Schrank von einem Mann. Und eben jetzt füllte er den Türrahmen beinahe vollständig aus; Sophia, die sich spielerisch sträubte, hielt er an sich gedrückt.
Gesehen hätte man sie nicht, doch eine schrille Stimme hinter Thomas’ Rücken machte klar, dass da noch eine Person versuchte, in die Küche zu gelangen.
»Nun mach doch Platz, Bub!«, rief seine Mutter. Viola und Marita mussten grinsen, als sich die kleine Frau schließlich an ihrem großen Sohn und ihrer Schwiegertochter vorbeidrängte.
»Wie riecht das denn hier?«, fragte sie, kaum dass sie in der Küche stand.
»Riecht doch prima!«, meinte Thomas. »Was machst du denn heute Feines? Lass mich raten: Es gibt Brathähnchen … und als Dessert irgend etwas Schokoladiges … – Brownies! Stimmt’s?«
Viola schüttelte warnend den Kopf. Papa steuerte mal wieder zielsicher auf ein Fettnäpfchen zu! Als würde Mama etwas so Einfaches wie ein gebratenes Hähnchen überhaupt in Erwägung ziehen!
»Zweimal falsch geraten! Es gibt Truthahn in scharfer Schokosauce!« Sophia sah sehr zufrieden aus, als sie das sagte, und schaute Thomas beifallheischend an.
Viola seufzte. Manchmal hatte sie das Gefühl, als könnte sie die Dialoge ihrer Eltern auswendig aufsagen. Komischerweise schienen sie beide ihre Sketche jedes Mal als völlig neu zu empfinden.
»Schokoladensauce zu Truthahn?« Thomas sah beinahe angeekelt aus. »Schokoladensauce gehört zu Vanilleeis oder meinetwegen zu Kuchen.«
Obwohl Viola genau das auch gedacht hatte, fühlte sie sich verpflichtet, ihrer Mutter beizustehen.
»Das ist ein ganz besonderes Rezept …«, begann sie, aber weiter kam sie nicht.
Ihre Oma, Thomas’ Mutter, unterbrach sie: »Das glaube ich gern. Das ist ja nicht mal italienisch, was ich noch verstehen würde.« – Sophias Mutter war Italienerin, und obwohl Sophia in Deutschland geboren war und ihr ganzes Leben hier verbracht hatte, blieb auch sie in Gertie Kühners Augen auf ewig Italienerin. – »Italienisch, das mögen manche Gäste ja gern; ich persönlich kann’s zwar nicht verstehen, aber sei’s drum. Warum machst du kein, äh, Timuri …« Sie verhaspelte sich und verstummte.
»Tiramisu«, sagte Sophia mit frostiger Miene. Sie sah ihre Schwiegermutter nicht an, sondern schaute unverwandt auf Thomas, doch der tat ihr nicht den Gefallen, ihr beizustehen.
»Warum überhaupt Truthahn? Haben wir Weihnachten, oder was?«
»Mexikanisch!«, warf Viola ein.
»Was, mexikanisch?«
»Es ist ein mexikanisches Nationalgericht!«
»Na und, haben wir vielleicht mexikanischen Nationalfeiertag?«
Viola sah den beleidigten Ausdruck im Gesicht ihrer Mutter, aber ihr Vater fuhr fort: »Spaß beiseite: Wer soll das essen? Das kannst du niemandem hier aus dem Dorf oder aus der Umgebung vorsetzen! Und die Urlauber wollen im Schwarzwald typisch badische Küche haben, jedenfalls irgend etwas, das ihnen bekannt vorkommt. Und Mexikaner kommen ja eher selten zu uns …«
Ironische Bemerkungen konnte Sophia ganz und gar nicht leiden. Sie wandte sich ab und fing an, Küchenutensilien von einer Ablage auf die nächste zu räumen. Das war zwar weitgehend überflüssig und unproduktiv, machte aber einen geschäftigen Eindruck und gehörig Lärm.
»Wir kochen hier tolle Sachen, und dessen sollten wir uns nicht schämen. Es ist eben nicht nur banale Hausmannskost!«, stieß sie hervor.
Alle wussten, gegen wen sich diese kleine Spitze richtete. Thomas’ Mutter hatte die kleine Gaststätte jahrelang allein geführt. Ihren Gästen hatte sie in all den Jahren zwar kein schlechtes, aber doch reichlich deftiges Essen vorgesetzt, dem jede Raffinesse gefehlt hatte.
»Was gibt es einzuwenden gegen deutsches traditionelles Essen?«, begehrte Gertie Kühner auf. »Es macht satt, es ist bezahlbar, und es schmeckt den Leuten!«
Tatsächlich war Sophia darin weitgehend mit ihr einig. Die deutsche Küche war weitaus besser als ihr Ruf. Aber erstens hätte Sophia nur äußerst ungern zugegeben, dass ihre Schwiegermutter auch einmal recht haben konnte, und zweitens fand sie wirklich nicht, dass die Mutter ihres Ehemannes, wenn sie die Kochschürze anzog, der vergessenen Qualität deutscher Traditionsgerichte gerecht wurde.
»Ich bin mir sicher, dass die Leute das Mole Poblano lieben werden«, fuhr Sophia fort.
»Mole Po – was?«, fragte Thomas.
»Mole Poblano. So heißt das Gericht. Es schmeckt köstlich. Du machst dich lustig, und dabei hast du noch nicht einmal probiert. Die Kombination ist vielleicht ungewöhnlich, sorgt aber für eine gute Überraschung. Sei doch kein solcher Banause!«
»Wie heißt es doch so schön: Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht!«, lachte Thomas. »Nein, Spaß beiseite, ich werd’s probieren. Aber ob’s mir schmeckt, ist ja gar nicht die Frage. Ich weiß doch, dass du die beste Köchin von ganz Süddeutschland und Süditalien zusammen bist.«
Er hörte ein leises, nichtsdestoweniger deutlich verächtliches Schnauben – seine Mutter war von den Kochkünsten ihrer Schwiegertochter so wenig überzeugt, wie Sophia von den ihren. Das war doch alles moderner Schnickschnack!
»Aber ich finde«, fuhr Thomas fort, »dass du dich übernimmst. Du stehst jeden Tag länger in der Küche. In meinen Augen ist das falscher Ehrgeiz. Wir haben hier ein einfaches Restaurant, eine Gaststube. Wir kochen für einfache Leute. Die schmecken all die feinen Zutaten gar nicht raus!«
»Hey, das ist herablassend. Jeder Mensch merkt den Unterschied zwischen schlechtem, gutem und sehr gutem Essen. Und falls nicht, muss man ihnen soviel Geschmackskultur eben beibringen.«
»Geschmackskultur!«, murmelte Gertie Kühner. Ihre Schwiegertochter glaubte wirklich, sie hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen!
»Außerdem macht es mir einfach keine Freude, Bohneneintopf zu kochen!«, erhitzte sich Sophia. »Ja, ich bin ehrgeizig. Ich will, dass die Leute, wenn sie nach einem Besuch in unserem Restaurant nach Hause gehen, nicht nur satt sind und zufrieden, sondern richtig begeistert.«
»Dann kannst du dich aber nicht beklagen, wenn dir die Arbeit zuviel wird«, sagte Thomas ernst.
»Ich beklage mich ja nicht. Außerdem –« Sophia brach ab, wusch sich die Hände, nahm dann zwei Dutzend Eier aus dem Kühlschrank, wandte sich wieder der Arbeitsplatte zu und begann, die Eier aufzuschlagen und sorgfältig in Eiweiße und Eigelbe zu trennen.
Thomas beobachtete die energischen, zielsicheren Bewegungen seiner Frau. Diese ein wenig rabiate Art, die sie manchmal an sich hatte, war einer der Gründe, warum er sie so sehr liebte. Hinter ihrer rauen Schale verbarg sich, sinnbildlich gesprochen, ein Kern aus feinstem Nougat … Er betrachte ihren gebeugten Nacken und den feinen dunklen Flaum ihres Haaransatzes; er hatte Lust, mit den Fingerspitzen darüberzustreichen, aber dies war wohl kaum der richtige Moment.
»Außerdem was?«, fragte er, als er sich sicher war, dass sie von selbst nicht weitersprechen würde.
»Außerdem möchte ich, dass wir jemanden einstellen. Einen Koch.«
Nun war Thomas wirklich verblüfft. »Das wolltest du doch bisher nie? Ich dachte, die gelegentliche Hilfe von Christina aus dem Dorf reicht dir? Du hast doch immer gesagt, du willst hier schalten und walten, wie es dir gefällt?«
»Ich habe meine Meinung geändert. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir eben auch mehr Einsatz bringen.«
»Noch mehr Einsatz? Und was soll das heißen, weiterkommen?«
»Ich meine, wir könnten uns verbessern. Wir könnten mehr Gäste haben, zufriedene und zahlende.« Sophia wandte sich um und sah ihrem Mann ins Gesicht. »Wenn wir einen Stern hätten -«
»Einen Stern!«, platzte Thomas heraus. »Übertreibst du’s nicht ein bisschen? Wir müssen doch nicht gleich zum Sternerestaurant werden!«
»Nein, natürlich nicht gleich«, beschwichtigte Sophia. »Aber es wäre doch ein schönes Ziel. Und ein guter Koch, einer, der das Metier von der Pike auf gelernt hat, würde auf jeden Fall eine Bereicherung für das Goldene Herz sein.«
»Sophia«, sagte Thomas und sah seine Frau eindringlich an, »ich bin ja nicht dagegen. Aber wenn wir das machen, wenn wir einen Koch einstellen, dann sollst du dadurch weniger Arbeit haben. Und auf keinen Fall mehr Arbeit, nur weil du dich in irgendwelche bombastischen Ideen verrennst.«
Sophia wandte sich ihm zu, ihre Augen leuchteten auf. Gefühle hatte sie noch nie verbergen können. Wenn sie wütend war, war es jedes Mal, als zöge eine düstere Wolke auf; und nun brach gerade die Sonne hervor. »Ehrlich, du bist einverstanden?«
»Na ja, wir haben’s ja vor zwei Jahren schon mal durchgerechnet. Wir müssten einen Koch bezahlen können. Und vielleicht macht es sich ja im Umsatz wirklich positiv bemerkbar.«
»Danke, Thomas!« Sophia drückte ihrem Mann einen Kuss auf die Wange. Auch wenn er ihre Gründe nicht ganz verstand und ihre Ziele nicht teilte, seinen Segen hatte sie jetzt jedenfalls.
»Wozu brauchen wir noch einen Koch?«, platzte Gertie Kühner dazwischen. Wie so oft, wenn es um ihre eigensinnige Schwiegertochter und insbesondere um die Aufgabenverteilung in der Gaststätte ging, wurde ihre Stimme noch etwas schriller, als sie ohnehin schon war. »Wieviel Luxus muss denn noch sein? Wir sind doch schon zu zweit! Zu dritt, wenn man Christina mitrechnet.«
Thomas sagte nichts. Er hatte nicht die Absicht, sich nach einem Beinahe-Streit mit seiner Frau nun mit seiner Mutter anzulegen.
Gertie Kühner ging mit Riesenschritten auf die achtzig zu, und nur mit sehr viel gutem Willen hätte man sie rüstig nennen können. Sie bewegte sich langsam und hatte oft Schmerzen in den Armen, besonders in den Schultergelenken. Ihr Ruhestand war wohlverdient und ihr von allen wohlvergönnt, doch Gertie Kühner genoss ihn nicht. Unermüdlich geisterte sie im Wohnhaus, in den Hotelfluren, in der Gaststube und ganz besonders in der Küche herum, und obwohl sie sich nirgendwo besonders nützlich machte, war sie vom Gegenteil überzeugt. Davon abgesehen war ihr Verstand so wach wie eh und je, und ihre messerscharfen Kommentare konnten der ganzen Familie und am allermeisten Sophia das Leben schwer machen.
Sophia wartete, doch wie immer schwieg Thomas. Müsste er seiner Mutter jetzt nicht entgegnen, dass man sie keineswegs als Köchin mitzählen konnte, nur weil sie hin und wieder Kaiserschmarrn oder Vanillewaffeln zubereitete?
»Wie auch immer, wir sind uns einig«, sagte Sophia mit ein wenig mehr Schärfe im Tonfall als beabsichtigt, »der Koch kommt.« Und dann fügte sie hinzu: »Er heißt Louis Bertram, er kommt morgen gegen Mittag.«
Thomas atmete geräuschvoll ein und wieder aus. Ja, er liebte seine Frau, aber sie regte ihn auf! Das sah Sophia wieder so ähnlich! Dauernd machte sie irgendwelche Sachen im Alleingang. Natürlich hatte sie recht, sie brauchte wirklich Hilfe in der Küche. Aber gerade weil sie recht hatte, und weil er natürlich einverstanden war, hätte sie doch mit ihm reden können, anstatt ihn vor vollendete Tatsachen zu stellen!
Thomas wurde selten laut. Wenn es einmal aus ihm herausbrach, war das Spektakel kurz, aber heftig und beeindruckend. Er war nun einmal ein Bär von einem Mann, und in diesen Augenblicken ahnte man, dass seine Kraft auch Fürchterliches anrichten könnte, wenn sie denn nicht mit einem so ausgleichenden und vernunftbegabten Charakter einhergehen würde.
»Wann wolltest du mir das sagen?«, polterte er.
Sophia zog unwillkürlich den Kopf ein – genauso wie ihre Schwiegermutter und die beiden Töchter, die die Szene aufmerksam verfolgten.
»Na, jetzt …«, sagte sie, nun doch ein wenig kleinlaut.
»Na, dann ist ja jetzt alles gesagt.«
Thomas drehte sich auf dem Absatz um und verließ die Küche; es war, als wäre er elektrisch aufgeladen und nähme die gesamte Energie aus dem Raum mit sich. Doch dieser Eindruck währte nur eine Sekunde, dann gab Gertie Kühner seinem Abgang unfreiwillig eine komische Note, indem sie – was immer das heißen sollte – »Tä!«, sagte und ihrem Sohn mit weitaus geringerer Geschwindigkeit hinterherzockelte.
*
Obwohl jetzt im März, noch dazu am frühen Morgen, die Temperaturen noch sehr frisch waren, war das Verdeck des metallisch-grau glänzenden Sportwagens, der vom Kreisverkehr am Ortseingang in die Hauptstraße von Hartholzheim einbog, heruntergeklappt. Es gab den Blick frei auf einen blonden jungen Mann. Mit seiner Lederjacke mit hochgestelltem Kragen, den typischen Cabrio-Handschuhen, die die Fingerknöchel frei ließen, und der ledernen Schirmkappe sah er aus wie einem Modejournal entsprungen. Mehrere Kinder, auf dem Weg zur Schule, stießen sich gegenseitig lachend in die Rippen. Sie schienen sich nicht sicher zu sein, ob sie den Fahrer und sein Auto bewundern oder sich darüber lustig machen sollten.
Louis Bertram fluchte. Schon wieder musste er auf die Bremse steigen. Sollte das Landleben nicht eigentlich idyllisch und friedlich sein und die Bauern auf ihren Feldern? Stattdessen walzte sich eine wahre Blechlawine durch die Ortschaft! Er war offensichtlich in den Berufsverkehr hineingeraten, und es ging immer wieder nur stockend voran. Louis trommelte ungeduldig mit den Fingern aufs Lenkrad. Er hatte sich extra zu nachtschlafender Zeit auf den Weg gemacht, um möglichst früh anzukommen und an seinem ersten Arbeitstag einen guten Eindruck zu machen, doch nun war er reichlich genervt … Hoffentlich lohnte sich die Mühe überhaupt! Immerhin war es ein Wagnis, die Probezeit in einem Restaurant anzutreten, ohne die Küche und seine Chefs vorher überhaupt gesehen zu haben. Was mochte ihn erwarten?
Ein wenig weiter vor ihm, in der Biegung der Straße, lag ein dreistöckiges, langgestrecktes Fachwerkhaus. Das schmucke Gebäude entsprach schon eher der Vorstellung, die Louis sich von seinem neuen Lebensmittelpunkt gemacht hatte. Louis fuhr notgedrungen langsam darauf zu, und obwohl seine Gedanken immer wieder zum Ziel der Fahrt voraus-eilten, nahm der Anblick des Hauses einen Teil seiner Aufmerksamkeit gefangen. Die Butzenscheiben der vielen kleinen Fenster blitzten sauber zwischen den einladend geöffneten roten Fensterläden. Vier oder fünf Stufen mit einem rotgestrichenen Geländer führten hinauf zur ebenfalls roten Eingangstür.
Louis fuhr bereits an dem Fachwerkgebäude vorbei, als ihm auffiel, dass ein goldenes ziseliertes Herz die Haustür zierte, und gleich darauf sah er ein weiteres, viel größeres Herz, das an der Ecke des Gebäudes in der Morgensonne leuchtete. Ein Schild mit einem Pfeil und einem P auf blauem Grund wies um das Haus herum zu einem Parkplatz.
Zum Blinken war es zu spät. Louis bog kurzentschlossen ab und ignorierte das Hupen der Autofahrer und die wütenden Blicke der Schulkinder.
Die Einfahrt führte auf einen einfachen Schotterparkplatz mit einem Dutzend Stellplätzen. Louis zog die Handbremse und atmete tief durch. Das war’s, er war angekommen. Oder, anders ausgedrückt: dies war die letzte Gelegenheit zum Umkehren.
Die Aussicht auf eine feste Anstellung im tiefsten Schwarzwald hatte Louis zunächst wenig verlockend erscheinen wollen. Er war Großstädter durch und durch; in Frankfurt war er geboren, und in Hamburg hatte er seine Lehrjahre verbracht. Er hatte seine Lehrzeit mit Bravour abgeschlossen, war aber dennoch nicht übernommen worden, aus betrieblichen Gründen. So hatte er sich eine kleine Auszeit in der Heimat gegönnt. Als er sich gerade daran machen wollte, die Hamburger und Frankfurter Nobelrestaurants anzuschreiben, die seinen Ansprüchen entgegenkamen, war dieser Anruf gekommen … Und je länger er mit dieser Sophia Kühner telefoniert hatte, desto mehr hatte er das Gefühl, dass er den richtigen Platz für den Start in seine Karriere als erfolgreicher Koch gefunden hatte.
Die Frau mit der sympathischen Stimme hatte ihm das Leben im Schwarzwald, wo Louis bisher nie gewesen war, in den schillerndsten Farben geschildert und ihm geradezu das Blaue vom Himmel herunterversprochen; sie hatte von seinen Fähigkeiten – oder hatte sie ›Künsten‹ gesagt? – gehört und wollte mit ihm gemeinsam das Restaurant auf Sterne-Niveau heben.
Natürlich hatte Louis sie nicht darüber aufgeklärt, dass es streng genommen gar keine Sterne-Restaurants gab: Der Guide Michelin, die Bibel der Gourmets, vergab seine Sterne nicht an Restaurants, sondern lediglich an die Chefs der dazugehörigen Küche. Wenn ein mit einem Stern ausgezeichneter Koch sein Stamm-Restaurant verließ, zum Beispiel um anderweitig zu vorteilhafteren Bedingungen zu arbeiten, dann nahm er seinen Stern mit, und nur mit einem neuen Sterne-Koch konnte das Restaurant sich seinen Stern bewahren. Wenn seine neue Chefin das wirklich nicht wissen sollte, so war das ihr Problem …
Louis hatte vor, diesen Landgasthof ›Zum Goldenen Herzen‹ innerhalb von drei oder vier Jahren zu Glanz und Ehren zu führen, die Lorbeeren – sprich: den Stern – einzuheimsen und sich dann auf zu neuen Ufern zu machen. Er gedachte jedenfalls nicht, sein Leben in einem verlorenen Nest im Schwarzwald zu fristen.
An der Rückseite des Hauses, vom Parkplatz aus zu erreichen, befand sich der Haupteingang für die Gäste des Hotels und Restaurants ›Zum Goldenen Herzen‹. Auch diese Tür war in einem warmen Rotton gestrichen; in der Mitte prangte ein weiteres sorgfältig und stilvoll verarbeitetes Herz aus Metall. Das musste Bronze sein, vermutete Louis.
Die Tür war offen, und der junge Koch betrat das geräumige Foyer. Vor ihm lag die Hotelrezeption. Die leeren Haken am Schlüsselbrett an der Wand dahinter zeigten Louis, dass das Hotel ausgebucht sein musste. Links der Rezeption führte eine Treppe nach oben, vermutlich zu den Zimmern.
Im Foyer gab es einige Türen, manche davon beschriftet. »WC«, las Louis, »Privat« und, auf der Tür zur Rechten, »Gaststube«. Dahinter hörte er das typische gedämpfte Murmeln und das Klappern von Geschirr und Besteck: zumindest ein Teil der Gäste saß gerade beim Frühstück.
›Zum Goldenen Herzen‹ – der Name war ja wirklich ausgesprochen kitschig. Aber, das musste Louis zugeben, hier in der Hotellobby war die Dekoration sehr geschmackvoll und nicht überladen. Goldenen Firlefanz suchte man vergeblich. Die weißen, fast schmucklosen Wände gaben dem Raum Helligkeit. An den Fenstern sorgten ockerfarbene Vorhänge für warmes Licht. Der gepflegte Parkettboden, der weiß verputzte Empfangstresen mit seiner blankpolierten Holzplatte und die breite Treppe mit den ausgetretenen Holzstufen und dem orange-ro-
ten Teppichläufer trugen zum Gesamteindruck unaufdringlicher Gemütlichkeit bei.
Louis überlegte kurz, ob er direkt ins Restaurant gehen sollte, entschied sich dann aber dagegen und drückte entschlossen auf die Klinke zur Tür mit der Aufschrift ›Privat‹.
Hinter der Tür lag eine andere Welt. So entspannt die Atmosphäre im Hotelfoyer war, so turbulent ging es in diesem Wohnungsflur zu. Louis zählte eins, zwei, drei Kinder und noch ein viertes Mädchen, das man nicht mehr als Kind bezeichnen konnte – es mochte fünfzehn oder sechzehn Jahre alt sein –, mittendrin ein Hüne von einem Mann, der der Vater der Kinderschar sein mochte und der sich trotz seiner beeindruckenden Statur offensichtlich nur mühsam durchzusetzen wusste.
»Marita, nun mach endlich voran!«, schimpfte er. »Setz die Mütze auf! Und Jonas, sag bloß, du hast deine Schuhe immer noch nicht an? Viola, hast du deinen Ranzen? Dann geh doch schon mal raus und steh uns nicht im Weg rum. Lilly, setz dich und zappel nicht herum, ich binde dir die Schnürsenkel. Beeil dich, sonst kommen deinetwegen alle zu spät in die Schule!«
Die Kinder schienen von seinem Schelten gänzlich unbeeindruckt. Die drei Jüngeren schnatterten und wuselten durcheinander wie von einem Aufziehmotor angetrieben. Das ältere, ausgesprochen hübsche Mädchen betrachtete sich mit zusammengekniffenen Augen im Flurspiegel, schürzte die Lippen und zupfte sich eine Haarsträhne ins Gesicht. Dann wandte sie sich um, sah Louis und machte erschrocken: »Ah!«
Alles geriet ins Stocken. Thomas reagierte als Erster: »Das hier ist eine Privatwohnung«, brummte er.
Louis schenkte ihm ein gewinnendes Lächeln. »Entschuldigung, ich bin zwar hier wahrscheinlich richtig, aber ich habe wohl den falschen Weg genommen. Ich bin der neue Koch. Ich habe mit Frau Kühner telefoniert.«
»Das ist meine Frau. Ich bin Thomas Kühner. Jetzt hat leider gerade niemand Zeit für Sie. Meine Frau kümmert sich um die Gäste, und ich muss noch schnell unsere Jüngste in den Kindergarten bringen. Lilly ist fünf«, sagte er und wies auf das kleine blonde Mädchen, das in der Nase bohrte und Louis mit unverhohlenem kindlichem Interesse anstarrte. »Und die anderen müssen jetzt auch los zur Schule. – Viola, dein Bus fährt gleich ohne dich ab!«
Viola, die Louis beinahe ebenso selbstvergessen angestarrt hatte wie ihre kleine Schwester, konnte sich von seinem Anblick nur mühsam losreißen. Er war mit Abstand der schönste junge Mann, den sie je gesehen hatte!
»Wow, äh, ich meine, ich bin Viola, und ich muss jetzt wirklich los«, stotterte sie und ging rückwärts zur Wohnungstür, stolperte dabei über einen der herumliegenden Schulranzen und entschwand mit vor Scham rotgefärbten Wangen.
»In zwanzig Minuten bin ich zurück!« Thomas drückte Marita ihre Mütze auf den Blondschopf, half Jonas in den Jackenärmel, sagte: »Setzen Sie sich irgendwo hin« und schubste die drei Kinder mehr oder weniger sanft durch die Tür ins Freie.
*
Wenn Dreizehnjährige sich verlieben, dann geschieht es Hals über Kopf, vollständig und bedingungslos. Bis zu dem Augenblick, als Louis Bertram in ihrem Leben auftauchte, hatte Viola für ihre kichernden Mitschülerinnen, die den Jungs der höheren Klassen kleine Zettel mit albernen Botschaften zusteckten und sich romantische Märchen ausmalten, nur ein Naserümpfen übriggehabt. Und nun?
Nun saß sie im Unterricht und malte gedankenverloren Dutzende von kleinen Herzen zwischen die ungelösten Mathematikaufgaben in ihrem Heft.
Sie versuchte sich zu erinnern, wie der junge Mann hieß – doch gestern, als Mama seinen Namen in der Küche genannt hatte, hatte sie darauf nicht geachtet. Wie hätte sie schließlich wissen sollen, dass der Name zu jemandem Außergewöhnlichen, Wichtigen, Wunderbaren gehörte? Noch wusste sie nichts über ihn, doch für sie war er eine wahre Erscheinung gewesen. Kein Schulbub mehr, obwohl er nicht wesentlich älter aussah als die Schüler der Abiturklassen, doch im Gegensatz zu denen hatte er Stil! Keine schlabbrige Hose, deren Hosenboden in den Kniekehlen hing, wie bei manchen Klassenkameraden, aber auch kein langweiliges Polohemd, weder falsch herum aufgesetzte Stoffkappe noch braver Seitenscheitel … Vielmehr, fand Viola, verliehen sein Outfit, die selbstbewusste Haltung und das halblang getragene, golden schimmernde Haar dem jungen Koch eine angenehm verwegene Ausstrahlung. Sie verbrachte den Rest des Vormittags in schwärmerischer Verträumtheit.
*
Als Sophia ihre Frühstücksschicht beendet hatte und kurz Zeit für eine Pause in der Wohnung hatte, war sie heilfroh, Louis Bertram dort bei ihrem Mann sitzen zu sehen. Gut, dass er da war! Es war einfach etwas anderes, selbst Experimente zu machen oder sich auf einen echten Koch berufen zu können. Das Mole Poblano am Vortag war ein Reinfall gewesen … Niemand hatte es von sich aus bestellt, obwohl ihr Sohn Jonas, der ein As im Schönschreiben war, den klangvollen Namen mit kunstvollen Lettern auf die Tageskarte gemalt hatte – nachdem sie ihn auf einem Blatt Papier vorgeschrieben hatte, denn Rechtschreibung gehörte nicht zu seinen Stärken – und obwohl auch die Erklärung ›Truthahn in Schokolade‹ darauf nicht gefehlt hatte. Klang das denn etwa nicht verlockend? Doch wo-ran es auch gelegen haben mochte, es war Sophia nur mit viel Überredungskunst gelungen, drei mutige Gäste dazu zu bewegen, das mexikanische Nationalgericht zu versuchen.
Als sie später mit dem neuen Koch darüber sprach, war der keineswegs erstaunt. »Die Leute haben eben ihre Erwartungen. Das Tagesgericht muss irgendwie mit den anderen Gerichten der Speisekarte harmonieren. Wer beim Betreten des Restaurants an Schupf-nudeln mit Sauerkraut denkt, der kann im Extremfall vielleicht noch gedanklich auf Hirschragout mit Preiselbeeren umschwenken, aber das ist dann auch das Äußerste.«
»Aber das ist ja total frustrierend«, stöhnte Sophia. »Das würde ja heißen, dass wir uns alle Neuerungen sparen können.«
»Nein, gar nicht!«, wischte der junge Mann ihre Bedenken vom Tisch. »Eine gute Möglichkeit wäre der totale Bruch. Wir zerreißen die alte Speisekarte, und ab damit in den Müll!«
»Nein!« Sophia schüttelte energisch den Kopf. Sie konnten das Risiko, die gesamte Stammkundschaft zu vergraulen, einfach nicht eingehen.
»Das ist ja nur eine Möglichkeit. Aber eins ist klar: Man muss offensiv vorgehen. Mal hier und da ein tolles Gericht zwischen dem ganzen gutbürgerlichen Küchenkrempel zu verstecken, das funktioniert einfach nicht.«
Louis Bertram lehnte sich lässig zurück, seine Finger spielten mit einem Stift.
»Also, die zweite Möglichkeit: Man macht einfach zwei Speisekarten. Also eine eher traditionelle Karte mit dem ganzen gängigen Zeug, und dann noch eine Karte fürs Besondere. Das Entscheidende ist, dass der Kunde, also der Gast, das Gefühl hat, er kann in jedem Bereich aus einem reichhaltigen Angebot wählen.«
»Und die dritte Möglichkeit?«
»Fällt mir keine ein.« Louis grinste.
Sophia schwieg einen Augenblick. Der junge Mann sprach so enthusiastisch …, doch aus irgendeinem Grunde sank ihr plötzlich das Herz. Es schien alles nicht ganz so einfach zu werden, wie sie es sich bisher ausgemalt hatte.
»Wie sollen wir das bloß schaffen?«, fragte sie schließlich leise. Doch ihr Gegenüber lachte nur vergnügt auf: »Na, dafür haben Sie doch mich!«
*
In den nächsten Tagen fanden im Haushalt und im Geschäft der Kühners einige mehr oder minder ausgeprägte Veränderungen statt. Thomas fühlte sich davon gleichsam überrollt. Er war der Einzige, der sich an Louis Bertrams Präsenz nicht erfreuen konnte. Dieser junge Koch wurde zum neuen Zentrum der Familie; offenbar hatte er allen die Köpfe verdreht.
Marita und Jonas wurden es nicht müde, Louis immer wieder neue Kunststückchen aus dem Zauberkasten vorzuführen, sie verkleideten sich für ihn oder legten eine CD mit Zirkusmusik ein, und zusammen mit Lilly tanzten sie dazu, schlugen Purzelbäume und Rad, machten abenteuerliche Verrenkungen und warteten begierig auf Louis’ Beifall.
Viola wiederum war mehr denn je zur schweigsamen, aber beharrlichen Beobachterin in der Küche geworden.
Und wann immer Sophia eine freie Minute hatte, steckten sie und Louis am Küchentisch die Köpfe zusammen. Gemeinsam erarbeiteten sie Zukunftsstrategien und Menüpläne. Thomas schwirrte der Kopf von all den Bezeichnungen der Köstlichkeiten, die es künftig geben sollte: Ochsenbrust mit Meerrettichsoße, Hechtklöß-chen, Zandersoufflé, Schneckensuppe, Truthahn-Piccata, Steinbutt mit Lauchhaube und Sepia-Farfalle, lackierte Wachtelbrust … – und so weiter und so fort. Und leider sah es vorerst nicht so aus, als wollte Sophia sich ein wenig mehr Erholung gönnen.
Dabei sah Thomas deutlich, dass sie Ruhe dringend nötig gehabt hätte. Die letzten Wochen waren anstrengend gewesen. Wie immer hatte die in dieser Region Deutschlands traditionell ausgiebig gefeierte Fastnachtszeit zwar für verstärkten Umsatz, aber eben auch für sehr viel Arbeit gesorgt. Und nun war zwar eigentlich Fastenzeit, aber von der vierzigtägigen Einschränkung, wie sie die katholische Kirche den Gläubigen nahelegte, war im Restaurant – selbst in dieser überwiegend katholisch geprägten Region – nicht viel zu spüren. Vielleicht wurden etwas weniger Fleischgerichte, dafür aber umso mehr Fischgerichte bestellt; und falls es tatsächlich Gäste geben sollte, die sich in dieser Zeit nur einmal am Tag sättigten, so taten sie es jedenfalls ausgiebig.
Nein, über Mangel an Arbeit konnten die Kühners schon seit geraumer Zeit nicht mehr klagen – über Mangel an Erholung hingegen schon. Im Grunde hatte Thomas das Gefühl, dass sich seit ihrem Umzug nach Hartholzheim vor zehn Jahren eine schwierige Phase an die andere gereiht hat-
te: die überstürzte Übernahme des heruntergewirtschafteten Gasthauses und die Sorge um seine damals schwerkranke Mutter, dann Maritas Geburt, gefolgt nur ein gutes Jahr später von Jonas’, der allmähliche Aus- und Umbau des Hauses, die Komplikationen in der Schwangerschaft, bevor Lilly geboren wurde, der Einzug von Amalia Carlucci, Sophias Mutter, die ständigen Geldsorgen, der Konkurrenzdruck …
Thomas fühlte sich müde, und er wusste, Sophia war es auch. Dennoch kannte er seine Frau gut genug, um zu wissen, dass sie kein Maßhalten kannte und dass auch gutes Zureden da wenig nützte.
Im Spaß sang Sophia manchmal den alten Gitte-Song: »Ich will alles, ich will alles, und noch viel mehr … – Damit bin ich aufgewachsen, das ist mein Lebensmotto!«, sagte sie. Doch auch wenn sie dabei lachte: die Selbstironie half nicht gegen die Tatsache, dass Sophia mitunter unersättlich war. Sie wünschte sich ein fünftes Kind, sie wollte das Hotel vergrößern und das Restaurant verbessern, sie plante großartige Partys für ihre Freunde und Events für die Gäste, sie hatte einen Filmclub im Ort gegründet – kurz: sie übernahm sich ständig und immer wieder. Thomas hatte den undankbaren Part, seine Frau zu bremsen.
*
Sophia ahnte nichts davon, dass ihr Mann sich Sorgen machte. Natürlich war sie erschöpft, und eine Woche Urlaub hätte ihr sicher gutgetan, aber andererseits fühlte sie sich zur Zeit völlig in ihrem Element. Sie liebte das Kochen!
Mit dem Hotel hatte Sophia möglichst wenig zu tun, das war eher Thomas’ Sache und die der Aushilfskräfte. Der Job des Zimmermädchens war beliebt bei den jungen Mädchen im Dorf, und ein paar ältere Frauen waren reihum für das Putzen zuständig. Sophia aber kümmerte sich um alles, was das Restaurant betraf.
In den vergangenen Jahren hatte sie dort alles umgekrempelt. Die Gaststube hatte vor zwei Jahren ein völlig neues, sehr viel anheimelnderes Aussehen bekommen, dann hatte Sophia den Aus- und Umbau der Küche in Angriff genommen und schrittweise neue Gerätschaften angeschafft; parallel dazu hatte sie das Angebot auf der Karte kontinuierlich erweitert. Der Aufwand begann sich zu lohnen: dank seiner guten Küche und der gemütlichen Atmosphäre war das Restaurant ›Zum Goldenen Herzen‹ zum Geheimtipp geworden.
Und nun hatten sie mit Louis Bertram einen hoffnungsvollen Küchenchef gefunden. Er schien insgesamt ein guter Fang zu sein; er war zwar nicht übermäßig fleißig, und viele der unangenehmeren Routineaufgaben blieben an ihr hängen, aber er kochte inspiriert, verriet ihr eine Menge Küchengeheimnisse und verbreitete gute Laune.
Wir sind längst gut genug, dachte Sophia, um mehr zu sein als ein Geheimtipp. Die Zeit ist reif für Werbeaktionen und offensive Pressearbeit! Und würde ein Artikel über das ›Goldene Herz‹ nicht auch eine tolle Überraschung für Thomas sein?
Sophia griff zum Hörer und war kurze Zeit später mit Regina Schneider verbunden, ihres Zeichens Lokalredakteurin des Beisacher Tageblatts. Sie verabredeten sich zu einem Interview und zur Besichtigung des Restaurants.
*
Der Erfolg war größer als beabsichtigt, überrollte die Kühners und riss den fröhlichen Enthusiasmus mit sich fort.
Nachdem der überaus löbliche Artikel erschienen war, gespickt mit Zitaten von Sophia und Louis, stand das Telefon nicht mehr still. Nicht nur schienen alle sporadischen Gäste genau jetzt einen Tisch reservieren zu wollen, auch die Redaktionen der Sonntags- und Gratiszeitungen baten um Stellungnahmen, Fotos und Rezepttipps, und sogar ein überregionales Kochmagazin brachte den sehr positiven Bericht eines Redakteurs, der sich nur kurz am Telefon mit Sophia unterhalten hatte und gar nicht persönlich erschienen war.
Im Stillen verfluchte Sophia sich selbst. Sie und ihr neuer Küchenchef hatten im Gespräch mit Frau Schneider den Mund ganz schön voll genommen – das war ihr gar nicht aufgefallen. Oder hatte die Redakteurin manches nachträglich geschönt? Schon die Überschrift war irgendwie peinlich: ›Ich will einen Stern!‹, prangte da in großen Lettern über der Seite, und das Foto in der Mitte zeigte Sophia in ihrer Küchenschürze, ausstaffiert mit einer Kochmütze, die sie sonst nie trug, in lächerlich stolzer Pose am Herd.
In ihrem Eifer und Überschwang hatte Sophia viel von ihren Plänen erzählt, doch manches von dem, was eigentlich halbgare Träume und bestenfalls Zukunftsmusik war, stellte der Artikel als im großen und ganzen verwirklicht dar. Nun war der Erwartungsdruck hoch.
Zusammen mit Louis hatte sie eine zweite Speisekarte aus dem Boden gestampft. Das meiste von dem, was dort verzeichnet war, überstieg Sophias Fähigkeiten. Selbst wenn der Geschmack stimmte; sie brachte es nicht fertig, die Köstlichkeiten so delikat anzurichten und zu präsentieren wie ihr Koch, der immerhin in Hamburg in einem der renommiertesten Restaurants Deutschlands gelernt hatte. Es ärgerte sie, dass sie dadurch von Louis so abhängig wurde.
Die Gäste, und zwar sowohl diejenigen, die regelmäßig und seit Jahren kamen, wie die neu angelockten, ließen es Sophia spüren, dass sie erstklassige Gerichte erwarteten. Sophia wagte es kaum mehr, sich mit Tiefkühltruhe und Mikrowelle zu behelfen – irgend jemandem würde es mit Sicherheit auffallen. Es war schon komisch: nie zuvor hatte sie so viele kritische Bemerkungen gehört wie ausgerechnet jetzt, da sie so gute Sachen servierten wie nie zuvor.
»Mama, spielst du mit mir?« Lilly, wie immer mit verstrubbelten Haaren und roten Wangen, kam in die Küche gehüpft. Mutter und Tochter sahen sich in diesem Augenblick sehr ähnlich: auch Sophia war zerzaust und erhitzt. Louis war, falls er den Stress überhaupt spürte, davon nichts anzumerken. Er pfiff leise vor sich hin, die Kochmütze – noch war es ein bescheidenes, aber keckes Schiffchen – saß ihm schief auf dem Kopf. Ihre Funktion erfüllte sie nicht, denn sein weiches blondes Haar quoll ungehindert darunter hervor; Sophia brachte es nicht über sich, ihn darauf hinzuweisen und zum Tragen eines Haarnetzes zu verdonnern.
Die Gaststube war rappelvoll. Es war nur eine Aushilfe, ein junges und noch reichlich unerfahrenes Mädchen aus dem Dorf, zum Servieren gekommen, Christina, die zweite Kraft, mit der Sophia fest gerechnet hatte, hatte kurzfristig absagen müssen, und Ersatz war nicht aufzutreiben. Thomas war unauffindbar, und Viola lernte für eine Schularbeit. In ihrem Alter durfte sie ohnehin nur arbeiten, wenn man zuvor eine Reihe aufwändiger Genehmigungen eingeholt hätte.
Und Louis Bertram weigerte sich generell, die Gaststube zu betreten, es sei denn, um am Ende des Abends an den Tischen vorbeizugehen und sich nach der allgemeinen Zufriedenheit zu erkundigen.
In diesen Augenblicken wollte Sophia vor zurückgehaltener Wut schier platzen – Louis konnte herumstolzieren wie ein Gockel! Dabei war er erst drei Wochen dabei, und Sophia leistete auf jeden Fall mehr als er; nur Lob bekam sie keines dafür …
Doch Sophia schalt sich selbst für ihre Eifersüchtelei, schluckte die Wut unverdaut herunter und verrichtete ihre Arbeit, als wenn nichts wäre.
Selbst als die Arbeit noch Spaß gemacht hatte – war das wirklich erst zwei Wochen her? –, war
es Sophia schwer gefallen, den
Rhythmus zu halten. Und nun? Spaß?
Nein, zur Zeit hatte sie nicht mehr die geringste Freude bei der Arbeit. Wenn ein neu kreiertes Gericht glückte, war das kein Grund mehr für ein wohliges Triumphgefühl, sondern nur noch Anlass für erschöpfte Erleichterung. Es gab im Restaurant keine gelungenen Abende mehr, sondern nur noch Abende, die sie ohne größere Katastrophen überstand. So zumindest empfand es Sophia.
Inzwischen spürte Sophia deutlich, dass sie am Ende ihrer Kräfte war. Schließlich war da nicht nur das Restaurant, sondern auch noch die Hausarbeit, die trotz einiger Hilfe ihrer Mutter und ihrer Schwiegermutter nie vollständig zu bewältigen war, und dann waren da die Kinder mit ihrem verqueren siebten Sinn für elterliche Anspannung: Warum bloß konnten sich die Kinder immer gerade dann so schwer selbst beschäftigen, wenn sie partout keine Zeit für sie übrig hatte? Dauernd riefen sie nach ihr …
»Mama …! Was ist jetzt? Spielst du mit mir?« Lillys Stimme wurde quengelig. Sophia hatte die Frage ihrer kleinen Tochter zwar gehört und in ihre trüben Gedanken eingeflochten, aber nicht bewusst registriert.
Nun explodierte sie.
»Was glaubst du eigentlich?«, kreischte sie.
Erschrocken blickte Louis auf.
Sophia war rot im Gesicht. »Sehe ich aus, als hätte ich Zeit zum Spielen? Sieben Uhr abends, ein Haufen hungriger Gäste, das Konsommee verkocht, ich habe ein Soufflé im Ofen – und du fragst mich, ob ich Zeit zum Spielen habe?«
Lilly begann, erschrocken zu weinen, aber noch war Sophia nicht am Ende ihres unbeherrschten Ausbruchs. »Spiele ich sonst um diese Uhrzeit mit dir? Nein! Abends spielen Kinder nicht, sondern gehen still und leise ins Bett und stehen ihren Mamas nicht im Weg! Warum bist du nicht bei Oma, die soll dir beim Zähneputzen helfen und dir deinen Schlafanzug geben!«
»Mensch, Mama!«, tönte es vorwurfsvoll von der Tür her, die vom Wohnbereich direkt in die Küche führte. Marita und Jonas waren durch das in der Wohnung deutlich hörbare Geschrei herbeigelockt worden.
»Schrei doch nicht so! Lilly kann doch schließlich nichts dafür, dass du keine Zeit hast«, sagte Jonas. Eigentlich stritt er ständig mit der jüngsten seiner drei Schwestern, doch wenn es hart auf hart ging, verteidigte er Lilly gegen alle Anfeindungen, notfalls auch gegen seine Mama. Jonas hatte einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn – und diesmal wurde Lilly ziemlich ungerecht behandelt!
»Ich habe abends nie Zeit! Das wisst ihr! Das ist doch nicht so schwierig zu verstehen!« Sophia konnte sich noch nicht beruhigen.
»Doch!«, sagte Marita. Sie war das energischste der vier Kühner-Kinder und nahm selten ein Blatt vor den Mund. »Das ist total schwer zu verstehen. Andere Eltern haben Zeit für ihre Kinder. Wir würden eben gern mal mit dir spielen. Und Lilly ist doch noch klein.«
Sophia spürte, wie ihr Zorn verpuffte und wie die Erschöpfung wuchs. Natürlich konnte sie nicht ernsthaft erwarten, dass die Kinder Verständnis für die angespannte Lage aufbrachten. Aber es war eine Tatsache, dass sie jetzt wirklich keine Zeit hatte, und es fehlte ihr an der nötigen Gelassenheit, um sich bei Lilly zu entschuldigen.
»Komm, Schatz«, versuchte Sophia die Situation zu retten, aber die rechte Wärme lag nicht in ihrer Stimme, »ich bringe dich geschwind rauf zur Oma, die hat bestimmt Zeit für dich. Vielleicht macht ihr noch ein schönes Puzzle, und dann geht’s ins Bett, ja?«
Lilly schob ihre Unterlippe vor; sie war sichtlich beleidigt, doch sie wischte sich mit dem Ärmel über die feuchten Augen und nickte. Sophia nahm sie an die Hand und zog sie mit sich durch die Tür und zur Treppe nach oben. Sie konnte einen hörbaren Seufzer nicht unterdrücken. Immerzu rannten die Kinder in halsbrecherischem Tempo durchs Haus – nur wenn man es eilig hatte, verwandelten sie sich in kleine, lahme Schnecken!
»Kannst du dich um Lilly kümmern?«, bat sie ihre Mutter.
Amalia Carlucci war erstaunt: »Das mache ich doch sowieso!«
Jeden Abend sorgte sie dafür, dass ihre Enkelkinder rechtzeitig und mit geputzten Zähnen ins Bett kamen. Meist erfüllte sie diese Aufgabe mit Vergnügen, doch manchmal kam es ihr vor, als würde sie zur Abwechslung gern mal einen Sack Flöhe hüten; das war bestimmt einfacher …
Nur montags brachte Sophia ihre Kinder selbst ins Bett. Montag war der Ruhetag des Restaurants, an dem nur die wenigen Hotelgäste versorgt werden mussten, die Vollpension gebucht hatten. Das schafften Thomas’ Mutter und Christina meist auch ohne Sophia. Und jetzt war ja auch noch Louis da.
»Sie stört mich in der Küche«, erklärte Sophia.
»Tu ich gar nicht!« Lilly machte ein trotziges Gesicht.
»Nicht absichtlich, Schätzchen«, tröstete Sophia sie, »aber ich fühle mich halt gestört. Ich habe heute so viel zu tun, da
stehst du nur im Weg.«
»Weißt du«, meinte Amalia Carlucci, und ein leichter Tadel in ihrer Stimme war nicht zu überhören, »ich habe ja Zeit für sie. Aber manchmal bin ich einfach nicht diejenige, die Lilly um sich haben will. Ich glaube, Lilly wollte einfach nur ein bisschen in deiner Nähe sein.«
»Ich könnte ja einfach am Küchentisch sitzen und still sein wie ein Mäuschen!«, sagte Lilly eifrig.
»Lilly«, seufzte Sophia, »meinetwegen an einem anderen Tag, wenn alles etwas ruhiger ist, aber heute geht es einfach nicht.«
»Es ist ja nie ruhiger …« Lilly war brummig.
»Bald, mein Mäuschen«, versprach Sophia, doch sie war nicht bei der Sache. Das Soufflé!
»Jetzt mach ein schönes Puzzle, gell? Und ich muss jetzt schnell in den Ofen schauen!« Sie drückte ihrer Tochter einen Kuss aufs weiche Haar und eilte die Stufen herunter.
In der Küche sah sie gerade noch, wie Thomas die Backofentür schloss.
»Um Himmels willen, was tust du da?«
Er fuhr herum. »Da bist du! Deine Gäste rufen schon nach dir. Delia ist total überfordert.«
Delia war die Aushilfe, die an diesem Abend letztendlich allein für den Service bei Tisch verantwortlich war. Natürlich war sie überfordert – ein Mädchen von achtzehn Jahren in der sprichwörtlichen Höhle des Löwen!
»Und du – kannst du nicht helfen?«
»Sophia, drüben im Hotel ist genauso der Teufel los wie hier! Wir haben einen Kranken im Zimmer acht und zwei Neuzugänge, die Beistellbetten brauchen. Ich kann mich jetzt wirklich nicht um deinen Job kümmern.«
»Entschuldige, dass ich gefragt habe«, sagte Sophia patzig. »Ich hoffe bloß, du hast den Backofen nicht aufgemacht?« Eine rein rhetorische Frage; sie hatte es ja selbst gesehen.
»Doch, dein Louis zieht es ja offensichtlich vor, eine Zigarettenpause einzulegen, anstatt mal einen Blick auf den Auflauf zu werfen.«
»Das ist nicht mein Louis. Und vor allem ist es kein Auflauf.«
»Nicht?«
»Nein, ein Soufflé.«
»Und was soll das sein? Worüber regst du dich jetzt schon wieder auf?«
»Ein Soufflé ist ein luftiges Gebilde aus Brandteig und Eischnee, in diesem Fall mit dem zarten Parfüm der Orange. Die Betonung liegt auf luftig! Soufflés sind so empfindlich gegen Kälte, dass man sie unter einer Wärmehaube serviert. Und sie fallen einfach in sich zusammen, wenn man den Backofen zu früh öffnet! Dann ist die Luft raus!«
Sophia war immer lauter geworden. Beim Sprechen hatte sie sich vor den Ofen gehockt und einen Blick durch die heiße Glastür geworfen.
»Das Soufflé steht auf der Tageskarte. Wir haben Gäste im Saal, die es bestellt haben«, fuhr sie fort. Sie hatte Tränen in den Augen. »Und was sehe ich da im Ofen? Das da ist tatsächlich nur noch ein schnöder Auflauf, den niemand, absolut niemand haben will! Warum kümmerst du dich nicht um deine Angelegenheiten und lässt die Finger vom Essen?«
»Gerade sollte ich dir noch helfen!«
»Eine großartige Hilfe«, höhnte Sophia.
Sie riss das misslungene Soufflé aus dem Ofen, verbrannte sich die Finger, fluchte, hielt die Hand viel zu kurz unter fließendes kaltes Wasser.
»Retten, was zu retten ist«, zischte sie, und ohne Thomas noch einmal anzusehen, zauberte sie sich ein falsch-freundliches Lächeln ins Gesicht und rauschte in die Gaststube.
Thomas merkte, dass er die Luft angehalten hatte, jetzt ließ er sie hörbar entweichen. »Die Luft ist raus, soso …«, murmelte er düster.
*
Die unzufriedenen Kommentare der Gäste blieben auch an diesem Abend nicht aus und drückten Sophias Stimmung auf den bisherigen Tiefpunkt. In den nächsten Tagen hatte Sophia das Gefühl, dass die dicke Luft, die im Hause herrschte, sie am Atmen hinderte. Nachts, wenn sie ins Bett schlüpfte, schlief Thomas schon oder tat zumindest so. Tagsüber ging er ihr aus dem Weg, und auch sie suchte nicht gerade seine Nähe. Oder schien das nur so, weil sie beide die ganze Zeit so beschäftigt waren?
Die Kinder reagierten auf ihre Art auf die schlechte Stimmung.
Viola war am wenigsten betroffen, sie bemerkte kaum etwas davon, denn ihre Gedanken kreisten fast ausschließlich um Louis. In ihrem Tagebuch notierte sie alles, was er sagte und tat, sie registrierte jeden Blick, jedes Zwinkern, jede Bemerkung, jede Veränderung des Tonfalls. Ob er auch ein bisschen verliebt in sie war? Sie wusste es nicht.
Marita und Jonas waren scheinbar unbekümmert. Die beiden unzertrennlichen Geschwister steckten wie immer die Köpfe zusammen, kicherten nicht weniger als sonst und dachten sich Streiche aus, die sie den Hotelgästen spielen könnten; doch ein aufmerksamer Beobachter hätte wohl sehen können, dass sie verunsichert waren.
Gerade weil ihre Eltern sonst nur selten und schon gar nicht mehrere Tage lang miteinander stritten, wussten sie nicht, was davon zu halten war. Niemand verlor ein Wort darüber. So wandten sich Marita und Jonas von den unzuverlässigen Erwachsenen ab und waren noch mehr als sonst aufeinander fixiert. Doch das bemerkte niemand – weder Thomas noch Sophia waren in diesen Tagen besonders aufmerksame Beobachter, und die beiden Großmütter hatten bisher nicht viel von der angespannten Situation mitbekommen.
Die fünfjährige Lilly reagierte am unmittelbarsten: sie wurde quengelig und unleidlich, und obwohl sie sich damit nur Ärger zuzog, wich sie ihrer Mutter nicht von der Seite.
*
»Wir haben wieder ein paar
Reservierungen reinbekommen«, sagte Sophia zu Louis, »am Freitag und am Samstag kommt jeweils eine größere Gruppe. Es sind Familienfeiern. Wir könnten dann ja auch – «
Louis unterbrach seine Chefin: »Bevor Sie weiterreden: mir steht vertraglich ein freies Wochenende zu, und ich habe schon jetzt eine Menge Überstunden abzufeiern. Ich werde also von Freitag bis nächsten Mittwoch eine Auszeit nehmen.«
»Das dürfen Sie nicht!«, sagte Sophia erschrocken.
»Doch darf ich das.«
»Louis, ich bitte Sie. Ich kann das nicht alleine schaffen. Und ich habe sonst niemanden, der die Qualität bringen kann, die die Gäste erwarten, und der diese Mengen bewältigen kann!«
»Das ist natürlich ein Problem. Aber es ist eben nicht mein Problem.« Louis hatte offensichtlich beschlossen, sich nicht beeindrucken zu lassen.
Sophia versuchte es anders, obwohl es ihr widerstrebte zu drohen: »Es ist Ihre Probezeit!«
»Das Risiko gehe ich ein. Ich habe ein Recht auf ein gewisses Maß an Freizeit. Ich bin nicht blind: dass Sie sich mit Ihrem Laden hier ein bisschen übernommen haben, ist ja überdeutlich. Aber ich sehe nicht ein, wieso ich das ausbaden sollte.«
Obwohl Sophia insgeheim fand, dass Louis Bertram nicht ganz unschuldig daran war, dass das ›Goldene Herz‹ den Sprung zum Gourmet-Restaurant ein wenig zu unvermittelt und letztlich unvorbereitet gewagt hatte, verlegte sie sich wieder aufs Betteln: »Louis, Sie bekommen Ihre Freizeit, ich versprech’s. Aber bitte nicht an diesem Wochenende. Das ist ein Notfall!«
»Aber es ist nicht mein Notfall. Ich denke überhaupt nicht dran, mich kaputtzumachen für ein paar Familienfeiern. Sind ja nicht meine Familien. Sagen Sie doch ab!«
Sophia schüttelte entsetzt den Kopf. »Das können wir uns nicht erlauben. Die Leute kämen nie wieder, und es würde sich herumsprechen. Wir können auf keinen Gast verzichten.«
Louis zucke mit den Achseln. »Dann ziehen Sie’s eben durch. Aber ohne mich. Am Donnerstag bin ich wieder da, und ich zaubere Ihnen dann gern ein Délice au Homard und deliziöse Olivenpasteten und meinetwegen auch eine Tomatensuppe mit Sahnehäubchen und Sherry. Ich bin Koch – nicht Sklave.«
*
Das Wochenende ging vorüber wie ein böser Traum. Sophia funktionierte wie ein Automat. Sie bestellte einiges von einem Catering-Unternehmen und ließ es – heimlich und verstohlen – zum Hintereingang hereinbringen, doch die Qualität der Speisen überzeugte weder sie noch die Gäste.
Die meisten Speisen bereitete Sophia selbst zu. Manche davon musste sie, um sie zur rechten Zeit im bestmöglichen Zustand zur Verfügung zu haben, einfrieren, nur um sie gleich darauf wieder aufzutauen. Sie stand morgens um fünf Uhr auf und ging am nächsten Morgen um halb drei zu Bett. Immer deutlicher sah man die Ringe unter ihren Augen. Sie kaschierte sie notdürftig unter einer Schicht Make-up.
Hatte sie es in den letzten Tagen absichtlich vermieden, Thomas zu begegnen – immerhin der Schuldige am Soufflé-Desaster! – so traf sie ihn nun auch kaum mehr zufällig.
Und die Kinder? Lilly hängte sich jetzt lieber an ihren Papa oder verzog sich, wenn auch der sie ungeduldig verscheuchte, zu Oma Amalia; ansonsten sah Sophia ihre vier Kinder von Zeit zu Zeit am Ecktisch als Gäste des Restaurants, wo sie, mal in Begleitung der einen, mal der anderen Großmutter, schweigsam und freudlos ihre Mahlzeiten einnahmen.
Sophia hätte nicht zu sagen gewusst, womit die Kinder ihre Zeit verbrachten; in Anbetracht der Lage war sie an diesem Wochenende bloß froh, dass niemand etwas von ihr wollte und dass auch die beiden alten Frauen sich nicht über die Last der Aufgabe beklagten, sondern den herrschenden Ausnahmezustand offensichtlich irgendwie akzeptierten.
Thomas bekam immerhin etwas mehr als Sophia davon mit, was seine Kinder trieben; denn je weniger sie sich in der Nähe der Küche aufhielten, desto häufiger drückten sie sich in den Hotelfluren und an der Rezeption herum.
Besonders seine Mittleren, Marita und Jonas, musste er immer wieder zur Ruhe mahnen. Es war den beiden eigentlich streng verboten, im Bereich des Hotels zu spielen, doch das Verbot schien die Sache nur umso interessanter zu machen. Mehr als einmal beschwerten sich Hotelgäste über lärmende Kinder, die in den Gängen Fangen zu spielen schienen.
Thomas tat dann immer so, als müsste es sich um die Kinder anderer Hotelgäste handeln, und versprach, sich darum zu kümmern. Ein ums andere Mal packte er seine beiden mittleren Kinder am Kragen und nahm sie ins Gebet; ein ums andere Mal nickten sie und gelobten Besserung. Doch es war wohl stärker als sie.
Am Sonntagabend aber trieben sie es toll wie nie. Ein lauter Schreckensschrei ließ Thomas an der Rezeption aufspringen. Immer mehrere Stufen auf einmal nehmend, eilte er nach oben.
Im ersten Stock stand Hortensia Filsmeier, eine vornehme und ein wenig schrullige Dame von über achtzig Jahren, die in regelmäßigen Abständen mit ihrem annähernd sechzigjährigen Sohn im Hotel Zum Goldenen Herzen abstieg. Zuerst sah Thomas nur die alte Dame, die stocksteif in ihrem Türrahmen stand und um Fassung rang, einen Wimpernschlag später sah er auch, was ihr so zusetzte.
Marita lag mitten auf dem Flur am Boden, ihr Oberteil war mit roten Farbklecksern übersät; Jonas hockte mit bebenden Schultern neben ihr.
Thomas kannte seine Kinder, deshalb ließ er das grausliche Bild nicht auf sich wirken, sondern erkannte innerhalb eines Sekundenbruchteils, um was es sich handelte: eine makabre Inszenierung. Marita mimte eine Schwerverletzte, Jonas den edlen Retter – der sich allerdings vor unterdrückter Lustigkeit kaum halten konnte.
Kann man leise brüllen? Nun, Thomas beherrschte diese hohe Kunst. Sein zwar gedämpftes, aber bedrohlich grollendes »Marita!«, brachte seine Neunjährige blitzschnell wieder auf die Beine. Die Köpfe der Kinder stießen dabei zusammen, Jonas verschluckte sich, und seine Augen füllten sich mit Tränen.
Obschon die Kühner-Kinder in ihrem Vater meist den freundlichen, kuscheligen Bär sahen,
wussten sie immer genau, wann sie das Maß überschritten hatten – jetzt zum Beispiel. Marita senkte den Kopf und schnitt die zerknirschte Grimasse der auf frischer Tat Ertappten, Jonas schluckte seine Tränen herunter und schaute, ob es an der Decke etwas zu sehen gäbe …
»Marsch, ab ins Bad, wascht das Zeug ab, und dann geht’s ab ins Bett«, kommandierte ihr Vater. »Morgen reden wir noch mal drüber.«
Die Kinder trotteten davon, und Thomas wandte sich an Frau Filsmeier, die immer noch kein Wort hervorbrachte. Hoffentlich bekam die alte Dame keinen Herzanfall!
»Ich muss mich vielmals entschuldigen«, begann er. »Ein Kinderstreich …, äußerst schlechter Geschmack … Es tut mir wirklich leid.«
Hortensia Filsmeiers Kopf nickte, als hätte er sich verselbständigt, doch dann verzog sich ihr Mund zu einem faltigen Grinsen. »Ich muss schon sagen, die beiden haben mir einen gewaltigen Schreck eingejagt. Ich habe schon überlegt, ob ich’s mal mit Mund-zu-Mund-Beatmung versuche«, kicherte sie. »Gehören die beiden zu Ihnen?«
»Tja, äh, gewissermaßen«, antwortete Thomas und hob in einer bedauernden Geste die Hände.
»Gewissermaßen, soso!« Hortensia Filsmeier kicherte immer noch, dann schnaufte sie: »Jetzt muss ich mich aber erst mal setzen. Meinen kleinen Ausflug einmal rund ums Hotel verschiebe ich besser auf später. Man weiß schließlich nie, ob man nicht hinter der nächsten Ecke nieder-
gemeuchelt wird. Ihr kleines Schwarzwalddorf scheint ja ein gefährliches Pflaster zu sein.« Sie kicherte wieder.
»Ich bringe Ihnen einen Likör«, rief Thomas ihr nach. »Wir haben köstlichen Walnuss-Likör da. Der beruhigt die Nerven. Auf Kosten des Hauses natürlich.«
»Den nehme ich gern an«, nickte Hortensia Filsmeier, bevor sie hinzufügte: »Setzen Sie’s den Kindern auf die Rechnung.«
*
Thomas sollte nicht dazu kommen, Marita und Jonas ins Gebet zu nehmen, und die beiden bekamen keine Gelegenheit zu erklären, dass eine Gruselgeschichte, die ihnen Oma Gertie in aller Unschuld vorgelesen hatte, sie zu ihrer kleinen blutrünstigen Darstellung inspiriert hatte. Denn noch am selben Abend trat ein echter Notfall ein.
Nach den beiden Familienfeiern am Freitag und am Samstag war Sophia mit den Nerven am Ende. Die jeweiligen Familien waren bester Stimmung gewesen und hatten wahrscheinlich nicht viel davon gemerkt, wie unterbesetzt sie in der Küche und im Service waren, wie sehr Sophia zwischen der geschlossenen Gesellschaft und der öffentlichen Gaststube hin und her rannte und dabei Blut und Wasser schwitzte. Nicht alle Speisen hatten ganz der Vereinbarung entsprochen, und vereinzelt muss-ten Gäste allzu lange auf ihre Getränke warten, doch Sophia hatte wohlweislich, noch bevor Bemerkungen dazu laut werden konnten, einen ordentlichen Nachlass auf die Endrechnung angekündigt.
Die Gäste in der eigentlichen Gaststube hatten sich weniger umgänglich gezeigt. Sophia hatte kurz entschlossen eine radikal abgespeckte Version der Speisekarte ausgelegt. Die Konsequenz war, dass sie immer wieder auf die Berichterstattung über ihr angeblich so exquisites Restaurant und dessen vermeintlichen Anspruch auf höchste Auszeichnungen angesprochen worden war, und die wenigsten Kommentare waren anerkennend gewesen.
Zwar waren die meisten Leute durchaus höflich geblieben, aber Sophias Gefühl, diese Mischung aus Tadel und Wohlwollen nicht länger ertragen zu können, wuchs von Stunde zu Stunde.
Sie war früher ein schüchternes Mädchen gewesen, immer ein wenig im Hintertreffen zwischen ihren drei lebhaften, lärmenden Brüdern und umgeben von einer italienischen Großfamilie. Sie hatte hart an sich arbeiten müssen, um zu einer selbstbewussten jungen Frau zu werden. Nun ging sie auf die vierzig zu, war mit beiden Beinen im Leben angekommen, war Ehefrau, vierfache Mutter und im großen und ganzen recht er-
folgreich im Beruf, und hier stand sie und musste sich in einem fort entschuldigen und lächeln, lächeln, lächeln …
Heute war Sonntag – gewöhnlich der Tag mit dem meisten Umsatz. Alle Tische des Restaurants waren besetzt, Sophia hatte sogar Leute abweisen müssen. Wie an den beiden letzten Tagen hatte sie den Gästen eine kleinere Variante der Speisekarte vorgelegt, denn obwohl sie heute keine zusätzliche geschlossene Gesellschaft hatte und obwohl ihre Schwiegermutter und Christina in der Küche mithalfen, fühlte sie sich größeren Aufgaben nicht gewachsen. Je weniger Überraschungen ihr in der Küche widerfahren konnten, desto besser. Trotzdem ging alles schief. Sophia war so müde, dass ihre Hände zitterten, und sie wusste selbst, dass sie mehr Fehler machte als ihre Schwiegermutter und Christina zusammen.
Gegen ein Uhr morgens schließlich leerte sich das Restaurant. Nur noch ein Pärchen saß an einem Tisch in der Ecke. Die beiden waren um die fünfzig Jahre alt, die Frau dürr und spitznasig, der Mann mit einem Schnauzbart in seinem von roten Äderchen durchzogenen Gesicht. Beide waren offenbar ein Herz und eine Seele; in absolutem Einvernehmen hatten sie sich über alles beklagt, worüber man sich nur beklagen konnte, hatten aber dennoch alles restlos aufgegessen und auch dem Wein sehr reichlich zugesprochen. Und nun bewiesen sie Sitzfleisch.
Sophia atmete erleichtert auf, als der Herr die Hand hob. Sie trat näher an den Tisch heran.
»Wir hätten dann gern die Rechnung«, verlangte er.
Sophia nickte. Im gleichen Augenblick begann die Frau, als hätte sie nur darauf gewartet, den Faden ihrer Beschwerden wieder aufzunehmen: »Also, wir hatten uns von unserem Besuch hier wirklich mehr versprochen. Die Speisekarte ist ja doch sehr schlicht. Keine große Auswahl, keine besonderen Gerichte …«
»Es tut mir leid, wenn wir Ihren Ansprüchen nicht genügen können«, sagte Sophia. Sie hielt den Blick gesenkt, ihre Kiefer mahlten. Diese Leute waren unangenehm, und sie hatte nicht die geringste Lust, sich bei ihnen zu entschuldigen, aber das Schlimmste war natürlich, dass sie vollkommen recht hatten. Die Speisekarte war nur etwas wert, wenn man sie durch eine Tageskarte mit sehr viel feineren Speisen ergänzte, was heute nicht der Fall war. Aber sollte sie ausgerechnet diesen Leuten erklären, dass der Koch lieber um die Häuser zog und sie als seine Chefin es nicht geschafft hatte, ihn zum Bleiben zu bewegen?
Louis war nicht einmal sofort weggefahren. Erst heute, am Sonntagmorgen, hatte er eine kleine Reisetasche in sein schnittiges Sportauto geworfen und war mit quietschenden Reifen davongebraust. Am Freitag und am Samstag jedoch, als Sophia ihn in der Küche so dringend gebraucht hätte, war er abends losgezogen und irgendwann spät nachts von seinen Abenteuern heimgekehrt, zurück in das Hotelzimmer, das in den nächsten Jahren seine Heimat sein sollte. Sophia hatte ihn gesehen, wie er durch die Hotellobby nach oben schlich. Sie hätte nicht behaupten können, dass er torkelte, aber er ging auch nicht vollkommen gerade. Wo mochte der junge Mann sich herumtreiben, er kannte sich doch in der Gegend gar nicht aus?
»Wir hatten mehr erwartet als die gute badische Küche«, legte die Frau mit der spitzen Nase nach, »stattdessen ist es eher weniger!«
»Es tut mir leid«, sagte Sophia. Sie fühlte sich plötzlich so erschöpft wie seit Jahren nicht mehr. Genau genommen konnte sie sich nicht erinnern, sich überhaupt jemals derart müde und ausgelaugt gefühlt zu haben. Sie brachte einfach nicht die Kraft auf, ihren unzufriedenen Gästen durch ein paar freundliche Worte und herzliche Entschuldigungen den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Sie wollte nur, dass diese Leute endlich gingen; sie wollte sich wie ein Baby zusammenrollen und schlafen …
Die spitznasige Besucherin fuhr fort, sich zu beschweren, doch Sophia konnte sich nicht mehr konzentrieren. Während der Wortschwall in ihren Ohren zu einem monotonen Rauschen wurde, spulte sich vor Sophias innerem Auge ab, was sie heute Abend noch zu tun hatte, bevor sie unter die Decke schlüpfen konnte: die Küche reinigen, ausgiebig lüften, durch die Gaststube fegen, falls Thomas das nicht machte – und sie würde ihn nicht darum bitten –, die Tischdecken wechseln und alles in perfektem Zustand für das morgige Frühstück hinterlassen; in den Kinderzimmern vorbeischauen, in der Hoffnung, dass alle sanft und selig schliefen, Maritas und Jonas’ Ranzen für den kommenden Schultag kontrollieren, Wäsche aus dem Trockner nehmen, die Waschmaschine leeren und die saubere Wäsche in den Trockner stecken, die Waschmaschine mit Schmutzwäsche neu befüllen …
Die Dame verstummte, wodurch Sophia wieder in die Realität zurückgeholt wurde. Es flimmerte vor ihren Augen, als sie versuchte, ihren Blick wieder scharf zu stellen und sich zu erinnern, welches die letzten Worte ihres Gastes gewesen waren. »Reichlich versalzen«?
»Wir kommen Ihnen im Preis entgegen«, brachte Sophia mühsam über die Lippen. Ihr Mund war trocken, und es summte in ihren Ohren.
Die Dame nickte, doch in ihren strengen Blick mischte sich jetzt ein wenig Besorgnis: Diese Köchin – oder war es gar die Chefin selbst? – gab sich zwar reichlich verstockt, aber letztendlich schien sie sich ihre Kritik doch sehr zu Herzen zu nehmen; sie war blass geworden.
Zehn Minuten später endlich half der Mann mit dem Schnauzbart seiner spitznasigen Begleiterin in ihren leichten Mantel. Thomas, der mit einer dumpfen Ahnung, dass etwas nicht stimmen könnte – noch weniger stimmen könnte als in den letzten Tagen und Wochen – war vom Hotelbereich herübergekommen, um nach dem Rechten zu sehen. Auf Sophias Wunsch hatte er eine um die Hälfte gekürzte Rechnung ausgestellt und damit doch noch den Hauch eines Lächelns in die Gesichter der Gäste gezaubert. Das Paar würden sie höchstwahrscheinlich hier nicht wiedersehen, doch die beiden würden mit ein wenig Glück zumindest nicht allzu schlecht vom ›Goldenen Herzen‹ sprechen und den immer noch guten Ruf des Hauses nicht dauerhaft schädigen.