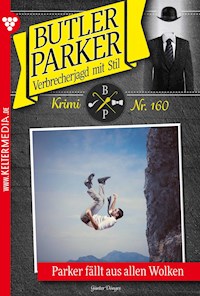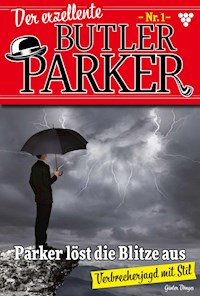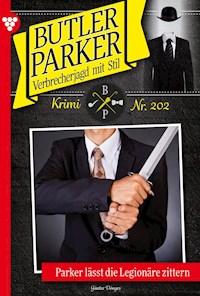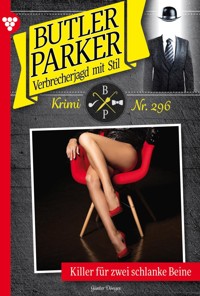30,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Butler Parker
- Sprache: Deutsch
Butler Parker ist ein Detektiv mit Witz, Charme und Stil. Er wird von Verbrechern gerne unterschätzt und das hat meist unangenehme Folgen. Der Regenschirm ist sein Markenzeichen, mit dem auch seine Gegner öfters mal Bekanntschaft machen. Diese Krimis haben eine besondere Art ihre Leser zu unterhalten. Butler Parker ist seinen Gegnern, den übelsten Ganoven, auch geistig meilenweit überlegen. In seiner auffallend unscheinbaren Tarnung löst er jeden Fall. Bravourös, brillant, effektiv – spannendere und zugleich humorvollere Krimis gibt es nicht! E-Book 1: Parker treibt die "Ratten" raus E-Book 2: Parkers Fischzug am Lochness E-Book 3: Parker macht die Schotten munter E-Book 4: Parker karrt den "Giftprinz" ab E-Book 5: Parker greift die Mädchenhändler E-Book 6: Parker zähmt den Blütenmörder E-Book 7: Parker schleift den "Eisenfresser" E-Book 8: Parker und sein Doppelgänger E-Book 9: Parker wirft mit Sahnetorten E-Book 10: Parker knackt die Wasserburg
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1289
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Parker treibt die "Ratten" raus
Parkers Fischzug am Lochness
Parker macht die Schotten munter
Parker karrt den "Giftprinz" ab
Parker greift die Mädchenhändler
Parker zähmt den Blütenmörder
Parker schleift den "Eisenfresser"
Parker und sein Doppelgänger
Parker wirft mit Sahnetorten
Parker knackt die Wasserburg
Butler Parker – Staffel 21 –E-Book 201-210
Günter Dönges
Parker treibt die "Ratten" raus
Roman von Dönges, Günter
Josuah Parker war erleichtert, als er dem japanischen Geländewagen entstieg, den seine Herrin, Lady Agatha Simpson, gesteuert hatte.
Autofahrer hatten erbost hinter ihnen gebrüllt, und an der Southwark-Bridge hatte ein total entnervter Radfahrer sich nur mit einem verzweifelten Sprung in die Themse retten können. Seine derben Flüche klangen Josuah Parker immer noch in den Ohren.
»Diese Leute«, klagte Lady Agatha, während Parker ihr aus dem Wagen half, »benehmen sich wie üble Rowdys. Aber das erlebe ich ja nicht zum ersten Mal. Was sagen Sie dazu, Mister Parker?«
»In der Tat, Mylady«, erwiderte der Butler diplomatisch. »Es ist wahrhaftig nicht das erste Mal.«
Die passionierte Detektivin setzte ihre beachtliche Leibesfülle in Bewegung und ging zielstrebig auf eine Passage zu.
Parker folgte gemessen seiner Herrin, die den heutigen Tag mit einem Einkaufsbummel zu verbringen gedachte.
Einige Leute drehten sich neugierig nach ihm um. Parker war ein mehr als mittelgroßer, alterslos wirkender Mann: das Urbild eines hochherrschaftlichen Butlers mit schwarzem Zweireiher, Eckkragen und schwarzem Binder. Unverwechselbare Zeichen an ihm waren die schwarze Melone, der Covercoat und der Regenschirm, der allerdings von ganz besonderer Art war. Dazu war der Butler die Würde in Person.
Agatha Simpson hingegen strahlte unbändige Energie aus. Sie war seit Jahren verwitwet und eine immens reiche Frau, die sich dafür entschieden hatte, als Amateur-Detektivin zu arbeiten. Sie hielt sich in ihrem Beruf für unübertrefflich und einmalig und verbuchte auch viele Erfolge, weil Josuah Parker geschickt im Hintergrund agierte und die jeweiligen Fälle diskret zu lösen pflegte.
In der Passage blieb Lady Agatha abrupt stehen und sah sich erstaunt nach allen Seiten um.
»Was höre ich da, Mister Parker?« fragte sie stirnrunzelnd.
»Mylady dürften Ohrenzeugin einer erregt geführten Diskussion sein«, antwortete der Butler gemessen.
»Genau das wollte ich sagen«, behauptete die ältere Dame. »Kann es sein, daß diese Diskussion in der Wäscherei da drüben stattfindet?«
»Mylady verfügen über ein unübertreffliches Gehör.«
Agatha Simpson wandte sich um und blickte auf ein Schild in der Passage.
»Tom Peacock – Reinigung und Wäscherei«, stand da in schmalen Lettern.
Die Tür bestand aus Milchglas. Weder die neugierige Agatha Simpson noch Butler Parker konnten hindurchsehen.
Dafür aber waren die Geräusche aus dem Innern eindeutig zu identifizieren.
In der Wäscherei brüllten ein paar Kerle durcheinander. Die angeregte Diskussion setzte sich offenbar auf höherer Ebene fort – mit Faustschlägen und Ohrfeigen.
Für die kampflustige ältere Dame bedeutete das die ernstgemeinte Aufforderung zum Eintreten. Sie schlitterte sozusagen wieder mal in einen Fall hinein.
Entschlossen öffnete sie die Tür und trat ein – und fand sich übergangslos in einer anderen Welt wieder.
Dichter Nebel hing in dem Raum wie in einem Inhalatorium. Die Luft war schwer und feucht.
»Wo bleiben Sie denn, Mister Parker?« fragte Agatha Simpson ungehalten. »Man sieht hier ja kaum die Hand vor Augen.«
»Stets an Ihrer Seite, Mylady«, versicherte der Butler, der eingetreten war und die Tür hinter sich geschlossen hatte.
Die vier Kerle ignorierten ihre Besucher. Sie waren so mit sich selbst beschäftigt, daß sie alles um sich her vergessen hatten.
Sie waren in dem zähen Nebel nur als vage Schatten zu erkennen. Aber diese Schatten hieben brüllend um sich, verteilten Ohrfeigen, schlugen mit den Fäusten und begleiteten alles mit saftigen Flüchen.
Aus einer Waschmaschine strömte Dampf. Aus einem Rohr tropfte Wasser auf den Boden. Ein Karton mit Seifenpulver flog quer durch den Raum und zerplatzte dicht neben der Tür.
»Habe ich das etwa als Angriff aufzufassen, Mister Parker?« verlangte Lady Agatha empört zu wissen. »Diese tobsüchtigen Lümmel ahnen wohl nicht, wen sie vor sich haben.«
»Meine Wenigkeit möchte behaupten, es schiene sich eher um ein Versehen gehandelt zu haben. Gezielte Angriffe dürften bei diesem Smog keinen großen Erfolg versprechen.«
In dem großen Raum roch es nach Seifenpulver, Chemikalien aller Art, ätzenden Dämpfen, kochendem Wasser und Knochenöl, dessen talgartige Konsistenz sich in diversen Flaschen auf den Regalen befand. Das entsetzlich stinkende Zeug wurde als Schmiermittel, zur Seifen- und Schuhcremeherstellung benutzt.
Parker wußte immer noch nicht, was hier los war. Er sah nur undeutlich vier Kerle, die sich wie wild prügelten. Aber der Grund dafür blieb vorerst unerfindlich.
Einer der Kerle sauste jetzt gerade mit einem Affenzahn quer durch die Wäscherei. Ein kräftiger Fußtritt hatte ihm den erforderlichen Schub verliehen, und das Waschpulver tat ein übriges, um ihn schneller flitzen zu lassen.
Er knallte mit dem Schädel an eine Wäschetrommel und heulte auf. Völlig verschmiert versuchte er auf die Beine zu kommen, doch der Untergrund war zu glatt, und so landete er zum zweiten Mal knallhart an der Wäschetrommel.
Josuah Parker hielt es für angemessen, den Schauplatz der Schlägerei diskret zu verlassen, doch seine kriegerische Herrin war damit keineswegs einverstanden. Sie hielt das Schauspiel für ergötzlich.
»Sehen Sie nur, wie die sich balgen, Mister Parker«, rief sie erfreut.
Der Butler hüstelte dezent und bot seiner Herrin den Arm.
»Wenn Mylady gestatten, wird meine Wenigkeit Mylady vom Schauplatz des Geschehens begleiten«, bot er an, aber damit stieß er auf taube Ohren. Agatha Simpson dachte nicht im Traum daran, den Schauplatz des Geschehens zu verlassen.
Sie suchte nach einer Möglichkeit, hilfreich in den Kampf einzugreifen, konnte sich aber noch nicht für eine Seite entscheiden, weil alles im wahrsten Sinn des Wortes noch undurchsichtig war.
Der Rattengesichtige ließ immer noch den Revolverlauf kreisen.
Agatha Simpson hatte inzwischen ihren perlenbestickten Pompadour in leichte Schwingung versetzt und bewies jetzt ihre Gefährlichkeit.
Sie holte einmal kurz aus und setzte den Pompadour zielsicher auf den Schädel des Mannes.
Die Wirkung war erstaunlich. Der Rattengesichtige zuckte zusammen, stöhnte dann, verdrehte die Augen und sackte schwerfällig in die Knie. Der leise Nachhall eines hohlen, dumpfen Geräuschs war noch zu hören, außerdem das Poltern, mit dem der Revolver auf den Boden fiel.
Der Glücksbringer im Handbeutel hatte voll sein Ziel erreicht. Bei diesem sogenannten Glücksbringer handelte es sich um ein einfaches Pferdehufeisen, das einst ein Brauereigaul getragen hatte. Dementsprechend Stark war auch die Wirkung. Der Glücksbringer war nur oberflächlich in dünnen Schaumstoff verpackt. Agatha Simpson handhabte den perlenbestickten Pompadour mit außerordentlicher Kraft und Geschicklichkeit, und da sie dem Hobby des Golfs und des Sportbogenschießens huldigte, war ihre Muskulatur auch entsprechend gut ausgebildet.
Einen Augenblick war die Schlägerei unterbrochen. Der zweite Kerl zog ebenfalls einen Revolver und kam näher. Er kniff die Augen zusammen, um in dem Dunst besser sehen zu können. Noch während er näherkam, bediente sich Parker aus dem reichhaltigen Angebot in den Regalen.
Er nahm eine Flasche Knochenöl und warf sie auf den Boden. Das schmierige Zeug lief aus und vermischte sich mit dem feuchten Seifenpulver zu einem aalglatten Bodenbelag. Parker warf noch eine zweite Flasche zu Boden und schickte einen Karton himmelblauen Waschpulvers hinterher, der detonationsartig barst.
Agatha Simpson stand mit höchst zufriedenem Gesichtsausdruck nahe der Tür und sah erstaunt auf den Effekt, den ihr Butler mit den Wurfgeschossen ausgelöst hatte.
Der Mann mit dem Revolver lief rückwärts, konnte sich aber nicht auf den Beinen halten und fiel der Länge nach hin. Der Rattengesichtige erhob sich, allerdings nur für den Bruchteil einer Sekunde, dann schlitterte er wie besessen durch die Schmiere, griff haltlos in der Luft herum und beendete seine Reise vor einer Waschmaschine, die er heftig umarmte.
Auch die drei anderen blieben nicht verschont. Einer ging zu Boden, der andere klammerte sich an ihn und folgte ihm. Der dritte flitzte wie vom Affen gebissen durch den Raum, flog an die Wand, fiel hin und versuchte aufzustehen. Vergeblich – in der Schmiere kriegte er kein Bein mehr auf den Boden.
Heulen und Zähneklappern war zu hören. Immer wieder versuchten die Männer, sich auf den Beinen zu halten, doch jeder Ansatz wurde im Keim erstickt.
Agatha Simpson war von diesem Effekt so begeistert, daß sie nun ihrerseits in die Regale griff und die brüllenden Kerle mit allem bombardierte, was ihr in die Hände fiel.
Der eine grapschte nach seinem Revolver und fiel prompt und schmerzhaft auf die Nase. Zu aller Pein knallte ihm ein weiterer Karton Waschpulver auf den Schädel. Eine zartblaue Wolke breitete sich aus, und der Kerl gab einen erstickten Schrei von sich.
Die anderen gerieten inzwischen in Panik, niesten, husteten und fluchten um die Wette. Sobald einer auch nur die Hände aufstützte, endete der Versuch mit einem kläglichen Fall.
»Herrlich ist das«, rief Lady Agatha und klatschte in die Hände. »Die Subjekte kommen überhaupt nicht mehr hoch. Wie finde ich das, Mister Parker?«
»Mylady dürften das höchst ergötzlich finden. Wie Mylady sicher wissen, handelt es sich hierbei um den sogenannten Reibungskoeffizienten. Mylady wissen ferner, daß es sich dabei um jene Kraft handelt, die aufgewendet werden muß, um die Geschwindigkeit eines reibenden Körpers konstant zu halten, im Verhältnis zum Körpergewicht. Mylady dürfen versichert sein, daß der. Reibungskoeffizient in diesem Fall gleich Null ist.«
»Selbstverständlich ist mir das bekannt«, schwindelte die Lady bedenkenlos, die vom Reibungskoeffizienten noch nie etwas gehört hatte. Sie sah nur den Erfolg, und der war mehr als erstaunlich, als die brüllenden Männer immer wieder vergeblich versuchten, auf die Beine zu kommen.
In wilder Wut, Beklemmung und Angst hieben sie nach allen Seiten um sich. Doch jede Bewegung setzte sich in der Schmiere sofort um und ließ sie hilflos von einer Seite zur anderen rutschen.
Selbst als einer versuchte, sich an der Waschmaschine hochzuziehen, gelang ihm das nicht. Er strampelte mit den Beinen, hielt das Gerät umklammert und kam nicht mehr davon los.
Ein anderer kroch mit einem Gesicht wie ein kranker Hund auf Agatha Simpson zu und versuchte ihre Beine zu fassen.
Für die streitbare ältere Dame war das einwandfrei ein tätlicher Angriff, oder zumindest der Versuch dazu.
Wieder trat ihr perlenbestickter Pompadour in Aktion, den sie an einer langen Lederschlaufe trug.
Der Glücksbringer traf wie gewohnt sein Ziel. Diesmal landete er auf einem mit Waschpulver und Knochenöl zweckentfremdeten Hinterkopf.
Da auch hier der Reibungskoeffizient aufgehoben war, hatte Agatha Simpson alle Mühe, den Glücksbringer rechtzeitig abzufangen, weil er wie ein Bumerang zurückkehrte.
Der kräftig geführte Hieb aber versetzte den Mann in rotierende Bewegung. Er drehte sich wie ein Kreisel auf dem glitschigen Boden und kam erst nach einer Weile unter einem Regal zum Stillstand. Der Aufprall war so gewaltig, daß dieses Regal umfiel. Knallend barsten Kartons und Flaschen. Himmelblaue und weiße Wolken wurden durch den Raum geblasen, weiteres Knochenöl lief aus. Der Geruch wurde schließlich so penetrant, daß selbst Parker leicht angewidert die Nase rümpfte.
»Was gedenke ich nun zu tun, Mister Parker?« fragte die Lady, die mißbilligend auf die rudernden Kerle sah.
»Mylady gedachten den Nachmittag mit einem Einkaufsbummel zu verbringen.«
»Richtig, das hatte ich vor. Hier gibt es für mich nichts mehr zu tun. Den Rüpeln habe ich es gründlich besorgt. Finden Sie nicht auch, Mister Parker?«
Josuah Parker verneigte sich leicht.
»Mylady verstehen es ausgezeichnet, immer die rechten Umgangsformen zu wahren«, sagte er höflich.
»Dann gehen wir jetzt«, entschied die resolute Dame bestimmt.
Aus dem himmelblauen Nebel ertönte wildes Zetern. Die Kerle brüllten immer noch ihre hilflose Wut hinaus.
»Das wird Folgen haben«, keifte eine bitterböse Stimme. »Das wird euch noch verdammt leid tun.«
»Tut es mir wirklich leid, Mister Parker?« fragte die Lady lächelnd.
»Meine Wenigkeit möchte sich dem Glauben hingeben, daß Mylady nicht unbedingt von dieser Gefühlsregung betroffen sind.«
Butler Parker lüftete höflich seine Melone in Richtung der undefinierbaren Nebelwolke und geleitete seine Herrin dann zur Tür hinaus.
Hinter ihnen blieb das totale Chaos zurück. Fünf restlos entnervte Männer schrien sich die Kehlen heiser.
*
Lady Agatha bewohnte in Shepherd’s Market, in der Nähe des Hyde Park, ein Fachwerkhaus, das auf den Grundmauern und Gewölben einer alten Abtei stand. Das Haus lag an der Stirnseite eines kleinen Platzes, der von weiteren Fachwerkhäusern eingerahmt wurde. Diese Häuser gehörten Lady Agatha ebenfalls.
An diesen Abend hatte es sich Lady Agatha gemütlich gemacht. Sie saß in dem großen Sessel vor dem Kamin, blätterte in einer Zeitschrift und trank abwechselnd Tee und Kognak. Immer wieder griff ihre Hand nach der Kristallschale mit den diversen Leckereien.
Josuah Parker legte gerade ein Scheit in den knisternden Kamin.
»Schrecklich, diese Süßigkeiten, Mister Parker«, meinte sie, »aber ich habe gerade in dieser Zeitschrift gelesen, daß der menschliche Körper unbedingt hin und wieder Zucker zu sich nehmen muß, damit er gesund und kräftig bleibt.«
Das klang fast wie eine Entschuldigung, denn in der Zeitschrift stand nichts davon, daß man diesen Zucker in Form von Keksen und Leckereien gleich pfundweise vertilgen mußte.
»Da kann ich Mylady nur beipflichten«, sagte Parker höflich. Sein Gesicht war glatt und ausdruckslos auf die jetzt leere Kristallschale gerichtet. »Mylady dürfen ihren Körper keineswegs vernachlässigen.«
»Dann bringen Sie mir noch ein paar kandierte Früchte, Mister Parker.«
Als der Butler das Gewünschte in einer weiteren Schale hereinbrachte, läutete die Türglocke.
Agatha Simpson sah unwillig hoch. Sie liebte es nicht sonderlich, in ihren Musestunden gestört zu werden.
»Sehen Sie bitte mal nach, wer mich jetzt noch belästigt, Mister Parker.«
Der Butler verbeugte sich knapp und ging zum verglasten Vorflur. Auf der rechten Seite öffnete er einen in die Wand eingebauten Schrank und schaltete die Fernsehkamera ein, die sich draußen unauffällig unter dem Vordach der Tür befand.
»Chief-Superintendent McWarden«, meldete Parker.
»Was will der Mensch denn nun schon wieder?« fragte sie seufzend. »Braucht er mich, um wieder einen Fall aufzuklären? Wie hat er es nur jemals zu seinem Posten gebracht? Lassen Sie ihn eintreten«, entschied sie dann.
McWarden, etwa fünfundfünfzig Jahre alt, untersetzt und mit einem deutlichen Bauchansatz ausgestattet, ähnelte einer leicht gereizten Bulldogge, was sein Aussehen betraf. Der Blick aus seinen Basedowaugen trug noch ein übriges dazu bei.
McWarden leitete im Yard ein Sonderdezernat, das dem Innenministerium unterstellt war und sich hauptsächlich mit dem organisierten Bandenwesen befaßte.
Da er unter Erfolgszwang stand und oft Probleme hatte, stellte er sich oft im Haus der Lady Simpson ein und bat hin und wieder um Mithilfe bei einem verzwickten Fall. Er suchte dabei vor allem Parkers Rat, schätzte aber auch die unkonventionelle und ungewöhnliche Art der Lady Agatha und nahm es sogar in Kauf, von der älteren Dame mehr oder weniger zynisch bespöttelt zu werden. Manchmal platzte McWarden dann aber doch der Kragen, und er reagierte giftig.
McWarden nahm nach der etwas kühlen Begrüßung umständlich im Besuchersessel Platz. Sein Gesicht sah unglücklich aus, und er blickte ein wenig ratlos von einem zum anderen. Er trug etwas mit sich herum, das ihm anscheinend selbst sehr zu schaffen machte.
»Was darf ich anbieten, Sir?« fragte der Butler.
Lady Agatha wedelte unwillig mit der Hand.
»Vorerst gar nichts«, entschied sie. »Ich weiß ja noch nicht mal, was McWarden überhaupt will.«
Als der Superintendent sehnsüchtig nach der Schale mit den kandierten Früchten schielte, brachte Lady Agatha sie mit einem schnellen Griff außer Reichweite und damit in Sicherheit.
»Sie sollten nicht nach Süßigkeiten schielen, mein Lieber« tadelte sie, »sehen Sie sich mal Ihren Bauch an. Süßigkeiten sind höchst ungesund.«
McWarden blickte schluckend auf seinen gewölbten Leib. Er hätte sich gern ein Gläschen Brandy anbieten lassen, aber bei dem sprichwörtlichen Geiz der Hausherrin war damit wohl kaum zu rechnen.
»Na, dann packen Sie mal aus, McWarden«, sagte Agatha Simpson jovial. »Sicher haben Sie einen Fall am Hals, mit dem Sie wieder mal nicht fertig werden und brauchen meine Hilfe. Sind Sie um diese Zeit überhaupt noch im Dienst?«
In McWardens Augen erschien ein kleines, boshaftes Licht. Er gestattete sich ein dünnes Grinsen, das Lady Agatha irgendwie hinterhältig erschien.
»Nein, ich bin heute nicht mehr im Dienst«, antwortete er. »Es handelt sich um einen rein privaten Besuch.«
»Was ja wirklich sehr selten ist«, meinte die passionierte Detektivin spöttisch. »Sie sind also gekommen, um bei mir Tee und Gebäck abzustauben?«
Agatha Simpson war immer sehr direkt und pfiff auf die Regeln der Höflichkeit. Aber das war McWarden gewöhnt.
»Ich komme aus einem anderen, nicht gerade angenehmen Anlaß. Ein Kollege von der Kripo gab mir den dezenten Hinweis, daß ...«
»Also doch ein Fall, den Sie nicht allein lösen können«, unterbrach die Lady zufrieden und überlegen.
McWarden ging nicht darauf ein. Er sprach den begonnenen Satz mit fast stoischer Ruhe zu Ende.
»... gegen Sie, Mylady, eine Anzeige wegen Körperverletzung vorliegt.«
Agatha Simpson verschluckte sich prompt an ihrem Tee.
»Was?« rief sie empört. »Wer hat diese wahnsinnige Idee gehabt? Ich höre wohl nicht recht, McWarden. Was sagen Sie dazu, Mister Parker?«
Josuah Parker hatte die Worte erstaunt zur Kenntnis genommen, und er wußte auch schon, wer die Anzeige erstattet hatte. Sein Gesicht blieb jedoch ausdruckslos und glatt.
»Mylady empören sich zu Recht. Meiner Wenigkeit ist nicht bekannt, daß Mylady sich zu einer Körperverletzung hinreißen ließen.«
»Na also! Was soll dann dieser Unsinn? Sie haben ja gehört, McWarden, daß ich keine Körperverletzung begangen habe. Wie sollte ich auch – ich, eine schwächliche, zarte Frau?«
McWarden sah sinnend auf die »schwächliche, zarte Frau«, die schon so manchen harten Gangster verprügelt hatte.
»Die Anzeige stammt von einem gewissen Tom Peacock, Mylady, der eine Wäscherei und Reinigung betreibt. Er und sein Bruder, denen das Geschäft gemeinsam gehört, behaupten, Sie hätten mit einem Hammer zugeschlagen.«
»Hatte ich einen Hammer dabei, Mister Parker?« fragte die Lady sanft.
»Meine Wenigkeit kann bestätigen, daß Mylady keinen Hammer bei sich trug«, versicherte der Butler. »Offenbar dürfte hier ein Irrtum vorliegen.«
»Vielleicht war’s ein perlenbestickter Pompadour«, meinte McWarden ein wenig boshaft. »Und vielleicht befand sich jener als Hammer bezeichnete Gegenstand darin.«
Josuah Parker räusperte sich leicht. Seine Herrin schien in Schwierigkeiten zu geraten, denn die Anzeige wegen Körperverletzung war keinesfalls als Witz aufzufassen. Die Kerle hatten ja gedroht, daß es noch Folgen haben würde.
»Vermutlich liegt hier ein bedauerlicher Irrtum vor«, wandte er sich an McWarden. Dann berichtete er in knappen Sätzen, was sich in der Wäscherei und Reinigung zugetragen hatte.
»Mylady handelte einwandfrei in Notwehr«, schloß er.
»Empörend, daß dieser Kniebock es wagt, eine Lady Simpson anzuzeigen«, sagte die Hausherrin. »Was bildet sich dieser Lümmel ein! Ich werde ihn mir ernsthaft vorknöpfen.«
»Peacock heißen die beiden Männer«, verbesserte McWarden, denn Lady Agatha war dafür bekannt, daß sie sich keine Namen merken konnte.
»Wenn der Fall so liegt«, meinte McWarden nachdenklich, »dann halte ich es für besser, wenn Sie mal mit ihm reden. Vermutlich zieht Mister Peacock dann die Anzeige zurück.«
»Mylady werden sehr diskret Vorgehen«, sagte Parker. »Meine Wenigkeit ist überzeugt davon, daß sich’ alles zum Guten wenden wird.«
»Das will ich aber auch hoffen, sonst lernen die Kerle mich von meiner unangenehmen Seite kennen.« Dabei musterte sie McWarden kühl und frostig.
Der Chief-Superintendent erhob sich aus dem Besuchersessel.
»Dann werde ich nicht länger stören«, sagte er.
»Das finde ich sehr taktvoll«, erwiderte die Lady. »Morgen früh werde ich diesem Plierstock einen Besuch abstatten. Sie können die Angelegenheit dann als erledigt betrachten, McWarden.«
Das war sie aber keinesfalls, denn damit fing alles erst richtig an.
*
Am anderen Morgen fuhren sie in Parkers hochbeinigem Monstrum, wie seine Trickkiste auf vier Rädern von Freund und Feind genannt wurde.
Das Monstrum war ein ehemaliges Londoner Taxi, aber die Technik des Wagens befand sich auf dem neuesten Stand. Parker hatte den Wagen nach seinen Vorstellungen umgestalten lassen und dabei seine eigenwillige Phantasie unter Beweis gestellt.
Die Detektivin saß im Fond des Wagens und dachte darüber nach, was sie den beiden unverschämten Kerlen sagen würde, die es gewagt hatten, eine Lady Agatha Simpson wegen vorsätzlicher Körperverletzung anzuzeigen. Dabei beobachtete sie auch gleich etwas mißmutig den zähen Verkehr auf den Straßen.
»Können Sie nicht schneller fahren, Mister Parker? Geben Sie doch einfach mehr Gas und verscheuchen Sie diese Rowdies.«
»Mit Verlaub, Mylady, meine Wenigkeit versucht nur, sich dem zähen Verkehrsfluß anzupassen.«
»Papperlapapp«, meinte sie wegwerfend, »manchmal glaube ich, daß Sie einfach nicht das richtige Durchsetzungsvermögen haben. Ich wäre schon längst an Ort und Stelle.«
»Mylady beherrschen einen vorzüglichen Fahrstil.«
»Das will ich meinen«, sagte sie zufrieden. »Und jetzt werde ich Ihnen gleich mal demonstrieren, wie man es anstellt, daß eine Anzeige sang- und klanglos zurückgenommen wird. Natürlich geht das nur, wenn man über psychologisches Einfühlungsvermögen verfügt, Mister Parker.«
»Darin sind Mylady unübertrefflich«, versicherte der Butler.
Das hochbeinige Monstrum hielt in der Nähe der Passage. Als Parker seiner Herrin aus dem Fond half, blieben wiederum einige neugierige Leute stehen und starrten abwechselnd den Butler und das Auto an.
Josuah Parker kümmerten diese neugierigen Blicke jedoch herzlich wenig.
Er schritt hinter der Lady her, die es furchtbar eilig hatte und holte sie ein.
Tom Peacock erkannte die streitsüchtige Dame auf Anhieb und zuckte ein wenig zusammen. Mißtrauisch äugte er nach einem hammerähnlichen Gegenstand, konnte aber nur den Pompadour an der langen Lederschlaufe entdecken.
»Sind Sie Mister Kniebock?« herrschte Agatha Simpson ihn an.
»Nein, nein«, sagte Peacock hastig. »Vermutlich eine Verwechslung. Mein Name ist Peacock, Mylady, Tom Peacock.«
Aus der Schädeldecke des Mannes wuchs ein ansehnliches Horn, das in allen Farben des Spektrums schillerte. Dort hatte ihn das Souvenir eines ehemaligen Brauereigauls voll erwischt.
»Also doch«, meinte die Detektivin triumphierend. »Das habe ich ja gleich gewußt.«
Josuah Parker sah sich inzwischen um und registrierte, daß ein paar der Waschautomaten den Dienst eingestellt hatten, weil ihre Verglasung total zertrümmert war. In der Wäscherei sah es immer noch so aus, als hätten die Vandalen gehaust. Ein Teil des Bodens war mit zäher Schmiere bedeckt, obwohl Peacock sich alle Mühe gegeben hatte, die Spuren zu beseitigen.
Ein weiterer Mann kam durch die Tür hinter den Maschinen herein. Er war klein und drahtig und hatte schütteres Blondhaar.
Auch auf seinem Schädel prangte ein Horn, doch durch die wenigen Haare kam es bei ihm besonders ausgeprägt zur Geltung. Der sogenannte Glücksbringer hatte hier ganze Arbeit geleistet.
Wenn die beiden Männer die Anzeige nicht Zurücknahmen, überlegte Agatha Simpson, dann werden ihnen nochmals zwei weitere großzügig ausgestattete Hörner wachsen, damit sich die Sache auch lohnte.
Der mit den schütteren Haaren stellte sich ebenfalls als Peacock vor. Beide kannten Lady Agatha, hatten mit ihr aber noch nicht geschäftlich zu tun gehabt.
»Sie haben Anzeige gegen mich erstattet, meine Herren«, sagte sie verärgert. »Und Sie haben weiterhin behauptet, ich hätte Sie mit einem Hammer geschlagen. Sehe ich so aus, als trüge ich ständig ein solches Schlaginstrument mit mir herum, um Geschäftsleute zu verprügeln?«
»Das nicht«, gab der eine Peacock eingeschüchtert zu. »Aber Sie haben mir und meinem Bruder etwas Hartes auf den Schädel gehauen, als wir uns in einer mißlichen Lage befanden. Ich suchte nur Halt an Ihnen, Lady, aber Sie schlugen gleich zu. Wir hätten Sie auch noch wegen Sachbeschädigung belangen können, besonders jenen Herrn dort.«
Peacock zeigte anklagend auf Parker, der so steif dastand, als habe er einen Ladestock verschluckt.
»Mylady fühlte sich angegriffen«, äußerte Parker. »Den Umständen nach zu urteilen, schien es sich um eine Auseinandersetzung größeren Stils zu handeln. Vielleicht haben Sie die Güte, meiner Wenigkeit mitzuteilen, worum es sich handelte.«
Die beiden Brüder sahen sich an und schwiegen verbissen.
»Sie haben sich jedenfalls geprügelt«, sagte die ältere Dame, »und dabei sind ganz schön die Fetzen geflogen. Haben Sie gegen die anderen Kerle auch Anzeige wegen Körperverletzung erstattet? Die haben doch sehr kraftvoll auf Sie eingeschlagen.«
»Die Herren beliebten auch, diverse Schießeisen mit sich herumzutragen und damit zu drohen«, warf Parker ein. »Gehe ich fehl in der Annahme, daß es sich bei den revolverschwingenden Gentlemen vielleicht um das handelt, was man allgemein nicht als feine Herren zu bezeichnen pflegt?«
Tom Peacock kratzte an der Beule auf dem Schädel und dachte nach. Eine sehr große Leuchte schien er nicht zu sein.
»Können Sie das vielleicht etwas klarer ausdrücken, Mister... äh ...«
»Parker, Josuah Parker, in Diensten der Lady Agatha Simpson.« Er deutete eine höfliche Verbeugung in Richtung seiner Herrin an.
»Mister Parker meint, ob das Gangster waren«, sagte Agatha Simpson.
Wieder warfen sich die beiden einen schnellen Blick zu.
»Gangster?« dehnte Tom Peacock, »was haben wir denn mit Gangstern zu tun«, entrüstete er sich.
»Wir doch nicht, Lady«, sagte sein Bruder eifrig. »Tom und ich haben uns entschlossen, die Anzeige zurückzuziehen. Stimmt’s, Tom?«
Der ältere Peacock nickte erleichtert.
»Natürlich. Das war nur in der ersten Aufregung«, versicherte er. »Ich werde nachher gleich anrufen und das erledigen. Sind Sie nun zufrieden, Lady?«
»Einigermaßen. Da bliebe nur noch meine Frage zu beantworten.«
»Welche Frage, Lady?«
Agatha Simpson trommelte mit den Fingern der rechten Hand auf der Ladentheke. Es hörte sich sehr ungeduldig an.
»Meine Frage ist, ob Sie gegen die anderen ehrenwerten Herren ebenfalls Anzeige erstattet haben.«
»Nein, das nicht«, sagte Peacock verunsichert, weil die ältere Dame immer noch ungeduldig mit den Fingern trommelte.
»Aha! Und warum nicht?« hakte sie sofort nach.
»Wir ... wir haben es den Burschen ordentlich zurückgegeben, und damit sind wir quitt. Sonst wäre das mit den Anzeigen ständig hin und her gegangen.«
Wieder sahen sich die beiden Brüder verunsichert an.
Parker hegte ernstliche Zweifel an den Worten. Die beiden Peacocks erweckten den Eindruck, als hätten sie Angst. Besonders Tom Peacock sah sich immer wieder in der lauernden Haltung eines Verfolgten um.
»Sie sprachen vorhin von Sachbeschädigung«, schaltete sich der Butler wieder ein. »Meine Wenigkeit möchte dazu bemerken, daß der angerichtete Sachschaden wohl erheblich größeren Ausmaßes sein dürfte als jener, der sich lediglich auf ein paar Kartons Waschpulver sowie diverse Flaschen Knochenöl beschränkte.« Er zeigte auf die zertrümmerten Vorderseiten der Waschmaschinen, die vorerst absolut unbrauchbar waren.
»Richtig, Mister Parker«, sagte die Detektivin, »genau darauf wollte ich auch gerade zurückkommen. Haben Sie das etwa angezeigt, Mister Bierbock?«
»Peacock«, verbesserte der Wäschereibesitzer hilflos. »Nein, wir ... äh ... wollen das noch nachholen.«
»Sie belügen mich, junger Mann«, erwiderte die Lady streng. »Sie belügen eine Lady Simpson fortlaufend. Ich mag aber nicht angelogen werden, mein Lieber.«
Sie hielt ihren Fächer in der Hand und gab Tom Peacock einen spielerisch anmutenden Klaps auf die rechte Schulter.
Die Wirkung war erstaunlich und übertraf Peacocks Erwartungen erheblich.
Ächzend verzog er das Gesicht, dann schoß ihm das Wasser sturzbachähnlich in die Augen. Seine rechte Schulter war für einige Zeit taub und gelähmt.
Er empfand plötzlich riesigen Respekt vor der schlagkräftigen Dame. Sein feuchter Blick fiel auf den Fächer, den die Lady spielerisch zusammenklappte. Er wußte nicht, daß dieser so harmlos aussehende Fächer mit Stahlseiten durchsetzt war und recht herzhaft eingesetzt zu werden pflegte. Dabei erweckte die Lady den Eindruck, als wäre das mehr eine freundschaftliche Geste.
Verdammt, dachte er, sie trägt auch noch irgendwo einen Hammer mit sich herum, und wenn sie zehnmal das Gegenteil behauptete.
»Nun, junger Mann, ich höre«, sagte sie. Der Fächer wurde wieder auseinandergeklappt, doch Peacock brachte sich mit zwei schnellen Schritten vorsichtshalber außer Reichweite.
»Ich will ja alles sagen«, jammerte er, wobei er sich mit der linken Hand über die schmerzende Schulter strich.
»Habe ich nicht gesagt, Mister Parker, daß man psychologisches Einfühlungsvermögen braucht, um einen Erfolg zu erzielen?«
»Das haben Mylady in der Tat«, erwiderte Parker höflich. »Der Erfolg ist im wahrsten Sinn des Wortes überwältigend.«
»Nun reden Sie endlich, junger Mann!« herrschte die Detektivin Tom Peacock an. Mit ihrem Fächer wedelte sie lässig durch die Luft. »Was ist hier wirklich passiert?«
»Wir werden erpreßt«, gab Peacock widerwillig zu. »Wir sollen eine Art Schutzgebühr bezahlen, oder aber eine Versicherung abschließen, damit unserem Geschäft nichts passiert – oder uns«, fügte er etwas leiser hinzu. »Als wir nicht zahlten, haben uns diese Kerle einen Besuch abgestattet. Sie haben es gestern ja selbst erlebt.«
»In der Tat«, sagte Parker, »ein sehr aufschlußreicher Besuch. Darf man fragen, von wem Sie erpreßt werden?«
»Wir kennen die Kerle nicht. Wir haben nur gehört, daß man allgemein von der Ratten-Gang spricht. Sie tauchen auf, verlangen ihre Schutzgebühr und verschwinden wieder. Sie erscheinen alle vierzehn Tage, um zu kassieren.«
»Dem Besuch und seinen Folgen nach zu urteilen, sind Sie der Zahlungsaufforderung offenbar nicht nachgekommen?«
»So ist es, Mister Parker. Ich denke nicht im Traum daran, mein sauer verdientes Geld den Ratten zum Fraß vorzuwerfen. Wir haben lange genug zu kämpfen gehabt, bis die Wäscherei einigermaßen etwas abwarf. Mit uns kann man das nicht machen.«
Bevor Parker etwas erwidern konnte, sagte Agatha Simpson entschieden: »Den Fall übernehme ich, Mister Parker. Immerhin sind wir von diesen Kerlen mit dem Revolver bedroht worden. Ich werde die Ratten schon aus ihren. Löchern jagen. Oder sehe ich das anders, Mister Parker?«
»Mylady werden unter Hinzuziehung Mister McWardens mit Sicherheit wie immer die richtigen Entscheidungen treffen.«
»Es genügt völlig, wenn ich McWarden kurz unterrichte. Sie werden dann im Hintergrund unauffällig agieren, Mister Parker.«
»Wie Mylady wünschen.« Parker deutete eine Verbeugung an.
Agatha Simpson hatte nicht die geringste Ahnung, wo sie den Hebel ansetzen sollte, aber sie gab sich schon siegreich auf der ganzen Linie.
Parker stellte noch ein paar gezielte Fragen, brachte aber nicht viel in Erfahrung, was ihm weiterhalf. Die Gesichter der Gangster hatten auch nicht viel hergegeben, weil sie durch Knochenöl und Waschpulver völlig entstellt wirkten.
*
»Die Anzeige wegen Körperverletzung ist tatsächlich eingestellt worden«, sagte McWarden verwundert.
Er wurde von Agatha Simpson etwas mißtrauisch beobachtet, weil er sich auf die Minute genau zum Tee eingefunden hatte.
»Haben Sie etwas anderes erwartet?« fragte die Detektivin schnippisch. Ihr Blick war mißbilligend auf Parker gerichtet, der dem Yard-Mann eine Tasse Tee kredenzte. »Dieser Bierbock hat die Anzeige ganz von selbst zurückgenommen.«
»Und was steckt dahinter, Mylady?«
McWarden zwinkerte der älteren Dame leutselig zu, schlürfte behaglich den Tee und bediente sich großzügig des Gebäcks.
»Es ist total übersüßt«, stellte die Lady erst mal fest. »Sie sollten sich zurückhalten, McWarden. Ich kenne einige Leute, die davon zuckerkrank geworden sind. Sie werden sich später mit Insulinspritzen herumplagen müssen.«
»Mag sein, aber das werde ich in Kauf nehmen müssen. Was haben Sie denn nun in Erfahrung gebracht?«
»Mister Parker?«
»Mylady haben in Erfahrung gebracht, daß die Brüder Peacock durch eine Gang, die sich die Ratten nennt, erpreßt werden, woraus Mylady den Schluß zogen, daß hier eine Bande am Werk ist, die sich nicht allein auf diese Brüder beschränkt. Mylady vermuten ferner, daß die Ratten-Gang Erpressungen größeren Stils begeht, und daß sie ihren Forderungen tatkräftig Nachdruck verleiht.«
»Sie haben mir das Wort aus dem Mund genommen«, sagte Agatha Simpson zufrieden. »Zu genau diesen Schlußfolgerungen bin ich gekommen.«
»Die Ratten-Gang«, überlegte McWarden nachdenklich. »Sie treibt tatsächlich seit einiger Zeit ihr Unwesen, aber wir haben keinerlei Beweise gegen sie, weil sich die Betroffenen aus Angst vor schwerwiegenden Folgen nachhaltig ausschweigen.«
Scheinbar in Gedanken vertieft griff McWarden erneut nach dem herrlich duftenden Gebäck und hielt Parker auffordernd die Teetasse hin.
»Wie können Sie nur solche Unmengen in sich hineinstopfen«, tadelte die Lady. »Ich sehe es noch kommen, daß Sie wegen Fettleibigkeit vorzeitig Ihren Dienst im Yard quittieren müssen, McWarden. Dazu der viele Tee, das muß ja eine scheußliche Pampe geben.«
McWarden blieb von der Mahnung völlig unbeeindruckt. Er lächelte freundlich, weil es Lady Agatha wieder mal gegen den Strich ging, wenn ihr Gebäck so rapide abnahm. Sie bemühte sich zwar nach besten Kräften mitzuhalten, doch McWarden schien heute seinen unersättlichen Tag zu haben.
»Kennt man denn den Drahtzieher dieser Ratten-Gang?« erkundigte sie sich. Dabei schob sie die Teekanne unauffällig zur Seite.
»Nein, leider nicht. Die Ratten-Gang ist uns nur dem Namen nach bekannt. Vor zwei Wochen wollte ein Opfer dieser Bande bei der Polizei auspacken, verschwand aber spurlos und wurde seither nie wieder gesehen. Der Fall wurde bis heute nicht aufgeklärt, und alle Spuren verliefen im Sand.«
»Der Mann ist ermordet worden«, behauptete die Detektivin sofort. »Daran besteht nicht der geringste Zweifel. Oder sind Sie da anderer Ansicht, Mister Parker?«
»Mylady dürften mit dieser Vermutung durchaus recht haben.«
»Sehen Sie – da haben wir schon den ersten Mordfall«, wandte sie sich an McWarden. »Wie werde ich jetzt Vorgehen, Mister Parker?«
»Mylady werden die Wäscherei unauffällig observieren lassen, bis sich einer der Gangster zeigt.«
»Das hatte ich allerdings vor. Nur auf diesem Weg kommt man zum Ziel und damit zum Erfolg. Die Ratten werden sich schon bald in meiner Falle wiederfinden.«
»Es freut mich aufrichtig, daß ich dabei nichts zu tun habe«, sagte McWarden grimmig. »Bandenunwesen fällt ja auch absolut nicht in meinen Zuständigkeitsbereich. Lady Simpson übernimmt das, und der Yard hat keine Mühe mehr.«
»Mylady beabsichtigt natürlich, mit dem Yard aufs engste zusammenzuarbeiten«, sagte Parker schnell, damit es keinen Ärger gab. »Das geruhte Mylady mir schon vor Ihrer Ankunft mitzuteilen, Sir.«
»So, na ja«, McWarden gab sich wieder etwas versöhnlicher. »Dann bin ich ja beruhigt.«
»Wann habe ich das gesagt, Mister Parker?« fragte sie stirnrunzelnd.
»Mylady geruhten das meiner Wenigkeit vor etwa einer halben Stunde mitzuteilen.«
»Ja, natürlich«, rief sie aus. »Genau das waren meine Worte. Wir werden also Zusammenarbeiten, McWarden.«
»Wie tröstlich«, erwiderte der Yard-Mann seufzend. »Es gibt doch noch Liebe zwischen den Menschen.«
Lady Agatha überhörte den ironischen Unterton geflissentlich. Sie hatte mal wieder etwas, das sie aufklären konnte, und daher war sie höchst zufrieden. McWarden war jedoch sehr erstaunt und verwundert, weil die Hausherrin ihm die Schale mit Gebäck hinüberschob und ihm sogar noch eine Tasse Tee aufnötigte. Vor lauter Verblüffung hätte er fast daneben gegriffen.
»Darf ich feststellen«, sagte Parker, »daß es bisher nicht gelungen ist, auch nur einen einzigen Namen eines Mitglieds dieser Gang herauszufinden?«
»Keinen einzigen«, bestätigte McWarden. »Diese Bande scheint unsichtbar zu sein. Man weiß auch nicht, wie groß sie ist. Glauben Sie, Mister Parker, daß die Peacock-Brüder vor der Polizei aussagen würden?«
»Vor mir haben sie jedenfalls ausgesagt«, brüstete sich die Detektivin. »Man muß nur psychologisch Vorgehen, mein Lieber.«
»Ich bin verpflichtet, mich an eine gewisse konventionelle Arbeitsweise zu halten, Mylady. Ich kann nicht so vorgehen wie Sie, aber ich werde bei den Peacocks mal nachhaken.«
»Es dürfte schwer sein, Sir, von den beiden Gentlemen etwas zu erfahren«, sagte Parker. »Sie kennen keinen Namen, aber sie könnten eine Beschreibung liefern.«
»Sie haben die Gangster doch auch gesehen. Erinnern Sie sich nicht mehr an die Gesichter?«
»Der eine sah wie eine Ratte aus«, meinte Agatha Simpson, »aber wir konnten sie wirklich nicht erkennen. Sie waren durch Waschpulver und Öl völlig entstellt.«
»In der Tat«, bestätigte Parker, »auch meine Wenigkeit ist nicht in der Lage, eine detaillierte Beschreibung zu geben.«
»Das dachte ich mir«, brummte McWarden. »Diese Kerle sind nicht zu fassen. Wenn wir jemand, der erpreßt wird, darauf ansprechen, hüllt sich alles in Schweigen. Ich glaube, ich werde das gleich veranlassen«, murmelte er vor sich hin. »Darf ich mal Ihr Telefon benutzen, Mylady?«
»Was wollen Sie gleich veranlassen?« fragte die Detektivin mißtrauisch.
»Ich schicke einen Mann zu den Peacocks. Vielleicht hat er Erfolg. Einen Versuch ist es immerhin wert.«
»Dann telefonieren Sie«, erlaubte die Detektivin. »Sie kennen ja die kleine Sammelbüchse neben dem Apparat. Heutzutage ist ja alles sehr teuer.«
»Ja, die kenne ich zur Genüge«, seufzte McWarden, »ich fürchte nur, ich habe kein Kleingeld.«
»Eine Pfundnote tut’s auch. Dann haben Sie für später noch ein Telefonat gut.«
McWarden telefonierte nicht lange. Er sprach nur kurz in den Hörer und legte dann auf. Als er wieder zum Tisch zurückkehrte, stutzte er. Von Tee oder Gebäck fand sich nicht die geringste Spur. Lady Simpson hatte bereits alles in verdächtiger Eile durch ihren Butler abräumen lassen, damit McWarden nicht wieder in Versuchung geriet.
»Ein Mann vom Yard wird hier anrufen«, sagte McWarden, als er Platz genommen hatte. »Es wird nicht sehr lange dauern.«
Josuah Parker glaubte nicht daran, daß die Peacocks etwas aus sagen würden, dazu hatten sie viel zu viel Angst vor den Gangstern. Er enthielt sich jedoch der Stimme und äußerte nichts.
Nach einer halben Stunde bestätigte sich das, als das Telefon läutete.
McWarden hörte eine Weile zu, bis sein Gesicht immer länger und mißmutiger wurde. Ziemlich verärgert kehrte er an den Tisch zurück und glich jetzt noch mehr einer gereizten Bulldogge.
»Natürlich werden die Peacocks nicht erpreßt«, sagte er. »keine Spur, sie hätten mit Gangstern absolut nichts zu tun. Und die gestrige Auseinandersetzung war nichts anderes als ein kleiner Familienstreit. So etwas muß ich mir anhören. Der Mann vom Yard hat nichts herausgefunden, was uns weiterhelfen kann. Mich erstaunt wahrhaftig, daß die Brüder Ihnen gegenüber alles offen zugegeben haben.«
»Ich habe eben das erforderliche psychologische Einfühlungsvermögen«, behauptete Lady Agatha stolz. »Das ist der Unterschied zwischen mir und Ihnen, McWarden. Sie gehen mit der Brechstange vor und bedienen sich rüder und ruppiger Methoden. Auf diese Weise erfährt man nichts. Man muß sich in die Geschädigten hineindenken können! Ist es nicht so, Mister Parker?«
»Myladys Erfolg war in der Tat durchschlagend und verblüffend«, gab der Butler zu. Er hatte noch deutlich das Bild vor Augen, als Agatha Simpson Tom Peacock den freundschaftlich wirkenden Klaps mit dem Fächer gab.
»Sie hören wieder von mir«, sagte McWarden. Er war immer noch verärgert, versuchte es aber zu verbergen.
Dann verabschiedete er sich ziemlich eilig.
*
Harry Peacock, der kleine drahtige Mann mit den schütteren Haaren, bastelte in seiner knapp bemessenen Freizeit gern an seinem Boot. Es war sieben Yards lang, mit Fock- und Großmast geriggt und lag an einem Themse-Steg etwas außerhalb von London.
Noch weitere Boote lagen hier, teilweise vergammelt und verrottet, weil sich kein Mensch darum kümmerte.
Harry Peacock beschäftigte sich leidenschaftlich gern mit dem Segelboot und pflegte es liebevoll. Am nächsten Tag wollten er und sein Bruder Tom eine kleine Fahrt unternehmen.
Er war so hingebungsvoll mit dem Streichen beschäftigt, daß er die Schritte erst vernahm, als sie abrupt endeten.
»Hallo, Sportsfreund«, sagte eine kalte Stimme.
Peacock fuhr herum und sah zwei Männer auf dem Bootssteg. Er erschrak, als er den Rattengesichtigen und seinen Kumpan erkannte, mit denen sie so unangenehm zusammengestoßen waren.
»Feines Boot, nicht?« meinte der Rattengesichtige. »Hat doch sicher ’ne Stange Geld gekostet, eh?«
»Wir... wir haben es als halbes Wrack gekauft und selbst hergerichtet«, antwortete Peacock mit krächzender Stimme. Ihm entging nicht, daß der andere sich immer wieder verstohlen nach allen Seiten umsah.
Peacock empfand plötzlich eine entsetzliche Angst. Weit und breit war außer den beiden Gangstern kein Mensch zu sehen.
Die beiden grinsten sich an, aber kalt und gemein und nichts Gutes versprechend.
»Geld, um das Boot zu unterhalten, haben sie jedenfalls«, sagte der Kerl mit dem spitz zulaufenden Rattengesicht. »Aber Versicherungen schließen sie nicht ab. Da geizen sie an jedem lausigen Copper.«
»Ja, wirklich schade. Jetzt hat der gute Tom noch eine Beerdigung am Hals, was ja auch nicht gerade billig ist. Aber ich bin ganz sicher, daß er danach zahlen wird.«
»Glaube ich auch«, versicherte der andere im Brustton der Überzeugung, »er kann ja an den Kränzen schon ‚ne Menge Geld sparen. Brüderchen muß bei seiner letzten Reise ja nicht so teuer ausstaffiert werden.«
Auf Peacocks Stirn erschienen feine Schweißperlen. Die immer stärker aufkommende Angst ließ sein Herz schneller schlagen. Seine Zunge lag wie ein dicker Kloß in seinem Hals.
»Was soll das heißen?« fragte er heiser. Er kannte seine eigene Stimme nicht mehr.
»Wir pflegen mit Leuten, die nicht zahlen wollen, kurzen Prozeß zu machen«, erklärte der Hagere. »Anders läuft unser Geschäft nicht. Wenn es sich weiter herumspricht, daß ihr nicht zahlt, werden die anderen aufmüpfig und zahlen auch nicht. Wenn du aber tot bist, dann werden die anderen sehr gern zahlen, denn schließlich möchten sie dein Schicksal nicht unbedingt teilen.«
»Wir zahlen ja«, keuchte Harry, dem der Schweiß jetzt in dicken Tropfen auf der Stirn stand. »Ich werde mit meinem Bruder reden, und dann ist alles in Ordnung.«
»Zu spät, Kleiner. Wir lassen uns von euch keine Eselsmützen aufsetzen. Ihr habt Zeit genug gehabt, aber jetzt ist unsere Geduld zu Ende, wie du wohl begreifen wirst. Es wird allen anderen eine ernste Warnung sein.«
»Ihr könnt mich nicht umbringen«, schrie Harry wild. Er sah sich nach einer Fluchtmöglichkeit um, doch das Boot erwies sich als nicht geeignet. Er konnte nur in die kleine Kajüte hinunter, doch da unten saß er erst recht in der Falle.
Voller Entsetzen sah er, wie der Rattengesichtige unter di Jacke griff und wie seine Hand wieder auftauchte. Sie hielt eine schwere Waffe mit Schalldämpfer.
»Nicht schießen«, schrie Harry wild.
Der verdickte Lauf hob sich ein wenig. Die beiden Kerle waren nur drei Meter von ihm entfernt.
Harry Peacock war zwar kein Draufgänger, aber so einfach abknallen lassen wollte er sich auch nicht. Die Kerle würden ihn eiskalt umlegen, daran hegte er nicht den geringsten Zweifel.
Aus den Augenwinkeln bemerkte er den Hammer auf den Planken, mit dem er zwei von ihnen kalfatert hatte. Daneben lag noch das Kalfateisen und ein weiterer kleiner Hammer.
»Du wirst den Hammer nicht mehr erreichen«, warnte der Gangster, der Harrys Absicht durchschaute. »Aber du kannst uns noch eine Frage beantworten.«
In Harry keimte erneut die Hoffnung auf, daß er Zeit gewinnen konnte. Vielleicht ließen die beiden doch noch mit sich reden ...
»Fragen Sie«, keuchte er.
»Als wir euch ein bißchen überreden wollten, erschienen zwei Leute in der Wäscherei. Eine dicke Lady und ein Kerl, der ein wenig an einen Geistlichen erinnerte. Wer war das? Sie kamen uns ganz unvermittelt ins Gehege?«
»Ich kenne sie nicht«, log Harry.
»So, du kennst sie also nicht. Sie kamen aber noch mal wieder, das haben wir beobachtet. Sie haben weder etwas gebracht, noch etwas abgeholt. Also haben sie euch ausgefragt. Wenn du jetzt immer noch nicht weißt, wer das ist, wirst du bald keine Erinnerung mehr haben.«
Der Mann mit dem Revolver trat einen weiteren Schritt vor und zielte wieder auf Harry. Sein Gesicht war eine unverhüllte Drohung.
»Spuck’s aus«, sagte er scharf.
»Die Dicke war Lady Simpson, und der Mann ihr Angestellter. Josuah Parker nannte er sich.«
»Na, fein. Und sie haben euch ausgefragt?«
»Ja«, gab Harry kläglich zu.
Die beiden Gangster wechselten einen schnellen Blick. Das kalte Grinsen war aus ihren Gesichtern verschwunden. Zwei Augenpaare blickten Harry eisig an.
Der andere hielt jetzt ebenfalls einen Revolver in der Faust, während er sich wieder nach allen Seiten umsah.
»Und was habt ihr den beiden erzählt?«
Harry druckste noch eine Weile herum, aber angesichts der auf ihn gerichteten Waffen und der entschlossenen Mienen der beiden, rückte er mit der Wahrheit heraus und erzählte es ihnen.
Wieder warfen sich beide einen Blick zu.
»Verdammt«, sagte der Hagere. Dann nickte er dem anderen zu.
Als der Rattengesichtige die Waffe noch etwas hob, stürzte Harry sich mit heiserem Schrei auf den Hammer. Er hatte ihn auch fast erreicht, als er es zweimal hintereinander in der Faust des Gangsters aufblitzen sah.
Dann spürte er es wie zwei feine Nadelstiche im Körper. Er griff sich an die Brust, sah Blut an seinen Fingern und faßte haltsuchend an die niedere Reling, wo er sich verkrampfte.
Er glaubte noch einen weiteren Blitz zu bemerken, aber er verspürte keinen Einschlag.
Seine Hände lösten sich von der Reling. Er taumelte zwei Schritte nach vorn und fiel auf Deck.
»Damit dürfte der Boß zufrieden sein, John«, sagte der Hagere. »Aber wir können ihn hier nicht liegen lassen.«
»Natürlich nicht. Dann faß mit an. Später werden wir uns mal um diese dicke Lady und den Melonenkerl kümmern. Hoffentlich haben sie nichts herausgefunden.«
»Eigentlich sahen die ganz harmlos aus.«
»Trotzdem werden wir nachhaken. Mir gefällt das nicht, daß sich da ein paar Schnüffler auf unsere Spur setzen. Gerade solche Amateure finden manchmal mehr heraus als die Bullen.«
Ihre Pistolen hatten sie wieder eingesteckt. Niemand beobachtete sie bei ihrem Tun, als sie Harry von Bord schleiften. Ungesehen schleppten sie den Toten fast fünfzig Yard weiter zu einem brüchigen Steg, der nicht mehr benutzt wurde.
Dort banden sie Harry den Hammer ans Bein und warfen ihn ins Wasser.
So unauffällig, wie sie gekommen waren, verschwanden sie auch wieder.
*
»Spreche ich mit Lady Agatha Simpson?« erkundigte sich eine höfliche Stimme am Telefon.
Die ältere Dame war selbst am Apparat, denn Butler Parker bereitete einen kleinen Imbiß vor.
»Ja, das tun Sie. Und wer sind Sie?«
Die Höflichkeit aus der Stimme verschwand schlagartig.
»Dann hör’ jetzt zu, du dicke Fregatte:« Noch ehe Agatha Simpson sich vor Schreck verschlucken konnte, erschien Parker. Sie bedeutete ihm mit der Hand, den zweiten Hörer zu nehmen. Der Butler hob würdevoll ab und beugte sich etwas vor.
»Laß deine Finger aus diesem Spiel, Mädchen, sonst wirst du nicht mehr viel Spaß am Leben haben, klar!«
»Gar nichts ist klar«, empörte sich die ältere Dame. »Wer sind Sie Flegel, und was wollen Sie überhaupt?«
»Ich spreche von Peacock. Wenn ihr beide euch damit noch mal näher befaßt, dann gehen die Lichter aus, und ihr seid schneller tot, als ihr denken könnt. Merk’ dir das gut, Dickerchen.«
Noch bevor Agatha Simpson geharnischt antworten konnte, wurde der Hörer aufgelegt.
Die Detektivin holte erst mal tief Luft. Dann sah sie Parker aus blitzenden Augen an.
»Haben Sie das gehört, Mister Parker? Dieser ungehobelte Lümmel nannte mich dicke Fregatte und Dickerchen. Was habe ich dazu zu sagen, Mister Parker?«
»Es dürfte sich in der Tat um einen ausgeprägten und geschmacklosen Flegel handeln, Mylady.«
»Wie kommt dieses verkommene Subjekt dazu, mich zu beleidigen?«
Josuah Parker wußte bereits, wer hier am Werk war. Die ersten von der Ratten-Gang wurden bereits nervös.
»Man droht Mylady unverhüllt, was auch meine bescheidene Wenigkeit einschließt«, sagte Parker. »Die Aufforderung, sich nicht weiter mit den Brüdern Peacock zu befassen, war überdeutlich.«
»Richtig. Also war es einer von der Rattenbande«, kombinierte die Lady sofort. »Die Kerle kriegen offensichtlich Angst.«
»Mylady kombinieren vorzüglich. Auf der Gegenseite scheinen Ungeduld und Nervosität zu herrschen.«
»Nicht mehr lange«, versicherte die resolute Dame. »Dann nämlich wird Heulen und Zähneklappern herrschen. Wo werde ich jetzt den Hebel zuerst ansetzen, Mister Parker?«
Bevor Parker antworten konnte, ging erneut das Telefon.
»Nehmen Sie ab, Mister Parker, ich kann diese Beleidigungen nicht mitanhören, ohne aus der Haut zu fahren.«
»Sehr wohl, Mylady.«
Tom Peacock war am Apparat. Aufgeregt und hastig teilte er mit, daß sein Bruder Harry spurlos verschwunden wäre.
»Wissen Sie, wo er sich zuletzt aufgehalten hat?« fragte Parker.
Agatha Simpson nahm inzwischen den anderen Hörer und lauschte mit gerunzelter Stirn den Neuigkeiten.
»Wir wollten morgen eine Segeltour unternehmen, Mister Parker. Möglicherweise hat er noch mal nach dem Boot gesehen.«
Die Detektivin war ganz gespannte Aufmerksamkeit. Sie lauschte weiter, doch viel mehr erfuhr sie nicht. Peacock vermutete lediglich, daß seinem Bruder etwas zugestoßen sein könnte und spielte damit auf die vergangenen Ereignisse an.
»Wie, glauben Sie, werde ich jetzt vorgehen, Mister Parker?« fragte die resolute Dame erneut. Scheinbar zerstreut häufte sie sich von dem kleinen Imbiß den Teller voll.
»Da sich neue Perspektiven ergeben haben, vermutet meine Wenigkeit, daß Mylady zunächst dort nachforschen werden, wo sich das Boot des verschwundenen Mister Peacock befindet.«
»Sehr richtig«, sagte Lady Agatha zufrieden. »Genau das hatte ich vor. Mitunter ist es doch erstaunlich, daß Sie fast meine Gedanken erraten können. Ich werde mich dort Umsehen und gestatte Ihnen, daß Sie mich begleiten dürfen.«
»Zu gütig, Mylady.« Parker verneigte sich ein wenig.
»Die Drohung dieses ungehobelten Flegels werde ich natürlich total ignorieren, Mister Parker.«
Der Butler hatte nichts anderes erwartet. Lady Agatha scherte sich den Teufel um derartige Drohungen.
»Sehr wohl, Mylady.«
Der kleine Imbiß hatte sehr rasch sein Leben ausgehaucht. Die liebevoll zubereitete Platte zeigte nur noch ihre spiegelblanke Oberseite.
Etwas enttäuscht sah Lady Agatha darauf.
»Wir werden gleich gehen«, entschied sie dann spontan. »Noch sind die Spuren frisch. Werde ich eigentlich McWarden vorher noch anrufen und informieren?«
»Mylady werden vermutlich erst den vermeintlichen Tatort persönlich in Augenschein nehmen wollen.«
»Natürlich. Außerdem ist so ein Anruf nicht billig. McWarden kann es ja hinterher erfahren.«
Die ältere Dame hatte es jetzt auffallend eilig, zu dem Boot zu gelangen, wo sie mit der Spurensuche beginnen wollte. Sie hatte allerdings nicht die geringste Ahnung, wo das Boot lag, aber um solche Bagatellen hatte sich grundsätzlich ihr Butler zu kümmern.
»Mylady dachten sicher daran, Mister Peacock mitzunehmen«, sagte Parker dezent.
»Das hatte ich allerdings vor«, erwiderte sie, obwohl sie daran überhaupt nicht gedacht hatte. »Natürlich, er kennt das Boot ja vermutlich besser als ich.«
Zehn Minuten später saß Josuah Parker am Steuer seines hochbeinigen Monstrums und fuhr durch die City in Richtung Chelsea.
Peacock war unterwegs zugestiegen. Er sah recht unglücklich und eingeschüchtert aus und wandte sich alle Augenblicke um, als würde man sie verfolgen.
»Mit Harry muß etwas Schreckliches passiert sein«, jammerte er. »Das habe ich einfach im Gefühl.«
»Noch ist gar nichts bewiesen«, beruhigte ihn Lady Agatha. »Aber das werden wir bald herausfinden.«
Etwas später erreichten sie den Bootssteg. Kein Mensch war zu sehen. Einsam, verlassen und teilweise vergammelt lagen die Boote da.
»Dort drüben liegt unser schnittiger Kahn«, schluckte Tom. »Er heißt ›Whirlwind‹, aber von Harry ist nichts zu sehen.«
»Unter einem Wirbelwind habe ich mir eigentlich etwas anderes vorgestellt«, sagte Lady Agatha naserümpfend. »Das ist ja nicht mehr als ein halbes Wrack.«
»Es hat vorher noch viel schlimmer ausgesehen. Wir haben viel daran gearbeitet.«
Tom Peacock stürmte schon vor, trampelte auf dem Deck herum und brüllte laut nach seinem Bruder. Er erhielt jedoch keine Antwort. Dann raste er unter Deck und kehrte sofort wieder zurück.
»Er ist nicht da«, meinte er ratlos.
Parker sah sich zunächst um.
»Aber er war hier«, stellte er fest, »das beweisen der Farbtopf, der kleine Hammer und das Kalfateisen.«
»Eindeutige Beweise für sein Hiersein«, stellte die Detektivin fest. Sie sah sich gelegentlich um, entdeckte aber nichts Auffallendes.
Dafür entging Parkers scharfen Augen nichts. Er trat näher an die Reling heran und musterte sie, weil er an der grünen Farbe einen dunklen Fleck bemerkt hatte. Genau genommen waren es mehrere dunkle Flecken, zwar etwas verwischt, aber sie stammten eindeutig von Fingern, die sich in der Reling haltsuchend verkrampft hatten.
»Was starren Sie denn so, Mister Parker?« fragte die Detektivin ungeduldig. »Da steht ein Topf mit Farbe, mehr nicht.«
»Wenn Mylady geruhen, die Stelle näher in Augenschein zu nehmen, werden Mylady fraglos feststellen, daß es sich bei diesen dunklen Flecken um das handelt, was man gemeinhin als Lebenssaft bezeichnet«, sagte Parker.
Agatha Simpson nahm die dunkle Stelle ebenfalls in Augenschein. Dann nickte sie sehr bestimmt.
»Das ist mir natürlich nicht entgangen«, behauptete sie. »Es handelt sich zweifellos um Blutspuren, die etwas verwischt sind. Was werde ich daraus schließen, Mister Parker?«
»Mylady werden zu der Schlußfolgerung gelangen, daß Harry Peacock verletzt war und haltsuchend um sich griff.«
»Zu der Schlußfolgerung bin ich bereits gelangt«, erklärte sie trocken. »Man hat ihn angeschossen und dann über Bord geworfen. Oder sehe ich das anders?«
»Mylady dürften das durchaus richtig sehen. Die Möglichkeit besteht immerhin.«
Tom Peacock wurde blaß. Er stöhnte leise, wankte zur Reling und blickte ins Wasser.
»Ich habe es geahnt«, murmelte er. »Mein armer Bruder.«
Das Wasser war nicht sehr tief. Mit einiger Mühe konnte man bis auf den Grund sehen. Dort lagen jedoch nur ein verrosteter Eimer und ein paar Konservendosen.
Parker untersuchte das Wasser vom Bug bis zum Heck, wurde aber nicht fündig. Von einer Leiche war nichts zu sehen.
»Es ist nicht auszuschließen, daß man Ihren Bruder mitgenommen hat«, sagte Parker. »Über Bord ist er nicht gefallen.«
»Sie meinen – er lebt noch?«
»Das entzieht sich meiner Kenntnis, Mister Peacock.«
»Er liegt unter dem Schiff«, behauptete Lady Agatha. »Oder die Strömung hat ihn fortgetrieben.«
Die Möglichkeit, daß die Leiche sich unter dem Schiffsrumpf befand, konnte Parker nicht ausschließen. Aber eine Strömung gab es in diesem abgelegenen Nebenarm der Themse nicht. Es gab zwar Ebbe und Flut, doch keinerlei Strömungen.
»Ich werde nachsehen«, sagte Peacock hastig. »Wir haben eine Unterwasserlampe, um beim nächtlichen Angeln Fische anzulocken.«
Er ging unter Deck und holte die Lampe. Dann kletterte er in das seitlich angehängte kleine Beiboot.
Parker folgte ihm gemessen. Gemeinsam leuchteten sie dann den Grund unter dem Boot ab. Ein paar Steine lagen dort, weiter fand sich nichts.
Tom Peacock war sehr erleichtert. Sie stiegen wieder an Deck, wo Lady Agatha unruhig auf und ab ging.
»Sehr sonderbar«, meinte Peacock. »Er ist verletzt und spurlos verschwunden. Ob sie ihn entführt haben, um mich zu erpressen?«
Parker glaubte nicht an diese Möglichkeit. Die Gangster machten mit ihren zahlungsunwilligen Opfern kurzen Prozeß, wie die Vergangenheit bewiesen hatte. McWarden hatte erzählt, daß ein Opfer bei der Polizei aussagen wollte, dann aber spurlos verschwunden war. Die Gangster hatten sich auch nicht mehr gemeldet, um die Angehörigen zu erpressen. Folglich hatten sie den Mann umgebracht.
Parker enthielt sich jedoch der Stimme, um Peacock nicht weiter zu beunruhigen. Man hatte Harry mit Sicherheit von Bord gebracht, doch von da ab verlor sich seine Spur.
Lady Agatha stand vor einem Rätsel, und da sie nicht weiter wußte, wandte sie sich an ihren Butler.
»Wie werde ich den Fall weiter verfolgen, Mister Parker?«
»Mylady werden sich zunächst Gewißheit verschaffen, daß es sich tatsächlich um Blutspuren des Mister Peacock handelt, indem Mylady unter Hinzuziehung Mister McWardens eine Blutanalyse vornehmen lassen werden.«
»Sie können tatsächlich Gedanken lesen, Mister Parker«, sagte die Detektivin scheinbar erstaunt. »Das hatte ich wahrhaftig vor. Dann ist McWarden gleichzeitig unterrichtet und kann nicht behaupten, ich würde hier allein ermitteln.«
Sie war zufrieden und wandte sich dem Bootssteg zu.
»Gehen wir«, sagte sie.
Tom Peacock folgte niedergeschlagen. Die Ungewißheit über das Schicksal seines Bruders zermürbte ihn.
»Sie können mich gleich bei McWarden absetzen«, äußerte Agatha Simpson etwas später, als sie in Parkers hochbeinigem Monstrum zurückfuhren. »Warum soll ich nicht auch mal kostenlos bei ihm Tee trinken. Gleichzeitig werde ich ihn unterrichten. Setzen Sie Mister Peacock dann ab und erledigen Sie die Besorgungen, Mister Parker. Ich werde Sie von McWarden aus anrufen, wann Sie mich abholen können. Natürlich wird dieser Mensch keinen einzigen Shilling für das Telefonat erhalten.«
Sie schien sich schon diebisch darüber zu freuen, McWarden soviel Kosten wie möglich aufzubürden.
»Sehr wohl, Mylady.«
Parker setzte seine Brötchengeberin am gewünschten Ort ab. Etwas später hielt das hochbeinige Monstrum an der Passage, wo sich die Wäscherei befand.
Peacock bedankte sich. »Diese Ungewißheit bedrückt mich«, sagte er. »Es ist scheußlich, nicht zu wissen, was passiert ist.«
»Es gibt noch keinerlei konkrete Hinweise für den Tod Ihres Bruders«, sagte Parker. »Es besteht auch durchaus die Möglichkeit, daß es sich um Blutspuren eines anderen Mannes handelt, die bei einem Kampf entstanden sind.«
»Hoffen wir es«, murmelte Peacock.
Parker fuhr nach Shepherd’s Market, um die aufgetragenen Besorgungen für seine Herrin zu erledigen.
*
Eine knappe Stunde später befanden sich Agatha Simpson und der Superintendent am vermeintlichen Tatort.
»Ich werde eine Probe dieser Blutspuren mitnehmen und im Yard untersuchen lassen«, sagte McWarden.
Es war Samstag, und McWarden hatte dienstfrei.
»Ich habe die Blutspuren natürlich auf Anhieb entdeckt«, behauptete die passionierte Detektivin. »Außerdem habe ich alles so gelassen, wie es war, um keine Spuren zu verwischen.«
»Das war sehr überlegt gehandelt, Lady Agatha.« McWarden konnte sich schon denken, wer die Spuren entdeckt hatte.
Alle beide bemerkten nicht, daß sie von der Zufahrtsstraße aus einem Auto sehr aufmerksam beobachtet wurden. In dem Wagen saßen der Rattengesichtige und sein Kumpan John, der Hagere.
»Das geht ja hier zu wie in einem Tollhaus«, sagte John. »Erst die Dicke mit Peacock und dem Melonenkerl, jetzt die Dicke mit einem anderen Schnüffler. Ich fürchte, sie werden bald etwas herausfinden.«
»Das glaube ich nicht«, meinte der Rattengesichtige. »Brooks hat angeordnet, daß wir sie aus dem Verkehr ziehen, und das werden wir auch tun.«
»Schön und gut, aber er wollte die Dicke und den Kerl mit dem Regenschirm und der Melone.«
»Egal, die beiden sind genauso gut. Um den Melonenonkel werden wir uns später eingehend kümmern. Vorher werden wir ihn aber noch etwas nerven.«
»Brooks hat aber nicht gesagt, daß wir die Dicke umlegen sollen. Er will ja London schließlich nicht mit Leichen pflastern.«
»Weiß ich. Wir bringen sie zu den alten Docks, wo der Schiffsfriedhof ist. Da kommt kein Mensch hin, nicht mal die Penner. Wenn wir sie dort einsperren, haben wir sie ja auch nicht umgebracht.«
»Stimmt. Aber sie werden verhungern oder verdursten.«
»Dann hätten sie eben genügend Proviant mitnehmen sollen«, sagte der Hagere grinsend.
Der andere grinste auch, aber es war kalt und hinterhältig und versprach nichts Gutes.
Sie lehnten sich zurück und beobachteten weiter. Dazu benutzten sie ein Fernglas und konnten selbst nicht gesehen werden.
Unterdessen hatte McWarden eine Probe des angetrockneten Blutes genommen und sie in ein kleines Röhrchen getan.
»Das Ergebnis haben wir in einer Stunde«, sagte er, »beim Yard wird schließlich rund um die Uhr gearbeitet. Dann haben wir auch zumindest eine Gewißheit. Ich werde weiterhin zwei Kollegen von der daktyloskopischen Abteilung herbeibeordern, um eventuelle Fingerabdrücke zu sichern.«
»Und was werde ich dabei tun?« fragte Lady Agatha. »Dieser Fall ohne Spuren bereitet mir langsam Kopfzerbrechen.«
»Abwarten und Tee trinken«, meinte McWarden. »Sie heißen nicht umsonst die Ratten: Sie erscheinen schnell wie die Ratten und verschwinden auch so schnell wieder. Bis man sie richtig zu Gesicht bekommt, sind sie längst davongehuscht. Deshalb muß man ihnen mit großer Geduld auflauern und dann zuschlagen.«
»Geduld ist nicht meine Stärke. Ich will Erfolge sehen und mich nicht in Geduld üben. Oder bin ich etwa ein Chinese?«
McWarden sah die streitbare Dame völlig ernst an, wobei er in ihrem Gesicht forschte.
»Nein«, sagte er trocken. »Chinesen sehen ganz anders aus.«
Er registrierte mit innerer Schadenfreude, daß Lady Agatha seit langer Zeit völlig perplex war, als hätte sie die Sprache verloren.
»Es geht eben alles nicht so schnell«, redete McWarden weiter, als Lady Agatha ihn immer noch fassungslos ansah. »Ich bin jedoch sicher, daß wir schon sehr bald etwas herausfinden werden.«
Die Detektivin hatte ihre Sprache endlich wiedergefunden.
»Wenn ich nur einen dieser Lümmel zu fassen kriegte, dann wäre der Fall schon so gut wie gelöst«, meinte sie.
McWarden lächelte. Er kannte den Eifer der älteren Dame, ihr Ungestüm und ihre Ungeduld.
»Gehen wir«, sagte er. »Wir werden beim Yard vorbeifahren und die Probe zur Analyse abgeben. Vielleicht sind wir dann schon einen kleinen Schritt weiter.«
»Das bezweifle ich. Was haben wir denn gewonnen, wenn wir die Blutgruppe kennen?«
»Die Gewißheit, daß es sich um Harry Peacock handelt und nicht um einen anderen.«
Lady Agatha schien mit der Antwort jedoch nicht zufrieden zu sein. Sie wirkte verstimmt, als sie das Boot verließ und den Steg betrat.
Von da an ging alles sehr schnell.
Sie standen gerade auf den Bohlen, als wie aus dem Nichts zwei dunkel gekleidete Männer auftauchten. Sie hielten Schußwaffen in den Händen, die unmißverständlich und drohend auf Lady Agatha und McWarden gerichtet waren.
»Mitkommen!« befahl der eine hart. »Da drüben, zum Auto ... Wenn ihr Faxen macht, gehen die Bolzengeber los!«
Agatha Simpson verspürte jedoch nicht die geringste Lust, der unfreundlichen Einladung zu folgen. Scheinbar nervös und eingeschüchtert schwang sie ihren Pompadour – die Wunderwaffe.
Der eine wunderte sich auch sehr, als das perlenbestickte Ding durch die Luft flog und auf seinem Unterkiefer landete, der daraufhin ein wenig aus der Fassung geriet. Der Gangster fletschte vor Schmerz die Zähne, jedenfalls erweckte er ganz den Eindruck, als würde er einen wütenden Hund imitieren.
Der andere war reaktionsschneller. Ohne ein weiteres Wort zu sagen, feuerte er zweimal.
Lady Agatha hatte ihren Schutzengel dabei, sonst wäre sie zweifellos getroffen worden. Der eine Schuß ging ins Blaue, während die zweite Kugel ihren Pompadour erwischte. Das Hufeisen hielt dem Beschuß jedoch stand. Nur die Kugel pfiff plattgedrückt und jaulend davon.
Dafür trat ein anderer Effekt ein. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pompadour hart zurückgetrieben, wirbelte Lady Agatha um die Schulter und traf den Gangster, den es schon mal erwischt hatte.
Das im Pompadour versteckte Hufeisen von beachtlicher Brauereigaulgröße flog dem Mann vehement in die Magengegend. Der Treffer war so hart, daß es ihm die Tränen in die Augen trieb, die Luft aus den Lungen preßte und ihn bäuchlings über den Steg fegte. Nach zwei Yard war seine kinetische Bewegungsenergie verbraucht, und er blieb stöhnend und nach Luft ringend ein paar Sekunden liegen.
Sein Kumpan verfolgte die Rutschpartie fassungslos, behielt aber die Nerven und zielte erneut mit der Waffe auf die beiden.
»Noch so ein mieser Trick«, sagte er heiser, »dann seid ihr hier an Ort und Stelle geliefert.«
Vorsichtshalber trat er jedoch aus der Reichweite der älteren Dame, die grimmig dreinblickte.
»Nur die Ruhe«, meinte McWarden, der einsah, daß sie hier keine Chance hatten.
Der andere erhob sich wieder und grapschte nach seiner Waffe. Dabei erweckte er den Eindruck, als würde er jeden Augenblick schießen.
Lady Agatha war so außer sich, daß sie erneut ihren Pompadour auf Reisen schicken wollte. Aber ein warnender Blick McWardens hielt sie gerade noch davon ab.
»Einsteigen!« befahl der Hagere. »Und greift mal mit den Gichthaken zum Himmel!«
Kochend vor Wut stieg Agatha Simpson in das Auto, gefolgt von McWarden, der ebenso grimmig dreinblickte. Der Yard-Mann merkte sich sehr gut die Gesichter der beiden Gangster und prägte sie sich ein.
»Was habt ihr Lümmel von der Rattenbande mit uns vor?« verlangte die ältere Dame zu wissen.