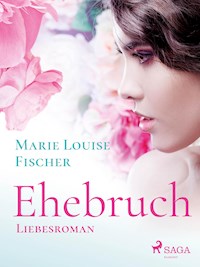
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ist die Ehe noch zu retten? Zum ersten Mal seit Jahren fährt Elis ohne ihren Mann in den Urlaub und stürzt sich Hals über Kopf in eine Affäre mit einer Reisebekanntschaft. Nach ihrer Rückkehr beichtet Elis Mann ihr, dass auch er eine Freundin hat, die er gerne heiraten möchte. Elis und ihr Mann beginnen die Punkte einer Scheidung zu erörtern, doch können die beiden wirklich voneinander lassen? -
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 643
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marie Louise Fischer
Ehebruch - Liebesroman
Saga
Ehebruch – LiebesromanCoverbild / Illustration: Shutterstock Copyright © 1980, 2020 Marie Louise Fischer und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726444834
1. Ebook-Auflage, 2020
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
»Mutti, weißt du zufällig . . .«, rief Romana Jacobs temperamentvoll, als sie die angelehnte Tür zum elterlichen Schlafzimmer aufstieß; mitten im Satz aber erstarb ihre Stimme fast zu einem Flüstern: ». . . wo meine rosafarbene Bluse hingekommen ist?«
Alle Schränke waren geöffnet, die Schubladen der Kommode herausgerissen, Hemden stapelten sich auf einem Hocker, und aufgeklappte Koffer standen auf den Betten.
»Die habe ich gestern abend gewaschen«, antwortete Elis Jacobs, ohne aufzusehen, und legte sehr sorgfältig einen Stoß Herrenunterwäsche in einen der Koffer, »braucht nur noch gebügelt zu werden.«
Obwohl schon Mitte dreißig, wirkte sie mädchenhaft, eine kleine, zierliche Frau mit zarten Fesseln und schmalen Handgelenken. Sie hatte dunkelbraune, mandelförmige Augen mit langen, sanft gebogenen Wimpern, eine leicht gebogene Nase und einen festen Mund.
»Heißt das, daß ich sie nicht anziehen kann?« fragte Romana, die, anders als es ihr Name versprach, ein blondes, blauäugiges, zur Zeit ein wenig plumpes Mädchen war. Man hatte sie so getauft, weil sie krausköpfig und schwarzhaarig auf die Welt gekommen war und man erwartet hatte, daß sie sich, gleich ihrer Mutter, zu dem ausgeprägt romanischen Typ entwickeln würde, wie man ihn heute noch häufig im Land an der Mosel findet.
»Erst, wenn du sie gebügelt hast.«
»Ach, Mutti, mach du das doch. Du weißt, ich kann nicht bügeln!«
»Du solltest es endlich lernen. Außerdem habe ich, wie du siehst, alle Hände voll zu tun.«
Romana lehnte sich gegen den Türstock. »Ja, das wollte ich dich schon fragen . . . was soll das eigentlich?«
»Ich packe, wie du siehst.«
»Aber es soll doch erst Donnerstag losgehen, und heute ist . . .«
»Sonntag«, fiel ihr die Mutter ins Wort; »danke, das weiß ich selber. Heute habe ich Zeit und Lust zum Packen, also tu ich es. Dir kann ich es übrigens auch nur raten.«
»Ich bin doch nicht verrückt.«
Elis überhörte diese ungezogene Bemerkung und blickte ihre Tochter an. »Eigentlich gut, daß du da bist. Lauf doch mal zu Vati und frag ihn, ob er den dicken weißen Pullover nicht auf den Rücksitz legen kann. Mitnehmen muß er ihn unbedingt, aber im Koffer nimmt er zuviel Platz weg.«
»Was soll ich nun«, maulte Romana, »meine Bluse bügeln oder Vati fragen?«
»Erst Vati fragen und dann bügeln.« Elis lächelte dem jungen Mädchen versöhnlich zu. »Komm, sei nicht so, Romy! Wenn du die Bluse nicht unbedingt jetzt gleich brauchst . . . später bügele ich sie dir schon.«
Romanas Miene erhellte sich; sie gab ihrer Mutter einen flüchtigen Kuß. »Manchmal entwickelst du geradezu menschliche Züge!« Mit diesen Worten eilte sie aus dem Zimmer.
Elis nahm sich nicht die Zeit, ihr nachzusehen.
Wenig später schlenderte Peter, der jüngere Sohn, herein. »Du packst schon?«
Elis lächelte ihn an. »Meine Kinder scheinen heute ihren besonders hellen Tag zu haben.«
Der Junge glich ihr sehr, nur daß sein braunes Haar nicht glatt war wie das ihre, sondern leicht gelockt.
Jetzt errötete er leicht. »Ich gebe zu, es war keine sehr geistreiche Bemerkung.«
»Nimm’s nicht tragisch. Wenn wir immerzu geistreich sein wollten, käme überhaupt keine Unterhaltung zustande.«
»Da hast du auch wieder recht.« Peter lachte erleichtert; dann wurde er ernst. »Hallo, Vati.«
Dr. med. Hanns-Heinz Jacobs war auf der Schwelle erschienen, eine kräftige, breitschultrige Erscheinung, hochgewachsen, die den Türrahmen fast ausfüllte.
»Nanu?« sagte Elis. »Das Schlafzimmer scheint ja heute nachmittag eine magische Anziehungskraft auszuüben!«
»Ich muß mit dir sprechen, Elis.« Er war erst Anfang vierzig; doch sein blondes Haar war schon von silbernen Fäden durchzogen, was seinem Äußeren eine besondere Note gab.
»Jetzt gleich?«
»Ja, jetzt.« Hanns-Heinz trat auf Elis zu. »Verschwinde, Peter.«
»Ich wollte sowieso zu Othmar . . . ich darf doch, ja?« Peter nahm die Gelegenheit wahr, sich rasch zu verziehen.
»Was ist denn, Hanns-Heinz?« fragte Elis überrascht und sah zu ihm auf. »Ärgert dich die Sache mit dem Pullover? Hast du Angst, daß er schmutzig wird? Ich könnte ihn ja auch . . .«
»Nein, Elis, laß den blöden Pullover aus dem Spiel.« Er sah sich suchend um, entdeckte einen freien Platz auf dem mit Kleidungsstücken bedeckten Bett und setzte sich. »Wir sollten noch einmal in Ruhe über alles sprechen.«
»Ich wüßte nicht, was es da noch zu reden gäbe.«
Er nahm ihre Hand und zog sie zu sich. »Du weißt, ich halte gar nichts von dieser Reise!«
»Ja. Das hast du mir oft genug gesagt. Es paßt dir nicht, daß ich allein verreise. Zum erstenmal in unserer Ehe. Aber du brauchst ja nur mitzukommen.«
»Ich bin seit langem für die Segelregatta gemeldet . . .«
»Und mein Hotel in Montegrotto ist seit langem gebucht!«
»Mußt du denn unbedingt dahin?«
»Du selber hast mir Thermalbäder verschrieben.«
»Die könntest du auch in Köln haben.«
»Jeden Tag hin- und herfahren? Das wäre eine schöne Erholung!« Sie versuchte, sich aus seinem Griff zu befreien. »Das alles haben wir schon mindestens hundertmal durchgesprochen. Müssen wir denn unbedingt die alte Leier immer und immer wiederholen?« Er hielt sie unerbittlich fest. »Bis du zur Einsicht kommst.«
Ihr Handgelenk schmerzte, wenn sie zerrte, und sie gab es auf. »Bis ich mich deinem Willen füge, meinst du. Denn einzusehen ist es nicht, warum ich zu Hause bleiben soll, wenn du in die Schweiz fährst, Peter nach England reist und Romana vorhat, die Osterferien bei ihrer Freundin zu verbringen. Nein, Hanns-Heinz, gib es auf. Diesmal kannst du mich nicht umstimmen.«
»Der junge Kirst ist unerfahren . . . er vertritt mich zum erstenmal . . .«
»Du wirst ihn schon einarbeiten. Hanns-Heinz, bitte, das hat doch keinen Zweck. Komm mir jetzt nicht damit, daß Peter acht Tage vor uns zurück sein wird. Frau Stöber hat mir versprochen, sich um ihn zu kümmern. Sie wird ausnahmsweise auch Samstag und Sonntag kommen. Du weißt, wie zuverlässig sie ist . . . abgesehen davon, daß Peter sich auch mal allein versorgen könnte. Also Schluß der Debatte. Gib auf. Mich kriegst du nicht herum.«
Er ließ sie los, erhob sich jäh und begann, vor ihr auf und ab zu laufen.
»Verstehst du denn nicht, daß ich es hasse, dich ganz allein in einem internationalen Hotel zu wissen?!«
Ihre dunklen Augen wurden noch ein wenig größer. »Nein«, erwiderte sie ruhig, »das verstehe ich nicht. Das ›Esplanade‹ ist ein braves Kurhotel, und ich bin nicht allein. Helma wird doch bei mir sein.«
»Helma!« — Aus seinem Mund klang der Name wie ein Schimpfwort.
Jetzt war Elis wirklich erstaunt. »Ich dachte, du magst sie?«
»Ich habe sie geduldet . . . weil sie deine Freundin ist.«
»Ach, du Armer.« Elis lächelte. »Das muß wirklich ein gewaltiges Opfer für dich gewesen sein, mich alle paar Monate zu meiner Freundin zu lassen. Die du noch dazu überhaupt nicht magst. Dabei, wenn ich mich recht erinnere, hast du früher ganz schön mit ihr geflirtet.«
Er verzichtete darauf, es zu leugnen. »Sie hat mich animiert!«
»Die böse, böse Helma!«
»Ja, sie ist eine schlechte Person!« Er packte Elis bei den Schultern und schüttelte sie. »Eine Junggesellin . . . in ihrem Alter! Single nennt man das ja wohl heute. Ich möchte wetten, die schläft mit jedem.«
»Nein, das tut sie nicht.« Elis leistete keinen Widerstand, sondern verhielt sich passiv wie eine Puppe. »Helma ist meine beste Freundin«, erklärte sie mit Würde — obwohl ihre Lage alles andere als würdevoll war, »und ich werde nie etwas auf sie kommen lassen.«
»Sie hat schon immer einen schlechten Einfluß auf dich ausgeübt.«
Elis befreite sich aus seinem Griff, strich ihre Hemdbluse glatt und vergewisserte sich, daß sie noch im Rockbund steckte. »Das ist doch alles Unsinn, Hanns-Heinz«, sagte sie begütigend, »du steigerst dich da in etwas hinein . . . ich verstehe dich gar nicht. Nur wegen dieser drei Wochen, die wir getrennt verbringen werden.« Sie sah in sein Gesicht und sagte rasch: »Ich habe eine Idee! Ich lasse Montegrotto sausen . . . so wichtig sind die Bäder für mich ja nun auch wieder nicht . . .«
»Und bleibst zu Hause?« Er strahlte auf wie ein Junge.
»Wo denkst du hin! Ich werde dich nach Thun begleiten.«
Die Freude auf seinem Gesicht erlosch. »Aber du machst dir doch gar nichts aus dem Segeln!«
»Ich habe ja auch nicht gesagt, daß ich segeln will. Ich werde spazierengehen, warten, bis mein hoher Herr abends ins Hotel zurückkommt.«
»Ich weiß nicht.« Er ließ sich schwer auf das Bett fallen.
Sie setzte sich neben ihn. »Wäre das nicht schön? Wir beide endlich wieder allein? Ohne Kinder.«
»Ja, schön wäre es schon.« Er zog sie an seine Brust. »Sehr verlokkend. Aber . . .« Er sprach nicht weiter.
Sie kuschelte sich an ihn. »Was . . . aber?«
»Es wäre eine zu große Belastung für mich.«
»Eine Belastung?« Sie richtete sich so heftig auf, daß sie mit dem Kopf gegen sein Kinn stieß. Er gab einen Schmerzenslaut von sich.
Sie ging nicht darauf ein. »Wann hätte ich dich je belastet!?«
»Nicht du, Elis! Natürlich habe ich das nicht persönlich gemeint. Aber allein die Vorstellung, daß du dich langweilen könntest . . .«
»Du kennst mich doch! Ich langweile mich nie.«
»Hier zu Hause hast du ja immer genug zu tun. Aber in Thun würdest du dich langweilen. Dort ist wirklich nichts, aber auch gar nichts los. Und dann: ich kann dir nicht einmal versprechen, daß wir die Abende zusammen sein werden.«
»Wieso?« fragte sie ungläubig.
»Ich weiß, wie es bei solchen Regatten zugeht. Auch abends bleiben die Segler lieber unter sich. Es wird unentwegt gefachsimpelt . . .«
»Du willst behaupten, daß keiner der Segler . . . wahrscheinlich werden auch Seglerinnen dabeisein, wie? . . . daß also keiner von all diesen weiblichen und männlichen Sportfreunden mit Frau, Ehemann, Freund oder Freundin anreisen wird?«
»Das nicht. Unbelehrbare gibt es immer und überall. Ich sage nur, daß man einem Nicht-Segler nichts Gutes antut, wenn man ihn zu einer Regatta mitschleppt.«
Seine Ablehnung verletzte sie; dennoch brachte sie ein Lächeln zustande. »Immerhin bleiben uns die Nächte!«
»Elisabeth!« Immer wenn er sie mit ihrem ganzen Namen anredete, war das ein Zeichen von Entrüstung; sie selber hatte sich als Kind Elis genannt, und dabei war es bis heute bei allen, die ihr nahestanden, geblieben.
»Habe ich was Schlimmes gesagt?« fragte sie kokett. »Unter alten Eheleuten, wie wir zwei es sind, sollte man doch offen . . .«
»Ja, ja«, sagte er ungeduldig, »aber du weißt, daß ich Diskretion sehr viel mehr schätze als Offenheit . . . gerade weil ich als Arzt so sehr mit der Körperlichkeit der Menschen konfrontiert werde. Tatsache ist . . . da du das Thema nun mal angeschnitten hast . . . daß ein Mann nach einem Tag auf dem Wasser fix und fertig ist. Gerade das würde ich als Belastung bezeichnen . . .«
»Die Situation ist geradezu lächerlich!« unterbrach sie ihn. »Rekapitulieren wir doch mal: du wolltest die Osterferien zur Teilnahme an einer Segelregatta ausnutzen. Da die Kinder auch aus dem Haus sein werden, entschloß ich mich zu einer Kur in Montegrotto. In heißen Auseinandersetzungen habe ich dich zu überzeugen versucht, daß dies eine sehr gute Lösung ist. Ich bin schon beim Packen, da kommst du und machst wieder Einwände. Ich schlage dir vor, mich nach Montegrotto zu begleiten. Das lehnst du ab. Ich erbiete mich, Montegrotto sausenzulassen und mit dir zu kommen. Das willst du auch nicht. Wenn das nicht lächerlich ist, dann weiß ich nicht mehr, was ich denken soll. Mein lieber Hanns-Heinz, ich habe in all den vergangenen Jahren Rücksicht auf deine Wünsche genommen, auch wenn sie hin und wieder nicht berechtigt waren. Aber daß du jetzt verlangst, ich soll allein hier zu Hause sitzen, während ihr alle ausfliegt . . . das geht entschieden zu weit.«
»Wenn du unbedingt deinen Dickkopf durchsetzen willst . . .« Er stand auf; seine Miene war düster.
Sie lief zu ihm hin. »Verstehst du denn nicht, daß ich eine Erholung dringend notwendig habe?«
»Doch, schon, Kleines.« Er strich ihr gedankenabwesend über das Haar. »Aber mir passen die Umstände nicht.«
»Ich würde ja auch viel lieber mit dir zusammen sein!« Ihr stiegen Tränen in die Augen.
»Nun ja, diesmal ist’s nicht möglich«, sagte er rasch; »beißen wir also in den sauren Apfel.«
Sie reckte sich auf die Zehenspitzen, um ihn zu küssen. »Vielleicht wird eine kurze Trennung unserer Ehe ganz gut tun.«
Der große Aufbruch der Familie Jacobs fand in aller Frühe statt. Selbst Romana, die die Osterferien am Ort, nur wenige Straßen entfernt bei ihrer Freundin Claudine, verbringen wollte, war schon vor sieben Uhr auf den Beinen. Während Elis an gewöhnlichen Tagen ihre Familie morgens antreiben und zur Eile mahnen mußte, konnte es ihnen heute allen nicht schnell genug gehen. Peter trabte endlich, sehr vergnügt in seiner Pfadfinderkluft, den breitrandigen Hut keck aufgestülpt, die steile Gasse hinunter. Romana folgte ihm, nach flüchtigem Abschied, nur wenige Minuten später.
Elis und Hanns-Heinz saßen sich am Eßtisch gegenüber. Sie war noch im Nachthemd, über dem sie einen aprikosenfarbenen seidenen Morgenmantel trug, der bis zum Boden reichte. Aber es war kein gemütliches Frühstück. Hanns-Heinz langte kräftig zu und stürzte den Kaffee viel zu heiß hinunter. Dabei sah er alle Augenblicke auf seine Armbanduhr. Er war schon reisefertig und sah gut aus in seinem blauen, am Hals offenen Hemd, der hellen Wildlederjacke und den weißen Jeans, die er allerdings kaum zubekommen hatte.
»Warum bist du nur so nervös?« fragte sie. »Bei der weiten Strecke, die du vor dir hast, kommt es doch auf ein paar Minuten früher oder später bestimmt nicht an.«
Er sprang auf. »Das sagst du so! Aber ein guter Start entscheidet manchmal über den ganzen Tag.«
»Ich will dich gewiß nicht aufhalten.«
Er bückte sich nach der Serviette, die ihm vom Schoß gefallen war, und warf sie auf den Teller. »Und du? Hast du es dir nicht doch anders überlegt? Es wäre ein gutes Gefühl für mich . . .«
Rasch stand sie auf und legte ihm die Hand auf den Mund. »Bitte nicht, Hanns-Heinz! Wir wollen uns doch den Abschied nicht verderben.«
Er nahm ihre Hand und küßte die Spitze jedes einzelnen Fingers. »Du wirst mir sehr fehlen, Liebes!« Der Blick seiner Augen, deren Blau unter den weißblonden Brauen sehr intensiv wirkte, war beschwörend.
»Du mir auch!« Sie stellte sich auf die Zehenspitzen, um ihn zu küssen.
Er nahm sie in die Arme, leidenschaftlich und besitzergreifend; sein Kuß hatte etwas Gewalttätiges. »Vergiß mich nicht«, sagte er, als er sie freigab.
Überrascht und atemlos sagte sie: »Hoppla, das bin ich ja gar nicht mehr von dir gewohnt.«
»Ich glaube, ich habe gar keine Lust mehr wegzufahren!« behauptete er; doch hastig, als fürchtete er, sie könnte zustimmen, fügte er hinzu: »Aber das ist natürlich alles Unsinn! Wir sind keine Kinder; ich muß jetzt los!«
Während er die Treppe zur Garage hinunterlief, öffnete sie die Haustür und trat hinaus, um ihn abfahren zu sehen und ihm noch einmal zuzuwinken. Über der Mosel lag noch ein leichter Dunst, aber es versprach ein schöner Tag zu werden. Einmal mehr freute sie sich, daß sie ihr Haus hier oben hingebaut hatten, an einen Südhang, der vor noch nicht allzu langer Zeit ein reines Weinbaugebiet gewesen war. Inzwischen war es ein Villenvorort geworden, und nur noch einzelne Flecken mit Rebenpflanzen zwängten sich zwischen die gepflegten Gärten. Ihr Vater hatte sie gewarnt: Die Patienten würden nicht daran denken, den steilen Aufstieg in Kauf zu nehmen. Aber er hatte nicht recht gehabt. Das helle, freundliche Wartezimmer schien nie leer zu werden.
Die Garagentür hatte sich geöffnet, und der Wagen rollte heraus. Hanns-Heinz Jacobs war ein methodischer Mann, der immer rückwärts einfuhr, um vorwärts starten zu können. Jetzt stieg er noch einmal aus, um das Tor zu schließen.
Elis beobachtete ihn und dachte, daß er allmählich darauf achten mußte, nicht zu dick zu werden; seine Bewegungen begannen, schwerfällig zu werden.
Er wußte, daß sie in der Haustür stand, und bevor er sich hinter das Steuer setzte, grüßte er zu ihr hinauf.
»Viel Spaß!« rief sie und »Gute Fahrt!«
Aber er hatte es wohl schon nicht mehr gehört, denn die Autotür war hinter ihm ins Schloß gefallen.
Im Gegensatz zu ihrer Familie hatte Elis mit Bedacht einen überhasteten Aufbruch vermeiden wollen. Jetzt ging sie langsam ins Haus zurück, bekämpfte erfolgreich den Zwang, das Geschirr zusammenzustellen und in die Küche zu bringen. Das konnte Frau Stöber später tun. Sie entschloß sich, noch eine Tasse Kaffee zu trinken. Die Zimmer waren erfüllt von einer ganz ungewohnten, aber sehr wohltuenden Ruhe. Elis hätte gern langsam und genußvoll die Zeitung gelesen. Aber heute war keine gekommen; es war Feiertag.
Obwohl sie keine Raucherin war, hatte sie jetzt Lust auf eine Zigarette. Sie hatte das Gefühl, in dieser schwebenden Stille etwas Besonderes tun zu müssen. Im Wohnzimmer nebenan mußten in dem Kästchen aus geschliffenem Achat noch Zigaretten sein. Sie ging hinüber, fand tatsächlich noch drei, nahm eine heraus und zündete sie sich mit dem silbernen Tischfeuerzeug an. Natürlich mußte sie husten, und natürlich schmeckte es ihr gar nicht; zu allem Überfluß war die Zigarette auch noch trocken geworden. Aber mit geradezu kämpferischer Entschlossenheit rauchte sie weiter. Als sie einen Schluck Kaffee genommen hatte, ging es schon ein bißchen besser.
Kaffeetasse und Untertasse in der rechten Hand, in der linken die Zigarette, schlenderte sie durch die Wohnung. Alles, was sie sah, gefiel ihr: das geräumige, aber überaus gemütliche Wohnzimmer, das Sofa mit den vielen farblich aufeinander abgestimmten Kissen zwischen hellem Beige und dunklem Braun, die goldgelben Vorhänge, der alte englische Mahagonischrank, der offene Kamin mit dem eingeschichteten Feuerholz.
Auf einmal wußte sie nicht mehr, warum ihr so viel daran gelegen hatte, mit ihrer Freundin Helma zu verreisen. Kein Hotelzimmer konnte auch nur annähernd so schön sein wie ihr Zuhause. Hier hätte sie sich jetzt einmal wirklich erholen können, die Bücher lesen, zu denen sie sonst nie Zeit hatte, den Fernseher einschalten, auch wenn der Film, der sie interessierte, erst elf Uhr nachts begann, Schönheitspflege betreiben, kurzum alles tun, wozu sie sonst keine Gelegenheit hatte.
Das alles erschien ihr sehr verlockend. Ihr kam der Verdacht, daß sie auf der Reise nach Montegrotto nur deswegen bestanden hatte, weil Hanns-Heinz so dagegen gewesen war.
Aber sie verscheuchte diesen Anflug von Selbsterkenntnis. So kindisch konnte sie unmöglich sein. Sie nahm den letzten Schluck Kaffee und drückte den Zigarettenstummel auf der Untertasse aus. Tausend gute Gründe sprachen dafür, ins Thermalbad zu fahren.
Fast auf den Glockenschlag neun Uhr klingelte es an der Haustür. Elis war inzwischen reisefertig und gerade dabei, Frau Stöber die letzten Anweisungen zu geben, von denen sie selber wußte, daß sie unnötig waren; die Zugehfrau arbeitete seit Jahren bei ihnen und wußte genau, was sie zu tun hatte. »Das muß meine Freundin sein!« rief Elis jetzt und reichte Frau Stöber die Hand. »Machen Sie’s gut und denken Sie daran: heute ist Feiertag! Räumen Sie nur das Gröbste auf, alles andere hat Zeit.«
Frau Stöber, klein wie Elis, im Gegensatz zu ihr aber überaus rundlich gepolstert, lächelte gutmütig. »Ich werd’ mich schon nicht übernehmen, Frau Doktor! Sie kennen mich doch!« Sie schüttelte ihrer Arbeitgeberin kräftig die Hand. »Eine gute Erholung wünsche ich Ihnen . . . und viel Vergnügen!«
»Danke, Frau Stöber. Das Vergnügen wird sich wohl in Grenzen halten.« Elis bückte sich, um ihre Reisetasche und ihren Koffer aufzuheben.
Frau Stöber kam ihr zuvor und wuchtete den Koffer hoch. »Der ist zu schwer für Sie, Frau Doktor!«
»Ich glaube, ich habe viel zuviel eingepackt . . . aber man kann ja nie wissen.«
»Ganz recht so . . . was man hat, das hat man!«
Elis war zur Haustür gelaufen und riß sie auf. Helma Herberger war noch dabei, ihren grasgrünen Flitzer zu wenden. Einige Augenblicke später schaltete sie den Motor ab und stieg aus. »Ich komme!« rief Elis.
Helma lächelte zu ihr auf. »Elegant wie immer!«
»Findest du?« Elis sah an sich herunter; sie trug eine der seidenen Manschettenblusen, von denen sie eine Unzahl besaß, einen Tweedrock, Perlonstrümpfe und handgenähte Schuhe; über dem Arm hatte sie einen hellen Nerzmantel und einen Regenmantel. »Ich habe mich nicht einmal geschminkt.«
Die Freundin hatte sich mit Tennisschuhen, Jeans und einem saloppen Pullover bequemer und — wie Elis insgeheim fand — zu jugendlich angezogen. Helma war eine große, etwas grobknochige Frau mit gebräunter, von allzu langen und allzu häufigen Bestrahlungen mit recht vielen Fältchen durchzogener Haut.
Elis kam die Treppe hinunter, und die beiden Frauen gaben sich die Hand. »Die neue Farbe steht dir gut«, sagte Elis anerkennend, »viel besser als das Schwarz. Das war zu kraß.«
Unwillkürlich strich sich Helma über das sehr gepflegte, kunstvoll verwilderte Haar, das sie häufig umfärbte; zuletzt hatte sie sich für Kastanienbraun entschieden.
»Kann ich dir etwas anbieten? Einen Kaffee vielleicht? Oder sollen wir gleich los?«
»Je eher, desto besser.« Helma ging um das Auto herum und öffnete den Kofferraum.
»Das ist Frau Stöber, du weißt schon«, machte Elis bekannt; »und das ist meine Freundin Helma Herberger, Rechtsanwältin in Köln.«
Da Helma mit Elis an gewöhnlichen Wochentagen nicht zusammenkam, war sie der Zugehfrau noch nicht begegnet. Sie nickte ihr zu, zündete sich eine Zigarette an und zeigte ihr, wo Platz im Gepäckraum war.
Frau Stöber wuchtete den Koffer hoch, wobei sie vor Anstrengung rot im Gesicht wurde.
Elis bettete ihre Mäntel sorgfältig auf dem Rücksitz und legte ihre Handtasche dazu.
Frau Stöber wartete, bis Elis sich wieder aufgerichtet hatte. »Also, gute Fahrt, Frau Doktor«, sagte sie dann.
»Ich schreib Ihnen eine Ansichtskarte!« versprach Elis, und bevor sie einstieg, mahnte sie noch: »Lassen Sie sich von Peter nichts gefallen!«
»Keine Sorge!« Frau Stöber stieg die Treppe hoch und verschwand im Haus.
Elis kurbelte das Fenster nieder und steckte den Kopf hinaus. »Kommst du, Helma?«
»Ich rauche nur noch meine Zigarette aus. Im Auto qualme ich nicht gern.«
»Sehr vernünftig«, sagte Elis; dabei konnte sie es kaum noch erwarten, daß die Reise endlich losging.
Sie kamen nur langsam voran, weil der Feiertagsverkehr sehr stark war. Die Straße schlängelte sich durch die zum Strom drängenden Berge, auf denen die Reben eben zu grünen begonnen hatten und von denen da und dort romantische Ruinen dunkel in den sanften blauen Frühlingshimmel ragten.
Aber die beiden Frauen hatten kein Auge für die Schönheit dieser Landschaft. Es drängte sie, rasch voranzukommen, und so berühmte und idyllische Weinstädte wie Boppard, St. Goar oder Bacharach, die sie durchfahren mußten, waren ihnen nur Hindernisse.
»Wir hätten doch lieber schon bei Metternich auf die Autobahn gehen sollen«, sagte Elis.
»Das ist mir inzwischen auch klargeworden«, sagte Helma friedfertig, »aber jetzt läßt es sich nicht mehr ändern.«
Sie quälten sich weiter durch den starken Ausflugsverkehr, bis sie hinter Bingen endlich auf die Autobahn Richtung Mannheim konnten. Von da an hatte Helma es leichter.
»Erzähl mir was!« bat sie.
Elis gab einen ziemlich humorvollen Bericht von dem Unmut ihres Mannes über ihre Reise und von seinen vergeblichen Versuchen, sie davon zurückzuhalten.
»Das Komischste war«, sagte sie, »als ich schon bereit war, aufzugeben und mit ihm nach Thun zu fahren, da wollte er das auch nicht. Er war geradezu ein bißchen erschrocken. Meinst du, daß er eine Freundin haben könnte?«
»Sicher«, gab Helma ungerührt zurück, »unmöglich wäre es nicht. Aber das muß es nicht sein. Vielleicht hatte er einfach Lust, mal auszuscheren. Sehnsucht nach einer Männergesellschaft . . .«
»Es sind auch Frauen mit von der Partie!«
»Aber das sind meistens Sportsweiber, die sich dem männlichen Ton anpassen. Ich finde seinen Wunsch, da alleine hinzufahren, ganz natürlich. Ihr seid sonst ja immer zusammen. Nicht daß ich das schlecht finde, im Gegenteil: es ist gut, daß du ihm in seinem Beruf hilfst. Es gibt kaum etwas, das mehr verbindet, besonders, wenn die erotische Anziehungskraft der ersten Jahre nachläßt . . .«
»Erlaube mal!« protestierte Elis.
»Du brauchst es gar nicht zuzugeben, ich weiß, wovon ich spreche.«
»Aber du warst nie verheiratet!«
»Aus gutem Grund. Wenn ich mit einem Mann ins Bett gehe, muß es spontan sein, bewußt, engagiert, leidenschaftlich . . . das alles ist aber, wenn das Miteinanderschlafen zur Gewohnheit geworden ist, nicht mehr möglich.«
Daraufhin schwieg Elis eine Weile; sie mochte nicht zugeben, daß Helma recht hatte, war aber zu ehrlich, um zu widersprechen. Endlich sagte sie: »Du weißt nicht, was Liebe ist.«
»Weißt du es?«
»Ja!« Elis warf den Kopf in den Nacken, daß ihre glatten dunklen Haare flogen. »Ein ganz starkes Zusammengehörigkeitsgefühl.«
»Das würde ich eher Freundschaft nennen.«
»Nenn es, wie du willst. Das, was Hanns-Heinz und mich verbindet, ist Liebe. Wir sind miteinander verwachsen.«
»Und doch unterstellst du, daß er dich betrügen könnte?«
»Das hätte mit unserer Liebe nichts zu tun. Selbst wenn er eine Freundin hätte, sie würde ihm nichts bedeuten . . . nichts im Vergleich zu mir und den Kindern.«
»Wie hübsch für dich, so sicher zu sein.«
Helma sagte es ganz freundlich, eigentlich gutmütig, und dennoch fühlte Elis sich durch diese Bemerkung verletzt. Es schien ihr Überheblichkeit herauszuklingen, ja sogar Verachtung.
Die beiden Frauen blieben stumm, bis sie das Autobahnkreuz Walldorf erreichten. Dort wechselten sie auf die E 4 über, die nach Basel führt.
»In Schaffhausen könnten wir Mittag essen«, schlug Helma vor; »dann sind wir schon hinter der Grenze.«
»Ich hab’ eigentlich keinen Hunger.«
»Wart’s ab.«
Tatsächlich mußte Elis zugeben, als sie später ein gutbürgerliches Restaurant am Marktplatz von Schaffhausen betraten, daß ihr eine warme Mahlzeit guttun würde. Die Speisenkarte war reichhaltig. Beide Frauen entschieden sich, ihre Ankunft auf Schweizer Boden mit Geschnetzeltem und Rösti zu feiern.
»Wenn du von hier ab fahren willst . . .«, begann Helma.
»Läßt du mich?!«
»Ja, sicher.«
»Das ist fabelhaft!«
Mit diesem Angebot Helmas war auch der letzte Rest von Mißstimmung bei Elis vertrieben. Elis hatte vor Jahren ihren Führerschein gemacht, aber nur zu selten Gelegenheit, selber hinter dem Steuer zu sitzen. Hanns-Heinz beanspruchte den Familienwagen für sich und ließ sie höchstens dann ans Steuer, wenn sie ausgegangen waren und er zuviel getrunken hatte.
»Also, wenn du jetzt fährst, kann ich mir ein Viertel roten Veltliner zum Essen bestellen . . . du bleibst gefälligst nüchtern.«
Elis lachte. »Was hältst du von mir?«
Das Lokal hatte Atmosphäre. Die Gewölbedecke war mit Szenen aus dem Schweizer Volksleben bemalt, Tische und Stühle waren rustikal, die Kellnerinnen, in weißer Bluse und weißer Schürze, adrett und höflich.
Elis war bald so gelöst, als hätte sie und nicht die Freundin Wein getrunken. »Ich war vorhin ein bißchen dumm«, gestand sie. »Du warst eingeschnappt.«
»Ja, stimmt. Gerade das nenne ich dumm. Unter Freundinnen sollte man nicht so sein.«
»Vielleicht war es auch meine Schuld«, bekannte Helma; »ich bin sehr für absolute Offenheit . . . zwischen uns beiden, meine ich. Zu wem könnte ich denn sonst noch offen sein? Aber man sollte dabei doch auf die . . . die Empfindlichkeit des anderen Rücksicht nehmen.«
»Und das hast du nicht getan?«
»Anscheinend nicht. Sonst wärst du doch nicht verletzt gewesen.«
Die »Saaltochter« räumte ab und brachte zwei Tassen Kaffee. Helma wartete, bis sie wieder allein waren, und zündete sich dann eine Zigarette an. »Du hast dir ein Bild von deiner heilen kleinen Welt gemacht . . . bitte, bitte, werd nicht schon wieder böse . . . vielleicht ist sie ja auch wirklich so heil, wie du glaubst. Ich kann es nicht beurteilen, und gerade darum steht es mir nicht zu, dich zu verunsichern.«
»Das wird dir nicht gelingen«, erklärte Elis mit Nachdruck.
»Ich verspreche dir, daß ich es in Zukunft tunlichst vermeiden werde . . . jedenfalls will ich es versuchen . . .«
Elis merkte, daß die Freundin noch nicht ausgeredet hatte. »Aber?« drängte sie. »Du wolltest doch noch etwas sagen?« »Vielleicht ist es mein Beruf, der mich ein bißchen skeptisch, ja vielleicht sogar zynisch gemacht hat. Ich wittere die Dämonen, die unter der Oberfläche bürgerlicher Wohlanständigkeit und Zufriedenheit lauern.«
Elis lachte. »Hübsch gesagt. Aber bei uns wirst du sie vergebens suchen.«
Am späten Nachmittag erreichten sie den Vierwaldstätter See und entschlossen sich, in Brunnen zu übernachten. Das Hotel, ein riesiger Kasten mit vielen Erkern, Balkonen und Terrassen, war um die Jahrhundertwende erbaut worden, vielleicht sogar noch früher. Es lag abseits vom Durchgangsverkehr am Ende einer langen Allee. Sie bekamen ein Doppelzimmer mit Blick auf den See, einen hohen Raum mit Parkettboden und schweren, soliden Möbeln.
»Mir gefällt’s hier!« rief Elis und öffnete die Tür zum Balkon. »Sieh nur, die Sonne geht unter! Und wie die Berge glühen! Ach, ist das schön!«
Helma trat hinter sie. »Ja, prachtvoll!«
Der See dehnte sich vor ihnen wie ein glatter Spiegel, der sich mehr und mehr verdunkelte, während die schneebedeckten Gipfel im Schein der roten Sonne aufglühten.
Beide Frauen machten sich frisch und brachen zu einem längeren Spaziergang auf.
»Du bist übrigens sehr gut gefahren«, lobte Helma.
»Ja, wirklich?« Elis errötete vor Freude und war froh, daß die Freundin es im Zwielicht nicht merken konnte. »Hanns-Heinz meckert immer an mir rum.«
Helma schluckte die Bemerkung, die sie ganz gern über Hanns-Heinz gemacht hätte, und sagte statt dessen: »Das haben Männer nun mal so an sich.«
»Anfangs«, bekannte Elis und versuchte, ihren Schritt dem der weit ausgreifenden Freundin anzupassen, »war ich noch ziemlich unsicher.«
»Du hast eben zu wenig Praxis.«
»Ja, leider. Ich hätte wahnsinnig gern ein eigenes Auto, wie du dir denken kannst. Aber die Garage ist zu klein für zwei. Und wann sollte ich es auch benutzen? Wochentags bin ich in der Praxis eingespannt, die Einkäufe macht Frau Stöber, und wenn wir an den Wochenenden etwas unternehmen, dann doch immer alle zusammen und mit dem Auto von Hanns-Heinz.«
»Das sind seine Argumente, nicht wahr?« fragte Helma.
»Ja«, mußte Elis zugeben.
»Ich habe eins dagegen: du könntest ein eigenes Auto gut brauchen, um mich in Köln zu besuchen.«
»Aber die Energiekrise«, sagte Elis; »das ist auch so ein Argument von Hanns-Heinz.«
»Ein schlechtes. Sollte Benzin wirklich noch teurer oder gar rationiert werden, so würdet ihr in einem kleineren Wagen besser fahren als in eurer schweren Familienkutsche. Reib ihm das mal unter die Nase.«
Elis seufzte leise. »Ach, weißt du, Helma, nein, das möchte ich nicht. Ich hätte schon sehr gern ein eigenes Auto, das stimmt, und leisten könnten wir es uns ja auch. Aber mich deshalb mit Hanns-Heinz rumzustreiten, das ist mir die Sache nicht wert. Der Familienfrieden ist mir entschieden wichtiger.«
»Ich finde, du läßt dich unterbuttern.«
»Darüber kannst du nicht mitreden.«
»Ja, ich weiß, ich war ja noch nie verheiratet. Wechseln wir also lieber das Thema!« Und das taten sie.
Am nächsten Abend kamen sie in Montegrotto an, dem bekannten italienischen Badeort nahe bei Padua. Die Landschaft war nicht beeindruckend, eher langweilig, auch der Ort selber hatte keinen Reiz: ein Hotel reihte sich an das andere, von dem dörflichen Charakter, falls es je einen gegeben hatte, war nichts geblieben.
Elis und Helma waren, beide übermüdet von der langen Fahrt, sehr enttäuscht. Zu ihrer Bestürzung fühlte Elis sich sogar den Tränen nahe. Doch gerade weil sie am Rande eines Nervenzusammenbruchs zu balancieren schien, wurde ihr klar, wie dringend sie Erholung brauchte.
»Wenn hier nichts los ist, um so besser«, sagte sie mit einem verkrampften Lächeln, »dann können wir uns wenigstens ausruhen.«
Unvermittelt lachte sie laut heraus.
»Was hast du?« fragte Helma irritiert.
»Ich mußte gerade an Hanns-Heinz denken! Der sieht mich so ungern in einem ›internationalen Hotel‹! Wenn der wüßte, wie brav das alles hier ist!«
»Warten wir’s ab.«
Die sehr elegante Atmosphäre im Inneren des Hotels tröstete sie über den Eindruck der trostlosen, sachlich modernen Fassade hinweg. Eine weite Halle empfing sie, auf deren dickem Teppichboden üppige Polstergarnituren aufgestellt waren. Nur wenige Gäste hielten sich hier auf. Schon in den nächsten Tagen sollten Elis und Helma am eigenen Leibe erfahren, daß die Kur anstrengend war, und verstehen, warum die meisten Patienten früh zu Bett gingen. An ihrem ersten Abend wunderten sie sich noch darüber. Ein freundlicher Italiener mit grauen Schläfen und blitzenden Zähnen überreichte ihnen den Zimmerschlüssel.
»Wir packen aus und möchten dann noch eine Kleinigkeit essen«, sagte Helma.
»Das wird leider nicht möglich sein!« Der Empfangschef war nicht die Spur verlegen und verlor auch nichts von seinem Charme. »Dinner ist von acht bis neun . . .« Er blickte auf seine Armbanduhr, um sich zu vergewissern, daß es nach neun Uhr war.
»Und danach gibt es nichts mehr?« fragte Helma.
»Leider nein. Die Küche ist geschlossen . . . aber wenige Schritte linker Hand ist ein Ristorante . . . La Coquille . . . sehr gut, sehr zu empfehlen . . .«
»Na, gehen wir erst einmal hinauf!«
Im Aufzug sagte Elis: »Na so etwas! Nach neun Uhr nichts mehr zu essen! Das ist ja ein Bauerngasthof!«
Sie lachten, und das half ihnen über ihren Ärger hinweg.
Der Hausdiener brachte ihnen die Koffer, sie gaben ihm ein Trinkgeld und packten aus. Das Zimmer war modern und sachlich eingerichtet: Möbel aus hellem Holz und pastellfarbene Vorhänge.
Helma, die sehr viel weniger eingepackt hatte als Elis, war eher mit dem Auspacken fertig. Sie warf sich in einen der kleinen Sessel, streifte die Schuhe von den Füßen, streckte die langen Beine von sich und zündete sich eine Zigarette an. Elis fand es unangenehm, in einem verräucherten Raum schlafen zu müssen, verbiß sich aber eine Bemerkung darüber.
Als könnte Helma Gedanken lesen, sagte sie: »Nur keine Bange, gewöhnlich rauche ich im Schlafzimmer nicht. Aber nach der langen Fahrt muß ich einfach einen Glimmstengel haben. Oder wäre es dir lieber, wenn ich unten auf dich warte?«
Elis, die Wäsche im Schrank eingeordnet hatte, drehte sich zu ihr um. »Weißt du, Helma, eigentlich möchte ich gar nicht mehr runter. Ich bin richtig müde.«
»Du willst doch nicht etwa jetzt schon zu Bett!?«
»Wenn du nichts dagegen hast.«
»Doch, das habe ich. Jede Menge sogar. Wir müssen das Schwimmbad ausnützen, das ist doch das Wichtigste an diesem Hotel. Also . . . husch, husch, hinein!«
»Heute abend noch?«
»Ja, heute abend. Und wir müssen uns für Massagen und Fango-Bäder einschreiben. Ich weiß, wie es da zugeht. Wenn wir das heute nicht tun, verlieren wir einen ganzen Tag.«
»Wenn du meinst . . .«
»Ja, ich meine!« Helma drückte ihre Zigarette aus, warf den Inhalt des Aschenbechers in die Toilette und spülte. Dann entkleidete sie sich und schlüpfte in ihren schwarzen, einteiligen Badeanzug. Wohlgefällig betrachtete sie sich vor dem hohen Spiegel in der Schranktür. »Ich kann mich immer noch sehen lassen!« Sie war zwar grobknochig, aber ihr Fleisch — sehr weiß nach dem langen Winter — war fest.
»Ja, du siehst gut aus«, bestätigte Elis.
»Du aber mal erst, meine Kleine!« Helma gab Elis einen raschen, schwesterlichen Kuß auf die Wange. »Jetzt hör aber auf mit der blöden Auspackerei und zieh dich um. Den Rest kannst du morgen verstauen.«
»Bin ja gleich fertig.« Elis ließ es sich nicht nehmen, die Flaschen, Tiegel und Tuben, die sie für ihre Schönheitspflege brauchte, im Bad aufzubauen. Dann klappte sie den Koffer zu, und Helma, die mehr als einen Kopf größer war, half ihr, ihn auf den Schrank zu schieben. Sie wählte unter ihren Badesachen einen weißen Bikini; ihre Haut war auch nach dem Winter leicht gebräunt. Beide Frauen schlüpften in Sandalen und Bademäntel und fuhren in den Keller des Hotels hinunter. Dort kam man zu den Bädern. Helma behielt recht. Als sie sich zur Massage eintragen wollten, mußten sie feststellen, daß nur um fünf Uhr am Morgen Termine frei waren.
»Das ist ja mörderisch!« rief Elis entsetzt. »Da verzichte ich lieber ganz!«
»Mörderisch . . . no, nix mörderisch!« Der Bademeister, ein muskulöser Mann in weißer Hose und weißem T-Shirt, lachte. »Die Signora nachher kann ins Bettchen hüpfen . . .«
»Aber dann bin ich wach!«
»Nein, nein, die Signora wird sein müde.«
»Ich versuch’s«, sagte Helma entschlossen.
Auch Elis gab nach. »Und ich hatte mich so aufs Ausschlafen gefreut.«
»Nächste Woche, wenn Pasqua vorbei, wir werden buchen um«, tröstete der Bademeister sie.
Auf dem Weg zum Thermalbad kamen sie an den Becken mit schwarzem Mineralschlamm vorbei, der gluckernd Blasen warf. »Huh, das sieht höllisch aus!« sagte Elis und hielt unwillkürlich Abstand.
»Angsthase!« neckte Helma sie.
»Möchtest du da etwa hineinfallen?«
»Natürlich nicht! Aber wenn man nur auf dem Weg bleibt, kann das ja auch nicht gut passieren. Ich finde es großartig, daß die Natur die Heilmittel für unser Zipperlein hier so verschwenderisch produziert.«
Das Schwimmbassin war von Bogenlampen erleuchtet, und über dem Wasserspiegel hingen weiße Dampfschwaden, so dicht, daß sie den hinteren Rand verdeckten. Dahinter lag nachtschwarze Finsternis.
»Ich friere«, sagte Elis schaudernd.
»Gleich wird dir warm werden!« Helma warf ihren Bademantel ab, band sich ein Tuch um ihr kastanienbraunes Haar, sorgsam darauf bedacht, ihre Locken nicht zu zerstören, und kletterte die schmale Leiter in das Bassin hinab. Platschend ließ sie sich in das warme Wasser fallen. »Es ist herrlich, Elis! Komm schon!«
Elis brauchte Zeit, ihr glattes dunkles Haar unter die weiße Badehaube zu stecken. Sie fummelte länger damit herum, als es nötig gewesen wäre, weil es sie Überwindung kostete, Helmas Beispiel zu folgen. Ihr Verstand sagte ihr, daß dies nichts anderes als ein Thermalbad war; aber ihrem Gefühl war die Szenerie unheimlich. Die wenigen Fenster des Hotels, die noch erleuchtet waren, schienen kalt und lauernd auf sie herabzustarren.
Trotzdem war das Schwimmen in dem heißen Wasser wunderbar. Nicht nur ihre Muskeln entspannten sich, auch ihre Nerven. Sie erlebte ein Gefühl des Losgelöstseins, wie sie es nie zuvor gekannt hatte.
Helma rief: »Du, hör mal! Es ist schon spät! Wir sollten Schluß machen!«
Elis widersprach wie ein kleines Mädchen: »Noch nicht! Bitte, noch nicht, nicht jetzt!«
Sie paddelten noch eine Weile herum, lachten und bespritzten sich. Ganz glücklich war Elis, als sie die Freundin zurückließ und allein, mit weit ausholenden Bewegungen, quer durch das große Becken schwamm.
Von einer Sekunde zur anderen wurde es dunkel. Elis schrie nicht auf, aber sie erschrak. Die Lampen am Rande des Beckens waren erloschen. Sie brauchte Sekunden, bis sie sich an die Finsternis gewöhnt hatte.
»Elis!« rief Helma. »Elis! Ich bin hier!«
Die Stimme der Freundin war vertraut und beruhigend in der plötzlich eingetretenen Finsternis.
»Ich komme!« rief Elis zurück. »Warte auf mich!« Sie schwamm auf Helma zu.
»Ich bin hier . . . an der Leiter! Wahrscheinlich ist es zehn Uhr . . . ich nehme an, sie schalten um zehn die Außenbeleuchtung ab!«
»Das muß einem doch gesagt werden!«
Elis erreichte die Leiter am Rande des Beckens. Die Freundin streckte ihr von oben die Hand entgegen und half ihr heraus. Elis war atemlos, nicht, weil sie sich angestrengt hatte, an den Beckenrand zu kommen, sondern weil die plötzliche Finsternis sie ängstigte.
Helma legte ihr ein Badetuch um die Schultern. »Trockne dich ab!
Man erkältet sich leicht, wenn man aus dem warmen Wasser kommt.«
Sie nahmen ihre Sandalen in die Hand und liefen barfüßig auf das Haus zu.
»Wenn wir bloß nicht in den Fango geraten«, sagte Elis.
Aber das war unmöglich. Von der heißen, brodelnden Heilerde ging eine solche Wärme und ein so starker Schwefelgeruch aus, daß sie sie selbst bei völliger Dunkelheit umgangen hätten. Nachdem ihre Augen sich erst an die veränderten Lichtverhältnisse gewöhnt hatten, erkannten sie alles: die Umrisse des Hotels, den Hintereingang, der zu den Massageräumen führte, die Mauer, die das Gelände gegen die Straße abschirmte.
Sie waren jetzt beide todmüde, befürchteten aber, vor Hunger nicht schlafen zu können. Deshalb zogen sie sich noch einmal an. Helma schlüpfte in Jeans, zog einen Pullover über den Kopf, Kniestrümpfe an und Schuhe mit niedrigem Absatz. Elis wählte einen karierten Rock, ein Twinset, Strumpfhose und hochhackige Pumps. Beide verzichteten darauf, sich zu schminken. Sie genossen das Gefühl unbegrenzter Freiheit.
Das La Coquille entpuppte sich als ein sehr italienisches Restaurant, trotz seines französischen Namens. Zwar standen französische Zwiebelsuppe und Bouillabaisse auf der Speisenkarte, aber Elis und Helma entschieden sich für Spaghetti bolognese und einen italienischen Rotwein. Es schmeckte ihnen großartig, nicht nur, weil sie hungrig waren. Nachher rauchte Helma noch eine Zigarette. Es waren noch andere Gäste im Coquille, aber sie beachteten sie nicht.
Die nächsten Tage vergingen behaglich und langsam, aber in einem von der Kur bestimmten Rhythmus. Kurz vor fünf Uhr standen sie auf, taumelten schlaftrunken zum Lift und ließen sich in die Massageräume hinunterbringen. Sie genossen es, geknetet, gewalkt und geklopft zu werden, machten sich dabei aber nicht die Mühe, die Augen offenzuhalten. Nachher sprangen sie in das heiße Wasser, wurden für kurze Zeit hellwach, lachten und scherzten miteinander, um dann, zurück in ihrem Zimmer, sofort wieder ins Bett zu klettern; Minuten darauf waren sie fest eingeschlafen.
Es folgte das Frühstück, das sie nur in Form einer Tasse Kaffee zu sich zu nehmen pflegten, und dann das Mittagessen, das zwischen zwölf und eins serviert wurde. Man konnte nicht à la carte speisen, sondern bekam immer nur das, allerdings sehr abwechslungsreiche und sehr schmackhafte, Menü vorgesetzt: eine Suppe, ein Zwischengericht, einen Fisch- oder Fleischgang, Käse und Dessert. Elis und Helma pickten sich nur das Beste heraus, obwohl sie hungrig wie die Wölfinnen waren und alles, vom ersten bis zum letzten Bissen, hätten verschlingen können. Sie machten sich lustig über die anderen Gäste, die sich schon zehn vor zwölf vor der noch geschlossenen Tür zum Speisesaal zu stauen pflegten, waren aber, wie die meisten anderen, selbst ständig zu früh dran und konnten es kaum erwarten.
Nach dem Essen ruhten sie sich eine Stunde aus und unternahmen dann Erkundungsfahrten in die Umgebung, nach Padua, zu den nicht allzu fernen Bergen. Dabei richteten sie es so ein, daß sie immer noch vor dem Abendessen im Thermalbad schwimmen konnten. Sie hatten Spielkarten mitgenommen, aber sie kamen nicht dazu, sie zu benutzen.
Obwohl sie nichts taten als sich zu entspannen und auszuruhen, waren sie abends sehr müde und froh, ins Bett zu kommen. Sie lasen noch ein paar Seiten, bevor ihnen die Augen zufielen. Einmal fragte Elis, als sie ihre Lektüre schon beiseite gelegt hatte: »Über mich und Hanns-Heinz hast du mich ja ganz schön ausgequetscht . . . aber was ist mit dir?«
»Mit mir!?« wiederholte Helma.
»Ja, mit dir. Frag nicht so dumm. Du weißt schon, was ich meine. Wie steht es mit der Liebe? Oder, wenn dir das zu hochgeschraubt klingt, mit dem Sex? Irgendwas wird sich doch abspielen!«
»Ja, schon.« Helma klappte ihr Buch zu und knipste die Nachttischlampe aus.
Sehr weißer, sehr heller Mondschein fiel ins Zimmer.
»Also was!« drängte Elis. »Hast du einen Liebhaber? Hast du mehrere? Hat er Absichten? Oder ist er verheiratet?«
»Also weißt du, mit verheirateten Männern lasse ich mich prinzipiell nicht ein, auch wenn es mir manchmal schwerfällt. Mit verheirateten Männern gibt es entweder Komplikationen oder, wenn es keine gibt, wenn er dich als Abenteuer einfach so abtut, fühlst du dich nachher wie der letzte Mensch . . .«
»Du hast also solche Erfahrungen gemacht?«
»Ja, in meiner Sünden Maienblüte. Aber das ist längst vorbei.«
»Also, keine Ehemänner. Was dann?«
»Nun, am liebsten Singles. Ich meine damit keine zufällig allein lebenden Männer, sondern überzeugte Singles. Die keinen Mut zu einer festen Bindung finden oder die Schnauze voll haben. Die vom Sex genau dasselbe wollen wie ich: ein gewaltiges Erlebnis, aber sporadisch, kein tägliches Allerlei.«
»Und kommst du nie in Versuchung . . . gerade dann, wenn das Erlebnis großartig war . . . was Dauerhaftes draus zu machen?«
»In Versuchung schon. Aber mein Verstand sagt mir, daß es, wenn es dauerhaft wird, nicht mehr einmalig sein kann.«
»Du verläßt dich also ganz auf deinen Verstand?«
»Doch, das tue ich. Wenn es irgend geht. Mag schon sein, daß ich mich manchmal selbst behumpse . . . aber immerhin, ich versuche es.«
»Bewundernswert!« sagte Elis, und mit diesen Worten schlief sie ein.
Am nächsten Vormittag schrieb Elis eine Ansichtskarte an Romana, eine an Peter und eine an ihren Mann.
Sie schrieb: Lieber Hanns-Heinz, wenn Du ahntest, wie stinklangweilig es hier ist, hättest Du Dir bestimmt keine Sorgen wegen meiner Reise gemacht — aber Langeweile soll ja sooo erholsam sein! Die Bäder sind es bestimmt! Schon vor dem ersten Hahnenschrei müssen wir zur Massage und plumpsen abends entsprechend früh ins Bett. Es gibt auch gar nichts, was man unternehmen könnte. Das Essen ist phantastisch, wenn sich die Mahlzeiten auch wie Abfütterungen im Raubtierkäfig abspielen. Dir wünsche ich schöne Tage, viel Erfolg — und komm mir braun gebrannt nach Hause! In Liebe Deine Elis.
Sie hatte quer über die Karte geschrieben, steckte sie jetzt in einen Umschlag und adressierte sie.
Zwei Tage später war es in Montegrotto schon gar nicht mehr langweilig. Ein interessanter Mann war aufgetaucht. Später erfuhren die Freundinnen, daß er schon einen Tag vor ihnen im Hotel Esplanade abgestiegen war, aber sie hatten ihn nicht gleich bemerkt. Doch er mußte ihnen auffallen, schon allein durch die Tatsache, daß er allein war. Allein schwamm er seine Runden im Thermalbecken, allein lag er, dick eingemummt, in der Mittagssonne im Liegestuhl, und allein saß er bei den Mahlzeiten an einem Tisch nahe dem Durchgang zur Küche.
Einmal begegneten sie ihm im Flur zu den Massageräumen. Er sah Elis an, und Elis war es, als hätte ein seltsamer Ausdruck in diesem Blick gelegen — wie ein Wiedererkennen. Es hatte sie betroffen gemacht. Aber es war nur ein kurzer Eindruck gewesen, und sie konnte dieses Gefühl rasch wieder abschütteln. Um nichts in der Welt hätte sie darüber reden können; es wäre ihr auch unmöglich gewesen, etwas in Worte zu fassen.
Es war Helma, die als erste die Sprache auf ihn brachte. Die beiden Frauen lagen nebeneinander am Schwimmbecken, als er in einiger Entfernung seinen Bademantel abstreifte und zu einer der Leitern ging.
Helma stieß Elis an. »Du, der sieht gut aus, wie?«
Elis sah kurz hinüber, schloß aber dann gleich wieder die Augen und sagte nur sehr unbestimmt: »Hm, hm!«
Der Unbekannte sah in der Tat gut aus: sein bräunlicher Körper war schlank und gut proportioniert, wodurch er größer schien, als er wirklich war; sein braunes Haar wich zwar an den Schläfen schon zurück, war aber weich und leicht gelockt.
»Nun sei doch nicht so schläfrig!« sagte Helma ärgerlich.
Elis schwieg.
»Hast du schon bemerkt«, fragte Helma, »der ist immer allein . . . möglicherweise ein Junggeselle.«
»Machst du dir Hoffnungen?«
»Werd bloß nicht kindisch, man wird sich doch noch über die Leute unterhalten dürfen.«
Helmas Ton war so scharf geworden, daß Elis es für richtig hielt, sich zu entschuldigen. »Sei mir nicht böse«, sagte sie und legte ihre Hand auf den Arm der Freundin, »das sollte ein Witz sein.«
»Ein Witz, mit dem du meine ganze Existenz in Frage stellst!«
»Nun übertreib aber mal nicht!«
»Du hast immerhin angedeutet, daß meine Ehelosigkeit unfreiwillig wäre und daß ich auch nur, wie alle anderen, drauf aus wäre, mir einen passenden Partner zu angeln!«
»So weit habe ich gar nicht gedacht . . . so was aber auch! Du hast vielleicht Ideen! Daß ich annehmen könnte, du würdest einen Mann als Heiratskandidaten in Betracht ziehen, mit dem du noch nicht ein Wort gewechselt hast! Ich meinte bloß, er könnte für dich als Ferienflirt interessant sein . . . Nein, wirklich, Helma, du bist überempfindlich.«
Helma seufzte schwer. »Kann schon sein. Aber wenn du wüßtest, was man sich als Junggesellin an blöden Witzen anhören muß! Schlimmer noch das gewisse Mitleid der meisten Frauen, die so was Geringschätziges in den Blick bekommen, so ein unausgesprochenes ›Das-arme-Ding-hat-keinen-abgekriegt!‹«
Als sie an diesem Nachmittag das Bad verließen, inszenierte Helma gekonnt einen kleinen Zwischenfall, und zwar genau vor dem Liegestuhl des interessanten Gastes. »Entschuldigen Sie«, sagte sie mit ihrem schönsten Lächeln, »beinahe wäre ich über Ihre Beine gestolpert.«
Er war höflich aufgesprungen. »Es ist Ihnen doch nichts passiert?« Mit der Andeutung einer Verbeugung fügte er hinzu: »Alexander Klinger.«
Sie wären miteinander ins Gespräch gekommen, wenn Elis bei ihnen stehengeblieben wäre. Aber das tat sie nicht, sondern sie marschierte mit sehr geradem Rücken schnurstracks auf das Hotel zu und hatte sich schon mehr als zehn Meter entfernt.
Beide sahen ihr nach.
»Entschuldigen Sie, bitte!« sagte Helma. »Meine Freundin!« Und sie lief Elis nach. »Was ist los mit dir?« rief sie, als sie sie fast erreicht hatte. »Warum rennst du weg?«
Elis drehte sich zu ihr um und funkelte sie aus ihren dunklen Augen an, die jetzt schwarz vor Zorn waren. »Das hast du mit Absicht getan!«
Helma hatte sie noch nie so aufgebracht gesehen. »Na und? Ich wollte ihn kennenlernen. Ich weiß jetzt, wie er heißt: Alexander Klinger.«
»Auf eine solche Art macht man keine Bekanntschaften!«
»Da irrst du dich gewaltig! So etwas geschieht allenthalben und alle Tage.«
»Helma! Begreifst du denn nicht? Er muß gemerkt haben, daß du es absichtlich getan hast. Begreifst du denn nicht, wie entsetzlich peinlich das ist?«
»Hör mal, Elis, jetzt übertreibst du aber. Du tust gerade so, als hätte ich mich ihm an den Hals geschmissen. Aber davon kann doch keine Rede sein.«
»Du hast dich unmöglich benommen.«
Während sie den Hintereingang des Hotels betraten und die Massageräume passierten, schwiegen sie. Im Lift waren sie allein, aber sie schwiegen weiter. Elis war so wütend, daß ihr die Worte fehlten. Helma begriff nicht, warum sie sich so aufregte.
»Mir scheint, du bist in deiner Ehe noch spießiger geworden, als ich befürchtet habe«, sagte Helma, als sie die Zimmertür aufschloß.
»Spießig!« rief Elis, riß sich den Bademantel herunter und warf ihn in eine Ecke. »Weil ich es abscheulich finde, wenn meine Freundin in meiner Gegenwart mit einem Fremden poussiert!« Sie zerrte sich den nassen Badeanzug herunter und knallte ihn in die Badewanne.
»Du hast einen sehr schönen Körper«, sagte Helma sachlich. »Wie kommst du jetzt darauf?« fragte Elis, aus dem Konzept gebracht.
»Weil ich ihn gerade betrachte. Du hast eine sagenhaft schmale Taille . . . und dazu dieser volle Busen.«
»Hör auf mit diesen Ablenkungsmanövern«, sagte Elis und begann, sich von den Zehen bis zum Hals einzucremen; dabei wurde ihr bewußt, daß Helmas Kompliment sie besänftigt hatte. Helma begann sich ebenfalls umzuziehen.
»Jetzt hör mir mal zu«, bat sie. »Du hast deinen Hanns-Heinz, deine Kinder, dein Haus, deine Frau Stöber . . . sag mal, warum läßt du dich eigentlich von ihr mit ›Frau Doktor‹ titulieren?«
»Weil ich es ihr nicht abgewöhnen konnte. Es hat lange gedauert, bis ich darauf gekommen bin, daß sie sich gehoben fühlt, für eine ›Frau Doktor‹ zu arbeiten; das ist etwas anderes als für eine simple ›Frau Jacobs‹.«
»Aber sie könnte doch auch für die ›Frau vom Herrn Doktor‹ arbeiten.«
»Solch philologischen Feinheiten ist sie nicht zugänglich.«
»Na, dann will ich dir noch mal verzeihen. Dieses dauernde ›Frau Doktor hier, Frau Doktor da‹ bei unserer Abfahrt kam mir reichlich übertrieben vor.«
»Und das hast du bis jetzt nicht gesagt?«
»Ich wollte keinen Streit, aber da wir ihn nun einmal haben . . .«
Elis lachte. ». . . ist es ein Abwasch, denkst du!«
Helma holte die Flasche Sherry vom Balkon, schenkte sich in ein Wasserglas ein und fragte Elis: »Du auch?«
»Hm, ja.«
Helma setzte sich in einen der beiden Sessel und zündete sich eine Zigarette an. »Also, was ich sagen wollte: du hast alles, was eine Frau sich nur wünschen kann, Familie, Beruf und einen Freundeskreis. Du hast es nicht nötig, Bekanntschaften zu machen. Aber ich lebe allein. Natürlich habe ich auch Freunde, Bekannte, so ist das nicht . . . aber jeder neue Mensch, mit dem ich in Berührung komme, ist für mich ein Gewinn. Und dabei ein bißchen nachhelfen . . . das ist in meinen Augen ganz harmlos.«
Elis brachte die Creme zurück ins Bad und zog einen trockenen Bademantel an.
»Das verstehe ich ja alles. Ich weiß, daß du viel allein bist, vielleicht fühlst du dich sogar manchmal einsam. Aber jetzt doch nicht . . . nicht im Augenblick. Wir sind doch Tag und Nacht zusammen. Du kannst mit mir über alles sprechen. Wozu brauchst du da einen Ferienflirt?«
»Aber, Elis, du bist doch nicht etwa eifersüchtig?«
»Nein, bestimmt nicht. Aber ich finde, wir sollten uns unseren Urlaub nicht durch so etwas verderben. Wenn es sich von selbst ergeben hätte . . . na, dann würde ich gar nichts sagen. Aber so etwas zu forcieren, halte ich ganz einfach für falsch.«
»Wenn du das so siehst . . .«
»Ja, genau so. Wir sind doch keine Schulmädchen mehr, Helma, die sich wegen eines Jungen in die Haare kriegen. Lassen wir den schönen Alexander Klinger in Zukunft links liegen, abgemacht? Sein Selbstgefühl kann einen kleinen Dämpfer bestimmt ertragen.«
Elis und Helma kamen fünf Minuten zu spät in den Speisesaal, denn es widerstrebte ihnen, sich mit der Horde der Gäste in der Halle zu drängen, bis die gläserne Doppeltür aufgesperrt wurde. Elis mußte sich Mühe geben, nicht zu Alexander Klinger hinzublicken, der schon an seinem Einzeltisch nahe dem Durchgang zur Küche saß. Um nicht wieder anzuecken, verkniff sich Helma ein ermunterndes Lächeln in seine Richtung.
Dann ergriff sie impulsiv den Arm der Freundin und hielt sie zurück. »Du, der hat ein Auge auf dich geworfen!«
»Laß mich los! Wir erregen Aufsehen!«
»I woher denn! Die sind doch alle voll beschäftigt!« widersprach Helma, ließ Elis aber los. Sie setzten sich an ihren Tisch und legten die Servietten auf den Schoß.
»Aber leugnen kannst du es nicht. Er hat bei deinem Anblick geradezu gestrahlt!«
»Ich hab gar nicht zu ihm hingesehen.« Elis zerkrümelte eines der knusprigen, ungesalzenen Brötchen auf dem Tischtuch.
»Dann bist du wirklich kalt wie ein Fisch!«
»Schon möglich.«
Elis wunderte sich über ihre gelassene Stimme und fürchtete gleichzeitig, daß die Freundin das laute Pochen ihres Herzens hören könnte.
»Aber er ist doch so sympathisch!«
»Wann wirst du endlich kapieren, daß ich an Ferienbekanntschaften nicht interessiert bin?« sagte Elis beherrscht und verteilte den Rest aus der Rotweinflasche, die auf dem Tisch stand, in ihre Gläser. »Wir sollten neuen Wein bestellen. Wieder Valpolicella?«
»Einverstanden.« Helma hätte gerne noch über Alexander Klinger gesprochen, war aber klug genug, das Thema für diesen Abend auszuklammern.
Am nächsten Morgen nahmen sie wieder um fünf Uhr in der Frühe ihre Massage und zogen danach ihre Badeanzüge an, um zum Thermalbecken zu laufen. Für beide war es immer wieder ein Abenteuer, so früh am Morgen auf zu sein. Es war noch dämmrig, der Himmel warvon einem lichten Pastellgrau, das sich dort, wo die Sonne aufging, rötlich verfärbte. Der Fangoschlamm gurgelte und brodelte, strömte Schwefelgeruch und Hitze aus.
Helma schien es eilig zu haben; sie war Elis einen Schritt voraus. Während sie sich den Bademantelgürtel enger zog, fiel ihr das Kopftuch aus der Hand. Das wirkte ganz natürlich, und Elis schöpfte nicht den mindesten Verdacht. Sie ahnte nicht, daß die Freundin Alexander Klinger bemerkt hatte, der ihnen folgte — langsamer, da er nicht den Verdacht aufkommen lassen wollte, daß er ihnen nachliefe.
Elis verhielt den Schritt. »He, Helma, du hast . . .« Da Helma sich nicht umdrehte, bückte sie sich und hob das Tuch auf.
Dabei stieß sie fast mit Alexander Klinger zusammen, der gerade das gleiche tun wollte.
»Oh, verzeihen Sie!« sagte er mit einem kleinen Lächeln. Sekundenlang sahen sie sich wie gebannt in die Augen, und Elis konnte nicht verhindern, daß sie rot wurde; sie hoffte, daß er es in diesem dämmrigen Licht nicht bemerken würde.
»Gehört es Ihnen?« fragte er.
Sie war so verwirrt, daß sie den Sinn der Frage nicht sogleich verstand.
Er deutete auf das Tuch, das sie in der Hand hielt. »Das Tuch, meine ich.«
»Onein, es gehört meiner Freundin.« Sie zog ihre Badekappe aus der Tasche des Frotteemantels und zeigte sie vor. »Ich setze das auf den Kopf.« Plötzlich überwältigte sie die Komik der Situation, und sie brach in ein Gelächter mit leicht hysterischem Unterton aus. »Was reden wir denn da! Das klingt ja wie aus einer Sprachlehre für Ausländer!«
»Sie haben recht.« Er stimmte in ihr Lachen ein. »Mein Name ist übrigens Alexander Klinger.«
»Ja, ich weiß«, sagte Elis, dachte aber nicht daran, sich vorzustellen, sondern nickte ihm nur zu und lief Helma nach.
Das Wasser wirkte sehr dunkel, fast schwarz, und war von feinen weißen Dampfwölkchen bedeckt. Helma saß mit baumelnden Beinen am Beckenrand.
»Du hast dein Kopftuch verloren«, sagt Elis.
»Ich hab’s gerade entdeckt.«
»Und warum bist du dann nicht zurückgelaufen?«
»Ich wollte dich nicht in der Unterhaltung mit deinem Verehrer stören.«
»Hör auf!«
»Nun, ihr habt doch sehr angeregt miteinander geredet und sogar, weithin hörbar, herzlich gelacht.«
Elis hatte ihre Sandalen abgestreift und den Bademantel über eine der Liegen geworfen. »Sei bloß still, da kommt er.« Sie steckte ihre Haare unter die Kappe und sprang mit einem Hechtsprung ins Becken.
Helma folgte ihr, indem sie sich vom Rand hinuntergleiten ließ; sie sprang nie, weil sie um ihre Frisur fürchtete. Mit ein paar kräftigen Stößen war sie an der Seite der Freundin. In dem weißen Dampf, der sie umgab, konnten sie glauben, allein zu sein.
»Spaß beiseite«, raunte Helma, »der ist nur deinetwegen so früh aufgestanden.«
»Unsinn.«
»Hast du ihn denn schon einmal um diese Zeit hier gesehen?«
»Zufall.« Sie hatten eine Ecke des Beckens erreicht, und Elis hielt sich an der Überlaufrinne fest. »Kein Wort mehr davon, ich beschwöre dich! Wenn er dich hören würde.«
»Ach, der ist bestimmt nicht in der Nähe!« behauptete Helma. Aber gerade in diesem Augenblick tauchte sein lachendes Gesicht aus dem weißen Dampf vor ihnen auf. »Meine Damen . . .«, rief er.
»Sie haben uns erschreckt!« protestierte Helma.
Er hatte nur Augen für Elis, die sich an der Rinne festklammerte, als fürchtete sie zu ertrinken. ». . . wissen Sie, daß ich eigens Ihretwegen so früh aufgestanden bin? Ich habe in den Massagelisten nachgesehen und . . .«
»Das haben wir uns schon gedacht«, unterbrach ihn Helma. »Jedenfalls bereue ich es nicht, es ist für mich ein echtes Erlebnis. Tagsüber kann es nichts Sachlicheres geben als dieses große rechteckige Becken mit den Sprungbrettern und der rückwärtigen Fassade des phantasielosen Hotelbaues . . . und jetzt wirkt alles romantisch, geradezu verzaubert.«
»Wir freuen uns, daß wir Ihnen etwas bieten können«, sagte Helma.
Elis, an die die Rede eigentlich gerichtet war, schwieg beharrlich weiter; sie hielt die Augen gesenkt.
»Und außerdem noch Ihre angenehme Gesellschaft«, sagte Alexander Klinger.
»Wir fühlen uns außerordentlich geschmeichelt«, gab Helma zurück.
»Komm, laß uns schwimmen«, sagte Elis und stieß sich ab.
»Gute Idee!« Alexander Klinger schwamm an ihrer Seite.
So fest Elis es sich auch vorgenommen hatte, es war ihr unmöglich, auf die Dauer bei ihrer starr ablehnenden Haltung zu bleiben. Alexander Klinger war freimütig und fröhlich, Helma ein wenig zu laut und zu burschikos, aber beide waren so guter Laune, daß es ansteckend wirken mußte. Natürlich konnte ein wirkliches Gespräch zwischen ihnen nicht aufkommen, aber sie schwammen miteinander, warfen sich Scherze zu, und als Alexander Klinger tauchte, bekam Elis Lust dazu, es ihm gleichzutun — es war Jahre her, daß sie es zum letztenmal versucht hatte, und es erfüllte sie mit Freude, daß sie es noch konnte.
»Bravo!« rief er bewundernd, als sie wieder auftauchte.
»Quer durch das ganze Becken!« Helma war beeindruckt. »Das hätte ich dir nicht zugetraut!«
»Du hast mich eben seit eh und je unterschätzt!« erwiderte Elis keck, nahm sich aber dann sogleich zurück: »Aber jetzt habe ich genug vom Wassersport. Mein Haar ist klitschnaß geworden, fürchte ich. Wir sollten Schluß machen.«
Die anderen waren einverstanden, und hintereinander stiegen sie eine der Leitern hoch. Elis konnte es so einrichten, daß sie als letzte kam; es wäre ihr unangenehm gewesen, Alexander Klinger hinter sich zu wissen. Als sie die oberste Stufe erreicht hatte, hielt er ihr hilfreich seine Hand entgegen.
Sie schüttelte den Kopf, von dem sie schon die Badekappe gerissen hatte. »Danke, das kann ich allein.«
»Schrecklich, diese Emanzipation!« Er stieß einen übertriebenen Seufzer aus.
»Von Elis kann man eine Menge sagen, aber bestimmt nicht, daß sie emanzipiert ist!« Helma schlüpfte in ihren Bademantel.
»Sie heißen also Elis. Ein ausgefallener Name . . .«
»Kommt von Elisabeth«, erklärte Helma.
Er sah Elis bittend an. »Elis? Und wie weiter? Nein, sagen Sie nichts, bleiben wir bei den Vornamen, das ist viel netter! Sie sind Helma, nicht wahr?«
»Elis Jacobs«, erklärte Elis, der eine so plötzliche Vertrautheit der Anrede denn doch zuviel war.
»Helma Herberger«, stellte Helma sich vor; »aber ich meine, wir sollten ruhig bei den Vornamen bleiben. Das ist lustiger, und außerdem paßt es besser zum Urlaub.«
»Wie wahr!«
Elis wollte protestieren, unterließ es dann aber doch, weil sie nicht als Spielverderberin dastehen wollte.
Danach sahen sie Alexander Klinger den ganzen Tag nicht mehr. Als sie aus dem zweiten Schlaf erwachten, war der Himmel bedeckt. Elis drängte zu einem Ausflug nach Padua, den sie sich seit ihrer Ankunft in Montegrotto vorgenommen hatten. Helma meinte, es sei besser und sparsamer, erst nach dem Mittagessen zu fahren, aber Elis setzte sich durch.
Unterwegs versuchte Helma immer wieder, über Alexander Klinger zu sprechen, aber Elis blieb bei diesem Thema so einsilbig, daß sie es endlich aufgab.
Sie aßen in einem kleinen Ristorante und bummelten dann in bester Laune durch die enge Altstadt von Padua, die noch von Wällen und Mauern umgeben ist. Sie besichtigten das berühmte bronzene Reiterstandbild von Donatello, das den Condottiere Gattamelata darstellt, der im 15. Jahrhundert die Truppen Venedigs gegen Mailand geführt hat. Sie traten auch in die dämmrige Stille der romanischen Kirche Il Santo, blieben vor dem Grabmal des heiligen Antonius stehen und streichelten, mehr aus Aberglauben als aus Glauben, die Hand seiner Statue, die in einer Nische aufgestellt ist.
»Dabei darfst du dir was wünschen«, sagte Helma.





























