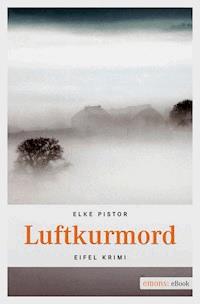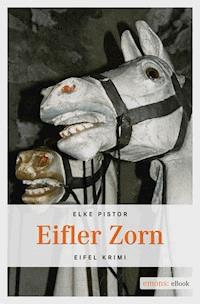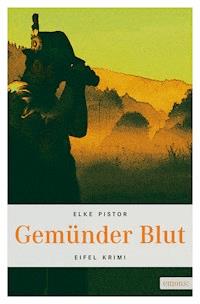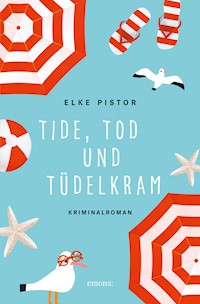Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ina Weinz
- Sprache: Deutsch
Eifler Neid: Ein Mord ohne Leiche - Hauptkommissarin Ina Weinz steht vor einem Rätsel Zwei Wanderer beobachten einen Mord im Nationalpark - aber eine Leiche wird nicht gefunden. Die Eifler Polizeihauptkommissarin Ina Weinz und Judith Bleuler von der Bonner Mordkommission stehen vor einem Rätsel. War das Ganze nur ein Hirngespinst? Als wenige Tage später eine Tote entdeckt wird, glauben sie sich einen Schritt weiter, aber: Wer ist die tote junge Frau, und was bedeuten die Male auf ihrer Haut? Eifler Neid ist ein atmosphärischer und spannungsgeladener Krimi, der die atemberaubende Landschaft der Eifel gekonnt als Schauplatz nutzt. Elke Pistor verwebt geschickt eine komplexe Fallanalyse mit den persönlichen Geschichten ihrer facettenreichen Protagonistinnen und erschafft so einen fesselnden Eifel-Krimi, der den Leser bis zur letzten Seite in Atem hält.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Elke Pistor, Jahrgang 1967, ist in Gemünd in der Eifel aufgewachsen. Nach dem Abitur zog sie zum Studium nach Köln. Hier lebt sie mit ihrer Familie und arbeitet als Autorin und Publizistin.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2014 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: Bert van Londen, agentur Wort und Bild Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-426-9 Eifel Krimi Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de Dieser Roman wurde vermittelt durch die Autoren- und Verlagsagentur Peter Molden, Köln.
Für Hannelore und Fred
PROLOG
Als du begreifst, was geschieht, weißt du, dass du in fünfzehn Minuten tot sein wirst.
Du siehst den Himmel und ein Gesicht. Undeutlich. Für einen Augenblick. Ein verzerrter Mund – ein Lächeln? In den Augen Fragen, die du nicht mehr beantworten wirst. Du erkennst deine Umgebung, die sanften Farben, das helle Licht. Nicht hier, denkst du, nicht jetzt. Es ist falsch, es ist ein Irrtum. »Lass mich reden, mich erklären, dir sagen«, willst du dem Schatten zurufen. Zu spät. Die Lippen bewegen sich, du hörst jemanden murmeln, abgehackt. Die Worte gehören zu der Fratze, zu dem Hass, zu der Verletzung, zu dem, was da über dir schwebt.
»Es tut mir leid«, sagt die Stimme. Mehr nicht. Du drehst den Kopf. Weg von den Berührungen. Du schwitzt. Wut überkommt dich. Auf dich, auf dein Vertrauen, auf deine Dummheit. Du windest dich, ruckst hin und her, suchst nach der Schwachstelle, findest keine. Du weißt, was geschehen wird. Willst es nicht glauben. Nicht wahrhaben.
Ich bin nicht gemeint, denkst du. Ruhig. Bleib ruhig.
Rede, denkst du.
Du hast die Toten gesehen. Sie berührt. Hast deinen Blick geschärft für die Arten, wie das Leben weichen kann. Für einen kurzen Augenblick siehst du dich, in deinen hellblauen Kittel gehüllt, mit Mundschutz über einen Körper beugen. Achtsam. Auf der Suche nach den kleinsten Zeichen, nach Spuren und Hinweisen. Du bist so stolz gewesen auf das, was du erreicht hast. Warst die Erste in der Familie. Weil du eine der Besten bist.
Ich bin nicht gemeint, denkst du in einer sekundenschnellen Endlosschleife.
Enge. Der Schweiß rinnt in Bächen über deinen Rücken und deinen Bauch, zwingt dich zur Reglosigkeit. Die Zeit dehnt sich aus. Die schnellen Bewegungen hinter dir, Schatten, zerfließen in deiner Wahrnehmung zu einem Bild, in dem das Jetzt verharrt. Hoffen. Flehen.
Nicht. Nicht ich, denkst du wieder und wieder.
Du weißt, du musst fliehen. Willst weg. Fortlaufen. Wie sie es getan hat, bis zum Ende. Das ist ihr Fehler gewesen. In diesem Augenblick wäre es nicht falsch, es wäre richtig. Doch du erkennst: Es ist zu spät. Du öffnest den Mund. Panik überrollt dich wie eine gewaltige Welle. Du willst schreien. Verstummst. Du atmest flach. Denkst.
Ruhe bewahren.
Deine Großmutter lebte in einer Hütte mit Lehmboden. Ohne Strom, Wasser und jegliche Hoffnung auf Besserung. Du wolltest ein anderes Leben. Dein Fortwollen hat dich hierhergebracht. Nicht das Vordergründige. Du schließt die Augen und erinnerst dich an die Hühner, die sie auf dem Holzblock geschlachtet hat. Manche wehrten sich gegen ihren harten Griff, flatterten und zeterten wild und versuchten zu entrinnen, bis ihr Kopf schließlich auf den Block gepresst wurde. Dann waren sie still. Warteten auf den Tod. Dunkle Pupillen, weit vor Angst. Du wirst sterben. Jetzt.
»Bitte«, sagst du. Atmest es aus, das Wort. »Bitte.« Doch kein Laut kommt über deine Lippen. Du zitterst. Du spürst, wie sich etwas auf deinen Mund legt. Eng. Auf deine Nase. Dein Atem wie warmer Nebel auf deiner Haut. Du saugst Luft, wo keine ist. Deine Augen weiten sich.
Nein. Nicht ich. Ich. Ich. Nein.
Wie du dich anstrengst. Wie deine Lungen pumpen.
Die Bücher sprechen von Euphorie, wenn man so stirbt, wie du gleich sterben wirst. Die Bücher lügen. Du würgst ohne Ton, windest dich und biegst im Todeskampf den Rücken durch. Suchst einen Ausweg. Doch die Gestalt neben dir lässt nicht los, sie hält fest, bis du dich erschöpft hast. Bis es zu Ende ist. Du weißt, ab jetzt bleiben dir noch fünf Sekunden des Denkens. Der Angst. Der Panik. Es zerreißt dich. Dein Puls rast, schneller und schneller und schneller. Schwindel. Das Gesicht weint. Nickt. Im stummen Schrei spürst du die Dunkelheit kommen, die dich mitnehmen wird. Hinabführen in eine Tiefe, in der du nichts mehr fühlst. In der dein Geist verhüllt ist vor den Schmerzen deines Körpers. Krämpfe, Zuckungen, Aufbäumen. Minutenlang. Dann reglose Stille. Nach zehn Minuten ohne Sauerstoff wird dein Gehirn unwiderruflichen Schaden erlitten haben. Dein Herz schlägt vielleicht noch eine Viertelstunde weiter.
Deine Lungen schnappen aus einem letzten Impuls heraus nach Luft. Ein Reflex. Kein Leben mehr.
EINS
»Hast du wieder nicht richtig zugehört, Helmuth? Die Frau hat dir das doch alles genau erklärt.«
»Natürlich hab ich das.«
»Aber dann könntest du es doch jetzt.«
Helmuth Haubrecht sah seine Frau Irmgard von der Seite an. Unter dem vorderen Rand ihres Fahrradhelms lugten zwei graue Haarsträhnen hervor. Ihre Wangen glühten rötlich und zeigten diese Art der Frische, die ein längerer Aufenthalt mit Bewegung an der Luft hervorrief. Ihre dunklen Augen blitzten. Eigentlich ist sie immer noch eine Schönheit, dachte er, wäre da nicht dieser Zug um ihren Mund. Eingeschlichen über die Zeit hinweg. Unmerklich erst, dann mehr und mehr, bis er ihm aufgefallen war, aber da war es zu spät gewesen und nicht mehr im Rahmen seiner Möglichkeiten, es zu ändern. Konnte man es Verbitterung nennen? Helmuth wusste es nicht. Er hatte es aufgegeben, danach zu fragen. So, wie er schon vor Jahren aufgehört hatte, es ihr recht machen zu wollen. Das ging sowieso nicht, hatte er in über fünfzig Ehejahren gelernt. Er war ihr nicht gut genug, egal, was er anstellte. Es hatte eine Weile gedauert, bis er begriffen hatte, dass sie ihre eigene Unzufriedenheit auf ihn übertrug. Sie brauchte immer einen Schuldigen. Als ob die Energie, die man für die heftigen Wortgefechte mit ihr aufwenden musste, nicht besser bei der Lösung des eigentlichen Problems aufgehoben wäre. Aber auch wenn er sich ausschwieg oder, was er eine Zeit lang praktiziert hatte, einfach den Raum verließ und wegging von ihr, nutzte es nichts. Sie folgte ihm, gab niemals Ruhe, bis sie recht behielt.
Oft war er zu bequem, seine Vorstellungen durchzusetzen. Sie regelte so vieles in ihrem gemeinsamen Leben und immer zu seiner Zufriedenheit. Selbst wenn er sich die Details mal anders vorgestellt hatte, gewöhnte er sich daran und richtete sich darin ein. Trotzdem kam es häufig zu unschönen Szenen wie jetzt. Stets war der Anlass ein nichtiger und keine Katastrophe, wie man aus dem Tonfall ihrer Worte hätte schließen können. Sie regte sich dennoch jedes Mal über alle Maßen auf.
»Darüber haben wir nicht gesprochen«, brummte er und mühte sich mit der Gangschaltung seines Pedelecs ab.
»Doch, sie hat es erklärt.« Irmgard ließ sich zurückfallen. »Ich habe es gehört.«
»Warum fragst du mich dann?«
»Ich habe dich nicht gefragt.«
»Das stimmt. Du hast nicht gefragt. Du hast mir nur wieder einen Vorwurf gemacht.« Helmuth zog beide Bremsen, und sein Rad blieb schliddernd stehen. Er war es leid. Er hatte gehofft, ihr mit diesem Ausflug eine Freude zu machen. Einen Tag in der Natur, die sie genauso sehr liebte, wie sie gern neue Erfahrungen machte. »Das hält jung«, sagte sie immer, wenn sie über solche Dinge mit ihren Bekannten sprachen, und dann hatte sie dieses Glitzern in den Augen, in das er sich vor einer Ewigkeit verliebt hatte und das er unter all dem Schutt eines halben Jahrhunderts Ehe jeden Tag zu finden hoffte. Also hatte er sie am Morgen mit einem Frühstück überrascht und anschließend ins Auto gepackt.
Im Informationszentrum im Nationalpark-Tor in Gemünd hatte ihnen eine freundliche Dame die beiden Elektroräder übergeben, die er reserviert hatte, und ihnen die Funktionsweisen erklärt. Es schien einfacher zu sein, als er vermutet hatte, und schon nach wenigen Metern hatte das Fahren ihm ungeheuren Spaß gemacht. Sein Plan sah vor, mit Irmgard bis an die Staumauer des Urftsees zu fahren, dort einzukehren und später gemütlich die Rückfahrt anzutreten. Die etwas mehr als zehn Kilometer bis zu ihrem Ziel hätten sie ohne große Anstrengung überwinden können. Dass er mit der Technik dann doch nicht so reibungslos klarkam, störte ihn, konnte aber das Gesamtvergnügen nicht schmälern. Bis Irmgard seine Versuche bemerkt und wieder einmal die Gelegenheit genutzt hatte, ihm seine Unfähigkeit vorzuwerfen. Er wollte das klären. Jetzt sofort.
Er schob sich aus dem Sattel und setzte einen Fuß auf die Erde. Den anderen ließ er auf dem Pedal stehen, bereit zu starten, nachdem er Irmgard die passende Antwort gegeben hatte. Hinter ihm fluchte seine Frau, Kies knirschte, und er hörte, wie sie stürzte. Er wandte sich um. Irmgard lag auf der Seite, das Fahrrad noch zwischen den Beinen. Sie schüttelte erbost den Kopf, stützte sich auf den linken Unterarm und wollte sich aufrichten. Stattdessen stieß sie einen Schrei aus und sank wieder zu Boden.
»Kannst du nicht aufpassen?«, zischte sie. »Jetzt bin ich wegen dir gestürzt.«
»Ich habe keine Augen im Hinterkopf, Irmgard«, entgegnete er und erinnerte sich daran, wie sein Sohn ihm vor Kurzem beim gemeinsamen Bau einer Gartenhütte gesagt hatte, er solle sich wehren.
»Was musst du auch bremsen?« Irmgard wandte unwirsch den Kopf zur Seite und versuchte erneut aufzustehen. Er ging zu ihr, hob das Rad auf und stellte es zur Seite. Er streckte die Hand aus.
»Kannst du aufstehen?«, fragte er, ohne auf ihre Vorwürfe einzugehen. Irmgard griff zu und kam langsam hoch. Ihren linken Arm hielt sie wie einen Fremdkörper vom Körper weg.
»Ich glaube, da ist etwas gebrochen.«
»Lass uns erst einmal eine Pause machen. Dann geht es vielleicht gleich wieder.«
»Ich möchte zu einem Arzt.«
Helmuth seufzte, nahm Irmgards Rad und drehte es gegen die Fahrtrichtung, aus der sie gekommen waren. »Dann los.«
»Und wie soll das deiner Meinung nach gehen?« Anklagend hob sie ihren Arm, wobei sie mit der Rechten den Ellbogen stützte. »Ich kann unmöglich mit dem Rad fahren.«
»Dann gehen wir eben zu Fuß.« Helmuth holte sein Gefährt, stellte sich zwischen die beiden Räder und umfasste die Lenker mit je einer Hand. »Kann losgehen.«
»Das sind fast sechs Kilometer.«
»Was schlägst du als Alternative vor?«
»Ruf jemanden an. Du hast doch ein Handy dabei.«
»Das funktioniert nicht.«
»Warum? Hast du wieder vergessen, es aufzuladen?«
»Es gibt hier keinen Empfang.«
»Wieso nicht?«
»Keine Ahnung.«
»Hast du dir den falschen Anbieter ausgesucht, der hier nicht sendet? Da muss man doch drauf achten, wenn man so ein teures Gerät kauft.« Irmgard giftete nicht, sie stellte fest.
»Wo ist denn dein Telefon? Vielleicht funktioniert das besser.«
»Du wolltest dich doch darum kümmern, hast du gesagt.« Sie verdrehte die Augen. »Aber wenn ich nicht an alles denke.«
»Du hast aber nicht daran gedacht, so wie es aussieht.« Helmuth packte fester zu und marschierte los. »Hinter der Kurve war ein Rastplatz. Dort kannst du dich hinsetzen, und ich fahre in den Ort, um Hilfe zu holen.« Er ging schneller, um einer Antwort zu entkommen, und presste die Lippen aufeinander. In der letzten Zeit hatte er sich mehr als einmal gefragt, warum er nicht schon vor vielen Jahren die Reißleine gezogen und die Ehe beendet hatte. Jetzt war es zu spät. Wenn sie sich jetzt trennten, bliebe von seiner Rente nichts mehr übrig, und sie würden beide ein Alter in Armut verbringen. Er fühlte einen Stich in der Brust. So hatte er sich das nicht vorgestellt.
Er erreichte die Sitzgruppe am Aussichtspunkt »Bird Watching Station«, lehnte Irmgards Rad an den Holztisch und setzte sich auf sein Fahrrad, während er auf seine Frau wartete.
»Bleib noch einen Moment«, sagte Irmgard, als sie zu ihm gestoßen war, und ließ sich auf die Bank fallen. »Vielleicht geht es nach einer Pause ja doch wieder.« Ihr Ton war jetzt deutlich weniger harsch. Sicher fand sie die Vorstellung, hier allein ausharren zu müssen, noch unangenehmer als die, mit dem verletzten Arm in den Ort zu fahren.
Helmuth nickte. Er stellte sein Rad ab und ging zu dem Rechten der beiden Fernrohre, die am Rand des Rastplatzes aufgebaut waren. Von hier aus hatte man einen phantastischen Blick über den Urftsee und die Anhöhen hinauf bis zur Burg Vogelsang. Helmuth beugte sich vor und sah hindurch. Es dauerte einen Augenblick, bis sich seine Augen auf die Schärfe eingestellt hatten, aber schließlich erkannte er ein Stück Brache direkt am Ufer des Sees. Der Widerschein der Sonne auf dem Wasser blendete ihn. Ein Blitz erhellte den dunklen Waldrand. Helmuth trat einen Schritt zurück, schaute über das Okular hinweg auf den See und hielt Ausschau nach der Stelle.
»Was machst du da?«, fragte Irmgard.
»Ich schaue mir die Umgebung an.« Er zeigte auf eine der Tafeln, die zur Erläuterung am Rand der Brüstung standen. »Mit diesen Dingern hier«, er wies auf die beiden Fernrohre, »kann man die Vögel beobachten. Es gibt an diesem Ort eine Menge Arten, die ich bisher noch nicht bewusst in freier Wildbahn gesehen habe.« Er beugte sich wieder zu dem Rohr hinunter und suchte noch einmal den Punkt von vorhin. Etwas an dem Blitz war ihm seltsam vorgekommen. Erneut bemerkte er eine Bewegung. Helmuth stutzte.
»Siehst du da was?«
»Ich bin nicht sicher.« Er schaute hoch, aber die Entfernung war zu groß, um mit bloßem Auge etwas erkennen zu können. »Vielleicht ein Wildschwein.« Er startete einen neuen Versuch. In dem Gebüsch, das an die Wiese grenzte, entdeckte er durch das Fernrohr einen dunklen Schatten und einen hellen Fleck. Als der Punkt sich rührte, traten die Einzelheiten des Bildes hervor. Ein Mädchen oder eine junge Frau lag dort im Gras. Über sie beugte sich eine Gestalt, schwarz verhüllt und maskiert. Die junge Frau strampelte mit den Beinen und schlug mit den Armen um sich, aber der Angreifer drückte sie mit einem Knie zu Boden.
»Mein Gott«, stammelte Helmuth und suchte hektisch sein Handy in der Jackentasche. »Er bringt sie um!« Hilflos sah er sich zu Irmgard um, die ihn mit verständnislosen Blicken musterte.
»Was erzählst du da wieder für einen Unsinn?«
»Das ist kein Unsinn.« Helmuth schüttelte sein Telefon, doch nichts veränderte sich an den Balken, die den Empfang angezeigt hätten, wenn da einer gewesen wäre. Hektisch blickte er durch das Rohr. Die dunkle Gestalt würgte das Mädchen, dessen Abwehrbewegungen immer schwächer wurden und schließlich erstarben. Der Angreifer löste seinen Griff, stand auf und trat mit dem Fuß gegen die junge Frau, als wollte er sichergehen, dass sie tot war. Helmuth schnappte nach Luft. »Er hat sie umgebracht«, flüsterte er heiser und spürte, wie ihm schwindelig wurde. »Ich muss Hilfe holen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät.«
»Helmuth!« Irmgard erhob sich von der Bank und humpelte auf ihn zu. »Du hast bestimmt nur wieder nicht richtig hingesehen. Wie soll denn dort jemand hinkommen?« Sie zeigte auf die Landzunge, die weit in den Stausee hineinragte, bevor sie durch das Fernrohr schaute. Sie schwenkte das Rohr hin und her, drehte an der Schärfeneinstellung. »Ich kann nichts sehen. Hast du es kaputt gemacht?«
»Herrgott, ich habe nichts kaputt gemacht.« Er schob sie zur Seite.
»Das waren bestimmt nur ein paar Schweine, die im Dreck nach Würmern gesucht haben.«
»Das sind ganz sicher keine Schweine gewesen, Irmgard.« Er stieg auf sein Rad, zögerte und griff in seine Jackentasche. »Hier. Das Handy. Vielleicht gibt es ja doch irgendwann wieder Empfang.«
»Du lässt mich wirklich allein hier?«
»Schaffst du es, mitzukommen?«
»Nein.«
»Dann muss ich dich zurücklassen, Irmgard.« Er zeigte mit ausgestrecktem Zeigefinger auf den See hinaus. »Dort draußen ist gerade eine junge Frau umgebracht worden. Ich muss Hilfe holen.«
»Und wenn der Mörder hierherkommt?«
»Du hast eben selbst gefragt, wie man dorthin kommen kann.«
Er wartete ihre Erwiderung nicht ab, sondern schwang sich auf das Rad, schaltete in den höchsten Gang und trat in die Pedale. Sein Gewissen meldete sich. Was, wenn der Täter wirklich kommen und Irmgard etwas antun würde, weil er sie für eine Zeugin hielt? Durfte er sie allein lassen? Auf der anderen Seite konnte es sein, dass jede Minute zählte, um das Leben der jungen Frau zu retten. Er schaute über die Schulter zurück. Irmgard saß hoch aufgerichtet und steif auf der Holzbank und sah auf den See hinaus. Ihren Helm hatte sie abgenommen und hielt ihn wie einen Schutzschild vor sich. Das Handy lag auf dem Tisch. Er konzentrierte sich wieder auf den Weg. Vorhin waren sie gemächlich gefahren, hatten jede Unebenheit, soweit es möglich war, vermieden. Jetzt holperte er durch Senken und hatte Mühe, das Elektrorad bei dem hohen Tempo unter Kontrolle zu behalten. Einmal ging ein Ruck durch das Vorderrad und schlug ihm den Lenker aus der Hand. Er fluchte, fasste nach und brachte das Rad wieder auf Spur. Ein stechender Schmerz bohrte sich durch seinen Brustkorb. Hatte er sich etwas gezerrt? Er schnappte nach Luft, hob sich ein Stückchen aus dem Sattel und setzte sich wieder. Nacheinander lockerte er seine Arme. Er hustete. Der Schmerz verging nicht. Er wurde intensiver, und ihm war, als raubte er ihm alle Kraft aus den Beinen. Er zog die Bremsen. Das Rad stoppte, und er stieg ab. Mühsam rang er nach Atem. Ihm wurde schlecht, und er übergab sich mitten auf den Weg. Seine Knie zitterten, als er sich von der Stelle entfernen wollte, und er musste sich mit seinem ganzen Gewicht auf das Fahrrad stützen. »Das kann doch nicht sein«, murmelte er, bevor er umkippte und ein Stück die Böschung hinunterrollte.
* * *
»Nein, Frau Müller, wir haben keine Kollegin dieses Namens hier bei uns auf der Wache«, bemühte ich mich, die aufgeregte Besucherin vor mir zu beruhigen. »Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Was vermissen Sie denn genau?«
»Mein Portemonnaie, eine Kette und das neue Taschentelefon, das mein Sohn mir vor ein paar Wochen geschenkt hat.«
»Sie meinen Ihr Handy?« Ich sah von meinem Notizblock auf. Die Frau tat mir leid. Wie sie dasaß, in ihrem besten Mantel, den sie sonst vermutlich nur sonntags zur Kirche anzog. Zurechtgemacht für den Gang zur Polizeibehörde. Sie hatte die siebzig weit überschritten, bewegte sich aber sicher und machte auch geistig einen fitten Eindruck. Sie war auf eine Trickbetrügerin reingefallen, und man konnte es ihr nicht verübeln. Die Diebin war geschickt. Stellte sich als Polizistin vor und gab an, eine Zeugenaussage überprüfen zu müssen. Frau Müller war die dritte Geschädigte in vier Tagen, die zu uns kam, um Anzeige zu erstatten. Es wurde Zeit, dass wir die Bevölkerung informierten.
»Was genau hat sie denn zu Ihnen gesagt?«
»Ich habe sie darauf hingewiesen, dass es sich um eine Verwechslung handeln muss.« Frau Müller umklammerte ihre Tasche, die sie vor sich auf dem Schoß stehen hatte. Auf ihren Handrücken erkannte ich Altersflecken, die als kleine Sprenkel ihren Unterarm hinaufwanderten. »Sie entschuldigte sich und bat mich, trotzdem kurz reinkommen zu dürfen, damit sie ihren Bericht schreiben kann.«
»Was passierte dann?«
»Ach Frau …« Sie zögerte und suchte nach einem Namensschild.
»Weinz. Ina Weinz«, half ich ihr aus.
»Frau Weinz, ich könnte mich ohrfeigen. Da hört man immer im Fernsehen von diesen Menschen, und am Ende fällt man selbst auf einen herein. Wie eine alte, dumme Frau.«
»Nein, das sind Sie nicht.« Ich lächelte. »Diese Trickbetrügerin geht sehr schlau vor, und wir müssen versuchen, sie so schnell wie möglich dingfest zu machen.«
Frau Müller erwiderte mein Lächeln und nickte. »Ja.«
»Können Sie mir eine Beschreibung der Frau geben?«
Wieder nickte sie, und ich notierte ihre Angaben auf dem Block, der vor mir lag. Ich würde später alles in das entsprechende Formular eingeben. Jetzt war es wichtiger, der alten Dame das Gefühl zu vermitteln, dass ich oder besser gesagt die Schleidener Polizei ihr helfen und dafür sorgen würde, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wurde. Ich musste ihr ja nicht sagen, dass es nur geringe Chancen gab, der Dame auf die Spur zu kommen, wenn wir nicht noch ein paar Anhaltspunkte mehr bekämen.
Mein Telefon klingelte. Eine Kölner Telefonnummer blinkte auf dem Display. Ich kannte sie. Es war meine alte Dienststellendurchwahl aus der Zeit, als ich noch bei der Mordkommission gewesen war, vor mehr als einem gefühlten Jahrhundert. Dabei waren noch keine vier Jahre vergangen, seit ich meine Siebensachen gepackt hatte und in die Eifel gezogen war. Der Kontakt zu meinem damaligen Kollegen und guten Freund Matthias Driesch war seither immer sporadischer geworden, beschränkte sich auf das eine oder andere private Telefonat und gelegentliche, über das Jahr versprengte Kölsch-Abende in unserer alten Lieblingskneipe. Wenn wir uns allerdings trafen, war es, als ob die letzte Begegnung erst ein paar Tage zurückgelegen hätte.
»Sie hat sehr langsam gesprochen. Das ist mir aufgefallen«, ergänzte Frau Müller übergangslos. Ich drückte den Anruf weg. Ich würde mich später bei Matthias melden.
»Hatte sie einen Akzent?«
»Nein. Sie klang nicht so, als würde sie hier aus der Eifel stammen.«
»Gut.« Ich notierte den Hinweis und legte den Stift zur Seite. »Wir halten Sie auf dem Laufenden. Allerdings …« Ich hustete verhalten und stand auf. »Allerdings kann ich Ihnen nicht versprechen, dass Sie Ihre Sachen wiederbekommen. Das Portemonnaie liegt sicher schon in irgendeiner Mülltonne, und das Handy landet vermutlich auf einem Flohmarkt. Haben Sie von der Kette Bilder? Oder eine Rechnung?«
»Nein.« Frau Müller wirkte bekümmert. »Der Schmuck ist ein Erbstück, von meiner Mutter. Eine Perlenkette. Mein Vater hatte sie ihr zur Silberhochzeit geschenkt. Sehr schade um das Erinnerungsstück.« Sie richtete sich auf und straffte die Schultern. »Aber so ist das im Leben, Frau Weinz. Man muss immer Abschied nehmen. Von Dingen und von Menschen, die einem viel bedeuten und ans Herz gewachsen sind. Ob man will oder nicht. Veränderung tut weh, aber man weiß, man wird es überleben. Auch das unabhängig davon, ob man will oder nicht.« Sie lächelte verhalten. »Und vor allem, je älter man wird.« Sie ging zur Tür. »Vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Weinz. Ich hoffe, von Ihnen zu hören.«
Ich lehnte mich auf meinem Stuhl nach hinten, hielt mich mit einer Hand an der Schreibtischkante fest und drehte mich hin und her, nachdem Frau Müller gegangen war. Eine Trickbetrügerin also. Ich ächzte leise und hatte Mühe, mich zur Weiterarbeit zu motivieren, obwohl es eine willkommene Abwechslung in meinem täglichen Einerlei bot. Nicht dass wir nichts zu tun gehabt hätten auf der Schleidener Wache. Im Gegenteil. Ich war ununterbrochen beschäftigt. Trotzdem wuchs meine Unzufriedenheit mit dem, was ich tat, von Monat zu Monat, ohne dass ich konkret hätte sagen können, woran es lag. Es war aber nicht nur das. Es war alles in meinem Leben. Meine Wohnung, die immer noch im halb fertigen Zustand verharrte, weil ich ihr nie meinen Stempel aufgedrückt, sondern nur einige meiner Möbel hineingestellt hatte. Meine Unfähigkeit, mich für oder gegen eine Beziehung zu entscheiden. Machte ich mir etwas vor, um mich weiterhin begehrt zu fühlen, wenn ich mal mit Steffen und mal mit Thomas so tat, als wären wir ein Paar? Mein mehr als kompliziertes Verhältnis zu Henrike, meinem Patenkind, die seit dem Tod ihrer Mutter vor zwei Jahren bei mir lebte und zu einem Vollblutteenager mit allen dazugehörigen Problemen herangewachsen war. Ich hatte gerade erst in meine Mutterrolle hineingefunden, wollte Henrike behüten und beschützen. Sie hingegen drängte ins Leben und musste sich bereits wieder lösen. Das Erwachsensein lernen.
Manchmal hatte ich das Gefühl, dass Henrike und ich nur deswegen in manchen Dingen gut miteinander auskamen, weil wir beide in gewisser Weise Opfer unserer Hormone waren. So unterschiedlich schienen Pubertät und Wechseljahre gar nicht zu sein. Ein großes Durcheinander in Kopf und Seele, darüber hinaus Pickel an Stellen und zu Zeiten, wo man sie überhaupt nicht gebrauchen konnte.
Vielleicht verdunkelte mir auch mein bevorstehender Geburtstag die Sicht auf die Dinge. Ein runder, wie man hier zu sagen pflegte. Fünfzig. Mit Glück die Mitte des Lebens, realistisch der Beginn des letzten Drittels. Das nährte meine Unzufriedenheit. Die klassische Frage nach dem »Alles«, das es dann gewesen sein soll. Nach dem Neuen, nach der Veränderung, nach der Entwicklung, die wie nicht eingelöste Versprechen im Raum standen. Jammern als Sinngebung. Selbstmitleid. Lebensmittekrise. Ich war schwer auszuhalten zurzeit. Sogar für mich selbst. Wieder ging das Telefon. Matthias.
»Feierst du eigentlich?«, fragte er, nachdem ich abgehoben und mich mit »Gärtnerei Rosenhügel« gemeldet hatte.
»Falsche Frage zur falschen Zeit.« Ich nahm den Block mit den Notizen meines Gesprächs mit Frau Müller und weckte meinen Computer.
»Ja oder nein?«
»Eher nein. Ich hab mir nur den Tag freigenommen.«
»Um eine wilde Party zu feiern?«
»Nein. Um mich zu verkriechen.«
»Gut.«
»Wieso gut?«
»Weil ich dann eine eigene kleine Festivität begehen kann.«
»Du wirst doch nicht fünfzig«, stellte ich fest.
»Nein. Ich werde befördert.«
»Wohin?«
»Falsche Antwort.«
»Wieso?«
»Im Normalfall beglückwünscht man denjenigen, der eine solche Mitteilung zu machen hat, mit einigen netten Worten, aus denen die Anerkennung und der Respekt sprechen, die man demjenigen für seine Leistung entgegenbringt.«
»Ich gratuliere dir, Matthias«, sagte ich mechanisch, löste ein Stück des Papiers an der Gummierung ab und rollte es mit dem Zeigefinger ein. Ich war nicht fair. Matthias konnte nichts für meine schlechte Laune. Und dass ich sie ihn spüren ließ, machte mich mir noch unsympathischer, als ich es ohnehin schon war.
»Du bist ungerecht, Ina. Ich kann nichts für deine Stinklaune.«
Pause. Ich grinste wider Willen.
»Du kannst meine Gedanken lesen.«
»Nicht erst seit heute.« Es klirrte im Hintergrund, und ich hörte ihn schlucken. Vermutlich trank er Kaffee aus einer von seiner Schwester getöpferten Tassen, von denen ich ebenfalls einige in meinem Büro stehen hatte. »Wie gut also, dass du nicht mehr hier arbeitest, denn sonst wäre ich als neuer Kommissariatsleiter dein Chef. Und wer will schon einen Chef, vor dem man keine Geheimnisse haben kann? Obwohl ich dich mit Kusshand sofort nehmen würde.« Sein Tonfall war wieder ernst geworden. Er atmete in die Pause hinein. »Also, was ist? Kommst du?«
»Zurück zur Kölner Mordkommission?« Im selben Moment, in dem ich das mit vorgetragener Ironie sagte, wurde mir klar, dass es weniger abwegig war, als ich ursprünglich gedacht hatte. Weg von hier. Weg aus der dörflichen Enge. Weg von den Routinen. Weg aus dem Eingebundensein in auferlegte Strukturen, die nicht meine waren. Nach Köln. Die Ruhe und Beschaulichkeit, die ich bei meinem Umzug nach Gemünd gesucht und in übergroßem Maß gefunden hatte, erstickten mich heute. Ich hatte mir etwas vorgemacht.
Statt einer Antwort schwieg Matthias und wartete ab.
»Wann?«, fragte ich nach ein paar Sekunden.
»So schnell hatte ich nicht mit deiner Zusage gerechnet – oder halt. Doch. Natürlich. Meine Überzeugungskraft ist wie immer exorbitant.«
»Ich meine deine Feier.«
»Schade. Aber nun gut. Übernächstes Wochenende hatte ich mir vorgestellt.«
»Da habe ich Geburtstag.«
»Du hast nicht an dem Wochenende, sondern an dem vor dem Wochenende stattfindenden Donnerstag Geburtstag. Wenn ich dich daran erinnern darf. Also?«
»Ich denke drüber nach, Herr Erster Hauptkommissar.«
»Tu das. Wenn du fertig bist, sag mir Bescheid. Und bring wegen mir den Förster mit.«
»Mal sehen. Ich glaube, es hat sich ausgeförstert.«
»Was glaubt er?«
»Das werde ich wohl nur erfahren, wenn ich zur Abwechslung mal ein wenig mit ihm plaudere. Das hat zurzeit eher Seltenheitswert.«
»Dann freue ich mich umso mehr, dass du mir deine Zeit geschenkt und wir beiden Hübschen mal wieder so ausführlich miteinander geplaudert haben, liebe Ina. Auf baldiges Wiederhören.« Es klackte in der Leitung. Er hatte aufgelegt.
Ich starrte den Hörer an. Matthias Driesch war der einzige meiner Kollegen, auf den ich mich wirklich immer blind verlassen hatte. Er war ein guter Freund. Trotz seiner Schrulligkeiten, trotz der unfassbar geschmacklosen Sweatshirts mit Bärchenapplikationen, die er von Zeit zu Zeit trug, und trotz seiner Eigenbrötlerei. Seit dem Tod seiner Mutter lebte er allein im elterlichen Haus in einem Kölner Vorort. Solange ich ihn kannte – und meines Wissen auch nicht in den Jahren zuvor –, hatte er noch nie eine längere feste Beziehung gehabt, weder mit einer Frau noch mit einem Mann. Der einzige schwarze Fleck auf der Seele unserer Freundschaft. Zu Anfang hatte ich versucht, mit ihm darüber zu reden, aber er hatte mich nur angesehen, den Kopf gesenkt und so schnell wie möglich das Thema gewechselt. Bei einer anderen Gelegenheit sprach er in dem Zusammenhang von Tauben auf dem Dach und Spatzen in der Hand und sah mich wieder mit dem gleichen Blick an. Als ich es erkannte, beeilte ich mich, das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken, um ihn nicht zu verletzen. Er war ein Freund. Der beste, den ich haben konnte. Aber nicht mehr, und es zu versuchen, hätte mit Sicherheit mehr zerstört, als uns beiden lieb gewesen wäre. In dem Moment hatte er begriffen, dass ich verstanden hatte, und wir schlossen einen unausgesprochenen Pakt, der seit vielen Jahren Bestand hatte. So manches Mal hatte ich mich mit einem leisen Bedauern gefragt, was geschehen wäre, wenn wir es versucht hätten. Wo es uns hingebracht hätte. Aber eine Antwort gab es nicht. Und jetzt wurde er Kommissariatsleiter. Er hatte es verdient. Nicht nur weil es an der Zeit war und er das entsprechende Alter erreicht hatte. Darauf kam es zum Glück nicht an. Er hatte es verdient, weil er ein großartiger Polizist war. Trotzdem bemerkte ich den Stich, den es mir versetzte. Die Sekunde, in der ich mich nicht für ihn freute, sondern das Gefühl hatte, mir wäre etwas genommen worden, was mir an seiner Stelle zugestanden hätte. Für diesen Posten war ich während meiner Zeit bei der Kölner Mordkommission eine hoch gehandelte Kandidatin gewesen, und vermutlich hätte ich, wenn ich geblieben wäre, meinen Fünfzigsten zusammen mit dieser Beförderung feiern können. Durch meinen Weggang hatte ich das alles verspielt. Und wofür? Ich zog genervt die Tastatur zu mir heran und öffnete das Berichtsformular, in das alle Vorgänge eingetragen wurden. Verkehrsunfälle, ab und an einen Hausfriedensbruch und als Highlight des Tages eine Trickbetrügerin. Na toll, dachte ich, ganz toll, Ina, und tippte die ersten Zeilen. Als das Telefon erneut ging, hob ich ab, ohne hinzusehen.
»Was vergessen?«
»Bitte?« Die Kollegin aus der Zentrale.
»Oh, Entschuldigung.« Ich räusperte mich. »Ich dachte, es wäre jemand anderes.«
»Aha.« Sie schwieg einen Moment, und ich hörte den Vorwurf in ihrer Pause. »Ein Arzt aus dem Schleidener Krankenhaus ist am Apparat. Er möchte mit dem diensthabenden Kommissar sprechen.«
ZWEI
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!