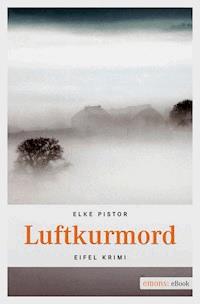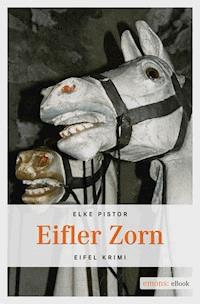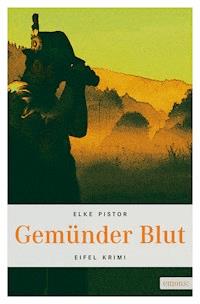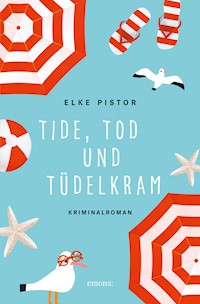Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Weihnachtskrimi
- Sprache: Deutsch
Die Miss Marple der Konditoren ermittelt auf dem Weihnachtsmarkt. Annemie Engel liebt drei Dinge in ihrem Leben: Schlager, ihren Kater Belmondo und ihren Beruf als Konditorin. Andere Menschen hingegen mag sie gar nicht. Am liebsten bleibt sie in ihre Backstube und backt Kuchen, Torten und vor allem Plätzchen, die ihr ihr Bruder Harald auf dem Weihnachtsmarkt verkauft. Doch als dieser kurz vor Weihnachten bei einer Explosion schwer verletzt und obendrein des Mordes verdächtigt wird, gerät ihre heile Welt aus den Fugen. Um ein altes Versprechen einzulösen, begibt sie sich auf die Suche nach dem wahren Mörder. Dabei ahnt sie nicht, welche Gefahren hinter den friedliche Kulissen des Niedelsinger Weihnachtsmarktes auf sie lauern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 382
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Elke Pistor, Jahrgang 1967, studierte Pädagogik und Psychologie. Seit 2009 ist sie als Autorin, Publizistin und Medien-Dozentin tätig. 2014 wurde sie für ihre Arbeit mit dem Töwerland-Stipendium ausgezeichnet und 2015 für den Friedrich-Glauser-Preis in der Kategorie »Kurzkrimi« nominiert. Elke Pistor lebt mit ihrer Familie und drei Katzen in Köln.
www.elkepistor.de
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2017 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: shutterstock.com/Doremi
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer
Lektorat: Marit Obsen
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-270-0
Ein Weihnachtskrimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Autoren- und Verlagsagentur Peter Molden, Köln.
Wunder gibt es immer wieder,heute oder morgenkönnen sie geschehen.Wunder gibt es immer wieder,wenn sie dir begegnen,musst du sie auch sehn.
»Wunder gibt es immer wieder«, gesungen von Katja Ebstein,Text und Musik: Christian Bruhn/Günter Loose (1970)
Kapitel 1
Als Annemie Engel am Morgen aufwachte, wusste sie, dass es ein Tag wie jeder andere werden würde. Sie freute sich, denn es war exakt das, was sie von ihren Tagen erwartete. Planbar, überschaubar und berechenbar sollten sie sein. Annemie Engel mochte keine Veränderungen. In den ersten zweieinhalb Jahrzehnten ihres bisher dreiundsechzigjährigen Lebens hatte es mehr Turbulenzen gegeben, als ihr lieb gewesen war. Aber in den ersten fünfzehn Jahren, so entschuldigte sie diesen Umstand regelmäßig sich selbst gegenüber, hatte sie eher wenig Einfluss darauf gehabt, und deswegen lag, so fand sie, die Verantwortung für die Geschehnisse in dieser Zeit nicht bei ihr. Mit fünfunddreißig hatte sie für sich eine Entscheidung getroffen und sie bis heute nicht bereut. Ganz im Gegenteil. Seit dem Tag, an dem sie zum ersten Mal die Tür hinter sich geschlossen hatte, wissend, niemand, den sie nicht einlud, würde ihr folgen, war sie zufrieden wie eine Maus in der Speisekammer. Denn Annemie Engel verabscheute nicht nur Veränderungen, sondern auch den Umgang mit fremden Menschen. Wobei das eine das andere oft bedingte, weswegen sie beides konsequent mied. Sie war seit Jahren nicht mehr aus dem Haus gegangen.
Annemie öffnete die Augen, drehte den Kopf und lächelte Belmondo zu, der neben ihr auf dem Kopfkissen schnarchte. Sie strich mit der Fingerspitze langsam von seiner Nasenspitze bis zur Stirn und kitzelte ihn an den Ohren. Aus dem Schnarchen wurde ein Schnurren. Der schwarze Perserkater seufzte tief, ohne die Augen zu öffnen. Annemie setzte sich auf, schob die Füße aus dem Bett und suchte mit den Zehen ihre Filzpantoffeln, während sie mit der linken Hand nach dem Morgenmantel griff. Sie hatte ihn am Vorabend sorgfältig bereitgelegt. Heute war der hellblaue Bademantel an der Reihe, denn heute war Freitag. Er war auch montags und mittwochs der Morgenmantel ihrer Wahl. Morgen, am Samstag, würde es der beigefarbene sein, so wie jeden Samstag, Dienstag und Donnerstag, und am Sonntag kam der lindgrüne mit Rosenmuster und Rüschen zu seinen Ehren.
»Frühstück, mein Lieber?«, fragte sie, stand auf und ging zum Fenster. Der Kater gab ein leises Knurren von sich. Annemie Engel schaute hinaus, betrachtete zuerst der Reihe nach die Häuser auf der gegenüberliegenden Seite mit ihren dämmerlichtgrauen Hauseingängen, den eng geparkten Wagen, den Mülltonnen und an Straßenlaternen angeketteten Fahrrädern. Hinter den meisten zugezogenen Gardinen und heruntergelassenen Jalousien schliefen die Leute. Nur vereinzelt fiel Licht auf den Gehweg vor den Häusern. Schatten bewegten sich darin. Wobei der Unterschied zwischen ihr und den anderen darin bestand, dass diese noch nicht schliefen, sie selbst aber bereits wieder aufgestanden war. »Unchristliche Zeit« hatte es irgendwann einmal jemand genannt, aber Annemie störte das frühe Aufstehen nicht. Hatte es noch nie. Als sie jünger war, sowieso nicht, und heute hatte sich ihr Körper längst an den Rhythmus ihres Berufes gewöhnt. Vermutlich konnte sie gar nicht anders, als direkt nach der Tagesschau zu Bett zu gehen und sechs Stunden und fünfzehn Minuten später ausgeruht und erfrischt zu erwachen. Ihre eiserne Disziplin, auf die sie sehr stolz war, tat ein Übriges.
Nach der gegenüberliegenden kam ihre eigene Straßenseite an die Reihe. Dazu beugte sie sich vor, bis ihre Stirn an die kalte Scheibe stieß. Sie drehte den Kopf nach rechts und links, blickte die Straße hinauf und hinunter und entdeckte zu ihrer Beruhigung nichts Ungewöhnliches. Alles war in Ordnung und zu ihrer Zufriedenheit.
Annemie zog den Morgenmantel an, schlang die Vorderteile eng um sich und knotete den Gürtel fest zusammen. Ihr Bild in dem großen Spiegel am Kleiderschrank ignorierte sie. Warum hätte sie auch hinschauen sollen? Sie wusste ja, wie sie aussah. Sie war dreiundsechzig und sicher kein eitler Mensch, aber sie musste zugeben, dass sie wirkte wie eine graue Maus im Tarnanzug. Graue Locken bis zum Kinn, die sie alle halbe Jahre einmal mit der alten Nähschere ihrer Mutter selbst schnitt, und eine Figur, die sich im Laufe der Jahre der Form ihrer Sahnebaisers angeglichen hatte. Im Sommer trug sie ärmellose Hauskittel aus pflegeleichtem Material und Birkenstocksandalen, jetzt im Winter zog sie unter den Kitteln enge Pullover und Strumpfhosen an. Wenn es zu kalt wurde, tat ihre graue Strickjacke über dem Kittel ihr wunderbar wärmendes Werk.
»Komm, mein Lieber«, rief sie über ihre Schulter hinweg dem Kater zu und hörte eine Sekunde später, wie er vom Bett plumpste und ihr auf seinen drei Beinen langsam folgte. Seine Krallen kratzten in unregelmäßigem Rhythmus über den Linoleumboden der Treppe, die zur Backstube hinunterführte. Auch Belmondo hatte seine besten Zeiten bereits hinter sich. Er hatte eines Tages an einem der Oberlichter zur Backstube gestanden und so lange herzzerreißend gemaunzt, bis Annemie sich erbarmt und das räudige Fellbündel ins Haus gelassen hatte. Er war schnurstracks auf die Schale mit Hackfleisch zugesteuert, die sie ihm hingestellt hatte, und hatte erst aufgehört zu fressen, als auch der allerletzte Krümel verputzt war. Dem Hackfleisch war eine Portion Sahne und der Sahne ein Stück Buttercremetorte gefolgt. Letzteres allerdings ungeplant, als Annemie nicht auf ihn geachtet hatte und der Kater auf die Arbeitsfläche gesprungen war. Nach seinem Festmahl hatte er sich zusammengerollt und so tief geschlafen, dass ihn selbst der Lärm der Teigmaschine nicht hatte aufwecken können. Seitdem teilte er Tisch, Bett und Backstube mit ihr.
Ohne das Licht anzuschalten, ging Annemie zur Anrichte, nahm eine Dose Katzenfutter und eine Gabel. Der Kater maunzte heiser und strich um ihre Beine, bis sie seine Futterschale gut gefüllt vor ihn auf den Boden gestellt hatte.
»Guten Hunger«, sagte sie und strich ihm über den Rücken.
Belmondo hob kurz den Kopf, blinzelte ihr langsam zu und widmete sich dann wieder seinem Napf. Die Schale klapperte. Annemie ging zur Kaffeemaschine, schaltete sie ein. Zwei Löffel auf drei Tassen. Direkt in die Thermoskanne. Eine zum Frühstück, eine nach dem Mittagessen und eine um fünfzehn Uhr. Nicht später, sonst konnte sie nicht einschlafen. Dann fünf Schritte zum Brotkasten, anderthalb Scheiben auf einen kleinen Teller, vier Schritte zum Kühlschrank, ein kleines Stück Butter, zwei Löffel Marmelade. Heute, montags und mittwochs Kirsche, dienstags, donnerstags und samstags Erdbeere. Quitte am Sonntag. Einmal war ihr die Quittenmarmelade ausgegangen, und sie hatte die Aprikosenmarmelade nehmen müssen, die sie für ihre Backwaren verwendete. Der ganze Tag war verdorben gewesen.
Mit Sorge betrachtete sie ihre schwindenden Vorräte. Es wurde dringend Zeit für einen Einkauf. Sie schrieb die Marmelade auf den Block mit dem Einkaufszettel, der auf der Anrichte lag, und überlegte, was sie noch brauchen würde. Das Katzenfutter reichte auch nur noch für ein oder zwei Tage.
»Du wirst immer verfressener, je älter du wirst, mein Lieber. Du musst mehr auf deine Figur achten!« Sie riss den Zettel vom Block und legte ihn so zurecht, dass sie ihn nicht vergessen würde, wenn Harald später kam. Er erledigte sämtliche Einkäufe für sie und verrechnete die Ausgaben mit ihren Einnahmen aus dem Keksverkauf.
Belmondo hatte sein Frühstück beendet. Er reckte sich, leckte zweimal über seine Vorderpfote und sprang dann auf das Regal mit den Vorratsdosen. Hier würde er bis auf kleine Unterbrechungen liegen bleiben und langsam vom Mehlstaub ergrauen, bis Annemie das letzte Blech aus dem Ofen gezogen und die Kekse zum Abkühlen auf der Arbeitsfläche abgestellt hatte. Annemie ging zu ihm und zupfte seine Decke zurecht, die sie ihm dorthin gelegt hatte, damit er es an seinem Lieblingsplatz bequemer hatte. Sie musterten sich einige Sekunden gegenseitig wie zwei Kollegen, die gleich in die Hände spucken und ihren gemeinsamen Arbeitstag beginnen würden.
»Heute sind Vanillekipferl, Zimtsterne und Butterspekulatius an der Reihe«, erklärte Annemie. Der Kater blinzelte und nickte.
Die Angewohnheit, nach dem Frühstück für Mensch und Tier in der Backstube noch im Bademantel die ersten Teigportionen anzusetzen, würde den Kontrolleuren vom Ordnungsamt vermutlich ebenso den Schweiß auf die Stirn treiben wie Belmondos Anwesenheit in der Backstube. Aber erst nachdem sie die veralteten Geräte, die rissigen Bodenfliesen und das spärliche Licht der Neonröhre beanstandet hätten. Annemies Backstube war, wie sie selbst, über die Zeit hinausgekommen, die man als gut hätte bezeichnen können. Annemie wusste genau, was passieren würde, wenn die Kontrolleure das nächste Mal bei ihr anklopften. Da nutzte es auch nichts, dass alles penibel sauber war und bis in die letzte kleine Ecke täglich geschrubbt und geputzt wurde. Vorschriften waren nun mal Vorschriften. Aber Geld war auch Geld. Und Annemie hatte keins. Nicht, um die Fliesen zu reparieren, nicht, um sich neue Maschinen anzuschaffen. Von den Einkünften, die sie durch den Verkauf ihrer Plätzchen, Kuchen und Teilchen an Haralds Marktständen erhielt, konnte sie leben, aber keine großen Sprünge machen. Harald hatte ihr angeboten, sie zu unterstützen, aber sie wollte nur von ihrer eigenen Hände Arbeit leben. Und wenn diese Hände zwar Kekse backen, aber keine Reichtümer erwirtschaften konnten, dann war das eben so. Punkt.
Annemie ging zum Kühlschrank und nahm die Butter heraus. Auf dem Rückweg begann sie zu singen, erst leise, dann immer lauter, und teilte dabei die Butter im Takt der Musik in kleine Stücke. Zweimal räusperte sie sich, dann war der Knoten aus ihrem Hals verschwunden. Die benötigten Gewürze standen alle in Reichweite auf einem Regal. Sie nahm sie und stellte sie auf die Arbeitsfläche. Als sie die Marzipanrohmasse und den Zucker aus der Vorratskammer holte, war sie beim Refrain eines ihrer Lieblingslieder angelangt. »Wunder gibt es immer wieder«, schmetterte sie dem Lärm der Maschine entgegen, während sie nacheinander die Butter, die Marzipanrohmasse und den Zucker hineingab und alles verknetete. Ihre Laune stieg mit jeder Note, die sie sang. Auch wenn sie außer dem Kater keine Zuhörer hatte, gab sie sich Mühe. Immerhin hatte sie als Kind im Kirchenchor die Solos singen dürfen. So schlecht konnte sie also nicht sein.
»Soll ich mit der Bank sprechen, Belmondo, was meinst du?«, rief sie über den Krach hinweg, als das Lied zu Ende war, und schlug die Eier in die Schüssel. Der Kater hob den Kopf. »Wenn ein Wunder geschieht und sie uns einen kleinen Kredit geben, kann ich das Notwendigste hier machen lassen.« Annemie nahm die Dosen mit den Gewürzen und öffnete sie. Sie maß nacheinander Zimt, Kardamom, Muskat, Salz und die gemahlenen Nelken ab, ohne die Aufschriften der Dosen zu lesen oder Angst vor einem falschen Griff zu haben. Sie erkannte jedes Gewürz an seinem Geruch, und das nicht allein deswegen, weil sie die Düfte seit Jahren kannte, sondern weil sie einen ausgeprägt guten Geruchssinn besaß. Sie schüttete die Mischung in den Teig. »Wir sind ja kein Großbetrieb. Das müsste doch machbar sein.«
Sie schaltete die Maschine auf eine höhere Stufe, gab das Mehl dazu, und der Lärm erreichte den Pegel eines landenden Flugzeugs. Sie konnte ihre eigene Stimme nicht mehr hören. Noch ein Punkt auf der Liste der Kontrolleure, diesmal in der Rubrik Arbeitssicherheit.
»Weißt du noch, wie viele Spekulatius Harald bestellt hat?«, fragte sie Belmondo, sobald der Teig fertig und die Maschine ausgeschaltet war. Sie griff nach einem ordentlichen Stapel orangefarbener Zettel. Annemie hatte irgendwann einmal die Farben festgelegt, und Harald hielt sich daran: Orange für die Bestellungen, blaue Zettel für private Mitteilungen und rote für besonders wichtige Sachen, die keinen Aufschub duldeten. Dann fiel ihr ein, dass sie gestern Abend nicht mehr nachgeschaut hatte.
Sie ging die Treppe hinauf und zum Briefkasten, der von innen an die Haustür geschraubt war. Sie öffnete ihn. Er war bis auf einen Brief von der Bank leer.
»War der feine Herr mal wieder zu bequem, einmal kurz um die Ecke zu gehen?«, knurrte sie unwillig, stopfte den Brief in die Tasche ihres Bademantels und öffnete die Tür zum Café, die ebenfalls vom Hausflur abging.
Das Dämmerlicht der Straßenlaternen fiel matt durch einen kleinen Schlitz über den Styroporplatten, mit denen die Scheiben abgehängt waren. Annemie vermied es, einen Blick auf die staubbedeckten leeren Regale und die umgedrehten Stühle auf den Tischen zu werfen, die ihre Beine wie tote Insekten in die Luft streckten. Das Café hatte vor achtundzwanzig Jahren zum letzten Mal Gäste empfangen, ehe Annemie am Abend die Tür verschlossen hatte. Seither lag es in einer Art Dornröschenschlaf, wobei Annemie dieses Bild nicht ganz richtig fand, weil das ja beinhaltete, dass das Café irgendwann vielleicht wieder geöffnet werden würde. Genau das würde zu ihren Lebzeiten aber nicht mehr geschehen.
Sie ging den kleinen Pfad bis zur Eingangstür entlang, den ihre Füße über die Jahre immer dann in den Staub getreten hatten, wenn Harald seine Zettel durch diesen Briefschlitz schob, statt sie in den Briefkasten zu werfen. Annemie hatte den Verdacht, dass er es absichtlich machte, nur um sie zu ärgern. Ihre gute Laune vom Singen war schlagartig verpufft. Sie bückte sich ächzend, um den Zettel aufzuheben.
»Liebe Annemie, ich brauche für morgen bitte sechshundert Stück Spekulatius, etwa genauso viele Kipferl. Zimtsterne habe ich noch, aber die Vorräte müssen aufgefüllt werden. Kannst du sie bitte schon für mich in Tüten verpacken? Viele Grüße, Harald«, stand in gedrechselter Schrift auf dem Papier.
»Das könnte ihm so passen. Ich bin Konditorin, keine Fachpackerin.« Annemie stopfte den Zettel in die Tasche ihres Morgenrocks, drehte sich um und ging wieder in die Backstube, wo der Teig genug geruht hatte. Mit beiden Händen griff sie die Schüssel, hob sie aus der Maschine und stürzte den Teigklumpen auf die Arbeitsfläche. Mit geübten Griffen formte sie daraus eine flache Kugel, die sie in Folie einschlug und in die Kühlung stellte.
Sie lehnte sich mit dem Rücken an die Arbeitsfläche und nahm einen Schluck aus ihrer Kaffeetasse. Der Kaffee war kalt, aber das störte sie nicht. »Was meint der denn, was ich bin? Was meint er, was er ist? Glaubt der, er könnte hier alles bestimmen? So weit kommt es noch. Das soll er sich besser nicht erlauben, der Herr, nach dem, was er sich geleistet hat.« Mit Schwung stellte sie die Tasse auf die Arbeitsfläche. »Oder was sagst du, Belmondo? Kann er das? Sich das leisten?«
Der Kater hob den Kopf und blinzelte.
»Findest du also. Aha. Das ist ja gut zu wissen. Ihr Kerle haltet natürlich zusammen.« Ärgerlich raffte sie ihren Morgenmantel noch enger zusammen und ging in Richtung Treppe. »Glaub aber mal nicht, dass er auch nur einen Finger krumm machen würde, was dich angeht. Dein Thunfischfilet könntest du dir bei ihm ins Fell schmieren.« Sie rauschte die Treppe hinauf.
Belmondo erhob und streckte sich. Dann ließ er sich auf den Boden plumpsen. Eine kleine Mehlstaubwolke schwebte über ihm, als er ihr folgte.
Exakt fünfundvierzig Minuten später – Annemie benötigte immer genau dreißig Minuten für ihre Morgentoilette (weniger Aufwand wäre unhygienisch, mehr wäre eitel) und fünfzehn für ihren Rundgang durch das Haus – stand sie wieder in der Backstube. Alles war, wie es sein sollte. Ihre beiden Zimmer aufgeräumt, das Badezimmer blitzte.
Seit ihrer Geburt lebte sie in diesem Haus, auf mehr als dreihundert über drei Etagen verteilten Quadratmetern, von denen sie aber mittlerweile nur noch knapp vierzig nutzte. Ihr Schlafzimmer, das Badezimmer und ein zum kleinen Wohnzimmer umfunktioniertes Kinderzimmer im ersten Stock über dem Café reichten ihr vollkommen aus. Sowohl vom Platz als auch von der Arbeit her. Belmondos langes Fell fiel nach nicht nachvollziehbaren Regeln aus und bildete kleine Fellbüschel, die wie Steppenläufer in der Wüste durch die Zimmer und die Flure rollten. Sie einzufangen und dazu noch den Staub aus jeder erdenklichen Ecke zu saugen, das Badezimmer zu putzen und die Fußböden sauber zu halten genügte Annemie an Putzarbeit in ihrem Privathaushalt. Dazu kam ja noch die Backstube.
Die übrigen Zimmer des Hauses mit den farbenfrohen Möbeln ihrer Eltern aus den siebziger Jahren, den vollgestopften Bücherregalen ihrer Mutter und den geerbten Ölschinken aus dem ehemaligen Schlafzimmer ihrer Großeltern darin hatte sie schon so lange nicht mehr betreten, dass es ihr schwerfiel, sich vor Augen zu führen, wie sie überhaupt aussahen. Sie erinnerte sich an Tapeten mit psychedelischen Mustern und eine orangefarbene Sitzgarnitur mit weißem Kunststoffrahmen, in die man hinein-, aber niemals hinauskam. Nippes und Spitzendecken, Fotos. Sie hatte die Vergangenheit weggeschlossen und die Schlüssel in einer Blechdose unter dem Treppenaufgang verstaut. Hier konnten sie bleiben, bis sie Rost ansetzten. Wenn sie das nicht schon getan hatten, denn Belmondo hatte das ein oder andere Mal wenig Zielgenauigkeit bei der Benutzung seiner dort ebenfalls stationierten Toilette bewiesen.
Annemie griff nach einem leeren Zettel und einem Kugelschreiber. »Verpack die Spekulatius selbst«, schrieb sie und legte den Zettel zur Einkaufsliste. Sie zögerte, schüttelte den Kopf und nahm sich die Nachricht noch einmal vor. Mit Schwung setzte sie ein dickes Ausrufezeichen hinter das letzte Wort und nickte zufrieden. Das musste er nun verstehen. Immerhin kommunizierten sie seit Ewigkeiten so miteinander. Nach dem »Ereignis«, wie Annemie es bezeichnete, hatte sie zuerst nie wieder mit Harald sprechen wollen. Auf Dauer hatte sich das aber als wenig praktikabel erwiesen, und so war sie dazu übergegangen, ihm Notizzettel mit kurzen Nachrichten zu schreiben. Harald hatte sich drauf eingelassen, wohl weil ihm letztlich nichts anderes übrig geblieben war. Sie war zehn Jahr älter als er, die große Schwester. Sie bestimmte die Regeln. Erst recht nach dem, was vorgefallen war.
Sie sah auf die Uhr. Um sechs würde Harald kommen und die fertigen Plätzchen für den Weihnachtsmarkt abholen. Sie musste sich beeilen, wenn alles rechtzeitig fertig sein sollte. Sechshundert Vanillekipferl, genauso viele Butterspekulatius und ein paar hundert Zimtsterne machten sich nicht von allein.
Um fünf Minuten vor sechs hatte Annemie singenderweise einen Zug nach Nirgendwo fahren, Conny Kramer sterben und Spaniens Gitarren erklingen lassen. In der Backstube duftete es nach frischem Weihnachtsgebäck verschiedener Couleur, und Annemie sog die buttrige Süße genüsslich durch die Nase ein. Sie hatte immer geglaubt, dass sie irgendwann dagegen abstumpfen würde. Dass ihre Nase schlechter und sie die gewohnten Gerüche nicht mehr wahrnehmen würde. Oder dass sie es nicht mehr ertragen könnte und zum Ausgleich an Senfgläsern, Bratkartoffeln oder eingelegten Heringen schnuppern müsste. Aber das war zu ihrer großen Freude nie passiert. Ganz im Gegenteil. Noch immer lief ihr bei den süßen Gerüchen das Wasser im Mund zusammen. Was gab es Besseres als eine Kombination aus zartschmelzender Schokolade und knusprigem Keks auf der Zunge? Was konnte himmlischer sein als der Geschmack einer samtigen Macaron-Ganache à la Piña Colada aus Ananas, weißer Kuvertüre, Rum und Kokosraspeln – auch wenn sie mit Rücksicht auf ihre Hüften seit Langem schon von allem immer nur ein Stückchen probierte? Die ganz modernen Sachen hingegen waren nicht so ihres. Torten, die unter dicken Fondant-Schichten verschwanden und deren Äußeres wichtiger war als ihr Innenleben, konnte Annemie nichts abgewinnen, auch wenn Harald schon den ein oder anderen Zettel mit entsprechenden Kundenwünschen hinterlassen hatte. Sie hob die letzten inzwischen erkalteten Kipferl mit zwei Löffeln vorsichtig in den Transportbehälter, verschloss ihn und schaute auf die Uhr. Harald war noch nicht da. Drei Minuten über der Zeit. Nun, er war nicht immer so pünktlich wie sie.
Nach zehn Minuten wurde sie unruhig, schob die Transportboxen hin und her, öffnete einen Deckel und rückte einen Zimtstern zurecht, bevor sie die Kiste wieder verschloss. Weitere fünfzehn Minuten und fünf auf Hochglanz polierte Backbleche später hielt sie es nicht mehr aus und beschloss, ihrem Bruder zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahrzehnten entgegenzugehen.
Sie stieg die Treppe hinauf, nahm ihren Mantel von der Garderobe, zog warme Stiefel an und öffnete die Haustür. Ein eisiger Wind schlug ihr entgegen, sehr kalt für den 1. Dezember. Sie streckte den Kopf zur Tür hinaus, schaute nach links und dann nach rechts die Straße hinunter. Jetzt waren deutlich mehr Autos und auch Fußgänger unterwegs. Einige Passanten grüßten sie im Vorbeigehen, und Annemie sah sich zu einem knappen Nicken genötigt. Vom Lieferwagen ihres Bruders keine Spur.
»Seltsam, seltsam, seltsam«, murmelte Annemie und trat wieder ins Haus. Sie merkte, wie Ärger in ihr hochstieg. Durch Haralds Unzuverlässigkeit geriet ihr ganzer Tagesplan durcheinander. Weitere Plätzchen und vor allem die Printen standen heute noch an. Schnaubend zog sie die Haustür hinter sich ins Schloss, hängte den Mantel zurück an den Haken und schlüpfte aus ihren Winterstiefeln. Nicht auszudenken, was diese Verspätung für Folgen haben könnte. Wenn Harald zu spät zum Marktstand kam, mussten die Kunden warten, reagierten vielleicht unzufrieden und gingen woanders ihre Plätzchen kaufen. Und sie, Annemie, müsste es ausbaden. Weniger Umsatz bedeutete weniger Geld. Weniger Geld bedeutete weniger Thunfischfilet für Belmondo und keine neuen Fliesen für die Backstube auf sehr lange Sicht.
»Es ist wirklich nicht zu fassen«, rief sie in die Backstube hinunter, weil sie Belmondo dort vermutete. »Was sollen wir nur machen, wenn –«
Die Türklingel unterbrach ihre Schimpftirade. Annemie drehte sich schwungvoll um, riss die Tür auf und hatte auf einmal vergessen, dass sie nie mehr ein Wort mit ihrem Bruder wechseln wollte.
»Was fällt dir ein, mich so lange warten zu lassen«, zeterte sie los, unterbrach sich aber, als sie bemerkte, dass es nicht Harald war, der da vor ihrer Tür stand.
»Frau Engel?«, fragte der Mann in der dicken Winterjacke und hielt ihr einen Ausweis hin. »Winfried Freudenruh ist mein Name, ich bin von der Polizei. Haben Sie einen Augenblick Zeit für mich?«
Kapitel 2
»Sie sind doch Frau Engel?«
»Ja.«
»Kennen Sie einen Herrn Harald Engel?«
»Ja.«
»Er ist Ihr Bruder?
»Sie sind von der Polizei. Was hat er wieder angestellt?«
»Frau Engel, vielleicht könnten wir kurz hineingehen.«
»Ich will damit nichts zu tun haben, was immer es auch ist. Er hat mir im Leben schon genug Scherereien gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass er es auch im Alter nicht lassen kann.« Annemie schob die Haustür zu.
»Warten Sie, Frau Engel«, sagte Winfried Freudenruh so laut, dass sie es auch durch die geschlossene Tür hören konnte. »Wären Sie bitte so nett und hören mir kurz zu? Ich muss wirklich mit Ihnen sprechen.«
Annemie zögerte. Dann zog sie die Tür einen Spalt auf und schaute den Polizisten schweigend an.
»Es wäre gut, wenn wir in Ruhe reden könnten.« Freudenruh erwiderte ihren Blick, lächelte zurückhaltend und mit zerknautschtem Gesicht, sodass Annemie unwillkürlich an einen dieser chinesischen Hunde denken musste, die sie neulich in einer Zeitschrift gesehen hatte. Er hatte in etwa ihr Alter, dafür aber noch erstaunlich volles weißgraues Haar, durch das er sich jetzt mit der Hand fuhr.
»Kommen Sie rein.« Sie öffnete die Tür, drehte sich auf dem Absatz um und ging durch den Hausflur in Richtung Treppe. Freudenruh folgte ihr. »Machen Sie die Haustür hinter sich zu«, wies Annemie ihn über ihre Schulter hinweg an. Sie stieg in die Backstube hinunter und machte sich an den bereits sehr sauberen Backblechen zu schaffen. »Ich muss die Waren fertig machen und habe nicht viel Zeit. Also wäre es mir lieb, wenn Sie sich kurzfassen.« Sie hoffte, er würde schnell wieder verschwinden. Kurz überlegte sie, ob es so schlau gewesen war, den Polizisten in ihre Backstube zu lassen, kam aber zu dem Schluss, dass die Polizei wohl kein Interesse an ihren kaputten Fliesen haben würde. Außerdem war hier der einzige Raum des Hauses, der ihrer Ansicht nach groß genug war, um genügend Abstand zwischen ihm und sich halten zu können.
»Frau Engel, Ihr Bruder hatte eine Notiz in seiner Brieftasche, auf der für Notfälle Ihr Name und diese Adresse vermerkt waren.« Er machte eine kurze Pause. »Es gab einen Vorfall auf dem Weihnachtsmarkt vor etwa zwei Stunden. Eine Gasexplosion.« Er verstummte und beobachtete sie. Annemie spürte, wie ihr trotz der Wärme in der Backstube kalt wurde.
»Ist er tot?«, fragte sie und wusste nicht, wo das Zittern in ihrer Stimme mit einem Mal herkam.
»Nein. Ihr Bruder wurde verletzt. Allerdings sehr schwer verletzt. Er liegt auf der Intensivstation. Die Ärzte wollen sicher mit Ihnen sprechen.«
»Aha.« Annemie nickte und schwieg.
»Möchten Sie, dass ich Sie hinfahre?«, bot Freudenruh an.
»Nein danke.« Annemie schüttelte den Kopf, blieb aber ansonsten reglos hinter der Arbeitsplatte stehen.
»Soll ich jemanden für Sie anrufen, damit derjenige herkommen und Sie unterstützen kann?«
»Ich brauche niemanden, danke.« Sie richtete sich kerzengerade auf, legte die Hände auf die Arbeitsfläche und schaute Freudenruh abwartend an.
»Da ist noch etwas, Frau Engel.« Sein Tonfall änderte sich. Von vorsichtigem Tasten hin zu mehr Aufmerksamkeit in der Stimme.
»Ja?«
»Ihr Bruder war nicht allein, als die Explosion stattfand. Es gab einen Toten. Horst Heßler. Kannten Sie ihn?«
»Nein. Ich gehe nicht aus dem Haus und kenne keine Leute.«
»Können Sie sich vorstellen, warum die beiden so früh am Morgen auf dem Weihnachtsmarkt waren?«
»Um zu arbeiten? Mein Bruder hat sicher alles vorbereitet.«
»Es ist hilfreich, wenn Sie uns alles sagen, was Sie wissen, Frau Engel. Wir prüfen intensiv, ob Fremdverschulden in Frage kommt.«
»Es tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen. Ich weiß nicht, mit wem mein Bruder seine Zeit verbringt.« Sie griff nach dem Mehlbesen. »Wenn ich Ihnen helfen könnte, würde ich das sicher tun. Aber ich kann es nicht. Deswegen würde ich mich jetzt gerne wieder an meine Arbeit machen, Herr …« Annemie suchte nach dem Namen.
»Freudenruh. Hauptkommissar Winfried Freudenruh.«
»Ja.« Annemie trat hinter der Arbeitsplatte hervor. Es fiel ihr sehr schwer, sich dem Kommissar zu nähern und an ihm vorbei zur Tür zu gehen, aber ihr Wunsch, allein und in Ruhe nachdenken zu können, war deutlich größer als die Abneigung gegen die Nähe dieses Fremden und die Nachrichten, die er mitgebracht hatte.
»Ich begleite Sie nach oben«, sagte sie und wies mit einer knappen Geste die Treppe hinauf Richtung Ausgang. Freudenruh zog eine Visitenkarte aus der Innentasche seiner Jacke und reichte sie ihr.
»Wenn Ihnen noch etwas einfällt, bitte ich Sie, sich bei mir zu melden, Frau Engel«, sagte er, bevor er nach oben stieg. Annemie folgte ihm schweigend. Als sie an der Tür standen, suchte er ihren Blick. »Ich werde in den nächsten Tagen noch einmal bei Ihnen vorbeischauen. Es gibt einige Fragen, die ich Ihnen stellen muss.« Es klang wie eine Drohung.
Er reichte ihr die Hand, Annemie ignorierte sie. Sie schloss die Haustür hinter ihm und drehte den Schlüssel zweimal herum. Dann ging sie wieder in die Backstube, nahm ihre Tasse und trug sie zur Spüle. Langsam drehte sie den Wasserhahn auf, ließ das Wasser laufen, bis es heiß wurde. Belmondo sprang von seinem Ausguck und strich um ihre Beine. Er maunzte, stellte sich auf die Hinterpfoten und rieb seinen Kopf an ihr. Annemie reagierte nicht. Sie griff nach der Spülbürste, schüttete etwas Geschirrspülmittel darauf und säuberte die Tasse sehr gründlich und ausdauernd. Der Kommissar hatte gesagt, die Polizei prüfe intensiv, ob Fremdverschulden vorlag. Das bedeutete, dass sie die Gasexplosion nicht für einen Unfall hielten. Dafür gab es sicher einen Grund. Es gab immer für alles einen Grund. Wie auch einen Schuldigen. Und in Haralds Fall hatten Grund und Schuld schon sehr oft miteinander in Zusammenhang gestanden. Aber das hier? Ein Toter? Das war nicht Haralds Art. Ein längst verdrängtes Gefühl zupfte leise an ihren Gedanken und wollte, dass sie sich Sorgen um ihren Bruder machte.
»Nein, das machen wir nicht mehr, Schatz, oder?«, fragte sie Belmondo, bückte sich und hob den Kater hoch. »So was wollen wir nicht mehr. Das ist uns noch nie gut bekommen. Wir kümmern uns einfach nicht darum. Harald muss die Suppe, die er sich eingebrockt hat, auch auslöffeln. Wir backen die Kekse. Er verkauft sie. Wir haben eine auf einem professionellen Umgang beruhende Geschäftsbeziehung. Mehr nicht.« Sie küsste Belmondo auf die Stirn und presste ihn an sich. Der Kater schnurrte.
Wieder klingelte es an der Haustür. Annemie schrak zusammen, Belmondo befreite sich und sprang zu Boden. Es klingelte erneut.
»Nicht schon wieder«, murmelte Annemie und wappnete sich, um sich an diesem Tag bereits zum dritten Mal der Außenwelt zu stellen. »Haben Sie etwas vergessen?«, fragte sie, als sie die Tür öffnete. Überrascht trat sie einen Schritt zurück.
Dort stand nicht Hauptkommissar Winfried Freudenruh, sondern ein Mann Anfang, Mitte dreißig in dunkler Lederjacke, die definitiv schon bessere Zeiten gesehen hatte, schwarzem T-Shirt und einer Jeans mit Löchern. Außerdem trug er Turnschuhe, bei denen Annemie nicht sicher war, ob die graue Farbe so gedacht oder angesammelter Dreck war. Der Dreitagebart und die dunklen Locken komplettierten das Bild eines Mannes, den Annemie noch nie gesehen hatte.
»Da bin ich«, sagte er, schob die Tür auf und stellte zwei große Koffer im Flur vor Annemies Füßen ab. »Wo kann das hin?« Er schenkte ihr ein strahlendes Lächeln. Annemie wich einen Schritt zurück.
»Wer sind Sie?«, fragte sie verblüfft.
»Na, Farin.« Der Mann sagte das so, als gäbe es nichts Selbstverständlicheres auf der Welt.
»Herr Na-fa-rin.« Annemie betonte jede Silbe und stellte einen Fuß quer hinter die Tür, um zu verhindern, dass er sie weiter aufschieben konnte. Man hörte ja so viel über das, was älteren Leuten alles passieren konnte. Der junge Mann schüttelte den Kopf. »Was möchten Sie hier?«
»Nein. Nicht Nafarin. Nur Farin. Farin Said.« Er machte wieder Anstalten, den Flur zu betreten.
»Nafarin oder Nurfarin. Das ist mir völlig egal.« Diesmal stellte sie sich mitten in den Hauseingang und musterte ihn von oben bis unten. »Sie sind doch Ausländer«, stellte Annemie fest.
»Nein. Das war ich mal. Das ist aber schon fünfzehn Jahre her. Seitdem lebe ich in Deutschland.«
»Sagen Sie mir, was Sie hier wollen, oder gehen Sie.« Annemie hatte keine Lust, sich weiter von ihm aufhalten zu lassen, wie auch immer jetzt sein Name war. »Und kommen Sie mir nicht mit einem Enkeltrick. Ich bin mir nämlich sehr sicher, keinen Enkel zu haben.«
Farin Said runzelte die Stirn, dann lachte er. »Nein, nein, keine Angst. Kein Enkel. Und auch kein Glas-Wasser- oder Mal-eben-telefonieren-Trick. Ich meine es ernst. Darf ich rein?«
»Und ich meine es ebenfalls ernst. Nein.«
Farins fröhliche Miene verschwand. »Dann wissen Sie nicht Bescheid?«
»Worüber?«
»Über Harald.« Er sprach jetzt leiser. »Er ist im Krankenhaus.«
»Doch, das weiß ich. Ein Polizist war gerade hier und hat es mir gesagt. Aber was hat das mit Ihnen zu tun?«
»Ich muss jetzt bei Ihnen wohnen.«
»Sie müssen was?«
»Bei Ihnen wohnen.« Er zeigte auf die Koffer und schlang dann wärmend seine Arme um sich. »Darf ich bitte reinkommen? Es ist kalt.«
»Nein, Sie dürfen nicht rein, und Sie dürfen auch nicht bei mir wohnen«, sagte Annemie energisch. »Da könnte ja jeder kommen.« Sie schnaubte ärgerlich und schloss die Tür.
Die Klingel ertönte. Annemie ignorierte sie, wandte sich um und ging zur Treppe. Es klingelte ein weiteres Mal, diesmal penetrant lange. Ärgerlich machte sie auf dem Absatz kehrt, riss die Tür auf und baute sich vor dem Mann auf.
»Wenn Sie nicht sofort verschwinden, rufe ich die Polizei«, schimpfte sie.
»Sie sind aber doch Haralds Schwester? Oder bin ich hier falsch?« Farin Said ließ die Schultern hängen, sein Sonnyboy-Lächeln war verschwunden.
»Ich bin Haralds Schwester, aber Sie sind hier trotzdem falsch. Das ist keine Jugendherberge.«
»Aber ich weiß nicht, wo ich sonst hinkann. Ich arbeite für Harald auf dem Markt. Gestern hat sich meine Freundin von mir getrennt, ich sollte meine Sachen packen und verschwunden sein, wenn sie heute von der Arbeit kommt, und Harald meinte, ich könnte übergangsweise im Stand übernachten.«
»Dann machen Sie das doch.«
»Der Marktstand hat die Explosion nicht heil überstanden.
»Das ist nicht mein Problem, sondern Ihres. Außerdem kenne ich Sie nicht einmal. Wieso sollte ich Ihnen glauben, dass Sie die Wahrheit sagen? Oder Sie sogar bei mir wohnen lassen? Warum gehen Sie nicht zu Ihrer Freundin und entschuldigen sich?«
Farin Said presste die Lippen aufeinander. »Harald hat mir mal erzählt, dass Sie eine Blume mit vielen Dornen sind, aber nicht, dass Ihr Herz hart wie ein Fels in der Wüste ist.«
»Reden Sie nicht so einen Unsinn«, wehrte Annemie schnaubend ab. »Von Dornen und Felsen hat er bestimmt nichts gesagt.«
»Aber er hat mir gesagt, dass Sie im Kern ein guter Mensch sind. Und deswegen bin ich jetzt hier, weil ich einen guten Menschen brauche und hoffe, dass Sie mir helfen werden. Der Neue meiner Ex wäre sicher nicht begeistert, wenn ich einfach so vor der Tür stehen würde.
»Na, dann sind wir ja schon zwei.«
Farin Said lächelte unsicher und neigte den Kopf zur Seite. »Ich könnte Ihnen doch helfen.«
»Ich brauche keine Hilfe. Von niemandem.«
»Wer soll denn jetzt Ihre Kekse verkaufen? Harald liegt doch im Krankenhaus.«
»Das mache ich selbst.«
»Aber Sie haben keinen Marktstand mehr. Jemand muss ihn reparieren.«
Annemie biss sich auf die Lippen. Dieser Farin hatte recht. Sie konnte zwar die Weihnachtsplätzchen in der Nacht backen und sie, wenn es wirklich nötig war, tagsüber verkaufen. Wobei die Vorstellung, zwölf Stunden lang den Menschenmengen ausgesetzt zu sein, schlimmer war als geronnene Buttercreme. Aber einen Weihnachtsmarktstand zu reparieren, und das auch noch so schnell wie möglich, überstieg definitiv ihre Fähigkeiten.
»Darf ich denn wenigstens kurz reinkommen, mich ein bisschen aufwärmen und meine Koffer bei Ihnen abstellen, bevor ich mich auf die Suche nach einem Bett mache?«, wollte Farin Said wissen. Er klang resigniert. »Bitte«, schob er nach, als Annemie keine Anstalten machte, sich von der Stelle zu rühren, weil sie innerlich immer noch schwankte, was sie darauf antworten sollte. »Oh.« Farin Said sah an Annemie vorbei in den Hausflur hinein. »Sie haben eine Katze.«
Annemie spürte, wie Belmondo um ihre Beine strich, und blickte irritiert nach unten. Er traute sich nie bis zur Haustür hervor, wenn Besuch da war – was ja ebenfalls so gut wie nie vorkam. Sehr wahrscheinlich hatte ihn die ungewöhnliche Häufung aus seinem gewohnten Rhythmus gebracht.
»Wussten Sie, dass Perserkatzen gar nicht aus Persien, sondern aus England kommen?« Farin Said bückte sich und streichelte Belmondos Kopf. Der schnurrte laut.
»Er mag sonst keine Fremden«, stellte Annemie fest, seine Bemerkung ignorierend. Sie zögerte einen weiteren Moment und trat dann von der Tür zurück. Annemie zeigte auf eine freie Stelle neben der Treppe. »Sie können die Koffer erst mal dort abstellen. Wir müssen überlegen, was zu tun ist.«
»Heißt das, Sie lassen mich bei Ihnen wohnen?«
»Nein, das heißt, wir müssen überlegen, was zu tun ist.« Annemie schob die Hände in die Taschen ihres Kittels.
»›Akl al einab habba‹, pflegte mein Großonkel zweiten Grades väterlicherseits zu sagen. ›Trauben werden eine nach der anderen gegessen.‹«
»Vielleicht könnten Sie ja bei Ihrem Großonkel zweiten Grades väterlicherseits wohnen? Haben Sie schon mal darüber nachgedacht?« Annemie schaute zu ihm hoch. Er war mehr als zwei Kopf größer als sie selbst und hatte eine sportliche Figur. Durchtrainiert nannte man das wohl heute.
Farin Said nickte. »Sicher. Er würde mich bestimmt bei sich wohnen lassen. Leider wäre das in Ägypten, und er ist außerdem schon tot.« Er hob bedauernd die Schultern. »Hätten Sie vielleicht ein Glas Wasser für mich?«
Annemie atmete tief ein und wieder aus, schloss und öffnete die Augen, ballte die rechte Hand zur Faust und ließ wieder locker. Das wiederholte sie dreimal, weil sie in der »Bäckerblume« gelesen hatte, dass das eine gute Entspannungsübung sei und man unschöne Dinge auf diese Weise einfach wegatmen könne. Wie sie damals schon vermutet hatte, funktionierte es nicht. Farin Said stand immer noch in ihrem Hausflur und lächelte sie erwartungsvoll an.
»Ein Glas Wasser. Dann überlegen wir.«
In der Backstube ging sie zum Geschirrschrank, holte ein Glas heraus und füllte es am Wasserhahn mit Leitungswasser. Sie reichte es Farin Said. Der nahm es mit einer leichten Verbeugung entgegen, trank einen Schluck und sah sich um. Er schloss die Augen und schnupperte genießerisch.
»Kardamom, Anis und Mandellikör. Lassen Sie mich raten. Butterspekulatius, Vanillekipferl und Zimtsterne.«
»Wenn Sie für Harald arbeiten, kennen Sie sicher seine Bestellung. Das ist also keine Kunst.« Annemie verschränkte abwehrend die Arme vor der Brust. Wenn dieser Farin meinte, er könne sie beeindrucken und um den Finger wickeln, hatte er sich aber gewaltig getäuscht. Sie selbst hatte einen ausgezeichneten Geruchssinn, konnte auch exotische Gewürze noch in kleinster Dosierung erschnuppern und bestimmen.
»›Eine schlaue Frau kann auch mit dem Fuß eines Esels spinnen‹, hat meine Großmutter mütterlicherseits immer gesagt.« Farin trank aus und brachte das leere Glas zur Spüle. Übergangslos fragte er: »Was haben Sie jetzt wegen Harald vor?«
»Was geht Sie das an?«
»Er ist mein Chef. Und mein Freund. Ich würde gerne zu ihm, aber sie lassen mich nicht, weil ich kein Angehöriger bin. Aber ich mach mir große Sorgen um ihn.«
Annemie musterte Farin von oben bis unten. Hatte sie da etwas verpasst? Ihr Bruder hatte nie geheiratet. Sie konnte sich zwar an eine oder zwei Freundinnen von früher erinnern, aber sonst war da nie jemand gewesen. Sie hatte es immer den besonderen Umständen zugeschrieben, und der Gedanke, der ihr jetzt kam, war neu für sie. Und irritierend. Sie wusste nicht, wie sie reagieren sollte. Heutzutage hatte man so was ja immer öfter. Männer mit Männern und Frauen mit Frauen. Und seit Neuestem durften sich auch alle untereinander verheiraten, wie sie lustig waren, was Annemie nur folgerichtig und gut fand. Aber hatte er nicht eben gesagt, seine Freundin habe ihn rausgeschmissen?
»Ich habe nicht vor, etwas zu unternehmen«, klärte sie Farin Said auf und beschloss, den Grad der Freundschaft zwischen Harald und Farin Said nicht näher zu eruieren.
»Nichts?« Verblüfft starrte Farin sie an. »Aber er ist doch Ihr Bruder.« Als Annemie nicht reagierte, ergänzte er: »Er ist Familie.«
»Ja. Zu meinem größten Bedauern.«
»Aber Sie müssen doch mit den Ärzten sprechen.«
»Müssen muss ich gar nichts.«
»Sie wollen nicht.«
»Ganz genau.«
»Warum?«
»Was geht Sie das an?«
»Nichts.« Farin Said zog die kleine Trittleiter unter der Arbeitsfläche hervor, mit der Annemie die weniger oft benutzten Backutensilien aus den oberen Hängeschränken holte, klappte sie auf und setzte sich. »Sie haben recht. Es geht mich nichts an. Ich frage Sie aber trotzdem. Weil Harald es verdient hat, dass sich jemand nach ihm erkundigt. Dass sich jemand um ihn kümmert.«
»Ich habe mich oft genug um ihn gekümmert. Und es ist mir nie gedankt worden. Ganz im Gegenteil.«
»Er hat Sie enttäuscht?«
»Ja.« Annemie legte die Hände auf die Arbeitsfläche. Sie fühlte sich glatt und kühl an. So wie ihr Inneres bei dem Gedanken an die Enttäuschung, die Harald ihr bereitet hatte. Sie hatte gelernt, es an sich abgleiten zu lassen.
»Was ist, wenn er stirbt?«, fragte Farin Said mit belegter Stimme. »Seine Verletzungen sind schwer.« Er sah sie an. Nachdenklich, wie Annemie fand. Nachdenklich und mit einer Trauer im Blick, die über seine Sorge um Harald weit hinausging. Sie kannte ihn seit nicht einmal zehn Minuten, hatte aber das Gefühl, er würde sich geduldig anhören, was sie zu erzählen hatte. Wenn sie es denn erzählen wollte. Was mit Sicherheit nicht der Fall war. Eher würde sie eine ganze Wagenladung Spritzgebäck von Hand aus der Tülle drücken.
»Was ist dann?«, fragte sie und war selbst erschrocken über die Härte in ihrer Stimme.
»Dann haben Sie die Chance vergeben, sich mit Ihrem Bruder zu versöhnen.«
»Auf Versöhnung bin ich nicht aus«, murmelte Annemie und horchte ihren eigenen Worten nach.
Farin Said blinzelte. Dann stand er abrupt auf. Er klappte die Leiter geräuschvoll zusammen und schob sie wieder unter die Arbeitsfläche. »Tja. Wenn das so ist. Ich hatte Sie wohl falsch eingeschätzt. Aber man kann sich ja mal irren. Ich gehe dann jetzt am besten und suche mir eine Bleibe. Irgendein Kumpel wird schon ein Sofa für mich frei haben.« Er ging zum Ausgang der Backstube. »Einen neuen Job finde ich sicher auch bald. Die Koffer komme ich holen, sobald ich was habe. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, wenn die noch ein paar Stunden in Ihrem Hausflur herumstehen.« Er stieg die Treppe hinauf. Annemie starrte ihm hinterher.
»Warten Sie!«, sagte sie leise, aber laut genug, dass er sie hören konnte.
Farin Said blieb stehen.
»Warum gehen Sie jetzt?«
Wortlos sah Farin sie über die Schulter hinweg an. Dann schüttelte er leicht den Kopf, wandte sich von ihr ab und ging weiter die Treppe hinauf.
Annemie hielt inne und lauschte auf seine Schritte. Die Treppe hatte siebzehn Stufen aus Stein. Die Jahre hatten in jede einzelne Macken geschlagen. Jede Stufe hatte ihren eigenen Klang. Annemie kannte jeden Ton genau und wusste, wann er oben sein würde.
»Warten Sie«, sagte sie und rief dann noch einmal, weil sie befürchtete, er könnte sie nicht hören: »Warten Sie!«
Sie hatte Streit mit Harald. Sie wäre diszipliniert genug, die doppelte Belastung von Backen und Verkauf auf dem Weihnachtsmarkt zu verkraften. Sie würde das schaffen. Allein. Aber etwas in dem Blick des jungen Mannes hatte sie schockiert. Gefiel sie sich wirklich so kaltschnäuzig und herzlos, wie er sie gerade gesehen hatte? Die Schritte blieben aus. Annemie ging zur Treppe und sah zu Farin Said hinauf.
»Können Sie auch einkaufen?«
Farin nickte.
»Und mit dem Bus fahren?«
»Auch das.«
»Dann bringen Sie mich zu Harald.«
Kapitel 3
Das Glimberger Krankenhaus sah aus wie ein bunter Bauklotz, den ein Kind auf der Wiese verloren hatte. Oder besser wie ein Haufen bunter Bauklötze, die von einem hyperaktiven Kind ausgeschüttet und dann kräftig durcheinandergewirbelt worden waren. Wenn man die weit voneinander entfernten Gebäudeteile überhaupt als ein Krankenhaus bezeichnen wollte. Das Parkhaus, neben dem die Haltestelle lag, an der Annemie und Farin aus dem Bus stiegen, war blau. Das Bettenhaus, auf das sie über einen grau gepflasterten Weg zugingen, strahlte in der Farbe Rot. Daneben erhob sich ein pinkfarbener Kuppelbau, der Annemie an einen Muffin erinnerte und den ein Schild als Psychiatrie auswies. Sie fragte sich ernsthaft, ob diese Farbe die Patienten nicht noch verrückter machte, als sie ohnehin schon waren, bis ihr einfiel, dass diese ja aus dem Gebäude hinaus- und damit auf die Bauten in Grün, Gelb und etwas, das wohlmeinend aussah wie geschmolzenes Schokoladeneis, schauten. In Wirklichkeit glich es aber eher der Hinterlassenschaft eines Hundes mit Verdauungsproblemen. So gesehen war es vielleicht sogar eine Art geschickte Farbtherapie, die ihnen den kreischend pinken Anblick ersparte.
Sie hatte sich für den Besuch im Krankenhaus extra umgezogen. Zu ihrem einzigen schwarzen Rock trug sie nun einen hellblauen Strickpulli, den sie früher immer sehr gerne gemocht hatte, weil die beiden beigen Längsstreifen links und rechts an der Seite so gut zu ihren blonden Haaren gepasst hatten. Der Pulli saß heute zwar etwas enger als vor fünfzehn Jahren, und ihre Haare waren grau und nicht mehr blond, aber das machte nichts. Außerdem hätte sie sowieso keinen anderen brauchbaren Pullover gehabt, weil sie im Haus nur die Kittel trug.
Annemie umklammerte die Henkel ihrer Handtasche und setzte behutsam einen Fuß vor den anderen, um zu testen, ob der Boden hier ebenfalls gefroren und spiegelglatt war, so wie auf dem Weg zur Bushaltestelle in der Nähe ihres Hauses. Sie war dort trotz der guten festen Schuhe ausgerutscht und wäre beinahe gestürzt, wenn der Herr Nurfarin sie nicht aufgefangen und wieder auf die Beine gestellt hätte. Seitdem zwickte ihre linke Seite, und sie fürchtete, sich etwas gezerrt zu haben. Trotzdem hatte sie den von dem jungen Mann höflich zur Stütze angebotenen Arm entschieden abgelehnt. Nur weil sie sich einverstanden erklärt hatte, mit ihm ins Krankenhaus zu fahren, durfte er sich keine plumpen Vertraulichkeiten erlauben. Man kannte das ja mit dem kleinen Finger und der ganzen Hand. Zwanzig Minuten lang, während der kompletten Fahrt von Niedelsingen nach Glimberg, hatte sie sehr sorgfältig darauf geachtet, ihn nicht zu berühren. Was sich auf den ihrer Meinung nach skandalös engen Sitzen des Busses nicht immer einfach gestaltet hatte.
»Mein Name ist Annemarie Engel, ich möchte zu meinem Bruder«, erklärte sie der Frau am Informationsschalter. »Möchten Sie meinen Ausweis sehen?« Sie kramte in ihrer Handtasche, nahm eine kleine Mappe heraus und legte ein dunkelgrünes Heftchen auf den Schalter.
»Das ist nicht nötig«, erwiderte die junge Frau, beugte sich dann aber interessiert vor. »So einen habe ich ja noch nie gesehen. Darf ich?« Sie griff zu, bevor Annemie antworten konnte, und schlug den Ausweis auf. Eine deutlich jüngere Annemie lächelte sie von einem verblassten Passfoto an. Die beiden Stempel der Stadt Niedelsingen unten links und oben rechts am Bildrand verdeckten große Teile ihres Gesichts.
»Der stammt ja auch von vor Ihrer Zeit. Ich habe ihn bereits seit mehr als dreißig Jahren. Ich gehe pfleglich mit meinen Sachen um, dann halten sie lange.«
»Aber der ist doch längst abgelaufen.«
»Das macht mir nichts aus. Ich verreise niemals.« Annemie packte den Ausweis wieder in ihre Handtasche und ließ mit einem lauten Klacken die Verschlüsse zuschnappen. »Wo ist mein Bruder nun? Ich würde die Sache gerne zügig hinter mich bringen und wieder nach Hause fahren.«
Die junge Frau suchte Haralds Namen im Patientenverzeichnis.
»Ihr Bruder liegt auf der Intensivstation im zweiten Stock. Ich gebe oben Bescheid. Bitte klingeln Sie an der Eingangstür der Station. Eine Schwester holt Sie dann ab und kümmert sich um Sie.«
»Bitte nehmen Sie noch einen Moment Platz, Frau Engel. Die Ärztin kommt gleich zu Ihnen. Möchten Sie oder Ihr Sohn einen Kaffee oder ein Wasser?«
»Er ist nicht mein Sohn. Und: Nein danke.«
»Wir haben auch Tee. Es steht alles dort auf dem Tischchen. Bedienen Sie sich, wenn Sie möchten.«