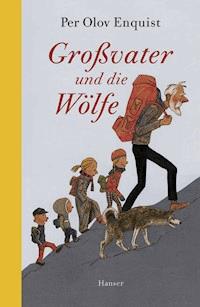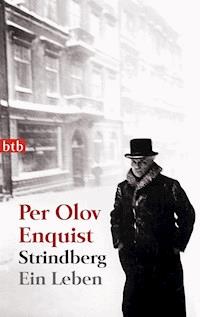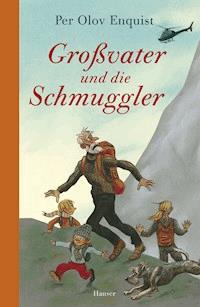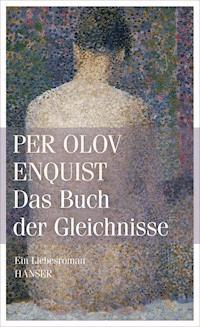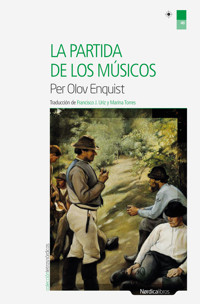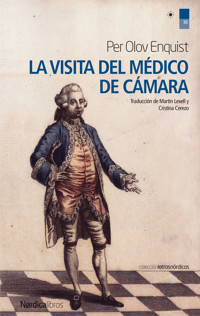Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von einem, der als Sohn einer strenggläubigen Volksschullehrerin in einem Dorf in Schweden aufwuchs und zu einem der angesehensten europäischen Schriftsteller wurde. Per Olov Enquist erzählt seine Lebensgeschichte, als ob es die eines anderen wäre: Er studierte in Uppsala, erlebte die RAF-Zeit in West-Berlin, schrieb in München als Journalist über die Olympiade und debütierte mit seinem ersten Theaterstück am Broadway in New York. "Wenn alles so gut ging, wie konnte es dann so schlimm werden?" - steht als Leitfrage über Enquists Biografie, die auch tief in die Alkoholabhängigkeit und an den Rand des Todes führte. Ein außergewöhnliches Buch, das sich liest wie ein zeitgenössischer Roman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 631
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser eBook
PER OLOV ENQUIST
Ein anderes Leben
Aus dem Schwedischenvon Wolfgang Butt
Carl Hanser Verlag
Die schwedische Originalausgabe erschien 2008 unter dem Titel Ett annat liv bei Norstedts in Stockholm.
Die Ausgelieferten wird zitiert in der Übersetzung von Hans-Joachim Maass, Hamburg 1969.
ISBN 978-3-446-24213-5
© Per Olov Enquist 2008
Alle Rechte der deutschen Ausgabe
© Carl Hanser Verlag München 2009/2012
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen
finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
INHALT
(coda)
Erster Teil – UNSCHULD
Der Zeichendeuter
Die Reise des Kreuzfuchses
Der Reisegefährte
Die kalbende Kuh
Zweiter Teil – EIN HELL ERLEUCHTETER PLATZ
In den Vorhof
Exit homo ludens
Eine Expedition
Berlin nach dem Regen
Eine Theaterbühne in München
Der Herbst am Broadway
Fruchtschale
Dritter Teil – INS DUNKEL
Regenwurm
Sjön 3, Paris
Fliehende Bekassine
Die Sterne über Island
Die Heimkehr des Kreuzfuchses
(coda)
In dieser isländischen Nacht im Dezember 1989 ganz klares Wetter. Man sieht die Sterne, aber kein Nordlicht.
Wo ist es hin.
Gegen vier Uhr am Nachmittag des 14. April 1998 geht er am stillgelegten Bahnhof von Skellefteå vorbei, geht langsam, um nicht aufzufallen, und sieht drei Männer auf der Treppe sitzen.
Er erkennt ihn sofort. Es ist Jurma. Leichter Regen fällt.
Es tut weh. Es dauert einige Sekunden, bis er begreift, warum. Wie immer beginnt er da, an etwas anderes zu denken, so überlebt man: Er ruft sich ein ähnliches Bild in Erinnerung, es stammt aus dem Film Philadelphia, oder vielleicht aus Bruce Springsteens Musikvideo zum Film. Dieser Springsteen geht auf einer Straße neben einer Fabrik, durch eine verwüstete Landschaft, ja, vielleicht ist es eine stillgelegte Fabrik, langsam und ohne sich umzusehen; man bekommt den Eindruck, dass die drei sitzenden Männer, die den Gehenden beobachten, seine Jugendfreunde waren, aber zurückgeblieben sind, während er weitergegangen ist.
Sie hatten ihm nicht nachgerufen, stehen zu bleiben.
Die Zurückbleibenden rufen den Gehenden ungern nach. Wie war es eigentlich, zurückzubleiben. Die drei Männer vor dem stillgelegten Bahnhof von Skellefteå teilten eine Flasche Wein, sicher nicht die erste. Jurma hatte den Kopf gehoben, als er ihn sah, wie in einer Geste des Wiedererkennens, dann aber den Blick gesenkt, wie vor Scham oder maßloser Wut.
Das tat weh. Es war unbegreiflich, dass nicht er selbst dort saß. Schwer zu verstehen. Ein Zufall vielleicht, oder ein Wunder?
Hat er Angst? Er hat Angst.
Aus Brighton im Frühjahr 1989 fast nur der Titel von etwas, was jetzt beinah ganz sicher ein unmöglicher Roman ist, sowie eine kürzere Aufzeichnung.
»Jetzt, bald, wird mein Wohltäter, Kapitän Nemo, mir befehlen, die Wassertanks zu öffnen, damit das Schiff, mit der Bibliothek darin, sinkt.
Ich bin die Bibliothek durchgegangen, aber nicht alles. Früher träumte ich insgeheim davon, ich könnte einmal alles zusammenfügen, einen Schlussstrich ziehen unter alles. Um am Ende sagen zu können: so war es, so ging es zu, dies ist die ganze Geschichte.
Doch das wäre wider besseres Wissen. Wider besseres Wissen ist anderseits eine gute Art, nicht aufzugeben. Wüssten wir es besser, gäben wir auf.«
Am Tag darauf nahm er den Wagen und fuhr einige Stunden zwischen Skråmträsk, Långviken, Yttervik und Ragvaldsträsk umher, um sich zu fassen.
Den Wagen, einen Audi, hatte er am Flugplatz Skellefteå gemietet, der ganz dicht neben Gammelstället am Bursjö angelegt worden war; in einem Waldgebiet, das seinem Onkel John gehört hatte, wie er glaubte. Man sank herab, um zu landen, und da lag der Hof, vielleicht hundertzwanzig Meter unter einem; dort hatte er der Großmutter aus der Bibel vorgelesen, als sie starb.
Er hatte, wie immer während des Landeanflugs, aus dem Fenster geschaut und den geographischen Punkt identifiziert, von dem aus sein Leben betrachtet werden konnte, und der junge Mann auf dem Platz neben ihm, er war an die dreißig und im Cheviot-Anzug, also der Reisegefährte, hatte wie gewöhnlich den Kopf vorgestreckt und gesagt So sieht es jetzt also aus, und er hatte geantwortet Ja, sie haben umgebaut, als sei das ganz natürlich. Onkel John ist ja jetzt fort, hatte er erklärend hinzugefügt. Ach, er auch, hatte der Mann, der vielleicht noch nie geflogen war und Gammelstället noch nie von oben gesehen hatte, gesagt, Ja, es sind wohl nicht mehr viele da, und was sollte man dazu noch sagen.
Der Mann auf der Bank vor dem Hauptbahnhof, dessen Name Jurma war, dürfte jetzt siebzig Jahre alt sein. Es war offensichtlich, dass er lange an der Flasche gehangen hatte.
Komisch, dass er lebte. Genug davon.
Er kann ein Ruderboot leihen und rudert hinaus zum Granholmen.
Die Insel hat jetzt einen anderen Namen, nach der Mutter benannt: Sie heißt Majaholmen. Eigentlich merkwürdig, sein Vater hatte doch die Hütte gebaut. Da saß sie in den Sommern und blickte übers Wasser.
Man sollte nicht so tief darin graben. Man wird ja nur verrückt.
Von allen Vögeln liebte er die Libellen am meisten.
Lange waren sie verschwunden. Im Herbst 1989 sah er sie wieder. Im Frühjahr 1990 flogen sie wie verrückt, und er konnte sich fast nicht beherrschen. Es war die Wiederauferstehung der Libellen, wie war das zugegangen!
*
Die Briefe.
Er wollte den Dachboden leeren und fand die Briefmappen, sieben Stück, und alle Manuskripte. Er war ganz sicher gewesen, sie verbrannt zu haben.
War es so. Das alles. Er konnte fast nicht atmen.
War es wirklich so.
Sie hatte ihm den Toshiba in den Schoß gelegt, als wäre es ein Hundewelpe, und die andere Frau, Sanne, setzte sich auf den Fußboden und zog ihm die Schuhe an.
Man hofft ja immer auf ein Wunder. Wenn man nicht hofft, ist man wohl kein Mensch. Und eine Art Mensch ist man wohl trotz allem.
Ist es jetzt soweit? Nein, noch nicht.
Erster TeilUNSCHULD
Kapitel 1DER ZEICHENDEUTER
Die Zeichen sehr unklar.
Jemand im Dorf erzählt dem Kind, beinahe flüsternd, von dem Traum, den Hugo Hedman im Winter 1935 gehabt hatte. In dem Traum fielen drei große Bäume, es waren Kiefern. Aber nicht bei einer Abholzung. Im selben Winter starben drei Männer im Dorf. Der Traum war ein Zeichen. De Elof galt als einer von denen, deren Tod durch das Fallen der Kiefern prophezeit worden war. Das Kind versteht später, dass de Elof keine »Kiefer« war, sondern »der Vater«, aber alles ist unklar.
Andere Zeichen: Seine Mutter ist schwanger, trägt den eingeborenen Sohn. Zur gleichen Zeit: Einer seiner Onkel väterlicherseits wird sehr jung als »geisteskrank« bezeichnet und für einige Zeit isoliert, wie üblich eingeschlossen in der kleinen Kammer. Da darf er von der Mutter nicht besucht werden, weil sie schwanger ist, übrigens mit dem Kind selbst, und geheime Strahlung von dem Geisteskranken (»de is verrückt«) kann dem Ungeborenen im Mutterleib schaden. Einige Jahre später (vielleicht im September 1939) fragt er, ob dies nicht trotz allem der Fall war, das wird verneint, die Strahlung des Geisteskranken hat ihm nicht geschadet. Falls doch, wird es sich später zeigen, ist aber nicht wahrscheinlich. »Geisteskrankheit« ist, erfährt er, eine Art Rastlosigkeit.
So vergehen die Jahre.
Plötzlich fällt ihm auf, dass die Mutter nie mehr schluchzt.
Er weiß nicht, was passiert ist, aber es hat aufgehört.
Zuerst schließt er daraus, dass sie froher geworden ist und ihre Einsamkeit als Witwe nicht mehr betrauert. Dann ahnt er, dass es nur ausgetrocknet ist. Sie hat anscheinend etwas eingesehen, und da ist es ausgetrocknet. Sie geht in ihrer Arbeit auf. Das ist die Schule, und die Freizeitarbeit für Christus. Ersteres ist Plackerei. Der Freizeitjob für Christus erfüllt sie indessen, meint sie, mit Licht.
O du mein Licht.
Das ist der Standpunkt, den sie einnimmt. Das Kind ist voller Bewunderung.
Die Entfernung zwischen dem grünen Haus, in dem sie wohnen, und dem Schulgebäude beträgt fünf Kilometer. Keine Tränen mehr. Als hätte sie aufgegeben, und sich gefügt.
Im Winter, wenn der Waldweg nicht ständig geräumt werden kann, fahren sie Ski. Die Mutter spurt, er folgt ihr. Das ist das Natürliche. Sie ist ja Volksschullehrerin. Die Schule eine B-2:a. Zuerst vom grünen Haus abwärts einen leichten Hang hinunter, dann über den Bach, danach eine sehr lange, dem Wind ausgesetzte Strecke über die Wiesen bei Hugo Renströms Hof und schließlich durch den Wald. Die Schule soll zwei Dörfer versorgen und liegt deshalb genau zwischen ihnen, was heißt, mitten im Wald; so haben es alle gleich weit, vielleicht zu weit, aber anderseits kann sich keiner beklagen. Es ist ja gerecht, aber im Winter bei Gegenwind auf der flachen Strecke vor dem Wald ziemlich unangenehm.
Sie hat wirklich keinen Grund, sich über ihr Leben zu beklagen.
Sie schreibt nicht mehr Tagebuch.
Als er nach ihrem Tod im Herbst 1992 aufräumt, findet er etwas, das Tagebüchern gleicht, aus den ersten Jahren nach dem Lehrerinnenseminar. Einige sonderbare Aufzeichnungen im Jahreskalender deuten an, dass sie vor der Heirat zwar ein von frommem Glauben erfülltes, aber ehrlich gesagt dennoch ziemlich lustiges Leben geführt hat. »Fest in Gamla Fahlmark« oder »Fest in Långviken«. Die Bekenntnisse über Feste hören mit der Verlobung auf, die Datierung ist unklar.
Mehrfach betont sie dem Sohn gegenüber ihre Zufriedenheit, und dass der Kuchen des Staates klein, aber sicher sei. Doch sie wütet gegen den Frauenlohn, der niedriger ist als der ihres männlichen Kollegen (gleicher Lohn wird 1937 eingeführt, aber sie ist nachtragend), und sie hebt hervor, wie wichtig es ist, dass jede Frau sich um einen Beruf bemüht, weil die Gefahr besteht, dass sie eines Tages Witwe wird.
Die Vorstellung von Scheidung existiert für sie nicht.
Ihre politische Heimat ist zweifellos die Folkparti.
Sie bewundert den Parteiführer Bertil Ohlin, der Professor ist, ungemein. Zutiefst kritisch nimmt sie zur Kenntnis, dass Erlander, der nur fil. kand. ist, sich Ohlin gegenüber mausig macht. Sie deutet nie an, dass sie letzteren schön findet (einmal entfährt ihr das Wort »schick«), doch das Kind versteht bald, dass ihre fast religiöse Verehrung für diesen Ohlin Untertöne hat. Viele Jahre später räumt sie, hart bedrängt, ein, dass der tote Vater Sozialdemokrat war. Aber es bestehe kein Grund, sich deshalb aufzuregen, meint sie. Vor seinem Tod wurde er ja trotz allem erweckt. Deutlicher wird sie nicht. Da er im Sommer als Stauer im Hafen und im Winter als Holzfäller gearbeitet hat, findet sie es natürlich, dass er dem Druck der Arbeitskollegen nachgegeben hat. Sie lässt durchblicken, dass sie ihn wegen seiner politischen Zugehörigkeit nie getadelt hat. Als der Sohn erwachsen wird und erzählt, dass er selbst Sozialdemokrat ist, seufzt sie schwer, sagt jedoch – sarkastisch oder humorvoll?, er kann nicht richtig klug daraus werden –, ja, da würde dein Vater sich freuen.
In jeder Klasse, die sie unterrichtet, bildet sie einen Chor. Immer dreistimmig. Dies ist ihr Zuhause, also der Gesang. Ihre Sympathie für die Folkparti ist eher von prinzipieller Art, nicht gefühlsbedingt.
Im Alter von siebenundachtzig Jahren und nach drei leichteren Schlaganfällen wird sie bei Dunkelheit und starkem Schneefall in südlicher Richtung gehend auf der Küstenstraße angetroffen. Sie geht in der für sie charakteristischen wiegenden Art und Weise und hat nur einen Fausthandschuh dabei. Sie schreitet energisch aus, als wäre sie auf dem Weg nach Umeå oder Sundsvall.
Es ist sieben Uhr morgens am ersten Weihnachtstag. Als man sie aufhält, sagt sie ärgerlich, sie sei auf dem Weg zum Ortsverein der Folkparti in Bureå, der seine Jahresversammlung abhalte, und sie habe keineswegs die Absicht, fernzubleiben. Man geleitet sie zurück und macht ihr keine Vorwürfe, denn ihr barsches Wesen ist allgemein bekannt und nicht einmal jetzt wagt jemand, ihr zu widersprechen.
Dies ist ihr letzter, wenngleich abgebrochener politischer Einsatz. Sie hat das Norran abonniert, die »freisinnige« Länszeitung. Das bedeutet sozialliberal.
Aber welcher Klasse gehören sie an, die Mutter, der Vater und er selbst?
Irgendwann im Jahr 1944 wird im Kirchspiel Bureå die Schulspeisung eingeführt, was bedeutet, dass die Kinder in der Schule ein kostenloses Mittagsessen erhalten. Dies ist jedoch im ersten Jahr an eine Bedürftigkeitsprüfung gebunden, und mittels einer wirtschaftlichen Analyse wird festgestellt, dass alle Kinder in Hjoggböle ein Anrecht auf diese Mahlzeit haben, bis auf zwei, die der privilegierten Oberklasse angehören. Betroffen sind die beiden Lehrerinnen (»der Kuchen des Staates ist klein, aber sicher« und so weiter) – was zur Folge hat, dass er und Thorvald, der Sohn der Vorschullehrerin Ebba Hedman, kein Essen bekommen. In jeder Mittagspause ziehen die Schüler hinauf in den provisorisch eingerichteten Speisesaal im Obergeschoss der Schule, wo seine Tante Vilma – die später in den Streit um die vertauschten Kinder, die Enquistsche Vertauschgeschichte, verwickelt wird – gute und nahrhafte Fleischsuppe serviert.
Die beiden Oberklassenkinder, Thorvald und er selbst, müssen im unteren Flur auf dem Fußboden sitzen und Butterbrote mit Margarine essen, die er hasst, und Magermilch trinken.
Er fühlt sich an den Pranger gestellt, schämt sich und kocht vor Empörung. Es ist ein Glück, dass er als lieb bezeichnet wird. Die satten Kinder strömen nach dem Essen mit hellem Lächeln an den beiden Lährarinn’jongs vorbei. Seine Auffassung von den Klassengegensätzen in der Gesellschaft steht damit fest. Nur begreift er nicht, dass das Unterklassengefühl, das er sich aneignet, auf einem Missverständnis beruht; er ist Oberklasse.
Er war nicht der einzige, der sich die Frage stellte, warum es ging, wie es ging. Das Dorf erforschte auch sich selbst. Es musste doch ein Ganzes geben. Sonst wurde man ja verrückt.
Schweden ist in dieser ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein Archipel von Tausenden im Waldmeer verborgenen kleinen Dörfern, Hjoggböle nicht ausgenommen. Das Dorf pflegt jedoch seine Geschichte, und die ist lang. Endlose Berichte über Armut, die besiegt wurde. Auf der Dorfversammlung am 1. Mai 1885 wurde beschlossen, dass die Witwe Lovisa Andersson zur Vermeidung von Mietkosten mit ihren Kindern im Dorf von Haus zu Haus geht. Einen Tag pro steuerpflichtige Hufe. Es sind Notjahre. Man tauscht die letzten Besitzgüter gegen Mehl. Einen Eimer, ein Fischnetz, einen Krug, ein Fell, vier Sensenstiele; bekommt dafür 12 Pfund Mehl. Kleine lustige Anekdoten, die er übergehen kann; das Protokoll der Dorfversammlung im Mai 1868 berichtet, dass der Bauer Erik Andersson in Hjoggböle zwei Jungen in den Wald schickte, um Baumrinde zum Brotbacken zu sammeln. Als die Jungen auf dem Heimweg waren, überquerten sie eine Kuhweide, die Kühe, die hungrig waren, sahen da die Jungen und ihre Baumrindenlast, stürmten auf sie zu und fraßen die Rinde auf. Die ausgehungerten Jungen konnten sich nicht verteidigen, und in den Wald zurückzugehen hatten sie nicht mehr die Kraft. Wurde Unterstützung zugesagt, 2 Pfund Mehl von der besseren Sorte, 2 Pfund von der schlechteren.
Glückliches Ende. Sie mussten jedoch ohne Rinde nach Hause gehen.
Wurde in Sjön, Hjoggböle, ein Armenhaus gebaut, bestehend aus einer Stube; wurde den Wohnungslosen übergeben. Anscheinend sind viele von ihnen Soldatenwitwen mit Kindern. Das Steinfundament des Armenhauses noch Mitte der fünfziger Jahre zu sehen. Er geht häufig dorthin, es liegt neben einer der Schutzwehren, die er als Siebenjähriger gegen die von deutschen Panzern unterstützten Infanterieangriffe plant. Das Steinfundament lag hinter dem Anwesen von Anselm Andersson; als der Fußballplatz Furuvallen dort angelegt wurde, verschwand dieses historische Denkmal.
Die lutherische Moral schon jetzt, um die Mitte des 19. Jahrhunderts, hoch. Er kann sie wiedererkennen. Beschloss die Dorfversammlung auf ihrem Treffen am 1. Mai, gemäß Paragraph 8, eine Strafe von 25 Kronen festzulegen für denjenigen im Dorf, der sein Haus als Spielstube zur Verfügung stellt; die Bußzahlung soll den Armen im Dorf zukommen.
Spielstube bedeutet Tanzlokal.
Ein Olof Enqvist ist jedoch noch nicht unter den Hilfsbedürftigen – im Gegenteil: Als das Haus und die Mühle in Forsen im Mai 1883 mitsamt dem Inventar versteigert werden, ersteht er das Haus für vier Kronen und fünf Öre. Vielleicht reißt er es ab und behält das Holz?
Ein Onkel des Großvaters. Er schreibt den Namen mit qv.
Unterhalb des grünen Hauses lag das Hobelwerk.
Er kann sich nicht erinnern, als Kind das Hobelwerk je in Betrieb gesehen zu haben. Es wurde irgendwann gegen Ende der dreißiger Jahre stillgelegt. Er versucht sich zu erinnern, aber es gelingt ihm nicht.
Das kleine Haus, das Sägenhaus, stand ja noch die vierziger Jahre über unten am Bach. Ein sehr niedriges Haus mit durchhängendem First. War es nicht nach vorn, zur Straße und zum Milchbock hin, offen? Er kann sich an keine Tür erinnern.
Schwer vorstellbar, wie die Hobelwerkstatt betrieben wurde. War am Ausgang des Sees eine Art Wasserfall gewesen, gab es einen Niveauunterschied zum Bach hin, stand dort ein Schaufelrad? Er findet ein Archiv, das Auskunft gibt: Der Motor, der das Hobelwerk antrieb, war ein 7 PS Glühkopfmotor Baujahr 1920, Modell 15. Natürlich war Wasserkraft nicht notwendig. Aber warum stand es dann gerade dort?
Hat man vielleicht das Holz auf dem Wasserweg herantransportiert?
Das Hobelwerk lag am Abfluss des Sees, und nur hundert Meter vom grünen Haus entfernt. Er ist als Kind überzeugt davon, dass er auf diese Weise eigentlich im Zentrum von Schweden, benannt Sjön, Hjoggböle, geboren ist. Der Beweis dafür: Man legt das Bethaus und den Milchbock und den Bach und die Brücke über den Bach und vor allem das Hobelwerk, das also nur noch als historisches Denkmal existiert und deshalb auf der Karte mit einem eigenen Symbol bezeichnet werden muss, zusammen. Man durfte jedoch nicht hochmütig werden, weil man in der Mitte des Reichs geboren war, eher hatte man eine Verantwortung für die Menschen am Rand. Also die südlich von Jörn. Oder die Menschen in Schonen.
Es lagen noch massenweise Späne herum, obwohl das Hobelwerk nicht mehr da war. Es gab einen ziemlich großen platten Haufen von alten nassen Spänen. Dort konnte man Angelwürmer suchen.
Hatte das Sägenhaus nicht eine Luke im Fußboden? Direkt hinunter in den Bach? Er ist fest entschlossen, das Rätsel des Hobelwerks mittels Untersuchungen ein für allemal zu lösen. Er weiß nicht mehr, wem das Hobelwerk gehörte. Vielleicht Sehlstedts.
Einem von ihnen. Vielleicht dem, der unten am Fußend getraang hatte.
Das Dorf ist uralt, seit dem Mittelalter hat es existiert.
Als 1543 Gustav Vasas Grundbuch erstellt wurde, gab es im Dorf fünf steuerpflichtige Bauern. Sie bestellten fünfeinhalb Hektar Land. Beim Pflügen hatte man Beile und Pfeilspitzen aus Grünstein und einen Dolch aus Quarz gefunden, die als Beweis dienen konnten, dass es schon seit der Zeit um 3000 vor Christus eine Form von Besiedlung gegeben hatte.
Er versucht es sich vorzustellen, doch ohne Erfolg. Aber er liebt es, sich als Teil der Urbevölkerung zu betrachten.
In den Sommern kommt er zurück und versucht zu rekonstruieren. Der Bach war um die Mitte der vierziger Jahre noch nicht begradigt und immer noch schön, es gab Plötzen darin. Gleich unten beim Hobelwerk wusch man. Den Steg über den Bach gab es noch lange, nachdem das Hobelwerk, also die Maschinen, fortgebracht worden war.
Er notiert: Der Steg ist fort.
Die Blutegel waren das Interessanteste am Steg. Man konnte auf dem Bauch liegen und sie beobachten. Aber man musste aufpassen, wenn man badete, denn die Blutegel, die vielleicht Rossegel waren, doch das spielte keine Rolle, lagen zusammengerollt auf dem Grund, und dann rollten sie sich aus und schwammen mit schlingernden Bewegungen. Man sollte eigentlich Angst vor ihnen haben, denn es hieß, dass sie dem Menschen das Blut aussaugten, bis er fast unmächtig wurde und zu Boden sank, aber wenn man jeden Tag mit ihnen umging, wurden sie so etwas wie Spielkameraden, die man mit langen Stöcken überlistete und hochholte und auf den Steg legte.
Wenn man sie tötete, gab es Schmierkram. Er beschloss deshalb, sie nicht zu töten, sondern gut Freund mit ihnen zu sein. Dann brauchte man ja keine Angst zu haben.
Man konnte das Dorf auf unterschiedlichste Weise sehen, je nachdem, wo das Zentrum war.
Das Natürliche war, dass der Milchbock und das Hobelwerk und die Blutegel das Zentrum des Dorfs ausmachten, und das freute ihn, ohne dass er sich deshalb großartig vorkam.
Er befindet sich im Zentrum, behält aber seine Demut. Beim Milchbock kommt die Dorfversammlung manchmal zusammen, dann sind da unten an die zwanzig Männer, keine Frau, und es hat den Anschein, als würden erregte Diskussionen geführt, die fast immer mit irgendeiner Schweinerei zu tun haben, deren sich die Meierei in Bureå schuldig gemacht hat. Es geht um irgend etwas wegen der Rücksendung von Magermilch. Die Bonzen in der Meierei haben einen unverzeihlichen Rechtsbruch begangen. Schwer zu verstehen. Er fragt die Mutter, aber sie schnaubt nur.
Die Mutter ist ansonsten eine große Freundin von Versammlungen, zumindest solchen, die im Bethaus abgehalten werden. Über die hat sie die Kontrolle. Die Treffen am Milchbock ärgern sie, weil sie weltlich sind und weil keine Frauen dabei sind. Für sie ist das Bethaus das Zentrum; dass das Hobelwerk, der Milchbock und die Blutegel ein Zentrum wären, wird sie gewiss mit Bestimmtheit abstreiten.
Weil es die Frauen sind, die in allen Familien das Sagen haben, meint sie, die Treffen am Milchbock seien ein weltlicher Schein. Theater beinahe, weil die wirkliche Macht im Dorf bei den Frauen lag, die jedoch nicht beim Milchbock erumstehe un schreie tue.
Und diese Empörung beim Milchbock, wenn die Mannsleut’ schreie tue, dass es jetzt genug sei und dass ein Milchstreik nötig wäre – daraus wurde ja nie etwas. Am nächsten Tag war es wieder ruhig. Aber wenn diejenigen, die wirklich die Entscheidungen trafen, also in den Familien, wenn diese Frauen dabei sein dürften! Dann käme vielleicht etwas dabei heraus. Zumal diese ja wussten, wie die Wirklichkeit aussah. Und es gewöhnt waren zu schalten und zu walten.
Der Milchbock war auch fort.
Er stellt im August 2003 fest, dass der See sich zurückgezogen hat. Vom grünen Haus aus ist er fast nicht mehr zu sehen. Damals in den dreißiger Jahren fuhren sie Schlittschuh bis zum Hobelwerk. Einmal jedes Jahr tat man sich zusammen und dünnte das Unterholz aus, damit der von allen so geliebte und bewunderte Wasserspiegel klar schimmern konnte. Jetzt ist das Unterholz undurchdringlich. Es ist, als sei das Auge des Dorfs zugewachsen, als seien die Augenlider verklebt. Sonst ist es schön.
Man fährt jetzt in zwanzig Minuten in die Stadt. Die Gärten gepflegt.
Das Dorf ist uralt, er möchte es sich gern als moosbewachsenen Baumstumpf vorstellen.
Es atmet jedoch, sehr langsam, fast mühsam, wie eine sterbende Frau, ungefähr wie die Mutter in den Stunden, bevor sie im Oktober 1992 vom Erlöser heimgeholt wurde und er bei ihr saß und ihre Lippen befeuchtete. Als er das Dorf als Erwachsener besucht, ist alles verändert; kein Moos, kein uralter Baumstumpf. Er ist gezwungen, das Ohr ans Dorf zu legen und den Atem anzuhalten, dann kann er entfernte Lockrufe hören.
Jemand flüstert, dass er es dazu bringen müsse, zusammenzuhängen, sonst würde man ja verrückt.
Mit der Zeit erfährt er, dass er einen Bruder hatte, der vor ihm geboren wurde, anderthalb Jahre nach der Hochzeit.
Sie hatte zu Hause gebären wollen. Das Kind lag falsch herum, aber die Hebamme, auf Stippvisite, kritisierte ihr übertriebenes Gejammer und erklärte, das Blag würd sich schon von selbs umdrehn. Trotz der Wehen kam das Kind jedoch nicht heraus. Die Mutter hatte vier Tage und Nächte gestöhnt, bis es ganz unmöglich war, sie zu halten, se hatt so furchbar geschriee! Es war eine Steißgeburt. Da hatte man aus Gamla Fahlmark ein Taxi bestellt. Sie hatte im Obergeschoss des grünen Hauses gelegen, und die Hebamme war nicht mehr gekommen, weil es ihr zuviel wurde. So war die Mutter vom Vater und einem Nachbarn hinuntergetragen worden, es war Sehlstedt. Die Treppe hinunter musste man zu zweit tragen. Åke Sehlstedt hatte es ihm erzählt, verstohlen, mit einem einzigen Detail. »Ich hab unten am Fußend getraang.«
Unbegreiflich, dass gerade dieses Detail sich eingraben sollte. Er wird es nicht los.
Er grübelt darüber nach, ob es ein Bild war oder ein Zeichen.
Aber es war eine Steißgeburt. Auf der Krankenstation kam das Kind schließlich und hatte auch noch die Nabelschnur um den Hals. Es hatte, meinte man, einige Minuten gelebt. Hierüber im Tagebuch eine Aufzeichnung. Damit galt es als lebendig und nicht als totgeboren. Der schnell Dahingeschiedene wurde auf den Namen Per-Ola getauft, und die Leiche im kleinen Sarg wurde fotografiert. Ein Leichenbild musste sein, daran führte kein Weg vorbei. Das Tote sah nettig aus, und auch er schien lieb zu sein.
Zwei Jahre später war er selbst geboren und auf denselben Namen getauft worden. Seine Mutter hatte erklärt, es sei das frühere Kind, mit dem Namen Per-Ola, das gestorben war, während er, der spätere Junge, also er selbst, mit demselben Namen, es war, der lebte. Er kann nur schwer begreifen, wer wer ist. Es kommt ihm unklar vor, ein wenig verdächtig. Konnte es also so sein, dass in Wirklichkeit er das Totkind im Sarg war, das fotografiert worden war, während der Bruder lebte?
Vielleicht hatte es eine Verwechslung gegeben?
Er wagt nicht zu fragen, doch er ist unruhig. Oder war es die ganze Zeit dasselbe Kind? Also, dass er selbst gestorben war und die Mutter fast das Leben gekostet hätte, um dann wieder aufzuerstehen. Oder, und dies war das Schwerste: War es so, dass er in seinem ersten Leben heimgeholt worden war unter die Gerechten, und jetzt zur Rechten Gottes saß, während er später das Kind war, das als Per-Ola bezeichnet wurde, mit demselben Namen!!! – dass dieser, der etwas später Geborene, unter den zurückgelassenen ungerechten Sündern war, die am Tag des Jüngsten Gerichts in Gehenna brennen sollten?
Noch unklarer wird es, als in der Familie wirklich eine Kindsverwechslung geschieht.
Es war Tante Vilma, die in der Krankenstation von Bureå lag und ein Kind bekommen hatte. Und da kommt die Schwester herein, auf jedem Arm ein Kind, beide einen Tag alt; und die Schwester hatte mit energischer Stimme zu Tante Vilma und Frau Svensson gesagt Erkennt ihr eure Kinner nich selbs!?
Aber se hatten’s nich getan, und da war der Fehler passiert.
Das waren die vertauschten Enquistschen Kinder. Und einige Jahre später wurde unten im Süden Richtung Stockholm eine große Sache in der Presse daraus, die bis vors Oberste Gericht ging. So fing es an. Zuerst die Unsicherheit, ob er selbst oder der Bruder gestorben war. Dann die Geschichte mit den vertauschten Kindern. Dies als Bekräftigung dessen, wie unsicher alles im Grunde war. Sieh dir nur Tante Vilma an und die Kleinen, die verkehrt landeten!!!
Man wusste nie sicher, wer wer war. Oder wer man selbst war.
Es war gleichsam gruselig. Irgendwann wurde ein Gerücht verbreitet. Es war viel später, aber noch lange bevor er Kapitän Nemos Bibliothek schrieb, über Eeva-Lisa und die Kinder, die verwechselt wurden, dass er in dieser Klarstellung in Romanform die Missverständnisse zurechtrückte, und all das, worüber man sich in den Häusern ereiferte. Er wollte durch die Darstellung der objektiven Wahrheit über die Verwechslung Klarheit schaffen, damit nicht mehr gedichtet würde.
Das Gerücht besagte nicht weniger, als dass er selbst in der Krankenstation von Bureå vertauscht worden sei. Er ist empört. Was kann daraus nicht alles zusammengereimt werden! Dass es in Wirklichkeit sein toter Bruder war, der kleine Tote im Sarg, der die Bücher geschrieben hatte; nein, dass er es war, der weltlich frivole Bücher geschrieben hätte, aber unter dem Namen des Bruders. Er ist empört darüber, dass zwei Verwechslungen vermischt werden.
Auf jeden Fall: Er war ein anderer.
Manche sagten, sie wüssten ganz sicher, dass Enquist vertauscht worden sei. Und er erbebte, aber er ermannte sich. Es schien jedoch das Gefühl von Unsicherheit zu verstärken, das er schon als Kind gehabt hatte. Man konnte nicht sicher sein. Er dementierte, doch nicht überzeugend. Er war ja nicht einmal selbst sicher. Er begann darüber nachzugrübeln, ob es wahr sein konnte, zuerst ein wenig im Spaß, dann wurde es unerfreulich.
Manchmal erkennt man ja sich selbst nicht wieder.
*
Und die Mutter?
Sie würde sicher nur schnauben, wenn er sie fragte, wie ein Pferd. Aber nie hätte er es über sich gebracht zu fragen, welcher von den Brüdern lebte, und welcher gestorben war. Und ob sie den ersten Totjungen gern gehabt habe, oder welchen von beiden sie lieber mochte.
Die Lösung fand sich vielleicht in einem Notizbuch, das er nach ihrem Tod entdeckt hatte. Sie schreibt dort nach der ersten Entbindung: »Trotz allem, was geschehen ist, weiß ich doch, dass ich auf jeden Fall einmal Mutter war.« Sonst kein Wort. Es fiel ihm schwer, das zu deuten. Glaubte sie nicht, dass sie noch einmal gebären konnte? Oder wollte sie nicht? Hatte sie aufgegeben, also ihn selbst aufgegeben?
Dass ich auf jeden Fall einmal Mutter war! Sie hatte wohl die Minute gemeint, die das Kind gelebt hatte. Es war die einzig plausible Deutung. Er versteht, dass Mutterschaft für sie etwas Wichtiges war. Verheiratet, aber kinderlos zu sein, war vielleicht eine Schande. Da war es besser, wenn es geboren wurde, aber später starb, an Krupp beispielsweise, wo sie blau wurden. Der Krupp hatte ja die sechs Geschwister von Großmutter Lova dahingerafft. Alle waren blau geworden.
Aber die Minute, die der tote Junge gelebt hatte, machte gleichsam einen Unterschied für sie aus. Sie wurde dadurch wohl zur Frau.
Sie hat seiner entschiedenen Meinung nach ein fast engelgleiches Aussehen, oder ist auf jeden Fall eindeutig schön.
Diese Schönheit wird jedoch auf merkwürdige Art und Weise verzerrt, als er von einer lebensbedrohlichen Krankheit heimgesucht wird, nämlich dem Entfernen der Mandeln. Es soll in der Krankenstation von Bureå geschehen, und er erfährt, dass Doktor Hultman die Operation durchführen wird, der auch seinem Vater beigestanden hat, als dieser aufgeschnitten wurde und starb.
Dieser Doktor, der seinen Vater getötet hat, beugt sich jetzt über ihn und senkt eine Stahlschlinge in seinen Hals hinab, die ihm die Mandeln herausreißen soll. So muss es auch für den Vater gewesen sein! Und der kleine Tote, der vielleicht er selbst war und der von ebendiesem Arzt herausgepresst wurde, während die Nabelschnur sich würgend um seinen zarten Hals schlang! Das grotesk verzerrte Gesicht dieses Arztes senkt sich herab, und jetzt reißt es Fleischstücke aus seinem schreienden Rachen. Er weiß, dass er der Dritte ist, der durch dieses Gesicht einer tödlichen Gefahr ausgesetzt wird: zuerst der auf den Namen Per-Ola getaufte Totjunge, dann der Vater, dann er selbst.
Er wird jedoch zum Leben errettet und bleibt eine Woche auf der Krankenstation liegen. Es heißt, eine Epidemie drohe (Scharlach?), und Besucher dürfen sich den Patienten auf der Krankenstation Bureå nicht nähern. Die Mutter fährt jedoch jeden Tag mit dem Fahrrad in den Zentralort und klopft ans Fenster des Krankenzimmers. Ihr Gesicht ist vor Angst grotesk verzerrt, als versuche sie, zu dem in Not Befindlichen hineinzurufen, es ist weit entfernt von seiner gewöhnlichen Schönheit, jetzt vor Angst verzerrt, und bekräftigt seine von Furcht beherrschten Ahnungen über den Doktor des Todes.
Sie kratzt mit den Fingern am Fenster, damit er sie bemerkt, als wäre sie ein ausgesperrter Vogel; mit den Flügeln, gegen die Scheiben.
Der Überlebende, soweit er denn ein solcher ist, wird im Dorf allgemein als lieb bezeichnet.
Er hört es oft und passt sich erfreut an. Er ist lieb. Auf Fotos aus jungen Jahren strahlt er Milde und eine lichte Nettigkeit aus. Er findet es natürlich, dass er lieb ist, hat aber oft Tagträume, die davon handeln, wie es wäre, wenn er nicht lieb wäre. Dann würde er mittels körperlicher Züchtigung bestraft, das war wohl bekannt. Er hat so etwas noch nicht erlebt, er weiß, dass die Mutter nur mit äußerster Selbstüberwindung und nur bei schweren Sünden zu körperlicher Züchtigung greifen würde.
Er denkt darüber nach, wie es sich anfühlen würde. Weil Züchtigung also praktisch etwas ganz und gar Verbotenes ist, beginnt er sich danach zu sehnen, nur ein einziges Mal körperliche Züchtigung zu erleben. Es wird zu einer fixen Idee, einem fast unerreichbaren Ziel.
Eines Tages erreicht er plötzlich das erstrebte Ziel. Er hat etwas getan; was er getan hat, verdrängt er später, aber die Mutter beschließt, ihn zu züchtigen, auf den bloßen Hintern. Schon nach den ersten Schlägen schreit er wie am Spieß, denn es zeigt sich, dass dies keine himmlische Erfahrung ist, die ihm den Eintritt in eine neue menschliche Landschaft ermöglicht, sondern dass es ganz einfach weh tut. Nur das. Er zieht schluchzend die Hose hoch, fällt bei der obligatorischen Betstunde vor Christi Angesicht auf die Knie und fühlt sich ungerecht behandelt und enttäuscht zugleich.
Er hat die Mauer zu einer neuen Erfahrung durchstoßen und kann nur zusammenfassen, dass es wehtat. Keine existentielle Einsicht.
Er ist lieb. Das scheint der Mutter ein Problem zu bereiten.
Das zentrale Anliegen in ihrem religiösen und pädagogischen Unterricht besteht darin, das Kind Aufrichtigkeit zu lehren, also reinen Herzens und ohne Furcht seine Sünden zu bekennen. Wenn er das tut, wird ihm Vergebung zuteil. Sie meint, dass das Bekennen ihm sogar ein höheres Ansehen bei jenen verschaffe, die nicht zu bekennen wagen. Sie benutzt ebendieses Wort, Ansehen. Er begreift, dass die Masse der Menschen nur diejenigen respektiert, die zugeben: Ich habe mich geirrt. Die Selbstgerechten, die nie ihre Fehler einräumen, werden von der Masse der Menschen verachtet. Das Problem ist nur, dass er, weil er so lieb ist, nie etwas zu bekennen hat. Er ist fast klinisch sündenfrei. Das ist für sie beide ein Dilemma. Er soll jeden Samstag, bevor er ins Bett geht, eine Sünde bekennen, die er während der Woche begangen hat, und Jesu Vergebung erlangen. Das haben sie gemeinsam beschlossen. Vielleicht ist es mehr die Mutter, die es gemeinsam beschlossen hat, doch der Beschluss steht auf jeden Fall, und er bereitet ihm große Angst. Nicht weil es so schwer wäre zu bekennen. Aber weil ihm nichts einfällt, was er bekennen kann.
Er sieht ein, dass er ganz einfach zu gut ist.
Verzweifelt überlegt er, während der Samstag näher rückt, was er bekennen könnte. Er findet nichts, vielleicht weil es nichts zu finden gibt.
Ihm kommt der Gedanke, bewusst zu sündigen, damit er etwas zu bekennen hat, aber dafür ist er einfach zu lieb, seine Nettigkeit ist wie in Beton gegossen; dies ist also auch keine Möglichkeit.
Er löst schließlich das Dilemma, nachdem er drei Samstage hintereinander zu seiner und der Mutter Enttäuschung ohne Sünde trockenes Gras gekaut hat, indem er eine Sünde erdichtet. Er bekennt, unter Tränen, beim Einkaufen im Konsum in Forsen dem Kaufmann ein Bonbon gestohlen zu haben, als der gerade nicht hinsah. Die Mutter ist erschüttert durch das Bekenntnis, lobt ihn aber ausdrücklich dafür, dass er bekannt hat, und nach der Betstunde, als Jesus Christus dem Sünder ganz sicher vergeben hat, schlafen beide ruhig ein.
Er hat jedoch nicht damit gerechnet, dass die Mutter in der folgenden Woche dem Kaufmann im Konsum, den sie gut kennt, weil beide aktiv im Vorstand des Abstinenzlervereins Blaues Band mitwirken, von der Sünde erzählt. Sie erzählt, dass das Kind ein Bonbon gestohlen hat.
Da stürzt die Decke ein.
Der Konsumvorsteher reagiert völlig verständnislos: Die beiden Bonbondosen werden hinter der Theke auf einem so hohen Regal aufbewahrt, dass das Kind sie unmöglich erreicht haben kann, wenn es nicht von himmlischen Mächten hochgehoben worden ist, und die Geschichte stellt sich als lügenhaft heraus. Die Mutter kehrt mit finsterer Miene zurück, sagt, dass er sie blamiert habe, und nach einem sehr kurzen Prozess gesteht das Kind, dass es gelogen hat. Kniefall und so weiter.
Dies ist an einem Mittwoch. Als der Samstag kommt, hofft er natürlich, dass diese unter der Woche begangene und bekannte Sünde, also die Erdichtung eines gestohlenen Bonbons, ihm als Samstagssünde angerechnet werde; aber nichts da. Die Mutter meint jetzt, diese Sünde läge außerhalb ihrer von ihr gemeinsam beschlossenen Absprache. Gilt nicht. Er muss an diesem Samstag für eine neue Sünde Rechenschaft ablegen.
Es ist eine verzweifelte Situation.
Er beneidet die Kinder, die nicht lieb sind, von denen er in den Erbauungsbüchern gelesen hat. Selbst kennt er kein Kind, also persönlich, das böse ist. Er glaubt, dass alle lieb sind, außer’m Maurits. Aber wenn er sein eigenes Liebsein genau betrachtet, kann keins der Kinder, die er kennt, es mit ihm aufnehmen.
Sie sind lieb, aber nicht im entferntesten so lieb.
Er trägt sein Liebsein wie ein Kreuz, oder eher wie einen Albatros um den Hals, resigniert aber, versteht, dass dieses Gutsein ihm von Jesus Christus auf seine Schultern gelegt wurde und dass niemand dieses Kreuz auf sich nehmen wird, um seine Golgathawanderung zu erleichtern.
Die Samstagsbekenntnisse hören jedoch plötzlich auf, dank eines ihm unbegreiflichen Ereignisses. Es hat mit seiner Pflegeschwester Eeva-Lisa zu tun. Von ihr darf er nicht erzählen. Er liebt beide, sie und seine Mutter, aber ihre immer heftigeren Konflikte quälen ihn. Er findet, dass seine Mutter, im Prinzip ein Urbild von Güte, nicht lieb zu Eeva-Lisa ist.
Er versteht es nicht.
Plötzlich schlägt er während der samstäglichen Stunde im Angesicht Christi und bei der üblichen verzweifelten Jagd nach eigenen Sünden, die er bekennen kann, vor, die Mutter solle bekennen, dass sie gegenüber Eeva-Lisa böse gewesen sei. Das wäre gerecht, deutet er an.
Es wird vollkommen still. Das Gesicht der Mutter ist stumm, und völlig abweisend. Sie sagt kurz und bündig, dass sie nicht verstehe, was er meint. Sie bricht die Andacht ab und fordert ihn auf zu schlafen. Er hört, dass sie nicht schläft. Ohne weitere Erklärung unterbleiben die Beichtstunden von nun an.
Der Montag nach diesem Vorfall ist ganz normal. Er versteht es fast nicht. Während der Gesangsstunde übt sie mit den beiden Klassen gemeinsam das Lied Still ruht der See ein, dreistimmig.
Mit der Zeit kommt auch ein anderer Lehrer in die Schule. Er heißt Dahlquist.
Er ist aus Vannäs, das tief im Süden liegt, fast in Stockholm, und Dahlquist bringt die neue Zeit mit. Er ist der erste im Dorf, der Ketchup benutzt. Die Mutter und er werden jetzt zu einem Sonntagsessen bei Volksschullehrer Dahlquist eingeladen, der einen höheren Lohn erhält als die Mutter, obwohl sie der gleichen Berufung folgen (wie sie dem Kind gegenüber einige Male beiläufig erwähnt, vielleicht nicht so wenige Male), also zu einem Sonntagsessen bei dem Kollegen und seiner Frau. Hinterher fahren die Mutter und er durch den Wald nach Hause, auf Skiern. Es ist nicht gespurt. Er hört die Mutter kritisch murmeln Ketchup und Ketchup und Ketchup, immer muss es was Besonderes sein mit diesem Ketchup. Er versucht, hinter dem schwarzen Rücken der Mutter zu entgegnen, dass dieser Ketchup gut geschmeckt habe, erntet aber nur Schweigen. Es ist unpassend, sich mit Ketchup aufzuspielen.
Sonst mag die Mutter ihren Kollegen und seine Frau sehr gern. Letztere war einmal schwedische Meisterin auf Skiern, mit der Damenstaffel über vier mal zehn Kilometer, und ist der einzige Sportstar des Dorfs. Bei den jährlichen Wettläufen für das Skiabzeichen applaudieren alle, wenn sie startet. Sie führt auch technisches Skitraining ein; in einer quadratischen Spur um das Schulhaus herum müssen die Kinder Stockarbeit lernen, Diagonalschritt, Doppelstockschub und Doppelstockschub mit Zwischenschritt. Das ist in Ordnung, die Mutter erklärt, dass daran nichts Sündiges ist. Nicht wie Sport am Sonntag. In extremen Notsituationen kann der Doppelstockschub mit Zwischenschritt sehr wohl zupasskommen. Im Süden Richtung Stockholm beherrscht keiner den Doppelstockschub mit Zwischenschritt.
Schon bald scheint sie ihre prinzipielle Skepsis gegen Ketchup ganz vergessen zu haben.
Ständig öffnet sich dank Dahlquist eine neue Welt.
In einer Stunde erwähnt dieser Dahlquist »eingelegte Zwiebeln« und fragt die Schüler – es ist jetzt die Klasse fünf und sechs, weil die Schule zu einer B-1:a angehoben worden ist –, ob sie eingelegte Zwiebeln mögen. Es hat noch niemand von eingelegten Zwiebeln gehört, geschweige denn welche gegessen. In der Frühstückspause stellt Volksschullehrer Dahlquist die Schüler in einer langen Reihe auf dem Schulhof auf und geht mit einem Einmachglas und einem Löffel an der Reihe entlang und stopft jedem Schüler mit dem Löffel eine eingelegte Zwiebel in den Mund. Es ist spannend.
So etwas ist in Hjoggböle noch nie passiert.
Dann geht er zurück an den Anfang und lässt jeden von der Marinade kosten, die jedoch nur für die halbe Klasse reicht. Sie finden, dass es gut und ungewöhnlich schmeckt, und legen öffentlich Zeugnis darüber ab, was sie gesehen und erfahren haben.
Außer Doppelstockschub auf Skiern ist Schneeballkrieg der einzige Sport an der Schule. Er findet in der großen Pause statt, bei Pappschnee. Weil er als lieb definiert ist, agiert er nie in der vordersten Frontlinie, bei den Mutigen. Er ist fast immer Nachschub, Munition und Tross und tut bei den Mädchen Dienst. Sie pressen Schneebälle, die auf eine Sperrholzplatte gelegt und zu den Kämpfenden nach vorn getragen werden. Sehr bald findet er den Versorgungsdienst langweilig und schafft sich eine neue Rolle, als Verräter, oder später Quisling.
Im Norran hat man ja gelesen, wer Quisling war.
Es geht so zu, dass er ein Brett mit fertigen, sehr harten Schneebällen nimmt, die die Mädchen aus der Klasse im Tross gemacht haben, doch statt sie den eigenen Frontsoldaten zu bringen, stürmt er mittendurch und gibt diese Munition den Feinden, die ihn daraufhin bejubeln, während seine eigenen Leute ihn verwünschen. Nach einer Weile wiederholt er die Operation, jedoch in die andere Richtung, und erntet erneut Jubel von der einen und Verwünschungen von der anderen Seite.
Er ist jetzt als Verräter definiert. Die Mädchen in den Versorgungstruppen wollen ihm die hergestellte Munition nicht mehr gern anvertrauen, aber er wird plötzlich sehr beredt und verspricht hoch und heilig, die Eigenen nie wieder zu verraten, man vergibt ihm und vertraut ihm aufs neue Bretter mit Munition an, bis er nach einer Weile wieder zum Feind überläuft. Jubel und so weiter.
Er befindet sich auf diese Weise als Verräter immer im Mittelpunkt, fühlt sich nie lieb und ist ganz und gar glücklich.
Außer seinem Liebsein ist seine Schmächtigkeit bezeichnend für ihn. Man kann ihn auch rank nennen. Wenn er im Sommer badet, wird er blau und bibbert stundenlang.
Aber: Ein einziges Mal schlägt er mit der Faust zu. Zwei Jungen aus der Klasse über ihm haben ihn in die Ecke zwischen dem Lokus und dem Holzschuppen gedrängt, sie wollen ihn mit Schnee waschen. Sie hohnlachen kalt und glücklich angesichts der schrecklichen Leiden, die sie ihm antun werden. Er hat Angst. Plötzlich schießt sein rechter Arm vor, er entdeckt zu seiner Überraschung, dass seine rechte Hand zur Faust geballt ist, sie trifft den Angreifer mit erstaunlicher Kraft auf die linke Wange, und der Verfolger stürzt zu Boden. Alle, er selbst eingeschlossen, sind unerhört verblüfft, der zu Boden Geschlagene erhebt sich unter furchtbaren Flüchen und Verwünschungen und mit immer detaillierteren Beschreibungen der Rache, die nun bevorsteht; doch nichts geschieht.
Nichts geschieht.
Zwei Tage später ist das eine Auge des Widersachers, er heißt Maurits, blau, und seine Backe ist stark gelb gefärbt. Seine Mutter bemerkt es während des Unterrichts und fragt, was passiert sei. Alle wissen es, alle betrachten gespannt diesen Maurits, aber er murmelt nur, dass er gefallen sei. Unerhörte Erleichterung. Es ist das einzige Mal in seinem Leben, dass er jemanden schlägt, selbst wird er hiernach auch niemals mehr geschlagen, er redet sich ein, dass er etwas gelernt hat.
Der Vorfall ist eine Ausnahme, vielleicht.
Im Winter 1944 kommen die Finnenkinder.
Es sind vierhundert auf einmal, dann kommen kleinere Gruppen mit einigen Dutzend; man hat die zentrale Volksschule in Bureå geschlossen und die Kinder auf Matratzen in den Klassenräumen untergebracht, das ganze Gebiet mit einem Gunnebozaun eingefriedet, damit die Kinder nicht das Kirchspiel verlausen, bevor sie entlaust werden. Die Finnenkinder neigen dazu, sich am Zaun zu scharen. Da kann der Volkshaufen sie in Augenschein nehmen. Er bittet inständig, einerseits den Erlöser, aber vor allem die Mutter, dass er sie auch anschauen darf. Er darf daraufhin einmal mit der Mutter ins Dorf fahren, nach Bureå, auf dem Gepäckträger ihres Ballonreifenfahrrads. Während sie Besorgungen macht, darf er vor dem Zaun stehen und sie betrachten.
Dort spielt sich eine Art Handel ab, ein Münztausch. Die Finnen stehen da und reißen die Münder auf wie Vogeljunge und rufen unbegreifliche Dinge in ihrer Sprache. Sie strecken die Hände mit finnischen Münzen aus und wollen sie zu äußerst vorteilhaftem Kurs wechseln, der die Bureåkinder unermesslich reich machen wird. Einige der letzteren tauschen, mehr um eine missionarische Tat zu tun, aber auf jeden Fall, um Finnengroschen zu bekommen, die sie sparen können.
Es ist ein beinahe andächtiges Gefühl, die Finnenkinder zu betrachten. Das Norran bringt jeden Tag auf der »Aus aller Welt«-Seite einen Kasten mit gebräuchlichen finnischen Wörtern, die man lernen kann. Da stehen die notwendigsten Wörter; aber außerhalb des Kastens im Norran, sozusagen, also bei den Finnenkindern selbst, finden sich andere und spannendere Wörter. Diese weiterreichenden Sprachkenntnisse sind notwendig, am Anfang hauptsächlich, um vögeln und Pimmel auf Finnisch sagen zu können, was keiner der Erwachsenen versteht. Dann auch zusammenhängende Sätze, und zwei der Finnenkinder bleiben und heiraten Kusinen von ihm.
Es ist beabsichtigt, die Kinder auf die Dörfer zu verteilen und sie nicht länger als nötig im Lager festzuhalten. Nach Hjoggböle kommen zehn von ihnen. Einer heißt Jurma; wird bei Bäckströms in Östra einquartiert. Schon nach einem halben Jahr spricht er ausgezeichnet die Skellefteå-Mundart. Jemand, eine Dichternatur, die die Kunst des Reimens gelernt hat, also der Lährarinn’jong, der sich aufgrund der schützenden Autorität seiner Mutter gegenüber finnischen Einwanderern für unverwundbar hält, läuft da in der Pause herum und ruft Finn schiet drinn! Finn schiet drinn!
Es ist nicht klar, was er damit meint, vielleicht dass Finnen im Haus auf den Fußboden scheißen, aber wahrscheinlich, dass Innentoiletten Verfall und einen Mangel an Zivilisation bedeuten; er hat ja ehrlich gesagt noch nie eine Innentoilette gesehen und deshalb angenommen, dass dies der Gipfel der Schmuddeligkeit sein muss. Lokus drinnen! Jurma, der sehr stark und alles andere als von ranker Konstitution ist, fängt ihn blitzschnell ein, schlägt hart und intensiv auf seine Oberarme, wo es wehtut, und schreit zwischen den Schlägen Na, wohin schiet de Finn??? und bekommt am Schluss von dem brüllenden Dichter am Boden die Bekräftigung Nä, he schiet nich drinn!!! Ich schwörs! He schiet nich drinn!!!
Auf diese Art und Weise wird ihre Freundschaft besiegelt, die jedoch nur ein Jahr lang dauern wird. Es ist der einzige Freund, den er in seiner Jugend hat, außer Eeva-Lisa, und dem Wald, wenn man so will. Aber von Eeva-Lisa muss er schweigen.
Die Mutter ist sehr darauf bedacht, dass er sich nicht überhebt. Deshalb lobt sie ihn selten oder nie.
Sie hält ihn zur Demut an, es ist fast lästig, aber er nimmt jetzt immer erfolgreicher eine Demutshaltung ein. Demut ist fast ebenso verführerisch wie Verrat. Demütig oder Verräter, er glaubt, im Mittelpunkt zu stehen, wenn auch nicht in der Rolle eines Helden. Seine Demut ist bestimmt von der zurückhaltenden Art der Mutter.
Aber ein Mal ist ihr ein Lob entschlüpft.
Auf seine Frage, was sie eigentlich von seinen Aufsätzen hält, antwortet sie nur, Ich hatte noch nie einen Schüler, der besser geschrieben hat als du. Das ist alles, es genügt, er ist für den Rest seines Lebens überzeugt davon, dass er taugt, sie braucht nicht zu loben.
Dieses eine Mal ist es ihr entschlüpft!
Dies, dass er taugt, dass es richtig war, sich zu verteidigen, Ketchup, seine eingeübte Demut, eingelegte Zwiebeln, die Verräterrolle und der Doppelstockschub mit Zwischenschritt auf Skiern sind wichtige Korrektive zu dem Alptraum, dass er durch eine Steißgeburt schon zwei Jahre vor seiner behaupteten Geburt zum Erlöser heimgeholt worden ist.
Das Dorf besteht eigentlich aus mehreren Dörfern.
Die Dörfer umgeben einen See, der Hjoggböleträsk heißt, durch ihn fließt der Bureälv, der aus dem Mjödvattsträsk kommt, dann macht der Fluss eine Biegung nach Norden und nach Osten, über Fahlkmarksträsket, Bodaträsket, Bursjön und fließt bis zum Meer bei Bureå. Um Hjoggböleträsket liegt das Dorf, wie eine Schlange! Die Ortsteile haben verschiedene Namen, Östra Hjoggböle, Västra Hjoggböle, Forsen und Sjön, Hjoggböle. Sechs Kilometer entfernt, am Bursjö, lebt seine Großmutter, der Hof liegt einsam am See, hundert Meter weiter liegt jedoch noch ein kleinerer Hof am Waldrand: Es sind nur diese beiden Höfe, Gammelstället und Larssonsgården. Im Larssonsgården, hundert Meter von seiner Großmutter Johanna entfernt, lebt der Vater des jungen Stieg, der Kriminalromane schreiben wird. Dass die zwei Höfe im Wald zwei Schriftsteller hervorbringen, ist hier das statistisch Normale, findet man, in diesen Dörfern gibt es mehr Erzähler als Kuhzitzen. In Hjoggböle, das größer ist, gibt es auch mit der Zeit fünf Schriftsteller. Jedes Dorf hat seinen Autor; aber Hjoggböle erlangt seine größte Berühmtheit durch etwas anderes.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!