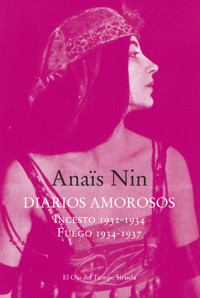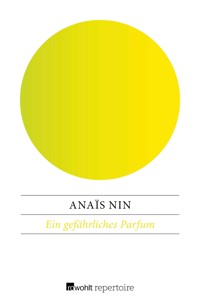
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
In Nizza, Paris und in den phantastischen Nischen der «Großen Welt» spielend, trügerisch nach Blüten und Hoffnungen duftend, sind Anaïs Nins frühe Erzählungen delikate, von origineller Beobachtungskraft und melancholischem Witz zeugende Versuche über die fatale Neigung von Männern und Frauen, dem anderen eben jene Züge auszutreiben, die ursprünglich die Anziehung bewirkten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Anaïs Nin
Ein gefährliches Parfum
Die frühen Erzählungen
Aus dem Englischen von Linde Salber
Ihr Verlagsname
Über Anaïs Nin
Über dieses Buch
Inhaltsübersicht
Ich sehe in meinem frühen Schreiben
eine frühe Ahnung von den Gefangenschaften
und Abhängigkeiten des Menschen.
Es war ein Mittel zu entkommen,
ein Fluchtweg in die Freiheit.
Anaïs Nin
26.7.1945
Vorwort
Anaïs Nin wollte immer eine Künstlerin, eine Schriftstellerin sein, die ihre eigenen Gefühle erforschen und darstellen kann. Dadurch hat sie sich oft von dem Leben entfernt, welches sie das «gewöhnliche» nannte. Es begann 1914, daß sie mit außerordentlicher Sensibilität ihre Gefühle dem einzigen «Freund», ihrem Tagebuch, anvertraute, nachdem der Vater die Familie verlassen hatte. Ein Leben lang blieb sie dem Tagebuch treu, welches heute allgemein als ihre wichtigste Schöpfung anerkannt ist. Aus vielen verschiedenen Gründen jedoch hatte das Tagebuch geheim bleiben müssen, und selbst 1966, als Anaïs Nin begann, Teile aus den etwa 35000 Seiten zu veröffentlichen, mußten viele persönliche Einzelheiten ausgelassen werden. So mußte Anaïs Nin, die so sehr wünschte, als Künstlerin von der Welt anerkannt zu werden, lernen, den Schutz gewährenden Rahmen des privaten Tagebuchs mit ihrem Schreiben zu verlassen. Gleichwohl wissen wir, daß das Tagebuch die wesentliche Quelle für alle fiktionalen Texte war.
Die sechzehn Erzählungen dieses Bandes sind ein Beispiel der frühen Versuche der Anaïs Nin, für die Öffentlichkeit zu schreiben. Sie sind das Ergebnis eines schöpferischen Ausbruchs zwischen 1929 und 1930, als sie, sechsundzwanzig Jahre alt, wieder in Frankreich lebte, nun mit dem amerikanischen «poet-banker» Hugh Guiler, den sie 1923 geheiratet hatte. Im Oktober 1929 trägt sie in ihr Tagebuch ein: «Es ist mein Ziel, und ich weiß, daß ich es erreichen werde, in aller Klarheit die undurchdringlichen, namenlosen und gemeinhin unbeschreiblichen Dinge in den Blick zu rücken. Ich will den flüchtigen, subtilen und ungreifbaren Gedanken Gestalt verleihen und denjenigen geistigen Werten eine Mächtigkeit zuerkennen, die üblicherweise recht vage und allgemein abgehandelt werden. Sie sind das Licht, welchem die meisten Menschen folgen, ohne sie wirklich wahr-nehmen zu können.»
Einzelne Erzählungen hat Anaïs Nin an Zeitschriften und Verlage geschickt. Es überrascht nicht, daß 1930 und selbst heute in Amerika kein «Markt» vorhanden war für eine solche Beschwörung «subtiler» und «üblicherweise unbeschreibbarer» Dinge. Und so wurde tatsächlich keine der Erzählungen je veröffentlicht. Sie landeten einige zwanzig Jahre später mit anderen aufgegebenen Manuskripten in der Sammlung einer amerikanischen Universitätsbibliothek. Kurz vor dem Tode der Anaïs Nin im Januar 1977 trat Valerie Harms mit dem Wunsch an die Schriftstellerin heran, diese Erzählungen in einer kleinen privaten Edition der Magic Circle Press zu veröffentlichen. Nach einigem Zögern stimmte Anaïs Nin schließlich zu, bestand aber darauf, ihren Entschluß in einem Vorwort zu rechtfertigen:
«Ich habe diese Erzählungen nie veröffentlichen wollen, da sie mir unreif erschienen. Aber dann dachte ich, es könnte für andere Schriftsteller interessant sein, der Entwicklung meines Werkes zu folgen und jeden Schritt des Reifungsprozesses zu betrachten … In diesen Erzählungen finden sich bereits zwei Elemente, die in meinen späteren Arbeiten eine große Rolle spielen sollten: Ironie und erste Andeutungen von Feminismus. Man hat mich schließlich überredet, diese Erzählungen all denen zugänglich zu machen, die mein Werk verstehen und lieben und deshalb Interesse an seiner Entwicklung haben. Also: dieses ist ein Buch nur für Freunde!»
Diese «unreifen», frühen Erzählungen enthalten in der Tat viele Themen im Keim und reflektieren viele im Tagebuch dargestellte persönliche Erfahrungen und Sorgen, die in den späteren fiktionalen Texten voll entfaltet wurden. So ist man versucht, das Bekenntnis auf diese frühen Erzählungen anzuwenden, welches Anaïs Nin ihrem zuerst veröffentlichten fiktionalen Text, Haus des Inzests, 1936, voranstellte: «Mein ganzes Wissen ist in diesem Buch enthalten …»
Becket, Massachusetts, Winter 1992/1993
Gunther Stuhlmann
Ungenutzte Zeitlosigkeit
Es war die übliche Einladung zu einer dieser üblichen Parties mit den üblichen Leuten und mit ihrem üblichen Mann. Warum bloß luden nur Freunde des «großen Schriftstellers» Alain Roussell sie zum Wochenende ein und nicht Alain Roussell selbst?
Außerdem regnete es.
Das erste, was Mrs. Farinole sagte, war: «Den ganzen Sommer über hat es hier nicht geregnet. Wie schade, daß es ausgerechnet heute regnen muß. Sie werden sich kaum vorstellen können, wie zauberhaft es hier sein kann.»
«Oh, aber das kann ich mir sehr gut vorstellen», antwortete sie und betrachtete voller Bewunderung die Berge, die Pinien, das Meer, das umrahmt zu sein schien, so daß sich ein windgeschützter Schlupfwinkel bildete. Und dann stellte sie sich einen gigantischen Windstoß vor, der den ganzen Ort wegfegen würde, und Mrs. Farinole, die sagen würde: «Es tut mir so leid, aber unser Haus ist davongeflogen, und so kann ich Sie nicht einladen, über Nacht zu bleiben. Ich muß dringend den Zimmermann anrufen.»
Und dann würde Alain Roussell zufällig vorbeikommen, der ein Fischernetz trug und auf der Suche nach einem Stoff war. Sobald er sie auf der Straße erblickte, würde er sagen: «Wollen Sie mit mir kommen? Wir können das Wochenende auf dem alten Fischerboot am Strand verbringen. Das ist ein riesig guter Platz.» (Er würde ein anderes Wort wählen, ein besseres als «riesig gut», aber es fiel ihr im Moment nicht ein.)
Ihr Mann würde sagen: «Warten Sie einen Augenblick. Ich muß ihren Regenmantel holen. Sie bekommt so leicht eine Nervenentzündung.»
«Dort steht Roussells Haus», sagte Mrs. Farinole. «Er hat sein Tor türkisgrün gestrichen. Es wird durch die Seeluft bald wieder grau werden.»
«Haben Sie alle seine Bücher gelesen?» fragte sie.
«Das werden wir, nach und nach», sagte Mr. Farinole. «Wußten Sie, daß er die letzten drei alle hier geschrieben hat?»
«Und sogar, während sie sein Haus reparierten», sagte Mrs. Farinole. «Ich begreife nicht, wie er das schaffen konnte.»
«Und seine Köchin war krank – das Haus war in schrecklicher Unordnung», fügte Mr. Farinole hinzu.
«Er hat etwas ganz Außergewöhnliches in einer Zeitschrift geschrieben», sagte sie.
«Er ist ein ganz außergewöhnlicher Mensch», sagte Mrs. Farinole. «Haben Sie schon davon gehört, daß er sein Auto selbst repariert hat, als der Mechaniker nicht wußte, was er machen sollte?»
«Und hier ist unser Haus», sagte Mrs. Farinole. «Henry, zeig ihr die widerspenstige Glyzinie.»
Sie blieben ein Weilchen vor der Eingangstür stehen.
«Sehen Sie sich diese Glyzinie an! Eine widerspenstige Pflanze – bestand zwei Jahre lang darauf, nach links zu wachsen, aber schließlich habe ich sie nach rechts und über die Tür biegen können, wo ich sie haben wollte.»
Während dieser Erzählung strahlte die kleine Mrs. Farinole vor Stolz. «Das ist ganz Henry, so wundervoll beharrlich zu sein.»
«Glauben Sie», fragte sie, «er könnte auch mich dazu bringen, nach rechts zu wachsen? Ich würde wirklich gern rechtsherüber und über die Tür wachsen, aber es kommt mir unmöglich vor.»
Mr. Farinole lachte. «Sie haben was Irisches in sich, nicht wahr?»
«Nein, warum?»
«Immer wenn Henry etwas Lustiges sagt, sagen wir: ‹Du hast was Irisches in dir, meinst du nicht?›»
«Ach, wirklich.»
«Und er antwortet jedesmal: ‹Aber auch ein bißchen Scotch.› Nun kennen Sie den Lieblingsscherz der Familie», sagte Mrs. Farinole.
«Ich finde das köstlich», sagte sie. Für kurze Zeit vernahm sie nichts mehr vom Rest des Gesprächs. Sie dachte, daß sie Roussell gern fragen würde, was er unter intuitivem Denken verstand.
«Durch intuitives Denken», meinte sie, «könnte ich dazu gebracht werden, nach rechts über die Tür zu wachsen, nicht jedoch durch reines Denken.»
Sie gingen zum Ende des Gartens.
«Was ist denn das? Ein Boot? Ein Boot in diesem Garten?»
«Ich zeige es Ihnen», sagte Mr. Farinole. «Es war schon hier, als wir das Haus bezogen. Es ist ein altes normannisches Fischerboot, das man als Werkzeugschuppen benutzte. Sehen Sie, es ist ganz schwarz, weil man es geteert hat, um es zu schützen. Hat es nicht eine wunderbare Form? So tief, so umfänglich, so behaglich, so sicher ausschauend.»
«Darf ich es von innen sehen, o bitte, darf ich?»
«Wir haben einmal ein Bett hineingestellt, für einen kleinen Jungen, der als Gast hier war. Er bestand darauf, hier zu schlafen. Er fand es so aufregend!»
Innen roch es nach Teer. Da waren ein Bett, ein paar alte Koffer, Gartengerät, Töpfe, Samen und Knollen. Da war ein kleines rechteckiges Fenster zu beiden Seiten der Tür. Das Dach neigte sich ein wenig.
«Oh, ich würde auch gern hier schlafen», sagte sie.
«Haben Sie was Irisches in sich?» fragte Mrs. Farinole.
«Denk an deine Nervenentzündung», sagte ihr Mann.
«Henry ist wahnsinnig stolz auf dieses Boot», sagte Mrs. Farinole.
«Der Gong ruft zum Abendessen», sagte er ausweichend und bescheiden.
Es war alles viel leichter, seit sie wußte, daß das Boot da war – so viel leichter, von einem Thema zum nächsten zu springen und immer vorsichtig zu vermeiden, daß eine gewisse laue Temperatur überschritten wurde.
Da gab es das Boot, das im dunklen Garten wartete, am Ende des sehr schmalen Pfades, das Boot mit seinem leicht gedrehten Eingang, seinen kleinen Fenstern, dem spitzen Dach, seinem beißenden Teerduft … das uralte Boot, das weit gereist und nun in einem stillen, dunklen Garten versunken war.
Die Atmosphäre in der Bibliothek der Farinoles hatte etwas Enges bei all dem gezwungenen Lachen. Sie durfte nicht aufhören zu lachen. Ihr Mann hatte gesagt: «Die Farinoles haben einen wunderbaren Sinn für Humor.» Da konnte man nichts machen.
Es war Schlafenszeit.
Daß sie wirklich im Boot schlafen wollte, glaubten die Farinoles erst, als sie den Weg dorthin schon halb zurückgelegt hatte, mit ihrem Nachtzeug unter dem Arm. Dann riefen sie: «Warten Sie! Warten Sie! Wir begleiten Sie.»
«Ich kenne den Weg», rief sie zurück und ging schneller.
«Sie werden eine Kerze brauchen.»
«Machen Sie sich keine Sorgen. Mir genügt das Licht der Mondsichel.»
Dann riefen sie noch irgend etwas, aber das hörte sie schon nicht mehr.
Sie ging um das Boot herum. Es war an einem alten Baum befestigt. Sie löste das schimmelige Tau. «Und nun bin ich fort», sagte sie, ging in das Boot und schlug die Tür hinter sich zu.
Sie lehnte sich aus einem der Fenster.
Die Mondsichel war von einer Wolke bedeckt.
Ein Windstoß fuhr durch den Garten.
Sie saß auf ihrem Bett und weinte. «Ich möchte wirklich gern fort. Leute wie die Farinoles möchte ich nie wieder sehen. Ich würde gern einmal laut denken dürfen, nicht immer nur in aller Heimlichkeit.» Sie hörte das Geräusch des Wassers. «Es muß eine Reise geben, von der man für immer verwandelt zurückkehrt. Es muß viele Möglichkeiten geben, mit dem Leben noch einmal zu beginnen, wenn man einen so schlechten Start hatte. Nein, ich möchte nicht noch einmal beginnen. Ich möchte fernbleiben von allem, was ich bisher gesehen habe. Ich weiß, daß es nicht gut ist, daß ich nicht gut bin, daß es da irgendwo einen riesenhaften Fehler gibt. Ich hab es satt, darum zu kämpfen, daß ich eine Philosophie finde, die zu mir und meinem Leben paßt. Ich will lieber eine Welt finden, die zu mir und meiner Philosophie paßt. Auf diesem Boot könnte ich gewiß davonfahren von dieser Welt, auf einem fremden weisen Fluß, zu fremden weisen Orten …»
Am Morgen lag das Boot nicht mehr im Garten.
Ihr Mann nahm den Zwei-Uhr-fünfundzwanzig-Zug nach Hause, um das Problem mit seinem Kompagnon zu besprechen.
Das Boot trieb auf einem dunklen Fluß dahin.
Es gab kein Ende des Flusses.
Am Ufer waren zahlreiche Anlegestellen, aber es sah alles sehr gewöhnlich aus.
Roussell hatte ein Haus am Ufer. Als sie sich anschickte, ihn zu besuchen, fragte er:
«Bewundern Sie mich?»
«Ich liebe Ihr Werk», sagte sie.
«Und das keines anderen?»
«Ich mag Currans Dichtung und Josiams kritische Schriften.»
«Halten Sie nicht hier an», sagte Roussell. Und sie sah, daß er von begeisterten Anbetern umgeben war; so bewegte sie ihr Boot weiter voran.
Eines Tages sah sie am Ufer ihren Mann. Er signalisierte ihr: «Wann kommst du nach Hause?»
«Was hast du denn heute abend vor?» fragte sie.
«Ich werde mit den Parks essen gehen.»
«Das ist kein Ziel», sagte sie.
«Worauf bist du denn aus?» rief er.
«Auf etwas Großes», antwortete sie und trieb fort.
Ruhigere Uferzonen breiteten sich aus. Es gab nichts Glänzendes oder Wunderbares zu sehen. Kleine Häuser überall. Manchmal kleine Boote, an einen Pfahl gebunden. Die Leute benutzten sie für kleinere Ausflüge.
«Wohin geht ihr?» fragte sie.
«Wir wollen ein wenig vom gewöhnlichen Leben ausruhen», sagten sie, «fort für ein paar Stunden, um unserer Phantasie ein wenig Spielraum zu geben.»
«Aber wohin geht ihr?»
«Nach einer Weile wieder nach Hause.»
«Gibt es denn dahinten nichts Besseres?»
«Sie sind aber eigensinnig», sagten die Leute kühl. Sie ließ sich weitertreiben.
Der Fluß kannte verhangene Tage und sonnige Tage, wie jeder andere Fluß. Manchmal gab es einen gewissen Zauber; Augenblicke befremdlicher Ruhe, in denen sie die gleiche intensive Erregung spürte, die sie in der ersten Nacht auf dem Boot erlebt hatte; als würde sie endlich in ein unbeschreibliches Leben hinaussegeln.
Sie sah aus dem kleinen Fenster. Das Boot bewegte sich sehr langsam und nirgendwohin. Sie begann ungeduldig zu werden.
Am Ufer sah sie alle ihre Freunde. Sie riefen ihr fröhlich, aber förmlich zu. Sie spürte, daß sie beleidigt waren. «Kein Wunder», dachte sie, «sie müssen mir inzwischen allerlei Einladungen geschickt haben, und ich habe ihnen nicht geantwortet.»
Dann kam sie wieder an Roussells Haus vorbei. Jetzt war ihr klar, daß sie sich im Kreis bewegt hatte. Er rief: «Wann kommen Sie zurück? Die Farinoles brauchen ihr Gartengerät und auch ihre Koffer.»
«Ich wüßte gern», rief sie, «was Sie unter intuitivem Denken verstehen?»
«Das können Sie ja doch nicht begreifen», rief er zurück. «Sie sind vor dem Leben davongelaufen.»
«Es war das Boot, das davongesegelt ist», sagte sie.
«Seien Sie doch kein Sophist», sagte er. «Es ist davongesegelt, weil Sie es wünschten.»
«Was meinen Sie, könnten wir uns ernsthaft unterhalten, wenn ich ans Ufer käme? Ich glaube, dann würde ich nicht weiterreisen wollen.»
«Oh», sagte Roussell, «aber es könnte sein, daß dann ich auf Reisen gehen wollte. Ich mag vollkommene Vertrautheit nicht; Sie könnten einen Artikel darüber schreiben.»
«Sie verpassen etwas», sagte sie. «Es würde ein interessanter Artikel.» Und sie trieb davon.
Am Ufer war immer nur das Übliche zu sehen, und darüber hinaus gab es keine Welt.
Ihr Mann rief ihr zu: «Wann kommst du nach Hause?»
«Ich wünschte, ich wäre jetzt zu Hause», sagte sie.
Das Boot lag im Garten. Sie befestigte das Tau an dem alten Baum.
«Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen», sagte Mrs. Farinole. «Kommen Sie und sehen Sie sich unsere Glyzinie an. Sie hat sich schließlich doch noch nach links gewandt, trotz allem.»
«Während der Nacht?» fragte sie.
«Haben Sie was Irisches in sich? Erinnern Sie sich nicht mehr, wie die Glyzinie vor zwanzig Jahren aussah, als Sie uns das erste Mal besuchten?»
«Ich habe viel Zeit vergeudet», sagte sie.
Das Lied im Garten
Sie entdeckte, daß sie etwas Ungewöhnliches an sich hatte, da sie es ablehnte, ihre Puppen wie Babies zu verzärteln, sie in Kinderwagen an der frischen Luft spazierenzufahren, sie in Windeln zu wickeln und mit ihnen auf kindische Weise zu sprechen. Sie machte Männer und Frauen aus ihnen, an deren Handlungen die Mitglieder ihrer Familie Anstoß nahmen, als sie begriffen, daß die Puppen eine unbewußte Parodie ihrer selbst waren. Doch später dann gab sie nicht mehr vor, diese leblosen und ausdruckslosen Körper zu beleben; sie spielte mit anderen Dingen.
Da war zunächst einmal sie selbst. Sie hielt das für ein ziemlich abwechslungsreiches Schauspiel. Auf andere zu schauen, ihnen persönliche Fragen zu stellen war sinnlos. Sie erhielt keinerlei Antwort, oder die Antworten wurden auf viel später verschoben, wenn sie verständig genug wäre, und das Schauen trug ihr nur Verbannung ein, Vertreibung aus den Räumen, in denen sich die Dinge wirklich abspielten.
Also beobachtete sie sich selbst, als wäre sie ein Insekt. Als erstes entdeckte sie, daß sie weinen mußte, wann immer ihre Mutter sang. Es war eine außerordentlich genußvolle Empfindung, welche das ganze Innere ihres Körpers bewegte, anschwellen und überlaufen ließ, um sich dann ganz allmählich in einer Empfindung süßen Friedens zu verlieren. Ein wunderbares Gefühl war das. Der Geschmack der Tränen übertraf alles, was sie je gekostet hatte.
Dann versuchte sie herauszufinden, ob es anderen Kindern ihres Alters ebenso erging. Sie hatte eine Klassenkameradin mit einem mürrischen Gesicht, die fragte sie. Nein, sagte die Mitschülerin, das sei das Albernste, was sie je gehört habe. Man weine, wenn man vom Lehrer geschlagen werde oder sich das Knie aufgeschlagen habe oder wenn einem zürnende Eltern das Vier-Uhr-Butterbrot und die Schokolade versagten. Oder wenn ein Bruder in seiner Grobheit das Gesicht der Lieblingspuppe mit seiner elektrischen Eisenbahn zertrümmere, so wie ihrer das getan habe, um herauszufinden, ob sein Zug wirklich Menschen überfahren könne.
«Oder vielleicht», sagte die Schulfreundin, «hat deine Mutter eine bedrohliche Stimme. Mein Vater hat so eine.»
Sie mußte wohl umfänglichere Nachforschungen anstellen. Dabei brachte sie in Erfahrung, daß ihr Gefühl keineswegs weit verbreitet war und daß Dora, wenn sie Ohrenschmerzen hatte, und Matilda, wenn ihr die Spardose gestohlen wurde, etwas ganz anderes fühlten. Und der Geschmack der Tränen konnte nicht mit dem von Schokolade konkurrieren.
Als sie entdeckte, daß sie der einzige Mensch auf der Welt war, der solch eigentümliche Stimmungen hatte, erfüllte sie eine Freude, die fast stärker war als die Traurigkeit. Auch diese Freude, fand sie schließlich heraus, kannten ihre Freundinnen nicht.
So saß sie eine Weile auf dem Balkon in einem kleinen Korbstuhl zwischen zwei Topfpflanzen und zwei Käfigen mit tropischen Vögeln und umarmte sich selbst so zärtlich, wie sie nie eine Stoffpuppe umarmt hatte, da in ihr so viel Merkwürdiges vorging, was einfach besser war als die Leblosigkeit der Puppen.
Sobald es dunkel und kühl wurde, gingen Vater und Mutter draußen spazieren, um die Hitze des Tages und das wilde Strahlen der Sonne zu vergessen. Ramona, das Dienstmädchen aus Valencia, brachte sie ins Bett, vertraute sie sämtlichen Heiligen im Himmel an und ging, statt nach ihr zu sehen, bis sie eingeschlafen war, hinaus auf den Platz bei dem Brunnen, wo ein Matrose auf sie wartete. Doch die Heiligen gewährten denjenigen keinen Schlaf, die durch seltsame Gefühle beunruhigt wurden, als trügen sie kitzelnde gefiederte Insekten in der Brust.
Sie lag wach, und in der Dunkelheit spürte sie, wie etwas in ihr kribbelte und sich regte. Es schien, als wüchsen ihr Flügel, wie sie es in heiligen Büchern gesehen hatte. Die Nonnen hatten diese Flügel Seele genannt. Das mußte sie wohl haben. Das mußte sie beunruhigt haben, wenn ihre Mutter sang. Und das war es, was nachts wuchs, wenn Ramona nicht da war, um nach ihr zu sehen.
Aber ihr Vater und ihre Mutter, die von alldem nichts wußten, schrieben ihren Zustand der Hitze und dem Fieber zu, das sich in der Stadt ausbreitete, und sie schickten sie an den Strand.