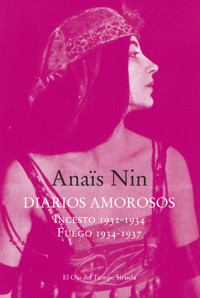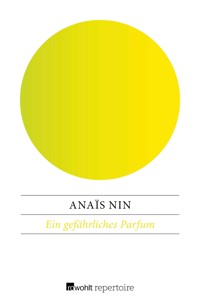9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Malerin Renate ist eine Abenteurerin, eine Menschenfängerin, eine Wandererin, die es früh aus dem heimatlichen Wien – und aus der überintimen Beziehung mit dem eifersüchtigen Vater – in die weitere Welt treibt: nach Mexiko, nach Kalifornien ... Die skurrilen, oft narzißtischen, fast immer künstlerisch begabten Leute, denen sie begegnet, mit denen sie in vielfältige Tauschverhältnisse eintritt, erinnern sie an die Wiener Parkskulpturen ihrer Jugend – so daß aus den manchmal grotesken, manchmal diabolischen Episoden des Romans allmählich ein Garten voller Statuen wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Anaïs Nin
Wien war die Stadt der Statuen
Über dieses Buch
Inhaltsübersicht
Für den echten Gärtner,
der eine Welt erschuf, in der
ein humoristisches Buch gedeihen konnte.
Eins
Wien war die Stadt der Statuen. Sie waren so zahlreich wie die Menschen, die die Straßen bevölkerten. Sie standen auf den höchsten Turmspitzen, ruhten auf steinernen Grabmälern, saßen hoch zu Roß, knieten und beteten, kämpften mit Ungeheuern und fochten in Kriegen, tanzten, zechten und lasen Bücher aus Stein. Wie die Galionsfiguren alter Schiffe schmückten sie die Dachgesimse. Sie standen in der Mitte der Brunnen und glänzten vor Nässe, als seien sie gerade geboren worden. Sommer wie Winter saßen sie unter den Parkbäumen. Manche trugen Kostüme früherer Epochen, andere hatten gar nichts an. Männer und Frauen, Kinder und Könige, Zwerge, Wasserspeier, Einhörner und Löwen, Narren, Helden, Weise und Propheten, Engel, Heilige und Kriegsleute bewahrten Wien eine Illusion der Ewigkeit.
Als Kind konnte Renate sie von ihrem Schlafzimmerfenster aus betrachten. Nachts, wenn die weißen Musselinvorhänge wie bauschige Brautkleider flatterten, hörte sie sie flüstern – das Wispern von Gestalten, die ein Fluch tagsüber versteinerte und die nur nachts zum Leben erwachten. Ihr Schweigen bei Tage lehrte sie, die erstarrten Lippen zu lesen, so wie man die Botschaften der Taubstummen entziffert. An Regentagen vergossen die granitenen Augenhöhlen mit Ruß vermischte Tränen.
Renate erlaubte niemandem, ihr die Geschichte der Statuen zu erzählen oder zu verraten, wen sie darstellten. Das hätte sie in die Vergangenheit verwiesen. Sie war fest überzeugt: Die Menschen starben nicht, sie verwandelten sich in Statuen. Sie lebten unter einem Zauberbann, und wenn sie nur wachsam genug war, so würden sie ihr erzählen, wer sie waren und wie sie jetzt lebten.
Renates Augen waren meergrün und aufgewühlt wie ein verkleinertes Abbild der See. Und wenn sie schon fast überflossen vor Empfindung, dann zitterte ihr Lachen wie ein Windglockenspiel und bildete eine kristallene Schale, das die türkisgetönten Ströme wie in einem Aquarium auffing. Dann wurden ihre Augen zu venezianischen Veduten, Kanälen aus reflektierendem Licht, in denen goldene Tupfen wie Gondeln schwammen. Ihr langes schwarzes Haar war aus dem Gesicht gekämmt, zu einem Knoten hochgesteckt und fiel von dort auf die Schultern herab.
Renates Vater baute Teleskope und Mikroskope, so daß Renate lange Zeit von keinem Gegenstand die genaue Größe kannte. Sie hatte die Dinge immer nur verkleinert oder vergrößert gesehen.
Der Vater behandelte Renate wie eine Vertraute, wie eine Freundin. Er nahm sie mit auf Reisen, zur Einweihung von Teleskopen oder zum Skifahren. Über die Mutter sprach er mit ihr, als sei Renate eine erwachsene Frau, und erklärte ihr, daß ihn die ständige Niedergeschlagenheit der Mutter aus dem Haus treibe.
Er liebte ihr Lachen, und manchmal fragte sich Renate, ob sie nicht für zwei lachte, für sich selbst, aber auch für ihre Mutter, die nie lachte. Renate lachte sogar dann, wenn ihr zum Weinen zumute war.
Mit sechzehn beschloß sie, Schauspielerin zu werden. Sie teilte es ihrem Vater mit, als er gerade Schach spielte, darauf hoffend, daß die Konzentration auf das Spiel seine Reaktion mildern würde. Doch er ließ seinen König fallen und wurde blaß.
Dann sagte er sehr kalt und ruhig: «Aber ich hab dich doch in den Schulaufführungen gesehen, und ich finde wirklich nicht, daß du eine gute Schauspielerin bist. Du hast nur eine übertriebene Version von dir selber gegeben. Und außerdem bist du noch ein Kind und keine erwachsene Frau. Du hast ausgesehen, als hättest du dich mit den Kleidern deiner Mutter zu einer Maskerade aufgeputzt.»
«Aber Vater, du hast doch mal gesagt, daß dir an Schauspielerinnen gerade das Übertriebene gefällt! Und jetzt verwendest du genau diesen Ausdruck gegen mich, um mich zu verurteilen.»
Renate sprach heftig, und beim Sprechen wuchs die Empfindung der Ungerechtigkeit mächtig an und entlud sich in einer langen Beschuldigungsrede.
«Immer hast du Schauspielerinnen geliebt. Deine ganze Zeit hast du mit ihnen verbracht. Ich hab dich mal an irgendeinem Abend an einem Spielzeug basteln sehen, das auf der Wechselwirkung von Spiegeln beruhte. Ich hab gedacht, es ist für mich. Weil ich doch so gern durch Kaleidoskope schaute. Aber du hast es einer Schauspielerin geschenkt. Einmal wolltest du mich nicht ins Theater mitnehmen, hast gemeint, ich wäre zu jung, aber du hast ein Mädchen von meiner Schule mitgenommen, und sie zeigte mir all die Blumen und das Konfekt, das du ihr geschickt hast. Du willst doch nur, daß ich ewig Kind bleibe, damit ich brav zu Hause hocke und dich aufheitere.»
Sie sprach nicht wie ein kleines Mädchen, das seinem Vater zürnt, weil er nicht an das Talent der Kleinen glaubt, sondern wie eine betrogene Ehefrau oder Geliebte.
Sie tobte und wurde immer zorniger, bis sie merkte, daß ihr Vater bleich geworden war und sich ans Herz faßte. Erschrocken hielt sie inne und rannte nach der Medizin, die sie ihn hatte einnehmen sehen, gab ihm die Tropfen, kniete sich neben ihn und sagte leise: «Vater, Vater, reg dich doch nicht so auf! Ich hab doch bloß so getan. Ich hab dir nur was vorgespielt, um zu beweisen, daß ich doch eine gute Schauspielerin werden könnte. Siehst du, du hast es mir geglaubt, und es war alles nur Theater.»
Diese leise gesprochenen Worte belebten den Vater. Er lächelte schwach und sagte: «Du bist tatsächlich eine sehr viel bessere Schauspielerin, als ich dachte. Du hast mir wirklich einen Schrecken eingejagt.»
Da sie sich schuldig fühlte, begrub sie die Schauspielerei. Erst viel später entdeckte sie, daß ihr Vater schon seit langem krank war, daß man es ihr verschwiegen hatte und es nicht dieser Auftritt gewesen war, der seine Herzschwäche zum erstenmal offenbarte.
In jeder Beziehung kommt es früher oder später zu einer Gerichtsszene – zu Beschuldigungen, gegenseitigen Anschuldigungen, Prozeß und Urteilsspruch.
Sie hatte für wenige Augenblicke die Stelle ihrer Mutter eingenommen und Beschuldigungen ausgesprochen, die ihre Mutter nie geäußert hatte. Ihre Mutter hatte sich damit abgefunden, zu grübeln oder zu weinen. Renate aber war unbewußt als Anwältin der ungeliebten Ehefrau aufgetreten.
Schuldig fühlte sie sich nicht, weil sie als Tochter gegen den Willen des Vaters rebelliert, sondern weil sie auf die Rolle und den Platz der Mutter im Herzen ihres Vaters Anspruch erhoben hatte.
Und sie wußte jetzt, daß auch ihr Vater nicht wegen des Aufbegehrens der Tochter verletzt war, sondern weil sie ein Geheimnis aufdeckte: Er hatte Renate nicht als Tochter, sondern als Frau betrachtet, und sein Beharren darauf, daß sie Kind blieb, sollte nur ihr enges Verhältnis verbergen, das ihm so teuer war.
Nach diesem Vorfall suchte Renates Vater nach einem Hauslehrer, denn damals weigerte sie sich auch, weiter zur Schule zu gehen.
Er hatte selber einen Bruder gehabt, der den Schulbesuch verweigerte und sich mit vielen Büchern in seinem Zimmer einschloß. Nur zum Essen oder zur Erneuerung seines Büchervorrats verließ er es. Nach sieben Jahren kam er heraus, bestand seine Prüfungen mit Auszeichnung und wurde Professor.
Nur eine milde Form des Wahnsinns gönnte sich der Professor, die sein gelehrtes und philosophisches Wissen jedoch nicht beeinträchtigte. Er behauptete, er habe kein Mark in den Knochen.
Renates Vater war überzeugt, sein Bruder gäbe einen guten Lehrer für Renate ab. Er könnte ihr Musik, Malerei und Sprachen beibringen. Und so konnte man sie auch eher ans Haus binden, wo sie dem Einfluß der anderen Mädchen entzogen war. Er klärte sie über die fixe Idee des Professors auf und wies sie ausdrücklich an, nie über Knochen oder Mark zu reden, da dies seine irrationale Zwangsvorstellung auslöse.
Selbstverständlich fühlte sich Renate stark versucht, dieses geheimnisvolle Thema anzusprechen, und der Knochenmarktick ihres Onkels interessierte sie weit mehr als alles, was er ihr vielleicht sonst noch beibringen konnte.
Sie grübelte tagelang darüber nach, wie sie dieses Thema auf taktvolle Weise in ihre Unterhaltungen einführen könnte. Zur Vorbereitung betrieb sie einige Nachforschungen in der Bibliothek. Sie entdeckte, daß Vögel kein Knochenmark besitzen. Dann kaufte sie ihrem Onkel einen Kanarienvogel mit Koloraturstimme und sagte zu ihm: «Hast du eigentlich gewußt, daß Vögel kein Knochenmark haben?»
«Ja», erwiderte der Onkel, «ich allerdings auch nicht.»
«Das ist ja großartig», sagte Renate, «das bedeutet ja, daß du fliegen kannst.»
Der Onkel war beeindruckt, ließ sich aber nicht aufs Glatteis führen. Aus Angst, daß sie ihn vielleicht drängen würde, diese neue Vorstellung weiter zu erkunden, erwähnte er sein Handikap nie wieder. Doch ehe er sich bezüglich dieses Themas ganz in Schweigen hüllte, gab er ihr eine rationale Erklärung für dessen Ursache.
«Meine Mutter hat mir einmal erzählt, daß sie in der Zeit, als sie mich noch stillte, schwanger wurde. Ganz allmählich habe ich dann begriffen, daß dieses andere Kind, mein Bruder, die ganze Nahrung für sich absorbiert und mir weggenommen hat, so daß ich am Ende kein Mark in den Knochen hatte.»
Zwei
Als Bruce nach Wien kam, fiel er Renate zunächst deswegen auf, weil er einer der Statuen ähnelte, die ihr durchs Schlafzimmerfenster zulächelten. Es war die Statue mit den Flügeln an den Fersen, von der Renate glaubte, daß sie in den Nächten umherstreifte. Jeden Morgen, wenn sie beim Frühstück saß, betrachtete sie sie. Sie war überzeugt, Hinweise auf lange Reisen zu entdecken. Das Haar wirkte zerzauster, und an den geflügelten Füßen klebte Schlamm.
In Bruce fand sie den langen Hals, die Läuferbeine, die Stirnlocke der Statue wieder.
Doch Bruce verleugnete seine Verwandtschaft mit Merkur. Er selber sah sich als Pan. Er zeigte Renate, wie lang das flaumige Haar an seinen Ohrläppchen war.
Da ihr die behende, rastlose Statue so vertraut war, ging sie auch mit Bruce unbefangen um. Verstärkt wurde die Ähnlichkeit noch dadurch, daß Bruce wenig redete. Oder aber er sprach mit dem ganzen Körper, mit Gesten, die beredter waren als Worte. Die Schultern nach vorne werfend, stürzte er sich ins Gespräch, als wolle er in seiner Strömung schwimmen oder fliegen, und wenn er nicht die richtigen Worte fand, schüttelte er sich, als tanze er zu einem jazzigen Rhythmus und als wolle er die Worte wie Würfel aus sich herausschleudern. Seine Gedanken waren noch in seinem Körper gefangen, und nur durch ihn konnte er sie übermitteln. Die Worte, die aus ihm herauswollten, schüttelten ihn, und in den Zuckungen des Körpers und dem scharrenden Rhythmus der Füße konnte man ihren Verlauf verfolgen. Wortkaskaden ließen jeden Muskel erbeben, mündeten jedoch schließlich in einem oder höchstens zwei Worten: «Mann! Kapiert? Mann! Alles klar? Mannomann!»
Ein andermal sprudelten sie in rhythmischen Sequenzen hervor wie Jazzvariationen, so rasch, daß man ihnen kaum folgen konnte. Er suchte nach Worten, die Jazzrhythmen entsprachen. Er wollte sich nicht erst mit Reihenfolge, Chronologie oder Aufbau abgeben. Ein abgebrochener Satz erschien ihm eloquenter als ein vollständiger.
Aber Renate, die sich seit Jahren darin übte, die unbewegten Lippen der Statuen zu lesen, hörte die Worte, die aus Bruces vollkommen geformtem Mund kamen. Und sie hörte dies: «Was tut man, wenn man vierzehn Generationen von seinem wahren Selbst entfernt ist, nicht zwei oder drei, sondern vierzehn Generationen vom Mittelpunkt entfernt?»
Zuerst einmal würde sie ein Porträt von ihm anfertigen. Er würde sich dann so sehen, wie sie ihn sah. Das wäre zumindest ein Anfang.
Viele Nachmittage arbeiteten sie zusammen. Bruce spürte das Mitgefühl in ihrer Stimme, und unter den schweren, sinnlichen Lidern sah er ein verkleinertes Bild seiner selbst; es schwamm im Schleier der Emotion, der feucht auf ihren Augen lag.
«Komm mit mir nach Mexiko», sagte Bruce. «Ich will ein bißchen rumziehen, bis ich weiß, wer und was ich eigentlich bin.»
Und so machten sie sich auf die Reise. Bruce wollte Raum und Zeit zwischen die Zyklen seines Lebens bringen.
Und jetzt, wo sie lange Strecken durch heiße Wüsten fuhren, in kleinen, nach Safran duftenden Restaurants am Straßenrand aßen, zum weichen Klang mexikanischer Lieder über regenbogenbunte Märkte bummelten, sagte er wie früher Renates Vater: «Ich höre dich so gerne lachen, Renate.»
Wenn der Platzregen sie auf dem Weg zu einem Stierkampf in ihren besten Kleidern überraschte, dann lachte Renate, als würden die Götter, mexikanische oder sonstwelche, sich einen Jux mit ihnen machen. Wenn es kein Hotelzimmer mehr gab, sie dem Rat des Barkeepers folgten und schließlich in einem Bordell landeten, lachte Renate ebenfalls. Und wenn sie spätnachts irgendwo ankamen, ein Sandsturm tobte und kein Restaurant mehr offen war, lachte sie wieder.
«Ich möchte das alles mitnehmen», sagte sie einmal.
«Aber was ist das denn eigentlich?» fragte Bruce.
«Ich weiß nicht so recht. Ich weiß nur, daß ich es mitnehmen und dann danach leben will.»
«Ich weiß, was es ist», sagte Bruce, während er den Inhalt ihrer Reisetaschen auf die Betten kippte und nach dem Wecker suchte. Dann packte er nachlässig wieder ein, und als sie ein paar Stunden später abfuhren, hielt er auf einer verlassenen Straße an, zog den Wecker auf und ließ ihn mitten auf der Straße stehen. Als sie dann davonfuhren, ratterte er plötzlich los wie ein zorniges Kind, das bebend vor Wut gegen die Mißachtung protestierte.
Manchmal hielten sie spätnachts an einem Motel an, das wie eine Hazienda wirkte. Die alten, riesigen kegelförmigen Backöfen waren in Schlafzimmer umgewandelt worden. Der brasero in der Mitte des zeltförmigen Raumes spie den Rauch durch die oben spitz zulaufende Öffnung. Rote und schwarze serapes bedeckten den kalten Stein. Renate bürstete dann ihr langes Haar. Und Bruce ging ohne ein Wort hinaus. Sein Abgang hatte etwas von einer magischen Nummer, denn er geschah ohne Ankündigung, und danach herrschte Stille. Und diese Stille wirkte nicht wie eine kurze Unterbrechung. Sie war wie eine Vorahnung des Todes. Sein entschwindendes, bleiches Gesicht vermittelte ihr den Eindruck eines Menschen, der sich am Mondlicht zu wärmen sucht. Die mexikanische Sonne konnte ihn nicht bräunen. Die norwegische Mitternachtssonne der Heimat seiner Eltern hatte ihn für alle Zeiten gebleicht.
Seinen gelegentlichen vagen Schilderungen hatte Renate entnommen, daß ihn seine Eltern in diesem undurchdringlichen Schweigen aufgezogen hatten. Sie hatten eine Sprache, in der sie sich miteinander unterhielten, und konnten sich nur in gebrochenem Englisch mit dem Kind verständigen. Als er elf war, hatten sie ihn ohne irgendeine Erklärung in Amerika zurückgelassen, waren nach Norwegen zurückgekehrt und hatten ihn von einem entfernten Verwandten aufziehen lassen.
«Distanziert war er», hatte Bruce einmal gesagt und gelacht. «Meinen ersten Job hab ich von einem Nachbarn gekriegt, dem die Kaugummiautomaten gehörten, in die wir einen Cent reinsteckten und dann eine Kaugummikugel oder, wenn wir Glück hatten, einen Preis rausbekamen. Die Preise waren Ringe, kleine Pfeifen, Zinnsoldaten, ein neuer Cent oder eine Krawattennadel. Mein Job bestand darin, ein bißchen Klebstoff reinzuschmieren, damit die Preise nie durch den Schlitz runterfielen.»
Sie lachten.
«Als ich dir in Wien begegnet bin, war ich unterwegs zu meinen Eltern. Dann dachte ich mir: Was soll’s? Ich kann mich nicht mal an ihre Gesichter erinnern.»
Ehe er das Zimmer verließ, hatten sie mexikanisches Bier getrunken. Während er in sein Glas schaute und es in der Hand drehte, sagte er: «Wenn du besoffen bist, funkelt ein ganz gewöhnliches Glas wie ein Diamant.»
Renate fügte hinzu: «Wenn du betrunken bist, kommt dir ein Eisenbett vor wie das Daunenbett eines wollüstigen Sultans.»
Er rebellierte gegen alle Bindungen, sogar gegen das zärtliche Gewebe von Worten, Versprechen und Komplimenten. Er ging, ohne zu sagen, wann er zurückkommen würde, sagte nicht einmal die Worte, die die meisten Leute Tag für Tag sagten: «Bis bald!»
Renate schlief dann in ihrem orangefarbenen Schal ein und vergaß, sich auszuziehen. Erst schlief sie, dann wachte sie wieder auf und wartete. Doch das Warten in einem mexikanischen Hotel mitten in der Wüste, wo nur die Hunde bellen und Palmen im Kerzenlicht fächeln, hat etwas Bedrohliches. So machte sie sich eines Nachts auf die Suche.
Die Landschaft war dunkel, von Glühwürmchen und dem Gesumm der Zikaden erfüllt. Nur ein einziges kleines Café war von orangefarbenen Öllampen erhellt. Bauern in schmutzigen weißen Anzügen saßen davor und tranken. Ein Gitarrist spielte und sang leise, als habe die Schläfrigkeit ihn fast in Trance versetzt. Bruce war nicht da.
Als sie über die dunkle Straße zurückwanderte, erblickte sie einen Schatten neben einem Baum. Ein Auto fuhr vorüber. Der Scheinwerfer beleuchtete die Fahrbahnseite und zwei Gestalten neben dem Baum. Ein junger Mexikaner lehnte an dem riesigen Stamm, und Bruce kniete vor ihm am Boden. Der Junge hatte seine dunkle Hand auf Bruces blondes Haar gelegt und sah mit offenem Mund zum Mond hinauf.
Weinend rannte Renate in ihr Zimmer zurück, packte ihre Tasche und fuhr davon.
Sie fuhr nach Puerta Maria am Meer, wo ihre Bilder ausgestellt waren. Und das Bild des nächtlichen Baumes mit den giftigen Blüten wurde von dem des Korallenbaums im glitzernden Sonnenlicht verdrängt, als sie diesen zum erstenmal erblickte.
Er stellte alle anderen Bäume in den Schatten durch die Intensität seiner orangefarbenen Blüten, die in festen, großen Sträußen aus den Spitzen der kahlen Zweige wuchsen, so daß weder Laub noch die Schatten von Laub die Explosion der Farben dämpfte. Die Kelchblätter schienen aus orangefarbenem Pelz zu bestehen und mit blutroten Ranken gesprenkelt zu sein. Eigentlich hätte man die Blüte des Korallenbaums Passionsblume, Blume der Leidenschaft, nennen sollen.
Sobald sie sie erblickte, wünschte sie sich ein Kleid von dieser Farbe und Intensität. Das war in einem mexikanischen Badeort nicht schwer zu finden. Alle mexikanischen Kleider hatten die Farben von Blumen. Sie kaufte das Korallenbaumkleid. Der orangefarbene Kattun war mit fast unsichtbaren blutroten Fäden durchwirkt, als ob die Mexikaner diese Farbe aus der Korallenbaumblüte selber gewonnen hätten.
Der Korallenbaum würde die Erinnerung an den schwarzen, knorrigen Baum und die beiden Gestalten im Schatten seines grotesken Geästs auslöschen.
Der Korallenbaum würde sie in eine festliche Welt tragen. Eine orangefarbene Welt.
In Haiti sagt man, daß die Bäume nachts wandern. Viele Haitianer beschwören, daß sie sie herumlaufen sehen oder am nächsten Morgen an anderen Orten wiedergefunden haben. Und so hatte sie zuerst das Gefühl, der Korallenbaum habe seinen Geburtsort verlassen und wandere durch die aromatisch duftenden Gassen oder den strahlenden festlichen Strand entlang. Ihr gestärkter Volantrock erinnerte sie an die Korallenbaumblüte, die nie am Zweig welkte, sondern, wenn sie starb, in jähem Fall zu Boden stürzte.
Das Korallenbaumkleid verschliß und verblich nicht in der tropischen Feuchtigkeit. Aber es überflutete Renate auch nicht mit seinen Farben, wie sie es erwartet hatte. Sie hatte gehofft, die orangefarbenen Flammen würden sie durchdringen und ihre Stimmung dem fröhlichen Leben des Badeorts gemäß einfärben. Sie hatte geglaubt, daß sie, erfüllt von seinem Feuer, mit dem orangegetönten Frohsinn der Einheimischen lachen könnte. Sie hatte erwartet, seine Lebendigkeit in sich aufzusaugen. Aber für die Seele, die ihre Trauer hatte verbergen wollen, blieb das Korallenbaumkleid eine Verkleidung.
Jeden Tag strahlte das Kleid intensiver, wurde es stärker von der Sonne durchflutet und deren blendender, hypnotischer Macht ebenbürtig. Doch Renates Seelenlandschaft erhellte es nicht. In ihrem Innern wuchs ein riesiger, quälender schwarzer Baum, den zwei junge Männer zu ihrem Liebeslager gemacht hatten.
Die Leute hielten sie an, wenn sie vorüberging, die Frauen, um sie zu beneiden, die Kinder, um sie zu berühren, die Männer, um ihre magnetischen Strahlen zu empfangen. Am Strand wandten sie sich ihr zu, als sei der Korallenbaum selber den Hügel herabgestiegen.
Doch unter dem Kleid trug sie den schwarzen Baum, die Nacht, in sich. Wie die Leute doch auf Symbolismus hereinfielen! Sie fühlte sich wie eine Hochstaplerin, die alle in ihren orangefarbenen Feuerkreis hineinzog.
Sie erregte die Aufmerksamkeit eines Mannes aus Los Angeles. Er trug eine weiße Seglerhose, ein weißes T-Shirt, war sonnengebräunt und lächelte ihr zu.
Ist er wirklich glücklich, fragte sie sich, oder trägt auch er eine Maske?
Am Strand hatte er bloß gelächelt. Doch hier auf dem Markt, dem hinter der Stierkampfarena, fand er sich nicht zurecht und wandte sich hilfesuchend an sie. Er wußte nicht, wo er war. Seine Arme waren mit Strohhüten, Stroheseln, Töpferwaren, Körben und Sandalen beladen.
Er war zwischen den Papageien, den duftenden Melonenschnitzen, den weiten Röcken und Bändern umhergeirrt. Die vom Wind geblähten Petticoats streiften sein Haar und die feuchten Wangen. Die Palmblätterdächer waren zu niedrig für ihn, und die Blattspitzen kitzelten ihn an den Ohren.
«Ich muß bald zurück», sagte er. «Ich hab mein Auto zwei Stunden allein gelassen.»
«Die sind nicht streng bei Touristen», antwortete sie. «Machen Sie sich keine Sorgen!»
«Oh, es steht nicht auf der Straße. Auf der Straße würde ich es nicht stehenlassen. Ich hab alle Hotels in der Stadt abgeklappert, bis ich eins gefunden habe, wo ich mein Auto in der Nähe meines Zimmers parken konnte. Wollen Sie mitkommen und es sich anschauen?»
Er sagte das in einem Ton, als biete er ihr einen Blick auf einen echten Picasso an.
Langsam spazierten sie in der Sonne dahin. «Es ist ein wunderbares Auto», sagte er, «das beste, das je gebaut wurde. In Los Angeles bin ich damit Rennen gefahren. Es ist sensibel wie ein menschliches Wesen. Sie haben keine Ahnung, was für eine Zerreißprobe die Reise von Mexico City nach hier war. Sie reparieren die Straße – ständig Umleitungen.»
«Was ist Ihnen denn passiert?»
«Nichts ist mir passiert, aber meinem armen Auto! Jeden Höcker auf der Straße hab ich gespürt, jedes Loch, den Staub, die Steine. Es hat mir weh getan zuzuschauen, wie es sich diese Straße entlangkämpft, von Kieselsteinen zerkratzt, teerverschmiert, mit rotem Staub bedeckt, mein schönes Auto, das ich immer so gut gepflegt habe. Es war, als würde ich selber auf dieser Straße marschieren. Ich mußte durch einen Fluß fahren. Ein kleiner Junge saß rittlings auf der Motorhaube und dirigierte mich mit propellerartigen Handbewegungen, zeigte mir den günstigsten Weg durch das Wasser. Aber die ganze Zeit hatte ich Angst steckenzubleiben – mein armer tiefgelegter Wagen in diesem trüben Gewässer, wo die Einheimischen ihre ganze Wäsche waschen und ihr Vieh baden. Ich hab den Sand und die Kiesel im Motor gespürt. Hab gesehen, wie die Fliegen, die Moskitos und andere Insekten den Kühler verstopften. Nie wieder will ich meinem Auto eine solche Tortur zumuten.»
Sie hatten das niedrige, breit hingelagerte, von einem großen Dschungelgarten umgebene Hotel erreicht. Dort stand unter einer Palme, zwischen Blumen und Farngräsern, das Auto, schnittig und glänzend und offensichtlich unbeschädigt.
«Oh, es steht in der Sonne», schrie der Mann aus Los Angeles und beeilte sich, es in den Schatten zu fahren. «Gut, daß ich zurückgekommen bin. Wollen Sie sich reinsetzen? Ich bestelle inzwischen was zu trinken.»
Er hielt ihr die Tür auf.