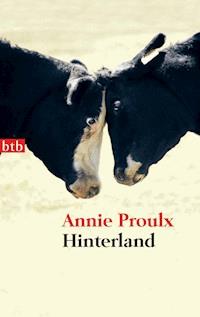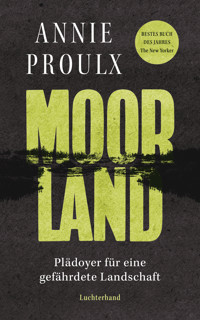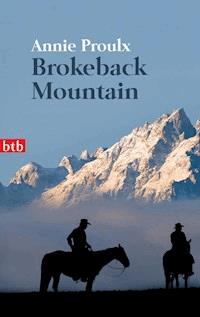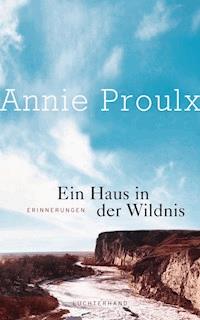
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Es ist nie zu spät, seine Träume zu verwirklichen
In ihren Erinnerungen erzählt Annie Proulx von der Liebe zu ihrer Wahlheimat Wyoming und ihrem Traum, sich dort, in einer ganz einsamen Gegend an einem Fluss unterhalb schroffer Klippen inmitten von Präriegras und Sumpf, das Haus ihrer Träume zu bauen. Ausgehend davon, erzählt sie zugleich die Geschichte dieses einst von Indianern besiedelten Landstrichs sowie die faszinierende Familiengeschichte ihrer französischen Vorfahren. Die Geschichte ihres abenteuerlichen Traums von einem Haus in der Wildnis wird so zum Panorama eines reichen Lebens und einer ganzen Welt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Ein Haus in der Wildnis
Erinnerungen
Annie Proulx
Aus dem Amerikanischenvon Melanie Walz
Luchterhand
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel Bird Cloud. A Memoir bei Simon & Schuster, New York.
Dank an Claus Keller für die Fachberatung
Copyright © der Originalausgabe 2011 Dead Line Ltd.
Copyright © der S/W-Illustrationen 2011 Dead Line Ltd.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2011 Luchterhand Literaturverlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Satz und eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-06608-6V003
www.luchterhand-literaturverlag.de
Für Harry Teague, der es entworfen,
für die James-Bande, die es gebaut,
und für Dudley Gardner, der es gegraben hat.
»… ein sehr merkwürdiges Gericht aus Wiener Würstchen, die am einen Ende zischend heiß waren und am anderen Ende gefroren – ein schlagender Beweis der Nicht-Leitfähigkeit von Würstchen in großer Höhe.«
H. W. Tilman
Kapitel 1
Die Nebenstraße nach Bird Cloud
März 2005
Die kuhgesprenkelte Landschaft ist von aschgrauer Farbe. Ich fahre durch flaches Weideland auf einer holperigen Landstraße, großenteils blankem Erdboden, denn den schützenden Kies haben dahinrasende Ranchlaster längst in den Graben geschleudert. Erstarrte Reifenspuren biegen von der Straße ab, durch den Schlamm hindurch in das Beifußgestrüpp, Zeichen, dass jemand auf entlegenen Weiden zu tun hatte. Es ist zu früh im Jahr für Gras; die Rancher füttern noch mit Heu, und die einzigen Farbtupfer in einer trüben Welt sind die vereinzelten Streifen gepresster grüner Luzernen. Die Linie, in der die Kühe stehen, zeichnet den Weg des Ranchers über die Weide nach; sie halten die Köpfe gesenkt und rupfen an dem leuchtendgrünen Heu.
Die blau-weiße Straße beschreibt Windungen wie eine umgedrehte Schlange, deren Bauch man sehen kann. Die Straßengräben haben die gleiche graue Unfarbe wie der Staub, der Beifuß und Goldastern überzieht, die Bankette sind bröckelnde Böschungen aus krümeliger Erde, die sagen: »Nicht weit von hier gab es einst Vulkane.« Es ist unmöglich, nicht an diese alten aschespeienden Vulkane zu denken, wenn man durch Wyoming fährt. Der Beifuß ist geschwärzt und geduckt durch den unablässigen Wind. Warum sollte hier jemand leben wollen, denke ich. Ich lebe hier.
Aber drunten am Fluss bei Bird Cloud ist es eine andere Welt. Am Nordufer erhebt sich eine Klippe hundertzwanzig Meter hoch, deren cremefarbene Deckschicht uralte versteinerte Korallenbänke sind. Die schmirgelnden und glättenden Winde, das sengende Sonnenlicht, die Überschwemmungen, der klirrende Hagel und die Regenfluten von Jahrtausenden haben diesen Monolithen bearbeitet. Nach Regenfällen wirkt die Klippe verwundet, mit dunklen Flecken und lotrechten Rinnen wie alten Narben. Zwei Meilen weiter westlich fällt die Klippe in Zikkuratstufen aus dunklem, eisenfarbenem Gestein ab. Am Ostende des Grundstücks weist die Klippe eine Verwerfung auf, eine schräg verlaufende Narbe, die ein befreundeter Geologe für einen möglichen Ausläufer des Rio-Grande-Rifts hält, das den nordamerikanischen Kontinent langsam auseinanderreißt. An keinem anderen Ort, an dem ich je lebte, habe ich mich so oft mit den unterirdischen Bewegungen der Kontinente beschäftigt. Die Verwerfung in der Klippe gemahnt daran, dass die Erde sich in einem langsamen, stetigen Verschiebungsprozess befindet, unerbittlich Kontinentalplatten aneinanderschiebt und auseinanderreißt, neue Ozeane und riesige Superkontinente bildet, eine gewaltige neue Pangäa Proxima, die man für eine Zeit in Hunderten Millionen Jahren in der Zukunft voraussagt, lange nachdem unsere Spezies die Bühne verlassen haben wird. Das Rio-Grande-Rift ist eine Verformung, die vor dreißig Millionen Jahren im späten Känozoikum begann, ein Dehnen und Auseinanderziehen der Erdkruste als Folge ihrer Aufwölbung, ausgelöst durch das Brodeln der heißen Magmaströme tief unten im Erdmantel. Das Rift erstreckt sich vom westlichen Texas und von New Mexico bis etwa zwanzig Meilen nördlich von Bird Cloud, und es hat nicht nur die Schlucht des Rio Grande bei Taos geschaffen, sondern auch einige der malerischsten Täler im ganzen Westen der USA.1 Offenbar hängt das Rift mit der Topographie der westlichen Basin and Range Province zusammen. Die diagonale Verwerfung in der Klippe von Bird Cloud, die gesamte abschüssige Form der Klippe und die Existenz des Zuflusses Jack Creek sind vermutlich allesamt Ergebnis dieser gewaltigen Dehnbewegung.
Die goldene Klippe von Bird Cloud erinnert mich auch an Uluru im roten Zentrum Australiens. Thomas Keneally hat schwärmerisch von dem »erhabenen Sandsteinkonglomerat« des Felsens geschrieben, dessen äußere Schichten so gleichmäßig erodieren, dass er nie die Form verändert, obwohl er im Verlauf der Jahrhunderte immer kleiner wird.2 Diesen massiven Megalithen in der Nähe von Alice Springs habe ich 1996 zusammen mit der Künstlerin Claire Van Vliet besucht, als sie die benachbarten Kata-Tjuta-Inselberge zeichnete, die wie riesengroße steinerne Turbane aussehen.
Es gibt einige Ähnlichkeiten zwischen Bird Cloud und Uluru, auch wenn sie ein wenig weit hergeholt sind. Beide Gesteinsmassive sind von ähnlicher Größe und Gestalt und verändern ihre Färbung je nach Tageszeit. Beide schimmern nach Einbruch der Dunkelheit, als besäßen sie innere Lichtquellen. Uluru hat seine Wasserlöcher auf der Oberfläche und gewundene Wasserläufe, die sich an dem gewaltigen Felskörper hinunterziehen, die Klippe hat den Fluss an ihrem Fuß. Sowohl Uluru als auch Kata Tjuta sind von großer spiritueller und zeremonieller Bedeutung für die Stämme der Aborigines, vor allem die Pitjantjatjara und die Yankuntjatjara, Wüstenbewohner des westlichen Australiens, doch die Geschichte, wie die ursprünglichen Eigentümer von der Bundesregierung um ihre geheiligten Stätten gebracht wurden, ist bekannt, traurig und hässlich. Mit dem »Abkommen« von 1985 zwischen den Anangu, den Ureinwohnern des Gebiets, und der Regierung wurden die Anangu gezwungen, Uluru und Kata Tjuta dem National Park Service zu überlassen und zu erlauben, dass Touristen Uluru besteigen. Ungeachtet der Tafeln des Park Service, die lediglich kundtun, dass die Ureinwohner das Besteigen des Bergs als Entweihung betrachten, klettern jedes Jahr Tausende Touristen rücksichtslos auf den Felsen. In meinem Teil von Wyoming waren die Klippen von Bird Cloud in früheren Zeiten ein Ort, an dem verschiedene Indianerstämme des Westens ihre Zelte aufschlugen, die Ute, die Arapaho, die Soshone, vielleicht sogar Sioux und Cheyenne. Elk Mountain in der Nähe markierte einen allseits anerkannten Kampfplatz.
Die Landschaft um Uluru herum ist von uralten Heldenpfaden überzogen, die seit der Traumzeit bestehen. Der Felsen besitzt rituelle Höhlen, in denen einzelne bedeutende Zeremonien einer der ältesten Kulturen der Welt noch heute begangen werden, in denen es geheiligte Fruchtbarkeitssteine gibt, von denen nur wenige Lebende wissen, und Wassertümpel, an denen sich sagenhafte Geschehnisse ereignet haben. Nach den seltenen Regenfällen fließen gewundene Bäche die roten Gesteinshänge hinab in verschiedene Wasserlöcher. Die Abhänge von Uluru werden durch eine Bodenfalte aufgefangen, die Kanju heißt, Keneally zufolge »eine freundliche Eidechse, die auf der Suche nach ihrem Bumerang nach Ayers Rock kam«3. Und Bird Clouds gelbe Klippe senkt sich im Osten allmählich ab und findet ihr Gegengewicht in der fernen Erhebung von Pennock Mountain.
Am Jack Creek leuchten die unbelaubten Weidenstämme rot wie glühende Kohlen. Weiden sind vorsichtig; sie zählen zu den letzten Sträuchern, die ihre Blätter sprießen lassen, denn bis Mitte Juni besteht Frostgefahr. Die Klippe spiegelt sich in dem onyxfarbenen Fluss, den der kräftige Biber auf dem Weg zu seinem Bau in der jenseitigen Uferbank durchschwimmt. Der Biber verschwindet zwischen den leuchtenden Salixstämmen.
An diesem Ort werde ich vielleicht meine Tage beenden. Glaube ich jedenfalls.
Meine negativen Charaktereigenschaften kenne ich sehr wohl: Herrschsucht, Ungeduld, krankhafte Schüchternheit, Jähzorn, Eigensinn. Die guten Eigenschaften sind schwerer zu erkennen, aber ich vermute darunter eine erkleckliche Portion Empathie und sogar Mitgefühl als Abfallprodukt der schriftstellerischen Phantasie. Ich kann mich in andere Leute hineinversetzen und tue es dauernd. Beobachtungsvermögen, Entschlussfreudigkeit (mit dem Ergebnis so mancher falschen Entscheidung) und ein Hang, alles im Übermaß zu tun, den Bogen zu überspannen und schwierige Aufgaben zu suchen, sind Bestandteil der Person, die ich bin. Die Geschichte hat vor langer Zeit Besitz von mir ergriffen. Ich komme mir vor wie Luigi Pirandellos Figur Dr. Fileno, … der dachte, er habe ein probates Mittel gegen alle Leiden des Menschen entdeckt, ein unfehlbares Rezept, das ihm und aller Menschheit bei jedem Unglück, öffentlich wie privat, Trost spenden würde.
Tatsächlich hatte Dr. Fileno nicht so sehr ein Mittel oder Rezept entdeckt, sondern vielmehr eine Methode, die darin bestand, von früh bis spät Geschichtswerke zu lesen und sich darin zu üben, die Gegenwart zu betrachten, als wäre sie ein Geschehen, das längst in den Archiven der Vergangenheit begraben lag. Mittels dieser Methode hatte er sich von allem Leid und Ärger kuriert und hatte – ohne vorher sterben zu müssen – zu einem ernsten und gelassenen Seelenfrieden gefunden, dem jene besondere Traurigkeit innewohnte, die auch dann noch von Friedhöfen ausgehen würde, wenn alle Menschen längst tot wären.4
Diese Haltung spiegelt sich vielleicht darin, dass man ein Haus baut, das den eigenen Interessen, Bedürfnissen und Charaktereigenschaften entspricht. Grundsätzlich lebe ich allein, obgleich im Sommer ein ununterbrochener Reigen von Besuchern und Freunden stattfindet. Ich brauche Platz für Tausende Bücher und große Arbeitstische, auf die ich Manuskripte und Recherchenmaterial häufen kann und auf denen ich Karten ausbreiten kann. Bücher sind mir sehr wichtig. Ich wünschte, ich könnte sie wie manche Verleger als »Produkte« sehen, aber das kann ich nicht. Ich habe in vielen Häusern gewohnt; die meisten waren ungeeignet und hatten eine merkwürdige Raumaufteilung, und keines hatte genug Platz für Bücher. In meiner Kindheit sind wir oft umgezogen, manchmal jedes Jahr. Mein Vater arbeitete in Textilfabriken in Neuengland, unermüdlich bestrebt, seiner frankokanadischen Herkunft zu entkommen, indem er immer wieder die Stelle wechselte und die Stufenleiter seines sozialen Ehrgeizes hinaufkletterte: »Bessere Stellen und mehr Geld«, wie er sagte.
Das erste Haus, an das ich mich lebhaft erinnern kann, war ein winziges Haus im nordöstlichen Connecticut, nicht weit weg von Willimantic; meine Eltern hatten es in den späten dreißiger Jahren von einer polnischen Familie namens Wozniak gemietet. Der Name Wozniak gefiel mir. Das Haus kann ich aus dem Gedächtnis zeichnen, obwohl ich nicht älter als zwei oder drei Jahre war, als wir darin wohnten.
Deutlich erinnere ich mich an das Schwindelgefühl, mit dem ich die Treppe zu erklimmen versuchte, daran, wie ich festgehalten wurde, als mein Pullover sich an einem Nagel verfing. Ich brütete irgendeine Krankheit aus; das Schwindelgefühl und der unnachgiebige Nagel sind mir nach siebzig Jahren noch gegenwärtig. Als ich krank war, bekam ich statt meines Bettchens im ersten Stock ein Lager am Küchenfenster eingerichtet. Meine Mutter schenkte mir eine Schachtel mit Chiclets-Kaugummis, die ersten Kaugummis meines Lebens. Ich leckte die glatte Zuckerverkleidung von jedem einzelnen Plättchen ab und legte die grauen Reste auf der Fensterbank aus. Wie hässlich und völlig ungenießbar sie aussahen.
Ein andermal stibitzte ich das Auge eines Heilbutts, den meine Mutter für das Abendessen vorbereitete (damals kaufte man ganze Fische), nahm es mit nach oben zu meinem Topf, den ich gerade benutzen lernte, warf es in die Urinpfütze und rief meine Mutter, damit sie mein Werk besichtigte. Sie war außer sich; sie erkannte das Fischauge nicht, sondern dachte, ich hätte ein sonderbares Stück Eingeweide verloren. Ich deutete ihre Verwundbarkeit als Ermahnung, Dinge für mich zu behalten, was mich bis in mein Erwachsenenleben geprägt hat.
Meine Mutter liebte die freie Natur, ihr Lieblingsbuch war Gene Stratton-Porters Girl of the Limberlost, und einmal ging sie mit mir in den Sümpfen spazieren. Man musste von einem Grasbüschel zum nächsten springen. Die Strecke dunklen Wassers zwischen den Grasbüscheln erschreckte mich, und irgendwann stand ich hilflos und heulend auf einem schwankenden Gras- und Erdklumpen und traute mich nicht, zum nächsten zu springen.
Wir besaßen einen grünen Zweisitzer mit einem Behelfssitz, auf dem ich wie eine kleine Prinzessin thronte, zusammen mit meinem kleinen Foxterrier Rinty, der später von einem Motorrad überfahren wurde, das er verfolgte. In diesem Wagen wurde meine Mutter einmal von einer Wespe gestochen, und ich musste weinen. Auf ihrem Rock waren Blutspuren, vermutlich von ihrer Monatsblutung, aber ich stellte eine andere Verbindung zwischen Ursache und Wirkung her und dachte, die Wespe wäre schuld an der Blutung.
Der Hurrikan von 1938 ereignete sich, als meine Zwillingsschwestern Joyce und Janet wenige Monate alt waren. Der Wind toste immer lauter und erschütterte unser kleines Haus. Ich weiß nicht, wo mein Vater war, vermutlich bei der Arbeit. Wir hatten kein Telefon und kein Radio. Meine Mutter beschloss, dass wir im Haus eines Nachbarn weiter unten an der Straße Zuflucht suchen sollten. Wir gingen zu Fuß, meine Mutter mit Kartons beladen, mit einem Koffer und mit einer meiner Zwillingsschwestern. Ich war zwar erst drei Jahre alt, musste aber die andere Zwillingsschwester tragen. Ich erinnere mich, dass in dem Haus des Nachbarn der Wind heulte und die Glastüren plötzlich ihre Glasscheiben verloren und Männer Bretter an die Glastüren nagelten, was das Innere des Hauses düster und unheimlich machte.
Meine Mutter stammte aus einer großen ländlichen Familie mit fünf Töchtern und vier Söhnen. Wenige Jahre nach dem Wirbelsturm bezogen wir ein Haus in Plainfield, Connecticut, das den Eltern meiner Mutter gehörte, Lewis und Sarah (Geer) Gill. Die Gills, Geers und Crowells waren die Nachfahren von Bauerngeschlechtern, die im neunzehnten Jahrhundert in die Textilindustrie übergewechselt hatten. Die Crowells hatten eine künstlerische Ader; einer war ein begnadeter Möbeltischler, ein anderer entwarf Schablonen für die Schmuckelemente von Hitchcock-Stühlen. Während wir in dem Haus in Plainfield lebten, war mein Vater im Ausland, in Südamerika, wo er beim Errichten einer Textilfabrik half.
Das Haus lag direkt an der Straße und war früher einmal eine Tankstelle gewesen, eine der vielen Unternehmungen, die der geschäftige Geist meines Großvaters Gill ersonnen hatte. Er hatte Bauteile für Textilmaschinen erfunden, die ihm nichts einbrachten, hatte dann die Tankstelle eröffnet und sie, einige Jahre nachdem wir dort gewohnt hatten, in einen Laden für Stoffe und Fabrikreste umgewandelt. Er konnte alles reparieren und war der geborene Schreiner. Diese Großeltern, von Kindern und Enkeln gleichermaßen »Ma« und »Dad« genannt, besaßen einen großen Garten, dessen exotische dickschalige Tomaten ich liebte; ich schälte die papierene Außenhaut ab und aß die süßlich-herben Früchte. Dad hatte einen griesgrämigen alten Hund, der Duke hieß. Es gab ein paar Kühe, um die meine Onkel sich kümmern mussten, und einen elektrisch geladenen Gartenzaun. Meine Cousins und ich fanden es lustig, uns an den Händen zu halten und am einen Ende der Kette den Elektrozaun anzufassen, so dass derjenige am anderen Ende der Kette den Stromstoß erhielt.
Meine Großmutter mütterlicherseits, Ma, geborene Sarah Mayo Geer, hatte als Vorfahren zwei verwaiste Brüder, die 1635 aus England, von Heavitree bei Bristol, nach Connecticut ausgewandert waren. Sie wirkte immer leicht überfordert von ihrer großen, kinderreichen Familie, und ihr Haus war zwar gemütlich, aber nicht besonders ordentlich. Das Papiergeld wusch und bügelte sie, damit es glatt war. Vielleicht hat sie es sogar gestärkt. Sie verlor schnell die Geduld, war geradezu süchtig nach Küchengeräten, war eine geborene Erzählerin mit großartigem Humor und schrieb eine Zeitlang eine Zeitungskolumne. Natürlich hat meine Familie mein Interesse an Büchern und am Schreiben immer auf Mas Einfluss zurückgeführt. Warum nicht? Auch andere aus unserer Familie haben Bücher und Artikel geschrieben; mein Onkel Ardian Gill hat einen Roman über John Wesley Powells Reise den Colorado hinunter verfasst. Mein Cousin David Robinson hat jahrelang für National Geographic geschrieben. Musik, Kunst und Kunsthandwerk spielten immer eine wichtige Rolle. Meine Mutter und ihre Schwester Gloriana (jeder von uns hatte mehrere Spitznamen, und Gloriana hieß Hikee) malten. Sarah, die älteste der Schwestern, entwickelte eine Vorliebe für Hinterglasmalerei und erweckte die Schablonen ihres Großonkels Bill Crowell wieder zum Leben. Die Kleidung ihrer Kinder nähten sie alle selbst. Meine Mutter hatte einen Webstuhl und webte Teppiche. Meine Schwestern und ich hielten es als Kinder für völlig normal, alles selbst zu machen. Jahrelang habe ich meine Kleidung selbst genäht, bis die Nähmaschinen durch die Elektronik so kompliziert zu handhaben und störungsanfällig wurden, dass es keinen Spaß mehr machte.
In dem Haus der Familie Gill, von meinem Großvater und meinen Onkeln erbaut, schien immer Aufregung zu herrschen, ständig suchte jemand nach etwas, was verlegt worden war, und auf dem Treppenabsatz im ersten Stock gab es ein wundervolles Fenster mit farbigen Glasscheiben. Ich schaute hindurch und sah, wie die Welt dunkelrot wurde, eklig orangegelb oder unnatürlich grün.
Bevor ich in die Schule kam, wohnten meine Mutter, meine Zwillingsschwestern und ich in einer kleinen Blockhütte inmitten von großen Kiefern am Ende des Grundstücks meines Großvaters. Bis heute versetzt mich der Geruch von Weißkiefernholz unweigerlich in die Kindheit zurück, verbunden mit einem Gefühl von Traurigkeit und unbestimmter Sehnsucht. Vielleicht lag die Zeit in der Blockhütte vor der Geburt der Zwillinge. Ich bin misstrauisch, was die Erinnerung betrifft. Meine Mutter hatte diese Hütte zusammen mit ihren Brüdern gebaut, vermutlich die Verwirklichung eines Traums aus ihrer Girl-of-the-Limberlost-Zeit. In der Hütte gab es einen alten Wachswalzenphonographen. Meine Mutter kurbelte, die Wachswalze drehte sich, und eine blecherne Stimme erzählte die Geschichte von den drei Bären.
Aus einem Fenster der Hütte ging der Blick in westliche Richtung zu einem Hügel, den Jahre zuvor ein Waldbrand verwüstet hatte. Die schwarzen Baumstümpfe hoben sich vor dem Himmel ab wie deformierte Giraffen und skelettierte Elefanten. Sie wirkten traurig und erschreckend. Wenn die Dämmerung sich verdichtete, sah es aus, als bewegten sich die knochigen Geschöpfe – hier zuckte ein Bein, dort beugte sich ein Hals. Heute krümmen sich in der Sommerdämmerung in Bird Cloud Fettholz und Goldastern zu riesigen Murmeltieren, krüppeligen Wapitihirschen. Der schönste Gegenstand in der Hütte meiner Mutter war ihr himmelblaues Brokatkleid, ein Geschenk meines Vaters. In einer Winternacht, in der sie vor Fieber glühte, wanderte sie barfuß in den Schnee hinaus, nur mit diesem wunderschönen Gewand bekleidet. Später hieß es, sie habe eine Lungenentzündung, und an dieser Krankheit litt sie oft.
Irgendwann verließen wir die Hütte und zogen in die ehemalige Tankstelle meines Großvaters, die zu einem Wohnhaus umgebaut worden war. Ich erinnere mich an die Langeweile des obligatorischen Mittagsschlafs und an das Muster der Risse in der Zimmerdecke, an die ekligen gelben Marshmallowhühnchen, die zu Ostern unsere Schuhe verzuckerten. Ich erinnere mich, wie ich einmal im Dunkeln aufwachte und etwas Heißes, Klebriges an meinem Ohr fühlte und merkte, dass ein Tier davonsprang. Es war eine Ratte, die mich gebissen hatte. Die Narbe und die Erinnerung sind mir geblieben. Obwohl meine Großeltern und Urgroßeltern in der Nähe wohnten und Tanten, Onkel und Cousins ständig zu Besuch kamen, kam ich mir einsam vor, als hätte ich mit dem summenden Bienenschwarm von Verwandten nichts zu tun. Der alte Duke biss mein Kätzchen tot, und ich war empört, dass er weiterleben durfte, als wäre nichts gewesen. Am liebsten hätte ich ein Gerichtsverfahren, eine Jury und ein Todesurteil gehabt.
Meine Mutter nahm gern Sonnenbäder und lag oft stundenlang regungslos im warmen, kraftlosen Sonnenlicht, zwei grüne Blätter auf den geschlossenen Augen. Wir hatten eine zahme Krähe (sie hieß Jimmy nach dem alten Lied mit dem Refrain: »Jimmy crack corn and I don’t care«). Sie war neugierig, hopste neben meiner Mutter über das Frotteetuch und nahm vorsichtig die Blätter weg. Mutter öffnete eines ihrer grünen Augen, und Jimmy sah zu seiner Beruhigung, dass sie nicht tot war. Als meine Mutter im Garten hinter dem Haus einen Kamin baute, durfte ich die Hand in den feuchten, rauen Zement drücken, bevor er hart wurde, und die Krähe spazierte darauf herum und hinterließ ihre Krallenabdrücke. Jahre später, als wir aus der Nummer 2217 in der McBride Avenue in Utica, New York, auszogen und unser Wagen bis unters Dach mit Kindern und Kleidern vollgepackt war, steckte mein Vater Jimmy in einen Pappkarton mit Luftlöchern und band den Karton an der hinteren Stoßstange fest. Als wir am Straßenrand eine Lunchpause einlegten, war der arme Kerl tot, von den Auspuffgasen vergiftet. Diese Untat konnte ich meinem Vater nie verzeihen. Die Unglücksfälle, die geliebten Haustieren widerfuhren, waren meine erste Bekanntschaft mit tragischen und unwiederbringlichen Verlusten.
Wir zogen unermüdlich um. Im Lauf der Jahre wohnten wir in Dutzenden von Häusern. Ein Haus auf Rhode Island hatte den Abdruck eines Menschenarms in dem bröckeligen Verputz am Fuß der Treppe. Von einem Haus in Black Mountain, North Carolina, hatte man eine gute Aussicht auf Bäume, in deren Schatten Kettensträflinge Rast machten, die als Straßenbauarbeiter eingesetzt wurden. Auf einem Grundstück in Maine gab es herrliche Ulmen, deren flache Wurzeln das Rasenmähen erschwerten. Dann wurde in einer Viertelmeile Entfernung der Highway gebaut, und fast unmittelbar darauf kam es zu einem scheußlichen Unfall, gefolgt von Polizeieinsatz, Rettungswagen und dem Krankenwagen, der nicht mehr helfen konnte. Ein offizielles Kreuz des Bundesstaates wurde am Straßenrand errichtet als Mahnung, dass sich dort ein tödlicher Unfall ereignet hatte, doch diese Sicherheitspolitik wurde aufgegeben, als die wachsende Ansammlung von Kreuzen am Straßenrand den Highway zu einem makabren Anblick machte.
Ein Hauptgrund für unsere ständigen Umzüge war der obsessive Wunsch meines Vaters, seiner frankokanadischen Herkunft zu entfliehen und sich zu einem neuenglischen Yankee zu stilisieren, der Armut der Arbeiterklasse zu entkommen, finanziell erfolgreich zu werden, die soziale Stufenleiter zur komfortablen Mittelschicht hinaufzuklettern. Er und seine Familie waren Opfer des in der tonangebenden Kultur der weißen, angelsächsischen, protestantischen Neuengländer virulenten Rassismus, der Einwanderer, vor allem frankokanadische Einwanderer aus dem Norden, als minderwertige Menschenrasse ansah. Unterschwellig bestehen solche rassistischen Ängste der Weißen in jener Gegend bis heute. Ich glaube, ein nicht zu unterschätzender Beweggrund für die Heirat meiner Eltern – sie waren kein harmonisches Paar – war die Herkunft meiner Mutter aus einer alteingesessenen Familie Neuenglands, arm, aber mit dem Vorzug der frühen Ankunft, kaum fünfzehn Jahre nach der Landung der Mayflower. Ihre Familie hat meinen Vater nie anerkannt, wie sollten sie auch? Ein Schwiegersohn mit dem nicht gerade unauffälligen mittleren Vornamen Napoleon! Bei unseren genealogischen Schürfereien haben wir noch prunkvollere französische Namen seiner Vorfahren ausgegraben wie Dieudonné, Narcisse, Norbot und Ovila, wogegen George Napoleon sich ziemlich harmlos ausnimmt. Immerhin ertrugen die Neuengländer ihn und uns, und wir taten alle so, als wären wir eine Familie, in der Gleichheit und Vielfalt geachtet wurden.
In unserer Kindheit und Jugend wussten wir nicht viel über die Familie meines Vaters, und wir besuchten sie auch nicht oft. Seine Mutter, Phoebe Brisson Proulx Maloney Carpentieri, war dreimal verheiratet: einmal mit einem Frankokanadier (Proulx), einmal mit einem Iren (Maloney) und einmal mit einem Italiener (Carpentieri) aus Neapel, der meinem Vater beibrachte, wie man Spaghettisauce macht – eine Sauce, die meine Schwestern und ich heute noch machen, unser bestes und vielleicht sogar einziges Geschenk von einem Vater, den kennenzulernen schwierig war.
Wir witterten also Geheimnisse. Unser Vater ließ ab und zu verlauten, wir seien teilweise indianischer Herkunft, doch er glaubte, der Beweis dafür habe sich in der Truhe seiner Großmutter Exilda (auch Maggie genannt) befunden, die nach ihrem Tod verschwand und nie wieder auftauchte. Das einzige Indiz für seine Vermutung waren die bräunliche Hautfarbe seiner Mutter und einige phantasievolle Zeitungsgeschichten. Es gab noch andere rätselhafte Geschichten, zum Beispiel die von einem Geschwür an der Nase unserer Großmutter Phoebe und von einer Fahrt über »den Fluss« (damit war immer der Sankt-Lorenz-Strom gemeint) zu einer indianischen Siedlung, wo ein Schamane oder Medizinmann auf nicht näher erläuterte Weise das Geschwür entfernte. Wir mochten unseren Vater und seine Mutter Phoebe noch so eindringlich um Einzelheiten und Erklärungen anbetteln, sie wurden uns nie gewährt. Anonymität schien ihr Ziel zu sein, doch das Halbwissen war Öl in das Feuer unseres Verlangens, mehr zu erfahren.
Dieses Gefühl der Verbundenheit mit Vorfahren der Sippe ist offenbar bezeichnend für alle Menschen, und die Geschichten, die man einst über die Verstorbenen erzählte, ausschmückte und verbrämte, sind möglicherweise die kruden Ursprünge der Geschichte und der Literatur. Die Römer verehrten ihre Ahnen und waren stolz auf die Verbindung zu alten Geschlechtern wie dem der Gracchen, der großen Reformer vor dem Bürgerkrieg gegen Ende des zweiten Jahrhunderts v.Chr., oder gar zu den sagenhaft alten Etruskern, die in vorrömischen Zeiten in Mittelitalien gelebt hatten. Als die Gletschermumie Ötzi aus der Kupfersteinzeit, dem Spätneolithikum gegen 3500 v.Chr., 1991 von einem schmelzenden Alpengletscher freigegeben wurde, ergab die Analyse ihrer mitochondrialen DNS, dass Ötzi einer genetischen Linie, einem sogenannten Haplotyp, namens »K« angehörte, die heute noch in rund acht Prozent aller Europäer zu finden ist. Dies weckte in vielen die Hoffnung, sie könnten ihre Abstammung bis zu Ötzi zurückführen. Wie aufregend, einen mehr als fünftausend Jahre alten Vorfahren mit einer Steinpfeilspitze im Rücken zu besitzen! Weitere Untersuchungen ergaben im Jahr 2008, dass der Mann aus dem Eis zwar der als K1 bezeichneten Haplogruppe oder Subgruppe des Haplotyps angehörte, sich aber in keine der heute noch existierenden drei Teil- oder Untergruppen von K1 einordnen lässt. Seine Subhaplogruppe ist entweder ausgestorben oder so selten, dass sie noch nicht entdeckt wurde, und die Wissenschaft nennt sie deshalb »Ötzis Zweig«. Einen Vorfahren Ötzi jedenfalls kann bis auf weiteres niemand in seinen Stammbaum einfügen – wie enttäuschend.
Nach all den Jahren seit meiner ersten Beschäftigung mit der eigenen Abstammung ist die weitverzweigte Familie meiner Mutter für mich noch immer von einer Atmosphäre des Besonderen umgeben wie von einem seltenen Duft, der Aura, wie sie eine beinahe vierhundertjährige Familiengeschichte in Neuengland bewirkt. Unter diesem Duft stelle ich mir ein Bukett aus Gerüchen vor, den Gerüchen von frischgemolkener Milch, frischgeschlagenem Eichenholz, Herbstlaub, Schnee, dumpfigen Sümpfen, Fotoalben und kalter Asche.
1 Die meisten älteren Quellen lokalisieren den nördlichsten Ausläufer des Rio-Grande-Rifts in Colorado, aber neuere Arbeiten von Geologen der University of Wyoming geben die südliche Mitte Wyomings als Standort an.
2 Thomas Keneally: Outback (Sydney: Hodder & Stoughton, 1983), S. 19.
3 Keneally, S. 19.
4 Luigi Pirandello: »La tragedia d’un personnagio«, in Novelle per un anno (Firenze: Giunti Gruppo Editorale, 1994), Bd. 1, S. 684, freundlicherweise übersetzt von Silvia Zanovello.
Kapitel 2
Eine Elle Stoff
Ende der achtziger Jahre besuchten meine jüngere Schwester Roberta und ich am Tag nach Thanksgiving unsere Mutter in ihrem kleinen Apartment in einer Seniorenwohnanlage in Bristol, New Hampshire. Damals wohnten wir beide in Vermont, westlich des Connecticut River. Es war ein milder Tag für die Jahreszeit – Ende November – mit dichter Bewölkung, Nieselregen und leichtem Nebel, einer jener dunklen Herbsttage, wie sie für Neuengland so typisch sind. Auf der Straße waren Jäger unterwegs, die im Kriechtempo von zwanzig Meilen in der Stunde fuhren und sich den Hals verrenkten, weil sie in die schütteren Wälder spähten.
Meine Schwester Roberta und ich sind uns nahe in der Hinsicht, dass wir oft ähnlich denken und fühlen. Zu jener Zeit bemühten wir uns, unsere Mutter Lois Gill Proulx einmal im Monat zu besuchen. Seit Jahren hatte sie an Bronchiektasen gelitten, einer irreversiblen Erweiterung der Bronchien, und sie hatte diese unheilbare Krankheit tapfer mit Atemgymnastik, Diät, Arznei und Willenskraft bekämpft. Lungenentzündungen und Dickdarmkatharre waren die unerwünschten und beharrlichen Begleiterscheinungen des Leidens. Ihre Lieblingsschwester Gloriana (die berühmte Hikee) litt an der gleichen elenden Krankheit; im Sommer 2008 stießen meine Cousine Eleanor Goodenough Milner und ich beim Durchsehen alter Unterlagen meiner Mutter auf einen ergreifenden und verstörenden Briefwechsel der zwei leidenden Schwestern. Der Eindruck ihrer verzweifelten Tapferkeit, die Witzeleien, die enge schwesterliche Bindung, der Hass auf unfähige und besserwisserische Ärzte, all das, was zwei Leute, die an dem gleichen Leiden laborieren, einander sagen können und was kein Außenstehender nachvollziehen könnte, überwältigte und erschütterte uns. Heute noch fällt es mir schwer, den Karton mit diesen Briefen zu öffnen, weil all die enttäuschten Träume dieser zwei liebeshungrigen Frauen mir daraus so lebhaft entgegenspringen.
An jenem Tag nach Thanksgiving fuhren Roberta und ich in die sich verdichtende Düsternis von Bristol hinein. Einen Häuserblock von der Wohnanlage unserer Mutter entfernt hatte es an der Ecke früher einen herrlichen Laden mit Mineralen und Drusen gegeben, mit Achatsplittern, Amethystkristallen, Sedimentgesteinsbrocken, Malachitplatten. Aber das Ladenschild war fort, und an seiner Stelle hing ein schlaffes Transparent im Schaufenster: Bezugsstoffe günstiger als im Grosshandel. Roberta und ich haben beide eine Schwäche für Perlen, Stoffe, Garn und Nadeln.
»Lass uns auf dem Rückweg schauen, ob der Laden noch geöffnet hat.«
»Einverstanden.«
Zum Essen gab es Schweinelende, Zwiebeln in Sahnesauce, die genauso schmeckten wie in unserer Kindheit, und Apfelsauce, die Roberta aus den (gegen ein Huhn getauschten) Äpfeln eines Nachbarn gekocht hatte. Unsere Mutter war erschöpft, aber bei relativ guter Gesundheit und Laune. Sie hatte sich zwei Tage lang mit den Vorbereitungen für das Essen abgeplagt. (Schuldgefühle!) Meine Mutter und ich tranken jede ein Glas Wein.
Am späten Nachmittag verließen wir sie. Es wurde langsam dunkel. Dünner Nebel verwischte die Umrisse der Äste und Zweige. An der Ecke fiel uns das Transparent ein, das für günstige Stoffe warb. Der Laden hatte noch geöffnet. Ich parkte meinen Pick-up, und wir gingen in den Laden.
Drinnen war niemand. Niemand. Zusammengefaltete Stoffe stapelten sich auf langen Tischen, Ballen funkelnden Brokats lehnten an der Wand. In dem Laden muffelte es nach alten Mineralen und nach schalem Zigarettenrauch, vermischt mit dem Geruch von nassem Laub und Regen, den wir mitbrachten.
Die Stoffballen waren so sperrig wie herumstehende Gehstöcke und verrutschten und fielen gegeneinander, als wir einen herauszuziehen versuchten. Es war schwierig, ein Stoffmuster zu erkennen, ohne ein Dutzend Ballen umzuwerfen. Während wir mit den tückischen Stoffballen kämpften, wurde die Tür geöffnet, und ein Mann kam herein.
Er hatte etwas auf unerklärliche Weise Abstoßendes. Sein Gesicht war von Falten und Runzeln durchzogen, sein schwarzes Haar über den schmalen Schädel gekämmt. Eingefallene, stoppelige Wangen, verfärbte Zähne. Die Tuchballen wirkten auf hinterhältige Weise lebendig. Der Mann begann in unterwürfigem, vertraulichem Ton auf uns einzureden. Seine Kommentare waren albern, dumm.
»Ja, ja, Damen wühlen gerne in Stoffen herum.«
Die verwünschten Ballen teurer Stoffe, wahrscheinlich gestohlen, dachte ich mir, wollten einfach nicht an ihrem Platz bleiben. Der Mann fragte uns, woher wir kamen. Ausweichend sagten wir nur »Vermont« und »jenseits vom Fluss«.
»Und von wo in Vermont? Aus welcher Stadt?« Er ließ einfach nicht locker.
»Oh, mitten aus Vermont, aus der Gegend von Montpelier«, log ich.
Als Nächstes bestand er darauf, uns seine Visitenkarte mitzugeben. Die Visitenkarten seien in seinem Antiquitätenladen auf der anderen Straßenseite. Nein, nein, wir wollten ihm keine Mühe bereiten. Wir wehrten sein Angebot ab. Ich hatte plötzlich das dringende Bedürfnis, ihn loszuwerden. Er begann Uhren aufzuziehen, ihre Zeiger zu verstellen. Er war mir zuwider. Die Stoffe waren schön und prächtig, die Preise waren denkbar niedrig, aber es war unmöglich, eine vernünftige Entscheidung zu treffen, während dieser Mann in seiner schmierigen Art immer weiterredete. Ich ergriff einen Stoffballen, ohne hinzusehen, und sagte, ich wolle eine Elle Stoff mitnehmen und zu Hause ausprobieren, ob es die richtige Farbe sei. Hauptsache, ich kam weg.
Er holte unter der Ladentheke einen verdreckten Zollstock und eine Schere mit abgebrochener Spitze hervor. Meine Schwester stand schweigend über einen leeren Vogelkäfig gebeugt, in dem alter Vogelkot klebte. Mit einer schwungvollen Geste und der Verheißung: »Ich gebe Ihnen mehr als eine Elle« maß der Mann den Stoff, schnitt kurz mit seiner Schere hinein, riss den Stoff ab und faltete ihn zu einem kleinen Viereck. Beim Bezahlen berührte seine Hand – eine anmutige Hand mit langen Fingern – meine Hand. Fiebrig heiß.
Doch noch immer ließ er uns nicht gehen. Ein Schwall von Ratschlägen, vorsichtig zu fahren, aufzupassen, Warnungen, es sei ein gefährlicher Abend, es sei neblig, die Straßen seien glatt, verfolgte uns aus dem Laden hinaus. Seine Beharrlichkeit war erstaunlich. Als wir schließlich auf dem Gehsteig standen, versicherten wir einander, dass das eine sonderbare Begegnung gewesen war.
Wir fuhren in westliche Richtung durch Nebel und Nässe. Das Licht war von nüchternem nördlichem Grau, die Straße lag verschwommen im Nieselregen. Dichter Nebel hing über dem Pemigewasset River. Am Stadtrand verbreiterte sich die Straße. Auf dem Highway waren wir allein. Meine Schwester las einen Brief. Wir erreichten die breite, weite Kurve, die dem Flussverlauf folgt. Vor uns waren auf der leeren Straße in der rauchiggrauen Stille zwei graue Wagen schräg ineinander verkeilt; aus beiden Wagen stieg Dampf auf, die Straße war ein Teppich aus Glassplittern. Wir hielten an. Schweigen, Stille, alles so statisch wie eine Inszenierung. In den schrecklich zusammengequetschten Wagen schien niemand zu sein, alles Glas bedeckte die Straße, alles Metall war verzerrt und verzogen. Eine breite rote Lache Kühlwasser glitzerte auf der nassen Straße. Wir gingen auf die Wagen zu. Ich konnte eine zusammengefallene Gestalt sehen.
Andere Autos tauchten hinter uns auf; die meisten wichen aus und fuhren weiter. Ein Pick-up blieb stehen. Zwei junge Männer sprangen heraus und begannen an der Tür des anderen Unfallwagens zu ziehen.
»Bewegen Sie die Insassen nicht«, rief ich.
Sie zogen die Hände von etwas, von jemandem zurück. Meine Schwester und ich standen vor dem näheren Wagen. Wir sahen den zusammengesunkenen Mann, sahen das Blut, sahen, dass er jung war und dichtes helles Haar hatte, das leuchtende Rot sickerte in einen blonden Schnurrbart, auf dem Sitz neben ihm eine Art Bohrwinde, Plastikwasserflaschen. Er stöhnte. Meine Schwester berührte ihn an der Schulter. Sein Gesicht war grau, seine Augen waren geschlossen. Seine Kleidung war mit Glassplittern übersät. Er verzog seinen Oberkörper. Seine Beine wackelten. Die Hand meiner Schwester lag leicht auf seiner Schulter.
Nun kam Verkehr aus beiden Richtungen, wich aus oder hielt an, und Leute stiegen aus, um herzustarren. Keine Polizei.
»Ich gehe Hilfe holen!«, rief ich den zwei jungen Männern zu.
»Die Polizeistation!«, riefen sie zurück. »Eine halbe Meile weiter.«
»Bewegen Sie sich nicht, wir holen Hilfe, gleich kommt Hilfe«, sagte ich zu dem Verwundeten. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er hörte, was ich sagte. Ich lief zu meinem Pick-up, warf einen Blick zurück. Meine Schwester stand noch immer neben ihm, ihre Hand auf seiner Schulter. Ich rief sie. Sie ging auf mich zu, drehte sich um und ging zu dem Verwundeten zurück, ging wieder in meine Richtung, aber widerstrebend, den Blick immer noch auf ihn gerichtet, die Hand ausgestreckt, als könnte sie es nicht ertragen, ihn zu verlassen. Einige Tage später erfuhren wir, dass er seinen Verletzungen erlegen war.
Auf der Polizeistation wurde der Einsatz von Polizisten, Sanitätern, Schneidegerät, Feuerwehrfahrzeugen und Verkehrspolizei organisiert. Innerhalb von Minuten fuhren sie mit Blaulicht und Sirenen vorbei. Wir fuhren nicht zu der Unfallstelle zurück, sondern nahmen eine andere, längere Straße, die viele Meilen Umweg bedeutete und mit Blechlawinen verstopft war, die durch den zunehmenden Nebel krochen. Ich fuhr langsam und vorsichtig.
Meine Schwester und ich waren beide überzeugt, dass der Mann in dem Laden uns mit seinem hinhaltenden Gerede und seinen Warnungen das Leben gerettet hatte. Nur wenige Minuten früher, dann wären vielleicht wir in den Unfall in der Kurve am Fluss geraten. Es war ein eigenartiges und beunruhigendes Erlebnis, dessen Bedeutung uns beiden bewusst war.
Am Abend jenes Tages rief ich meine Mutter an und erzählte ihr von dem Unfall und von dem Mann in dem Laden, der uns so unheimlich gewesen war und uns möglicherweise das Leben gerettet hatte.
»So, so«, sagte sie. In ihrer Stimme schwang leicht verächtliche Belustigung mit. »Du weißt schon, wie er heißt, dieser Mann in diesem Laden?«
»Nein. Er wollte uns seine Karte geben, aber ich habe sie nicht genommen.«
»Er heißt Proulx«, sagte sie. Ihr Ton – oder täuschte ich mich? – hatte die besonnene neutrale Yankee-Haltung gegenüber meinem Vater, die ich als Ablehnung zu deuten gelernt hatte. Diese Eröffnung war wie ein Stromschlag. Persönliche Fragen sprudelten. Meine Schwester und ich tauschten uns intensiv aus. Das Schweigen unserer Kindheit, unseres Erwachsenenlebens war mit einem Mal durchbrochen. Wer war dieser Mann mit unserem Namen? Wer waren wir? Wer waren unsere Verwandten? Wir wussten so wenig. Die amerikanische Erfahrung, die Konzentration auf individuelle Leistung, das Erwerben von Besitz und Geld, um den eigenen sozialen Wert zu beweisen, gründet sich auf dieses Gefühl des Verlusts, diese Entfremdung von der Wärme des Zuhauses, auf Isolation von genetischen Banden. Diese Abgetrenntheit von der eigenen Sippschaft bewirkt eine innere Einsamkeit, die mit wachsendem Alter zunimmt. Viele Menschen, vor allem Einwanderer, erfüllt ein unstillbares Bedürfnis, das Puzzle zu lösen, die fehlenden Teile zu finden. Und was hatte das uns angetan, die wir als Außenseiter aufgewachsen waren und nirgends hingehörten – als ich fünfzehn war, hatten wir mehr als zwanzig Umzüge hinter uns –, zu keiner Familie gehörten bis auf die helläugige Yankee-Sippe unserer Mutter, die uns diskret zu verstehen gab, dass wir anders und irgendwie mit einem Makel behaftet seien? Heute bereuen wir, dass wir nicht mit dem Mann gesprochen haben, der unseren Namen trug.
Auch ich bin im Lauf meines Erwachsenenlebens unzählige Male umgezogen. Teilweise rührt dieses peripatetische Verhalten daher, dass Amerikaner ein bewegliches Volk sind, doch ich habe obendrein eine frankoamerikanische Herkunft, stamme also von wurzellosen Leuten ab, die keine nationale Identität besitzen und in den Vereinigten Staaten nirgends hingehören. Am ehesten vergleichbar mit unseresgleichen dürften die Franzosen in Maine sein, die sich dort eine Heimat verschafft haben, und die Franzosen von der kanadischen Ostküste, die, als sie 1755 aus Acadia vertrieben wurden, nach Frankreich gingen und von dort nach Louisiana, weil man sie in Frankreich nicht haben wollte, und in Louisiana wurden sie zu Cajuns, was eine Verballhornung des Worts »Acadians« (Acadier) ist. Die Orte und Häuser unseres Lebens haben eine Geschichte, auch wenn wir sie nur selten kennen.
Wir schlüpfen in von anderen errichtete Häuser oder Wohnungen und haben fast nie eine Vorstellung davon, wie dort früher gelebt wurde, ob der erste Besitzer einen Obstgarten mit Kirschen und Birnen unterhielt, wie es zu der bizarren Treppe mit verschieden hohen Stufen kam, ob das große Stück Schiefer im hinteren Garten ein Wolfsstein ist, ob Indianer diesen Ort kannten und was sie dort taten. Solche Dinge fragte ich mich, als meine Familie in Neuengland immer wieder umzog, unsere Herzen in Vermont zurückließ, nach North Carolina weiterzog und dann nach Maine zurück, ohne jemals Zugehörigkeit zu einem dieser Orte zu entwickeln. Jack Kerouac traf den Nagel auf den Kopf, als er von »der schrecklichen Heimatlosigkeit aller Frankokanadier in der Fremde Amerikas«5 schrieb. Ein Jahr meines Lebens wohnte ich in Montreal, und mehrere Jahre besuchte ich dort die Oberschule von Vermont aus, schnappte ein wenig joual auf, den frankokanadischen Arbeiterslang, wurde mit der flachen Flusslandschaft und den Gesichtern der Anwohner vertraut. Jahre später besuchte ich eines Wochenendes ein Treffen frankoamerikanischer Schriftsteller auf einer Insel in Maine. Als ich den Raum betrat, war der Schock des Wiedererkennens wie ein Schlag. Die Anwesenden waren keine Angloamerikaner, es waren Leute mit mir vertrauten Zügen, mit langen Fingern und zartem Knochenbau, mit dunklen Augen und Haaren und einer bestimmten Art, sich zu bewegen und zu gestikulieren. Tränen traten mir in die Augen, und für einen Augenblick verspürte ich das eigenartige, aber wohltuende Gefühl, mich im heimatlichen Rudel zu befinden, und ich träumte davon, nach Quebec oder Montreal, auf die Halbinsel Gaspé oder nach Montmagny zu ziehen. Aber inzwischen hatte ich zu lange allein gelebt und war zu anglisiert für eine solche Rückkehr.
Da die Neugier auf meine Familienursprünge mir keine Ruhe ließ, beauftragte ich 1993 Diane L., eine Genealogieforscherin aus Connecticut, herauszufinden, wie es sich mit den verworrenen Stammlinien in der Familie meines Vaters verhielt und ob die Gerüchte über indianische Vorfahren zutrafen und falls ja, um welchen Stamm oder welche Gruppe es sich handelte. Im Verlauf der nächsten Jahre überprüfte sie Geburten- und Todesregister, konsultierte umfangreiche Verzeichnisse über Einwanderer, Taufen, Heiraten, Geburten, Volkszählungsergebnisse, Totengräberberichte und stand im Briefwechsel mit genealogischen Gesellschaften. Für die kanadische Seite der Nachforschung entdeckte Richard De Gruchy, ein Genealoge aus Montreal, Verwandte, deren Namen ich noch nie gehört hatte. Die Ergebnisse waren verwirrend, ein Zuviel an statistischen Informationen über zu viele Leute, alles andere als begreifbar oder klar. Ich fühlte mich so verloren, als wäre ich eine der zahllosen, einander entfremdet umherirrenden und doch miteinander verwandten Figuren in Peter Matthiessens Buch Lost Man’s River.
Die Zweige der Familie meines Vaters schienen zunächst bei seiner Mutter Phoebe Brisson zu enden, der Tochter von Olivier (Levi) Brisson und Exilda (Maggie) LaBarge, und seinem Vater Peter Ovila Proulx, 1886 als Sohn des Michel Preault [sic] und seiner Frau Melina geboren. Die neuenglischen Beamten entstellten die französischen Namen und waren von den Ortsnamen der Quebec-Region hoffnungslos überfordert, so dass es zu den abenteuerlichsten Schreibweisen kam: St.-Rémi südlich von Montreal wurde zu St. Remal oder St. Remic, Kanada. Offenbar waren alle Mitglieder der Familienzweige mehrmals verheiratet, alle hatten Spitznamen und außerdem dit-Namen, und zudem benutzten sie alle gleichzeitig amerikanisierte Formen ihrer Vornamen. Sie hatten immens große Familien mit hoher Säuglingssterblichkeit und nannten das nächste Kind oft nach dem Kind, das gerade gestorben war. Doch allmählich klärten sich die Dinge.
Die Abstammung meiner Großmutter Phoebe Brisson von den LaBarge führte zu einem Robert Laberge zurück, der »1633 in Columbière in der Diözese Bayonne geboren« war und sich später in der Normandie niedergelassen hatte. Er wanderte nach Quebec aus, ließ sich in Montmorency nieder und heiratete dort 1663. Sein Ururenkel Joseph Maria LaBarge, 1787 in L’Assomption in Quebec geboren, verließ seine Heimat 1808 als Einundzwanzigjähriger. Hiram Chittenden schreibt darüber:
Er nahm den üblichen Weg, den Ottawa River hinauf und durch das verzweigte Gewirr von Wasserläufen im nördlichen Ontario, das zur Georgian Bay und zum Huron-See führt. Von dort begab er sich über die Mackinaw-Straße und den Michigan-See zur Green Bay und den Fox River und den Wisconsin River entlang zum Mississippi, den er bis St. Louis befuhr. Er benutzte für die ganze Reise ein einziges Kanu aus Birkenrinde und trug es nur acht Meilen über Land.6
In St. Louis heiratete er 1813 »eine Kreolin, die von spanischen und französischen Siedlern im Mississippi-Tal« abstammte.7 Aus dieser Ehe gingen sieben Kinder hervor. In den späten zwanziger Jahren meldete er sich auf eine Zeitungsannonce, mit der hundert tüchtige Männer für die Arbeit als Fallensteller und Pelzjäger im amerikanischen Westen gesucht wurden, und 1828 nahm er teil an General William H. Ashleys Pelzjagdexpedition. Heute tragen der La Barge Creek und die Stadt La Barge im Westen Wyomings seinen Namen. Ortschaft und Fluss wurden nach ihm benannt, weil es hieß, ein Arikaree-Indianer, der die Trapper begleitete oder in ihrer Nähe lagerte, habe ihn dort skalpiert. Der Scout und Trapper James Clyman und der hemmungslose Aufschneider James Beckwourth, ebenfalls Trapper, behaupteten zwar, Joseph Maria LaBarge sei dort ums Leben gekommen, doch so verhielt es sich nicht.8 In seiner Biographie des Sohns, des Kapitäns Joseph LaBarge, berichtet Hiram Chittenden, der Vater habe am Kopf eine Tomahawknarbe gehabt, möglicherweise als Folge des Überfalls in Wyoming, obwohl er am Missouri auch in andere Kämpfe mit Indianern verwickelt war. Ashleys Notizen von dieser ersten Expedition in den Westen erwähnen eine Felsklippe westlich des Pass Creek und südlich von Elk Mountain. Man kann es nicht mit Gewissheit sagen, aber wenn die Trapper dem North Platte River folgten, dann war diese Klippe vermutlich die Klippe von Bird Cloud, ein auffälliges Wahrzeichen.
Joseph Maria LaBarge kehrte nach St. Louis zurück, verlegte sich auf die Köhlerei, führte eine Pension und rekrutierte junge Männer für Ashleys Pelzexpeditionen. Drei seiner Söhne, der 1815 geborene Joseph und die jüngeren Charles S. und John B., wurden Dampfschiffkapitäne. Als Siebzehnjähriger verpflichtete Joseph sich für drei Jahre als »voyageur, engagé oder Schreiber« bei Pierre Choteaus wenig zimperlicher American Fur Company und stieg schnell zum Dampferkapitän auf, der sich mit den ständig verlagernden Fahrrinnen des breiten Flusses bestens auskannte. Er wurde berühmt als erster Lotse auf dem Missouri, und es heißt, Mark Twain habe ihn als Muster seiner Dampferkapitäne benutzt.9 In seinem ersten Jahr bei der American Fur Company verbrachte er den Winter von 1832 auf 1833 in einem Dorf der Pawnee-Indianer in der Nähe von Council Bluffs und lernte die Sprache und die Gebräuche des Stammes.
Im Jahr 1837 sollte der Unglücksdampfer St.Peterder American Fur Company den Mandan am Oberlauf des Missouri die Pocken bringen und den Steppenbrand ansteckender Krankheiten entzünden, der in den darauffolgenden Jahrzehnten die Indianerstämme des Westens nahezu ausrottete. LaBarge war nicht Kapitän bei dieser Fahrt (das war Bernard Pratte jr.), doch wenige Jahre zuvor hatte er seine eigenen Erfahrungen mit Epidemien gemacht. In seinem zweiten Jahr als Kapitän im Dienst der American Fur Company war er 1833 Mitglied der Mannschaft unter Kapitän Andrew Bennett an Bord der Yellowstone. Zu den Passagieren zählten der deutsche Naturforscher und Ethnograph Prinz Maximilian zu Wied-Neuwied und sein Begleiter, der Schweizer Maler Karl Bodmer. Nordamerika wurde zu jener Zeit von einer verheerenden Choleraepidemie heimgesucht, und auch an Bord des Dampfers brach die Krankheit aus. Die Mannschaft war so dezimiert, dass Kapitän Bennett sich nach St. Louis aufmachen musste, um neue Leute anzuheuern, und für die Zeit erhielt der junge LaBarge das Kommando. Schon bald rotteten sich am Ufer Leute aus der Umgebung zusammen und drohten, das Schiff anzuzünden, wenn es nicht unverzüglich den Staat Missouri verließ. Heizer und Maschinist des Schiffs waren der Cholera zum Opfer gefallen. Der achtzehnjährige LaBarge befeuerte den Heizkessel allein und steuerte das Schiff nach Westen bis oberhalb der Einmündung des Kansas River. Das war der Anfang seiner Karriere.
Von da an arbeitete er abwechselnd für die American Fur Company und auf eigene Rechnung, wobei er wiederholt finanzielle Katastrophen erlitt. In seiner langen Laufbahn lernte LaBarge viele berühmte Zeitgenossen kennen. Schon in seiner Jugend hatte er General Lafayette persönlich erlebt. Als Kapitän beförderte er auf seinem Dampfer den Künstler und Ornithologen James Audubon ebenso wie die jesuitischen Patres und Missionare Christian Hoecken und Pierre-Jean De Smet.10 Er war mit Brigham Young bekannt. Sein Bruder Charles kam 1852 bei der Explosion eines Dampfers ums Leben, und dreiunddreißig Jahre später brach sein Bruder John bei einem Landemanöver bei Bismarck, North Dakota, zusammen und war tot, doch Joseph LaBarge erreichte das biblische Alter von vierundachtzig Jahren und starb 1899 als hochangesehener Bürger von St. Louis. Als ich diese Informationen meinem Vater zukommen ließ, äußerte er sich nicht dazu. In jungen Jahren hätte es ihn vielleicht interessiert, doch nun, kurz vor seinem neunzigsten Lebensjahr, bedeutete ihm so etwas nichts mehr.
Die Brissons waren weniger glanzvolle Vorfahren. Drei der ersten Brissons waren aus Frankreich nach Neufrankreich (in das heutige Mississippi-Becken) ausgewandert. Einer von ihnen, Sébastien Brisson, dit (genannt) Laroche, ließ sich in der Gegend von Laprairie, St.-Constant und St.-Rémi nieder, und laut dem Genealogen Richard De Gruchy stammen alle Brissons von St.-Rémi von diesem Sébastien ab, der um 1671 in Bordeaux in der Provinz Guyenne geboren wurde. Im Juni 1722 heiratete er in Quebec Marie-Marguerite Larivière.
Den Familienglauben an indianische Vorfahren kann ich zwar nicht teilen, aber ich kann mir vorstellen, wie er entstanden ist. Olivier oder, wie er sich selbst nannte, »Levi« Brisson, der Großvater mütterlicherseits meines Vaters, gelangte um 1860 herum aus dem frankokanadischen Dorf St.-Rémi in Napierville County südlich von Montreal nach Connecticut. St.-Rémi liegt nicht weit entfernt von Kahnawake, der Mohawk-Reservation am Sankt-Lorenz-Strom im Norden des Staates New York. Levi ließ sich in East Killingly an der Grenze nach Rhode Island nieder und erlangte beträchtlichen lokalen Ruhm, denn er behauptete, mit drei Ehefrauen mehr als vierzig Kinder gezeugt zu haben, die von Quebec bis nach Minnesota und Connecticut verstreut lebten. Mehrmals wurde er für Zeitungen interviewt. Die Reporter bemühten sich, sein gebrochenes Englisch so wiederzugeben, wie man sich den typischen Frankokanadier vorstellte. In diesem Pidgin klingt seine Geschichte so:
Ichweiße,dassefünfzehnKindelebendig,aberwievielinMinnesotaoderandereOrtinKanada,ichnichteweiße.Früherichwohlehabede,abersovielkrankundsovielBegräbnis,hatmichgemachtearm.Mondieu,weraufeziehtdreisogroßFamiliewieich,issenichteindieLagezumacheSparnisse,wennisseFarmer.Isseanders,wennArbeiterinFabrike.KannschickeseineKindeinFabrike,kannmacheSparnisse,kannzurücknachKanada,issewohlehabedeaufeigeneFarm.DiekleineMädchenhierissejüngste.HatFraugehabtnocheine,issenichtegelebte.Issegeborenetot,issekeinPlatzfüraufKirchhof.11
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: