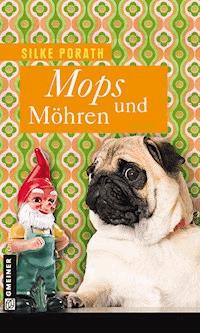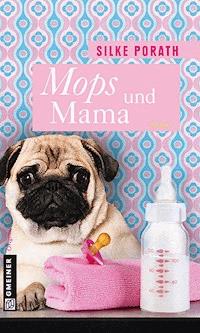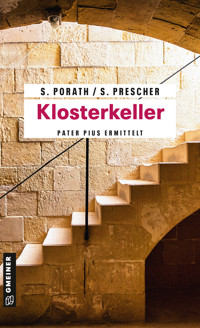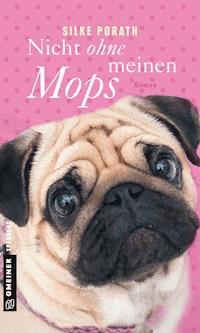Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Frauenromane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Endlich ist Stella an der Reihe: Sie darf für das Frauenmagazin ›Donatella‹ eine der begehrten Reisereportagen schreiben. Doch anstatt Wellness auf Tahiti zu genießen, landet die Berliner Journalistin mit einer chaotischen Reisegruppe beim Lama-Trekking auf der schwäbischen Alb. Von wohltuenden Massagen ist Stella also weit entfernt. Was sie aber nicht von dem einen oder anderen Flirt abhält. Und dann ist da noch Lamahengst Dalai mit seiner Herde. Und die hält die Urlauber ganz schön auf Trab!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Silke Porath
Ein Lama zum Verlieben
Roman
Impressum
Ausgewählt von Claudia Senghaas
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2015 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung der Fotos von:
© lukasvideo / Fotolia.com,
© Zsolnai Gergely / Fotolia.com
ISBN 978-3-8392-4566-8
Widmung
»Widme dich der Liebe und dem Kochen mit ganzem Herzen.«
Dalai Lama
Der rote Salon
Stella
Mit den Träumen ist das so eine Sache. Die meisten überraschen uns einfach mitten in der Nacht, halten uns ein paar Minuten auf Trab und verschwinden wieder im Nichts. Manche hallen einen Tag lang nach, die angenehmen können sich wie eine Kuscheldecke auf die Seele legen und den ödesten Novembertag zu einem Sonnentanz machen. Klingt kitschig, ist aber so.
Und, naja, dann sind da die weniger netten Träume, bei denen man heilfroh ist, wenn der Wecker scheppert. Oder wenigstens die Müllabfuhr morgens um fünf mit Scheppern und Karacho die Biotonnen leert.
Leider kommt kein Müllwagen. Es rattert kein Wecker. Nicht mal ein zu früh aus dem Nest gefallener Vogel piepst.
Das hier ist echt.
Ein Albtraum.
Und ich bin mittendrin.
15 Augenpaare strahlen mich an. Mir ist das Lächeln vor exakt zwei Sekunden eingefroren. Dabei sollte ich jetzt vor lauter Freude an der Decke des Konferenzraums hängen, direkt unter den Halogenstrahlern, die dem Sternenhimmel nachempfunden sind. Stella hat es geschafft. Stella ist dran. Sie darf die nächste Reisereportage schreiben. Sie folgt Inga, die Wellness auf Guadeloupe hatte. Andrea (Töpferwochenende im Périgord). Anna (Indien, Ayurveda). Stella bin ich.
»Und?« Paola nickt mir aufmunternd zu, und ich weiß, dass ich jetzt etwas sagen muss. Wenn die Chefredakteurin »Und?« sagt, reicht ein weit aufgerissener Mund nicht. Inga tritt mich unter dem Tisch mit ihren 200-€-Pumps gegen das Schienbein. Ich fixiere die letzte Ausgabe der ›Donatella‹, die in der Tischmitte neben den winzigen Saftfläschchen und den teuren Keksen liegt. Das Titelbild – eine grauhaarige Best-Agerin, die sowas von haargenau zum alternativ-schicken Image der Zeitschrift passt – verschwimmt vor meinen Augen.
»Äh.« Okay. Ich kann noch sprechen. Noch ein Beweis mehr, dass ich das hier nicht träume. Leider.
»Interessant.« Klingt lahm, ich weiß.
»Wusste ich doch, dass du die Richtige für den Job bist!« Paola macht mit ihrem Montblanc ein tintenblaues Häkchen hinter den Tagesordnungspunkt ›Stella in der Hölle‹. Der Rest der Konferenz läuft an mir vorbei wie ein Film, bei dem jemand viel Ton und viel Farbe weggedreht hat. Wir liegen gut im Timing für die nächste Ausgabe, das Mode-Dossier über Schuhe und Taschen aus Lachsleder findet großen Anklang, und der Psychoteil mit Interviews von Iris Berben und Cindy aus Marzahn über das Frau-Sein an sich und wasweißich geht in die Postproduktion.
»Lachsleder ist DAS Thema in Mailand.« Paola ist begeistert. Ich wusste bis gerade eben nicht, dass man aus Lachs was anderes als furztrockene Filets in Sahnesauce machen kann. Aber bis eben hatte ich auch noch keine Ahnung, dass es Menschen gibt, die ohne Zwang Geld dafür bezahlen, um mit einem Lama über die schwäbische Alb zu pilgern.
»Ach komm, das ist trendy«, versucht Inga, mich zu trösten, als wir eine halbe Stunde später in der Kaffeeküche stehen. Blick auf die Spree, wenn man sich auf einen Hocker stellt und den Hals verrenkt. Ich tippe mir an die Stirn und versenke drei Stück Zucker im Milchschaum.
»Was bitte soll daran trendy sein, hinter einem stinkenden Kamel durch die Pampa zu latschen?«
Inga sagt nichts. Lange nichts. Womit sie eigentlich alles gesagt hat, ehe sie es mit den Stichworten Natur, Tiere, Erholung versucht. Netter Versuch, aber Natur gibt es im Park, Tiere sind nicht so meins, und erholen kann ich mich auch auf meinem Sofa. Wenn schon Natur, Viechzeug und Erholung, dann doch bitte sowas wie Safari, Wellness, Strand und von mir aus dann auch ein Lama. So viel ich weiß kommen die aus Tibet oder so, da wird’s doch wohl verdammich noch eins einen Wellnesstempel geben, der für unsere Leserinnen interessant ist?
»Sie es mal so, du kannst auf Redaktionskosten passende Kleidung shoppen.« Inga ist sichtlich froh, ein Argument gefunden zu haben, und strahlt mich an.
»Wanderschuhe? Weißt du, wie die aussehen?«
Inga strahlt nicht mehr und gibt sich mit einem Schulterzucken geschlagen. Ich packe eine Handvoll Schokorosinen auf die Untertasse und trotte zu meinem Schreibtisch. Ich teile mir das Büro mit Inga. Es ist der kleinste Raum – aber der mit Abstand gemütlichste. Unsere beiden Schreibtische stehen sich gegenüber. Die Bildschirme haben wir so platziert, dass wir einander gut sehen können. In der Mitte steht ein Bonbonglas aus Omas Zeiten, das Inga auf dem Flohmarkt entdeckt hat. Meistens ist es gut gefüllt mit Himbeerbonbons aus der kleinen Manufaktur in den Hacke’schen Höfen. Aber weil heute nicht mein Tag ist, ist das Glas leer. Ich notiere mir innerlich, Süßkram zu kaufen, tröste mich mit den Schokorosinen und lasse mich auf das rote durchgesessene Sofa plumpsen, das wir zwischen die Aktenschränke an die Wand hinter meinem Schreibtisch gequetscht haben. Auf Ingas Seite steht zwischen den Büroschränken in Stahlgrau ein knallrotes Regal. Keiner weiß, wie es jemals in die Redaktionsräume kam. Keiner wollte es haben, als die ›Donatella‹ ins neue Gebäude gezogen ist. Also haben wir es adoptiert, und seitdem dient es uns als Lager für alles, ohne dass man nicht vernünftig arbeiten kann. In roten Pappkartons lagern lebenswichtige Dinge wie Puder, Lippenstift und Deo. Ersatzzahnbürsten. Haarbürsten. Fusselbürsten. Tampons, Binden, Aspirin, Nagelfeilen, ein gutes Sortiment an Lacken in allen Farben und jede Menge Feinstrumpfhosen als Ersatzpaare. Und im Karton ganz unten links Raumspray, aktuell Granatapfel-Vanille. Das brauchen wir nämlich dann und wann, wenn in unserem roten Salon Land unter ist und wir ganz schnell den Aschenbecher brauchen, um die geheimen Geheimzigaretten darin auszudrücken.
Eigentlich ist das Rauchen in der Redaktion sowas von streng verboten – aber das ist mir jetzt sowas von egal. Außerdem raucht bis auf Paola jeder hier, die einen mehr, die anderen weniger. Inga holt also die Utensilien aus dem Karton, wobei sie sich bücken muss, und ich mal wieder denke, dass ich mir für so einen Knackarsch die Hand abhacken lassen würde. Oder naja, einen Fingernagel. Dann reißt sie das Fenster auf und klemmt sich neben mich auf die Couch. Der einzige Nachteil an unserem Büro ist die Aussicht. Da ist nämlich keine: Wir starren direkt auf die fensterlose Betonwand des Nachbargebäudes. Oben ist ein bisschen grauer Himmel zu sehen, unten der Innenhof mit Müllcontainern. Bis zur Hälfte der Zigaretten inhalieren wir schweigend und pusten den Rauch, so gut es eben geht, Richtung offenes Fenster. Schließlich grinst Inga mich an.
»Du weißt schon, welcher Tag heute ist?«
»Mittwoch.« Ich weiß immer, wann Mittwoch ist. Erstens ist da immer Konferenz. Zweitens ist dann das Wochenende schon in Sicht. Und drittens läuft dienstags meine aktuelle Lieblingsserie. The Walking Dead. Zombies. Blut. Manchmal brauche ich sowas.
»Ja schon.« Inga grinst mich an. »Ich meine das Datum.«
»Hast du Geburtstag?« Ich verschlucke mich fast am Rauch. Nicht auszudenken, wenn ich den Ehrentag meiner liebsten Kollegin und Freundin vergessen hätte! Andererseits … der war doch erst? Da haben wir doch neulich erst einen astreinen Absturz mit reichlich Cocktails hingelegt?
»Du. Also irgendwie …«
»Ich? Das wüsste ich aber. Es sei denn, du meinst die Trekkingtour und dass ich durch die Lamaspucke im Gesicht hinterher wie neugeboren aussehe.« Ich knirsche mit den Zähnen.
»Jetzt vergiss doch mal die blöden Viecher. Überleg mal, was war heute vor acht Monaten?« Inga drückt ihre Zigarette aus und sieht mich erwartungsvoll an. Ich nehme einen letzten Zug. Puste den Rauch aus. Starre in die graue Wolke und blinzle die Tränen weg.
»Marvin.«
»Bingo! Seit acht Monaten bist du die Flachpfeife los!« Inga springt auf und verstaut den Aschenbecher in seiner Kiste. Dann zückt sie das Raumspray und nebelt Granatapfel-Vanille in die Luft. »Herzlichen Glückwunsch!«
Ich versuche, zu lächeln. Kann ich aber nicht. Oder wenn, dann nur ein bisschen.
»Das feiern wir.« Meine Kollegin setzt sich an ihren Schreibtisch und strahlt mich an. »Und zwar, so richtig.«
Ich versuche, einigermaßen glücklich auszusehen, bin mir aber nicht sicher, ob mir das gelingt.
Marvin.
Marvin und Stella.
Zwei Jahre lang.
Und jetzt?
Stella.
Marvin und Corinne.
Einfach so.
Nein, nicht einfach so. Ich hab es kommen sehen. Allerdings nicht ganz so deutlich wie Inga, die vom ersten Moment an eine Aversion gegen ihn hatte. Milde ausgedrückt. Naja, um ehrlich zu sein, umgekehrt war es genauso. Inga ist nun mal niemand, der ein Blatt vor den Mund nimmt. Ebenfalls milde ausgedrückt. Ich erinnere mich noch sehr deutlich an das erste Zusammentreffen der beiden. Ich war seit vier Wochen bei der Donatella, nachdem ich mein Studium mäßig erfolgreich abgeschlossen hatte. Aber mal ehrlich, wer braucht im Alltag schon die Kenntnisse, welche Sentenzen in Kafkas Werken am häufigsten vorkommen, oder wie der gute alte Charles Bukowski die neue Literatur der amerikanischen Westküste prägte? Eben. Das Beste an meinem Studium war für mich mit Abstand, dass ich Marvin traf. In der Mensa, denn woanders begegnen sich Literaturwissenschaftler und Marktforscher selten. Unser erstes Treffen war sozusagen ein Volltreffer: mein Teller mit Zucchinicremesuppe auf sein blütenweißes Hemd. Zum großen Glück für seine Haut war die Suppe wie immer nur lauwarm, und zum großen Glück für mich, dachte ich jedenfalls damals, nahm er die Sache mit Humor.
Mich selbst nahm er noch am selben Abend in meiner Studentenbutze. Von da an waren wir ein Paar, und ich dachte mir, das würde ewig so weitergehen. Man liest doch immer wieder, dass die besten Ehen am Studien- oder Arbeitsplatz entstehen. Ich gebe zu, heimlich habe ich immer mal wieder das Internet mit seinem grandiosen Angebot nach dem schönsten aller Hochzeitskleider durchforscht. Aber erstens machte Marvin keinerlei Anstalten, vor mir in die Knie zu gehen und um meine Hand anzuhalten. Und zweitens war mir schon auch klar, dass wir beide erst einmal so etwas wie Karriere aufbauen mussten. Dass Marvin einen Job in Düsseldorf annahm, okay. Gibt ja Bahn und Flugzeug, und ich war unter der Woche bei der Donatella auch voll beschäftigt damit, so zu tun, als hätte ich bereits alle Ahnung vom Journalismus. Drei, vier Monate ging das alles wunderbar. Bis Marvin im Flieger nach Berlin einen Tomatensaft bestellte. Den ihm Corinne servierte. Das folgende Wochenende verbrachte er anstandshalber noch mit mir, dann steckte er den kleinen Marvin in seine neue Flamme und den Verlobungsring an ihren Finger.
»Okay. Feiern wir das«, sage ich lahm.
»Was wird hier gefeiert?« Ich zucke zusammen, als Paola die Tür zu unserem roten Salon aufreißt.
»Äh … also … die Story mit dem Trekking«, stammle ich und stehe auf, wobei die letzte Schokorosine auf den schneeweißen Teppich purzelt. Ich kicke sie unter das Sofa, ehe Paola etwas bemerken kann.
»Ich wusste doch, dass du dich freust«, strahlt die Chefin mich an und lässt sich nun ihrerseits auf das rote Sofa sinken. Sie schielt Richtung Bonbonglas, und ich meine, einen Anflug von Bedauern in ihren perfekt geschminkten Smokey Eyes zu erkennen, weil das Glas leer ist. Dabei hat Paola noch nie ein Himbeerdrops gelutscht. Was man ihr auch ansieht: Entweder hat sie sündhaft teure Shapewear unter dem Bleistiftrock in Taubengrau, oder sie ist so dünn, wie sie aussieht. Ich ziehe automatisch den Bauch ein. Meine Chefin wedelt mit einer weißen Mappe durch die Luft.
»Da hast du alles an Infos«, sagt sie und schlägt die dünnen Beine übereinander. Ich starre auf ihre sehr, sehr hohen Schuhe. Taubengraues Wildleder, passend zum Rock. Meine Achtzentimeterabsätze sehen gegen Paolas Traumschuhe wie Flachtreter aus. »Außerdem konnte ich bei der Verlagsleitung etwas für die Ausstattung lockermachen.«
»Ausstattung?« Inga horcht auf. ›Ausstattung‹ hieß bei den vergangenen Reportagen, dass die Kolleginnen auf Verlagskosten shoppen durften. Nagelneue Badeanzüge. Watteweiche Bademäntel. Extraordinäre Sonnenbrillen und was frau sonst so braucht, wenn sie eine Reportage über Wellnessoasen schreibt.
»Am besten gehst du in dieses Sportgeschäft am Alex.« Das Wort ›Sportgeschäft‹ spricht Paola mit einer Mischung aus Belustigung und Verachtung aus. Aus den Augenwinkeln sehe ich, dass Inga grinst. Ich weiß, welchen Laden am Alexanderplatz Paola meint. Nämlich einen von denen, die ich freiwillig nie betreten würde. Ich seufze, nehme die Infomappe entgegen und nicke demütig.
»Ach ja, das Beste weißt du ja noch gar nicht!« Paola lehnt sich zurück und strahlt mich an. »Dem Veranstalter ist ein Teilnehmer abgesprungen. Du kannst schon morgen fliegen!« Was sie dann noch sagt, bekomme ich nicht ganz mit. Nur Stichworte: Flug nach Stuttgart, Mietwagen, sowas. Mittwoch. Heute ist Mittwoch. Morgen Donnerstag. Und statt am Freitag wie geplant einen gemütlichen Abend mit Inga zu verbringen, soll ich hinter wilden Tieren durch die schwäbische Pampa latschen. Meine Laune ist da, wo der Nullpunkt ist. Was ich Paola nicht zeige, hoffe ich. Die schwadroniert noch ein bisschen über die neue Ausgabe, das Exklusivinterview mit Iris Berben und die happy-fancy-romantic Fotostrecke für die Herbstausgabe, für die sie samt Fotograf nach Südfrankreich fliegt. Dann endlich, endlich schält sie sich aus dem durchgesessenen Sofa, streicht ihren Rock glatt und zieht ein Büro weiter.
»Uff.« Ich bin platt und lasse mich auf meinen Bürostuhl sinken. Die Mappe liegt drohend vor mir auf dem Schreibtisch. Ich schiebe sie nach rechts. Nach links. Und stopfe sie schließlich in meine Handtasche. Lesen kann ich das auch später. Zu Hause. Oder gar nicht.
»Wie weit bist du mit dem Artikel über ganz spätes Mutterglück?«, will ich von Inga wissen. Die verdreht die Augen.
»20 Zeilen.«
»Na passt doch.« Inga muss in einer Woche abgeben. Da sind 20 Zeilen über Frauen, die jenseits der 45 schwanger geworden sind, doch schon eine Menge. Meine Kollegin stöhnt.
»Ich weiß, was du willst«, knurrt sie.
»Na dann, worauf wartest du?«
Inga seufzt ergeben.
Eine dreiviertel Stunde später und nachdem ich mich im redaktionellen Mailsystem ordnungsgemäß abgemeldet habe, sind wir mit Erlaubnis ihrer Hoheit Paola von und zu Donatella am Alexanderplatz angekommen. Trekking erfordert schließlich eine spezielle Spezialausstattung. Die ich definitiv nicht besitze. Und auch gar nicht besitzen will. Welche gesunde Frau in Berlin braucht unförmige Wanderschuhe, mannsgroße Rucksäcke und Hosen mit 20 Taschen an jedem Bein? Eben. Wir folgen den Touristen aus der U-Bahn, und ich atme tief ein. Nichts riecht so wie Berlin und seine U-Bahnen: ein bisschen muffig, ein bisschen warm, ein bisschen nach Eisen und ein bisschen nach toter Ratte und frisch aufgebackenen Schrippen. Viele nehmen diesen Geruch nicht mehr wahr, aber ich freue mich jedes einzelne Mal, wenn ich an der Großstadtluft schnuppern darf. Ich habe auch schon Vergleiche angestellt. Die Metro in Paris hat eher eine süßliche Note im Odeur. Was vielleicht an den Parfums liegt, mit denen die Franzosen sich so gerne einnebeln. London dagegen riecht ein bisschen wie ein nasser Putzlappen. Mehr Vergleiche habe ich nicht, aber in dieser Reihe riecht mein Berlin einfach am besten. Als wir auf die Straße treten, hakt Inga mich unter. Ich sehe das Shoppingcenter schon von Weitem – und habe gar keine Lust darauf. Stattdessen wandert mein Blick zum Fernsehturm, der sich wie eine übergroße Stecknadel aus Beton über dem Platz erhebt. Von da oben hat man einen fantastischen Blick auf die ganze Stadt, und ich nutze gerne jede Gelegenheit, mich vom Aufzug in die Höhe katapultieren zu lassen. Da oben ist es irgendwie surreal. Leider hatte ich bislang erst drei Mal die Gelegenheit dazu. Beim ersten Mal konnte ich es absolut gar nicht genießen, weil ich gegen meine Höhenangst zu kämpfen hatte. Knapp was über 200 Meter sind eben über 200 Meter! Beim zweiten Mal waren meine Eltern mit dabei, und ich habe es nicht gewagt, einen Cocktail gegen meine Höhenangst zu trinken. Und als ich das dritte Mal auf dem Alex war, haben Marvin und ich die ganze Zeit geknutscht, da war nichts mit Aussicht. Ich ruckle an Ingas Arm.
»Erst mal Alkohol«, verkünde ich. »Betrunken sehe ich nicht, wie beschissen ich in einem Wanderoutfit aussehe.«
»Cheerioh!« Inga lacht. Für ein Schlückchen ist sie immer zu haben.
Wir haben Glück. Die Schlange vor den Aufzügen ist sehr kurz. Den Shop mit Berliner Andenken, wo es alles vom Ampelmännchen als Plätzchenausstecher bis Radiergummis in Fernsehturmform gibt, lassen wir links liegen. Dadurch gelingt es uns, die Horde schwäbischer Touristen zu überholen, die laut tratschend die Treppen hinauf steigt.
»Noo ned huudla!«, ruft ein Opi, als ich ihn aus Versehen anremple.
»Ihnen auch einen schönen Tag«, sage ich und nicke ihm aufmunternd zu.
»So äbbes däds bei uns dahoim ned gäba«, brummelt der Herr und sieht uns nach, wie wir flugs – weil ja geübt – die Sicherheitskontrolle passieren. Vor den beiden Aufzügen steht … niemand. Ist mir noch nie passiert, und ich freue mich schon darauf, mit Inga allein die 40 Sekunden im Lift zu genießen. Naja, allein ist man da nie, es fährt ja immer ein Liftboy mit. Meistens ein älterer Herr, der auf einem Barhocker neben den Knöpfen sitzt und der jedes Mal dasselbe erzählt. Dass der Aufzug sechs Meter in der Sekunde an Höhe gewinnt. Dass man das an der Lichtleiste ablesen kann. Und dass er nicht nach Köln fährt, falls jemand falsch zugestiegen ist. Ich habe es noch nie erlebt, dass der Spruch jemandem auch nur ein mildes Lächeln entlockt hat.
Die Tür des rechten Lifts gleitet auf, und ein halbes Dutzend Japaner oder Chinesen kommt laut plappernd aus dem Aufzug. Mister Liftboy – tatsächlich derselbe Mann wie immer, und ich befürchte, er hat auch dasselbe Hemd an wie immer – bittet Inga und mich galant in sein einspuriges Gefährt.
»I will au mit!« Oh nein. Der schwäbische Rentner kommt im Schweinsgalopp um die Ecke.
»Sonst noch wer?«, will der Fahrer wissen und wuchtet sich auf seinen Sitz.
»Noi, die send no beim Zoll. Mei Frau häd äbbes en dr Dasch, was ed gohd.« Ich versuche, zu übersetzen: Seine Kollegen sind offenbar noch an der Sicherheitsschleuse, weil die Gattin des Herrn was auch immer in ihrer Handtasche mit nach oben fahren wollte. Ich tippe auf eine Dose Linsen.
»Gugg, Mädle, häddsch ed so schnell laufa müssa!« Unser Mitfahrer sieht mich beifallheischend an.
»Entschuldigung, ich verstehe Sie nicht«, knurre ich.
»Ich sagte, Sie hätten sich nicht so beeilen zu müssen, jetzt sind wir gleich weit.« Huch, der Mann kann Deutsch! Der Liftboy schielt um die Ecke. Niemand kommt.
»Na dann wollen wir mal!« Die Tür gleitet zu. Und schon geht es nach oben, begleitet von viel ›Ah‹ und ›Oh‹ seitens des Schwaben, als der Fahrstuhlführer seine Litanei runterrattert. Während Inga und ich das typische Berliner Gesicht machen, nämlich unbeteiligt zu tun bis in die letzte Pore, hängt der Tourist förmlich an den Lippen des Liftboys.
»Falls jemand nach Köln möchte, dann ist er falsch eingestiegen.«
Inga verdreht die Augen. Ich verdrehe die Augen. Und der Schwabe lacht.
»Der isch guad!« Und dann ist es vorbei, wir sind oben angekommen. Unser Mitfahrer stürmt sofort zu den Panoramascheiben. Inga und ich biegen nach rechts zur Bar ab und klemmen uns jede auf einen der komplett unbesetzten Hocker. Zwischen zwei und vier ist happy Hour, an normalen Tagen drängelt sich hier die Meute. Aber scheinbar sind wir mit dem Schwaben und dem Barkeeper alleine. Surreal, irgendwie. Aber egal, ich brauche Alkohol, schnappe mir die Karte und schwanke zwischen etwas Hartem und etwas ganz Hartem. Inga schwankt auch, obwohl sie noch stocknüchtern ist: Der Mann hinter dem Tresen ist sowas von genau ihr Beuteschema! Ich linse über den Rand der Karte und beschließe, meiner Freundin das Feld zu überlassen. Und die ackert auch gleich so richtig los, was ich verstehen kann, denn der Typ ist wirklich schick. Schwarze Locken, an den Schläfen leicht grau. Groß, schlank und stahlblaue Augen, die man in der Farbe sonst wohl nur in Form von künstlichen Kontaktlinsen kaufen kann. Seine scheinen echt zu sein, und Ingas Begeisterung auch. Binnen Sekunden weiß sie, dass er Mike heißt, aus Spandau kommt, eigentlich Streetworker ist und sich auch wundert, warum heute so wenig los ist.
»Macht ja aber nix, wenn ich so reizende Gäste habe«, sülzt Mike und sieht dabei Inga sehr intensiv an. Das heißt: ihre Augen eher nicht, sein Blick wandert eindeutig eine Etage tiefer, und ich ahne, dass meine Kollegin sich fragt, welchen BH sie eigentlich trägt und ob der das, was er pushen soll, auch ausreichend pusht.
»Dürfen wir was zu trinken haben?«, flötet Inga. »Wir haben nämlich einen Notfall.« Aha. Die Nummer mit dem hilflosen Schäfchen. Zieht bei den meisten Kerlen und scheinbar auch bei Mike, der begeistert nickt, vor lauter Freude vergisst zu fragen, was der Notfall ist, und uns ruck und zuck zwei Cocktails mixt, die so garantiert nicht in der Karte stehen.
»Notfall?«, frage ich Inga flüsternd.
»Ja, nein, eher Notstand … ich meine … hach, ist der süüüüß!«
Süß ist auch das, was Mike uns dann kredenzt. Jede Menge exotisches Obst, jede Menge Alkohol und obendrauf jeweils ein Schirmchen. Wahrscheinlich stellt Inga sich jetzt vor, wie sie unter einem großen Schirm liegt, Mike an ihrer Seite, ringsum Strand und … ach, geht mich ja nichts an.
»Ich muss mal«, hasple ich, schnappe mir mein Glas und trolle mich um die Kurve. So gesehen ist es ja praktisch, dass hier oben alles irgendwie rund ist, und ich hoffe, dass es bei Inga und Mike auch rund läuft. Vor mir läuft der Schwabe und sieht gar nicht mehr so begeistert aus wie eben im Aufzug.
»Wo bleiben die denn?«, fragt er mich.
»Wer?« Ich lehne mich über das Stahlgeländer und starre nach unten. Dann nippe ich an meinem Cocktail. Holla, der hat’s in sich! Keine Ahnung, was genau in meinem Glas ist, aber es haut definitiv rein und es ist sicher kein Vorteil, dass ich außer ein paar Schokorosinen noch nicht viel im Magen habe. Naja, die Ananasstückchen im Glas kann ich ja auch essen.
»Meine Frau, die Annerose. Und die anderen.«
»Vielleicht sind die stecken geblieben?«, scherze ich.
»Im Aufzug?« Der Mann macht sehr große, sehr runde Augen.
»Kann ja mal vorkommen«, unke ich. So weit ich allerdings weiß, ist das erst ein oder zwei Mal passiert. Wenn überhaupt.
»Ja und dann?«
Ich zucke mit den Schultern und sehe einem Doppeldeckerbus dabei zu, wie er an einer Ampel steht.
»Da muss man doch was machen!« Der Mann klingt ein bisschen verzweifelt, und er tut mir fast schon leid. Aber ehe ich etwas Beruhigendes sagen kann, ist er schon auf und davon Richtung Lift. Er drückt wie besessen auf den Rufknopf und es passiert – nichts.
»Des geits doch ed!«, schimpft er und noch einiges mehr, das ich beim besten Willen nicht verstehen kann. Seine Tirade wird durch das Klingeln eines Telefons unterbrochen. Ich schiele zur Bar. Mike hat den Hörer des Wandapparats in der Hand. Nickt. Brummt. Legt auf. Und ruft dann: »Der Lift hängt!«
Dem Schwaben fällt der Unterkiefer runter.
»Wie, der hängt?«
»Na, am Stahlseil, nehm ich an«, knurre ich und zerbeiße ein saftiges Ananasstückchen.
»Kleines technisches Problem«, erklärt Mike. Inga seufzt theatralisch.
»Darf ich Ihnen ein Getränk anbieten?« Der Barkeeper nickt dem Schwaben aufmunternd zu. Der zögert, freut sich dann aber sichtlich, als Mike ihm erklärt, dass das selbstverständlich aufs Haus gehe und das Portemonnaie des Touristen nicht belastet werde. Der Schwabe entscheidet sich für ›auch so eins‹, womit er einen Fruchtcocktail meint. Und da Mike gerade dabei ist, macht er davon gleich vier.
»Wie lange dauert das denn?« Unser Tourist nuckelt am Strohhalm, wobei er mit der Brille an das blaue Schirmchen stößt, welches auf dem Boden landet. Er bückt sich, hebt es auf und faltet es zusammen. Dann steckt er es in seine Hemdtasche »Kleines Souvenir für meine Annerose.«
»Tja, das kann schnell gehen oder länger.« Mike bleibt kryptisch. Inga hängt an seinen Lippen, und ich beschließe, ihr den Spaß zu gönnen.
»Sollen wir uns setzen?«, frage ich den Touristen. Er nickt und folgt mir zu einer stylishen, aber höllisch unbequemen Couch. Eine Weile nuckeln wir schweigend an unseren Drinks.
»Herbert, i be dr Herbert«, sagt der Mann schließlich.
»Stella.«
»Freit mi!« Er streckt mir die Rechte hin, und ich schlage ein. Sein Händedruck ist eine Spur zu fest. Er schüttelt meine Hand, als gäbe es dafür noch ein Freigetränk.
»Bisch du von hier?«
»Ja, bin ick, wa.« Na gut, perfekt Berlinern war noch nie meins. Schließlich komme ich aus dem Badischen, ein kleines Kaff, das auf den meisten Landkarten nicht mal eingezeichnet ist und das ich, wann immer möglich, tunlichst verschweige. Na gut, eigentlich wurde ich nur im äußersten Südwestzipfel des Landes geboren. Und bin dort auch nur in den Kindergarten gegangen. Und ein halbes Jahr in die Grundschule. Dann wurde mein Vater krank. Bis heute weiß niemand so genau, was diesen Mann, der in meinen Augen immer so stark wie ein Tannenbaum war, einfach so umgehauen hat und woran er kein halbes Jahr später starb. Meine Mutter weinte eine Woche lang, und als ich eben dachte, ihre Augen würden gleich aus dem Kopf geschwemmt, schnäuzte sie sich lautstark, sagte ›So‹ und begann zu packen. Zu telefonieren. Briefe zu schreiben. Und ehe ich wusste, wie mir geschah, stand ein Umzugswagen vor unserem Haus – und wir landeten in Berlin. Meine Mutter arbeitet noch heute in derselben kleinen Parfümerie wie damals, hat mittlerweile eine ganze Reihe Bekanntschaften verschlissen und mir keine Steine in den Weg gelegt, als ich direkt nach dem Abitur mit der Halbwaisenrente im Gepäck nach Tiergarten gezogen bin. Ich meine, mich zu erinnern, dass der Damalige auch Herbert hieß, kann aber auch Karlheinz gewesen sein. Im Moment scheint sie Single zu sein. Ich nehme mir vor, sie nach meiner Reportage mal wieder zu besuchen. Falls sie Zeit hat und nicht gerade mit einem Erwin, Johann oder wem auch immer anbandelt.
Herbert reißt mich aus meinen Gedanken. Er scheint mit meiner kleinen Dialekteinlage zufrieden zu sein, fischt mit dem Plastikstäbchen eine Erdbeere aus dem Glas und kaut begeistert.
»Mir send vo Wailenga«, erklärt er mir. Ich nicke. Dann erfahre ich, dass Herbert, seine Annerose und ein halbes Dutzend weiterer Schwaben jedes Jahr einen anderen Ausflug machen. Bislang haben sie schon Hamburg, Wien und Essen abgeklappert, waren in Köln, Berchtesgaden und einmal sogar in Paris. Davon allerdings bekommt Herbert noch immer rote Ohren, und mehr als sein gerauntes ›Muhläng Ruhsch‹ ist ihm auch nicht zu entlocken. Heute hat die Truppe den letzten Tag in Berlin, und nach dem Besuch des Fernsehturms, der für die Schwaben definitiv noch in der DDR zu liegen scheint, steht noch Kultur auf dem Programm. Was, das hat Herbert vergessen. Oder verdrängt. Jedenfalls holt er Luft, starrt auf sein leeres Glas, schnappt sich meins und geht zur Bar. Ich verrenke mich so weit, dass ich sehen kann, dass Mike mittlerweile neben Inga sitzt. Zwar dreht sie mir den Rücken zu, aber ich kenne ja ihre Masche mit den auf ellenlang geschminkten Wimpern, die sie klappern lässt, und dem Schmollmündchen. Bei Mike scheint sie zu ziehen, denn er klebt förmlich an ihren Lippen und lässt sich von meinem neuen Freund Herbert nur ungern stören. Immerhin mixt er uns noch zwei Cocktails. Ich will Herbert zurufen, ob er eine der kleinen Knabberschalen mit Nüssen mitbringen kann, denn mittlerweile kreist der Alkohol doch merklich in meinen Blutbahnen. Aber der schaut nur unglücklich, als er hört, dass es aus dem Liftschacht und von der Technik nichts Neues gibt.
»Wie lange können wir denn überleben?«, rufe ich. Mike grinst.
»Verdursten muss bei mir niemand.« Und dabei sieht er Inga sehr tief in die Augen. Oder den Ausschnitt. Kann ich nicht so genau erkennen, denn in dem Moment steht Herbert vor mir und drückt mir meinen Cocktail in die Hand. Dieses Mal ist das Schirmchen gelb und seines grün. Ich nehme meins, falte es zusammen und gebe es ihm.
»Für Annerose.«
Herbert strahlt. »Des isch aber nett!«
»Gell!«, rutscht mir raus. Keine Spur Berlin. Herbert scheint es nicht zu merken. Statt dessen bittet er mich, ihm zu erklären, was man genau sieht, wenn man vom Turm nach unten guckt. So ganz genau weiß ich das auch nicht, aber der Schwabe kann ja nicht wissen, wo genau die Botschaften sind, welche breite Straße wohin führt und wo exakt die Mauer mal verlaufen ist. Ich finde mich als Fremdenführerin ziemlich gut, und nachdem wir die halbe Runde um den Turm gemacht haben und wieder an der Bar ankommen, füllt Mike ungefragt nochmal zwei Gläser für uns. Inga zwinkert mir zu. Ihre Wangen sind gerötet und ihre Augen glänzen, was sicher nicht nur vom Alkohol kommt. Ich verstehe und ziehe Herbert weiter. Nächste Runde.
Draußen wird es langsam dunkel, und mir wird ein bisschen schwummrig. Als wir erneut an der Bar vorbeikommen, ist Berlin zu unseren Füßen zu einem blinkenden Lichtermeer geworden. Und der Boden unter meinen Füßen scheint auch Wellen zu schlagen. Zum nächsten Cocktail (rosa Schirmchen, auch für Annerose) schnappe ich mir eine Schale Cracker. Herbert und ich nehmen wieder Platz auf dem Sofa. So unbequem ist es eigentlich gar nicht. Wir teilen uns das Salzgebäck, und ich erfahre, dass mein neuer Kumpel mal Lehrer war, Erdkunde und Geschichte. Mein Vater war auch Lehrer. Allerdings Fahrlehrer. Ich frage mich, ob er mit mir auf den Alex gegangen wäre. Vielleicht schon. Viele Erinnerungen an ihn habe ich leider nicht, und sein Gesicht, das mir als Kind noch so präsent war, verschwimmt immer mehr, und an seine Stelle treten die verblassenden Fotografien aus Mamas rotem Album. Papa und ich neben dem Tannenbaum. Papa mit mir auf dem Arm, ich habe verheulte Augen und eine scheußliche selbst gestrickte Mütze auf dem Kopf. Papa neben mir, als ich die Schultüte im Arm habe.
»Hassu Kinner?«, will ich von Herbert wissen und lutsche ein Stück Ananas.
»Ha noi. Des hätt nia glabbt. Schad.« Herbert seufzt und kippt den Rest seines Cocktails in den Rachen, dann rülpst er leise, und kurz darauf macht es ›Pling‹. Das kam allerdings nicht aus Herbert, sondern vom Lift. Wir rappeln uns hoch, wobei Herbert bedenklich schwankt, und starren zu den Aufzügen. Die rechte Tür gleitet auf. Außer dem Fahrer ist die Kabine leer.
»Wo isch mai Annerose?«, ruft Herbert.
»Sind Sie Herr Ketterle?«
»Höchschdper… persönlich.« Herbert nimmt Haltung an, so gut das eben geht.
»Ihre Gattin lässt ausrichten, dass sie schon vorgefahren sind, um den Beginn der Vorstellung nicht zu verpassen. Ich soll Ihnen das hier geben.« Er reicht Herbert ein Ticket. Für das Varieté. »Zur Pause könnten Sie das noch schaffen.«
Herbert hickst. »Kommsch mit?«
Ich schüttle den Kopf. »Ich muss noch shopp… shopp… einkaufen.«
»Grad schad.« Er reicht mir die Hand. Ich bitte ihn, kurz zu warten, und schiele um die Ecke. Inga und Mike sitzen mittlerweile so nah beieinander, dass die Luft zwischen ihnen förmlich knistert. Ich beschließe, die beiden in Ruhe turteln zu lassen, und fahre mit Herbert nach unten. Dort hat sich eine lange, lange Schlange vor den Liften gebildet. Die Leute murren, als wir aussteigen. Dabei können wir ja nichts dafür, dass hier mal ein paar Stunden nichts ging. Moment mal – Stunden?
»Herbert, wie spät ist es?«
Er taxiert seine Armbanduhr. »Dreiviertelneun.«
»Wie bitte?«
»Zwanzichfümmunvierzich.«
»Scheiße.«
»Des sagt mr aber ned.« Der Lehrer wackelt mit dem Zeigefinger vor meiner Nase.
»Zu spät.« Der Laden hat längst zu. Was vielleicht gar nicht so schlecht ist, denke ich, denn langsam wird mir ein bisschen schlecht. Ich begleite Herbert zur Bahn, setze ihn in die hoffentlich richtige und fahre selbst nach Hause. Irgendwo werde ich schon ein paar alte Turnschuhe haben, tröste ich mich selbst. Und mal ehrlich, es ist doch auch wurschtegal, wie ich angezogen bin, wenn ich mich von wildgewordenen Lamas anspucken lasse. Ich lehne den Kopf an die Scheibe, die angenehm kühl ist, und seufze. Irgendwo da oben hat Inga gerade den Flirt ihres Lebens. Und ich? Reise unbemannt durch die Berliner Nacht, und vor mir liegen ein noch nicht gepackter Koffer und ein Trip, den ich freiwillig niemals gemacht hätte. Keine zehn Lamas hätten mich aus freien Stücken auf die Schwäbische Alb gebracht. Höchstens ein Wellnesshotel. Aber das ist in meinem Karriereplan wohl erst mal nicht vorgesehen.
Was anderswo geschah,das Stella nicht wissen konnte,das aber für die Geschichte wichtig ist
In der Schweiz starrte Regula Schmitt-Pfefferer etwa zur selben Zeit aus dem Fenster, als Stella das im Berliner Fernsehturm tat. Das heißt, sie starrte ihr eigenes Spiegelbild an, das an der Scheibe leicht verzerrt wirkte. Was, wie sie fand, sowohl zum Wetter draußen (trüb und regnerisch) und zu ihrer Stimmung (trüb und grau) passte. Selbst im verschwommenen Spiegelbild erkannte Regula die grauen Schatten um ihre Augen. Da konnte auch die teure Creme aus der Parfümerie am Mailänder Flughafen nichts mehr ausrichten. Ihre Haare, frisch blond gesträhnt und zu einem akkurat geschnittenen Bob frisiert, lagen wie Spaghetti um den Kopf. Immerhin war die Maniküre gelungen, auch wenn es Regula irrsinnig viel Kraft gekostet hatte, die anderthalb Stunden sitzen zu bleiben und nicht mit dem Kopf auf die Tischplatte zu knallen und sich womöglich die Nagelfeile der Fachkraft in die Augen zu rammen.
Hinter ihr auf dem Boxspringbett für knapp 3.000 Franken lag der Hartschalenkoffer, bis zum Rand gefüllt mit Klamotten, Handtüchern und Schuhen. Nicht das, was Regula sonst einpackte, wenn sie unterwegs war. Normalerweise stapelten sich in ihrem Gepäck Kostüme und Blusen aus Seide oder Leinen, Schuhe aus dem Waffenschrank, ein oder zwei Bücher, die sie dann doch nicht las. Und immer ein ganzer Stapel Broschüren. Hochglanz. Teures Papier. Mit Fotos, die die Firma ein Vermögen gekostet hatten, obwohl nur Käse darauf war. Rohmilchkäse im Holzfässchen. Hartkäse auf einer Porzellanplatte. Schnittkäse auf Bauernbrot. Der Foodstylist aus Los Angeles hatte ganze Arbeit geleistet, und die Texter aus einer Züricher Agentur ebenfalls. Die meisten, denen Regula die Prospekte zeigte, bekamen sofort Appetit. Ihr dagegen war er seit Monaten vergangen. Sie konnte den Käse, den sie als Marketingleiterin auf Messen, bei Händlerverbänden und sonst wo präsentierte, nicht mal mehr riechen. Obwohl sie wusste, dass das buchstäblich Käse war und die wie Topmodels beleuchteten Lebensmittel mit Haarspray und Farben aus der Sprühdose auf lecker getrimmt waren und nach dem Shooting eigentlich auf den Sondermüll gehörten. Innerlich fühlte Regula sich wie ein Schweizer Raclette: zerlaufen und so richtig, richtig zäh und schwer.
Sie seufzte, was sie in letzter Zeit oft tat. Vielleicht durfte sie das mit 47 Jahren auch. Womöglich gehörte diese graue Stimmung sogar dazu, wenn man, wie sie, täglich damit rechnete, dass die Wechseljahre an die Tür klopften. Dabei fühlte sie sich nicht alt, nicht im Kopf. Nach zwei kurzen Ehen (anderthalb Jahre mit Herrn Schmitt, drei mit Herrn Pfefferer), die beide kinderlos geblieben waren, und der zwar nicht steilen, aber erfolgreichen Erklimmung der Karriereleiter hatte sie ein kleines Vermögen auf dem Konto, die Wohnung war beinahe abbezahlt und sie konnte sich jedes Kleid kaufen, das sie wollte. Blöd nur, dass sie seit ein paar Monaten keins mehr wollte. Auch keine Schuhe mehr. Sie ertappte sich dabei, wie sie in der Züricher Bahnhofsgegend umherstromerte und wie magisch angezogen wurde von den kleinen Läden in den kleinen Gassen, die Kitsch und Krempel im Angebot hatten. Ein Sortiment Teelichter erfüllte Regula mit demselben satten Gefühl wie noch vor Kurzem die hauchdünnen halterlosen Strümpfe aus dem Fachgeschäft. Mittlerweile hatte sie eine regelrechte Sammlung von roten, pinkfarbenen, hellblauen und apfelgrünen Kerzenhaltern, die wie Fremdkörper im ansonsten in Beige und Weiß gehaltenen Appartement wirkten. Ihrer Putzfrau gefielen sie – und ansonsten hatte noch kein Mensch die kitschigen Dinger gesehen. Wer auch? Regula hatte einen Job, da brauchte sie keine Freunde. Hatte auch gar keine Zeit dafür.
Sie wandte sich abrupt um und schnaubte. Seufzte. Klappte den Koffer zu und wuchtete ihn vom Bett. Die kleinen Rollen schnurrten wie ein Kätzchen, als sie den Koffer ins Wohnzimmer zog. Auf dem gläsernen Esstisch lagen die Unterlagen für die Reise. Noch so eine Sache, die sie an sich selbst nicht verstand. Das war wie mit den Kerzenleuchtern. Eigentlich hatte sie den aufgelaufenen Urlaub mit ganz viel Wellness verbringen wollen. Bali oder auch Thailand, Bungalow direkt am Strand. Oder Kenia, warum nicht, andere Frauen ihres Alters flogen auch nach Mombasa und ließen sich für drei Wochen von einem nachtschwarzen Loverboy vorgaukeln, eine Prinzessin zu sein. Aber die Angebote, welche das Internet vorschlug, waren ihr alle fad und grau vorgekommen. Sie konnte nicht einmal mehr sagen, wie sie die Homepage der Lamafarm in Süddeutschland gefunden hatte. Irgendetwas hatte dafür gesorgt, dass sie das Anmeldeformular ausfüllte. Den Kollegen hatte sie erzählt, sie ginge in ein Kloster, abschalten, unter Managern und Ihresgleichen. Regula pustete die drei Kerzen in den purpurroten Haltern aus und tippte sich selbst an die Stirn bei dem Gedanken, dass sie morgen in aller Herrgottsfrühe im Zug sitzen würde. Immerhin 1. Klasse, Ruheabteil. Dann warf sie einen Blick auf das Smartphone. Keine Anrufe, aber 22 neue E-Mails. Sie drückte den Aus-Schalter.
Als Regula in Zürich sich die beige Bettdecke über den Kopf zog und dem Kissen ein »So an Chääs!« zurief, warf in Wiesbaden Bjarne Hellstern einen letzten Blick auf den Käsewagen. Mit einem Kopfnicken bedeutete er dem Kellner, dass das Arrangement seinen Segen hatte, und der Mann schob das Gefährt in den Gastraum. Bjarne gähnte hinter vorgehaltener Hand und schielte auf die Bahnhofsuhr, die über der Schwingtür zwischen Restaurant und Küche hing. Noch zwei, drei Stunden, dann war Feierabend. Seine Finger rochen nach Zwiebeln. Er nickte dem Souschef zu und verschwand im Büro. Durch die Glasscheibe hatte er einen guten Blick auf das Geschehen an den Herden. Das Klappern der Töpfe und die gebellten Befehle der Kollegen drangen nur gedämpft in den Raum. Bjarne setzte sich in den schwarzledernen Drehsessel. Die Federn stöhnten, als seine gut 100 Kilo sie zusammendrückten. Oder vielleicht hatte auch Bjarne selbst gestöhnt. Kloppke, der Oberkellner, jedenfalls hatte so etwas angedeutet. Dass ihm sein Chef in letzter Zeit gar nicht gefalle (Bjarne gefiel sich selbst nicht), dass er sich Sorgen mache (wenigstens einer!) und dass er ihm mal eine Auszeit nahelege. Immerhin habe Bjarne seit der Eröffnung des ›Hellstern‹ vor 13 Jahren keinen richtigen Urlaub mehr gemacht.