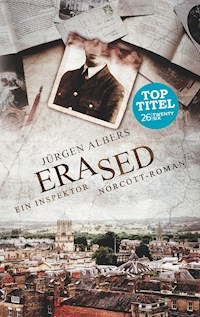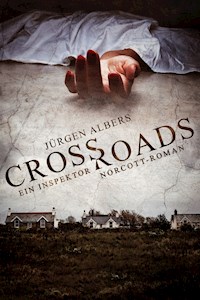Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Jürgen Albers, auch bekannt aus der Fernsehdokumentation "Goodbye Deutschland", legt mit diesem Buch seine Autobiographie vor. Was kaum jemand weiß: Hinter dem selbstbewussten und knallharten Nachtclub- und Casinobesitzer verbirgt sich ein sensibler Mann mit einer schweren Kindheit. Als Betreiber von Privatbordellen lernt Albers das knallharte Geschäft mit Bars und Nachtclubs kennen, begleitet von Gewalt, dem stets präsenten Arm der Justiz und unglücklichen Liebschaften. In "Heiße Miezen - Mein wildes Leben als Nachtclub- und Casinobesitzer" gibt der Autor seinen Lesern private Einblicke in sein Elternhaus, die Flucht in ein anderes Leben und den Traum von Amerika - oder doch Mallorca?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 800
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Am Anfang war das Leben
Als ich am 22.9.1961 um 2 Uhr morgens das Licht der Welt erblickte und im Entferntesten hätte ahnen können, was mich erwartet, wäre ich wohl laut schreiend weggelaufen, wenn ich denn schon hätte laufen können. Da ich es noch nicht konnte, musste ich wohl bleiben und das, was kam, ertragen. Oder besser gesagt, zu überleben versuchen. Dies wurde wohl auch mein ständiger Begleiter: der ewige Kampf, zu überleben und nicht den Verstand zu verlieren.
Drei Tage vorher, Grube Gouley, WürselenMorsbach, 10 Uhr vormittags, Mein Vater Horst, von Beruf Bergmann, Ing., geht mit seinem Kumpel Alfons („Kumpel“ werden im Bergbau die Kollegen genannt) in 860 Meter Tiefe mit einem weiteren Kumpel einen Stollen entlang. Horst sagt zu Alfons: „Irgendwie habe ich ein Gefühl im Bauch, dass mir gar nicht gefällt.“ „Ja“, sagt Alfons, „heute knackt und kracht es etwas komisch über uns.“ Weitere Worte konnten nicht mehr gewechselt werden, denn der Berg brach mit einem lauten Krachen und Ächzen ein und begrub alle drei unter sich. Verschüttet unter Tonnen von Stein und Geröll mit sinkenden Chancen zu überleben. Zu Hause, meine Mutter kurz vor meiner Geburt, mit ihrer Schwester Gerda, als der Alarm in der Grube losging, der kilometerweit zu hören war und jedem, ob er wollte oder nicht, sagte: Einsturz, verschüttet, Grubenunglück ... Alle, die ihre Männer „auf Schicht hatten“, wussten was das heißt. Sofort die Fragen, die sich in die Köpfe gruben: In welcher Tiefe ist es passiert, kommt meine Familie davon? „Nun mach dir mal keine Sorgen“, sagte Gerda, „warum soll Horst es sein.“ Noch konnte keiner ahnen, dass drei Tage banges Warten bevorstand. „Wir gehen bei den Eltern vorbei und zusammen zur Grube“, sagte Marlies (Zusammenfassung von Maria Elisabeth) zu Gerda. Mein Opa Peter, im 2.
Weltkrieg als Scharfschütze im Russlandfeldzug, hatte beste Nerven und das Getöse des Alarms schon gehört. „Nun reg dich nicht auf, Marlies. Wird schon nicht Horst sein. Gehen wir rüber und sehen einfach nach. Man wird uns schon informieren.“ Auf dem Weg zur Grube, die nur ein paar hundert Meter von der Wohnung entfernt war, kamen bereits die ersten Nachrichten, die wie Hiebe auf einen einschlugen. „860, 860 ... auf 860 Meter Einsturz; drei Leute vermisst.“ Beim Eintreffen an der Grube wurde die Nachricht zur Gewissheit. Horst wurde mit zwei Kollegen vermisst. Auf über 80 Meter Länge war der ganze Stollen eingestürzt. Keiner wusste, waren die drei vor dem Einsturzgebiet oder wurden sie unter allem begraben? Die ersten Rettungsmannschaften waren vor Ort und das Graben begann. „Was ist los, Marlies?“ sagte Gerda, „du zitterst am ganzen Körper und bist ganz blass. Bekommst du wieder einen Anfall? Geht es dem Baby gut?“ Meine Mutter fiel einfach in sich zusammen. Sie litt von Kindesalter an an epileptischen Anfällen schwerster Form. Sie war fast immer mit Gerda allein, weil niemand sie kennen lernen wollte, obwohl sie eine hübsche junge Frau war. 1,60 groß, schlank, dunkle Haare, die fast immer hochgesteckt waren, 22 Jahre jung, aber eben nicht ganz gesund. Bis mein Vater kam ...
Aus Erzählungen weiß ich, dass es für meinen Vater wohl Liebe auf den ersten Blick war. Sie war eine große Last für die ganze Familie und man war froh, als durch Horst und die Hochzeit die Anfälle fast ganz ausblieben, bis zu der Nachricht, die sie zusammenfallen ließ wie ein nasser Sack.
Mein Vater lag unterdessen unter Balken begraben, die sich so verkeilt hatten, dass er ein wenig Platz über sich hatte.
Und die verhinderten, dass er von dem Ganzen erschlagen wurde. Neben ihm lag Alfons, bewusstlos und verletzt, aber lebendig. Der dritte war tot. Er hatte keine Chance. Horst verspürte Schmerzen im rechten Bein, das unter einem Balken eingeklemmt war. Blut lief von der Stirn über das Gesicht, aber er lebte. Er konnte nicht ahnen, dass er erst drei Tage später geborgen werden würde, mehr tot als lebendig. „Oh Gott“, sagte Gerda zu ihrer Mutter, meiner späteren Oma Maria, „was machen wir mit Marlies? Die Anfälle werden immer schlimmer. Wir müssen sie ins Krankenhaus bringen.“ Die Eltern von meinem Vater Horst – seine Mutter Eva Maria und sein Stiefvater Georg, genannt Schorch – und sein Bruder Günther waren mittlerweile aus Sorge ständig in Grubennähe. Als meine Mutter, mehr geistesab als anwesend, etwas zur Ruhe kam, fragte sie: „Gerda, gibt es was Neues?“ „Nein, Marlies, sie graben noch, man hat noch Hoffnung, aber es sind schon drei Tage. Gib die Hoffnung nicht auf, Marlies. Sie werden ihn finden, da bin ich mir ganz sicher.“ „Ich glaube, das Baby kommt“, sagte Marlies zu Gerda, bevor der nächste Anfall kam und sie das Bewusstsein ganz verlor. (Diese Anfälle sind hirnorganischer Art und verursachen schwere Störungen des Bewusstseins bis hin zu Bewusstlosigkeit und Zitteranfällen. Das übliche Krankheitsbild bei einem Anfall sind Zittern, der Kranke liegt ohne Bewusstsein am Boden, da es ihn wie ein Blitz aus heiterem Himmel trifft, und Schaumbildung vor dem Mund.) „Mutter“, rief Gerda, „wir müssen ins Krankenhaus, das Baby kommt!“ „Ja, beeilen wir uns. Zum Glück ist das Krankenhaus in Bardenberg um die Ecke.“ Zur selben Zeit, nur einige hundert Meter entfernt, aber 860 Meter tief, stießen die Rettungsmannschaften auf die drei Verschütteten. „Schnell“, rief der Leiter der Rettungsaktion, „zwei leben! Benachrichtigt das Krankenhaus in Bardenberg. Wir kommen mit zwei Schwerverletzten.“ 22.9.1961, 20 Uhr, Krankenhaus Bardenberg, Hauptflur zum OP und Kreißsaalbereich Die beiden Verletzten wurden nacheinander über den hellgrüngekachelten Flur Richtung OP gefahren. Zeitgleich wurde Marlies über den gleichen Flur Richtung Kreissaal gefahren. Sie wurden aneinander vorbei geschoben. Der eine, während einer NotOP um sein Leben kämpfend, und seine Frau, mittlerweile mit hohem Blutverlust durch die beginnende Geburt um zwei Leben kämpfend, Richtung Kreißsaal. „Das Kind steckt im Geburtskanal, es kommt nicht“, sagte der Arzt zu Gerda und den anderen Angehörigen, die mittlerweile fast alle eingetroffen waren.
„Es sieht nicht gut aus, wir werden das Kind mit einer Zange holen (sogenannte Zangengeburt), es sieht gar nicht gut aus“. „Mit Frau Albers steht es noch schlechter“, sagte der Arzt. Sie hat viel Blut verloren und ist immer noch ohne Bewusstsein. Wir geben ihr keine große Chance. Rechnen Sie mit dem Schlimmsten, für beide.“ „Wir müssen versuchen, das Kind zu retten“, sagte Dr. Allhofs.
„Versuchen wir es mit der Zange am Kopf zu packen und rauszuziehen.“ Dann sofort auf die Kinderstation.
„Bluttransfusionen, Blut, wir brauchen mehr Blut für Frau Albers“. Nach 35 Minuten war ich auf „dieser“ Welt. Meine Mutter war mehr tot als lebendig. „Frau Kreutz“, sagte Dr.
Allhofs zu meiner Oma. „Das Kind lebt. Es hat gute Chancen zu überleben. Jedoch um Ihre Tochter steht es recht schlecht. Wir denken, sie schafft es nicht. Wir haben getan, was wir konnten. Der Rest liegt in Gottes Hand.“ So also lag meine Mutter im Sterbezimmer und kämpfte ums Überleben. Mein Vater lag auf der Intensivstation nach der gut verlaufenen NotOP und ich auf der Kinderstation, ebenfalls bei meinem Versuch zu überleben. Wer braucht so einen Start ins Leben? Das Leben?! beginnt. Nach zwei Wochen konnte mein Vater entlassen werden. Immer noch nicht ganz gesund, aber in der Lage, das Krankenhaus zu verlassen. Jedoch für immer mit Narben im Gesicht, auf der Stirn hauptsächlich, die merkwürdig blau verfärbt waren von der Kohle, die in die Wunden eingedrungen war. Sein Kumpel überlebte ebenfalls. Für den Dritten konnte man nichts tun, außer ihn zu bergen und ihn wieder unter die Erde zu bringen. Meine Mutter überlebte nach unzähligen Bluttransfusionen mehr schlecht als recht. Kurz nach meinem Vater konnte sie, zwar schwach, aber dennoch so weit genesen, das Krankenhaus verlassen. Ich „durfte“ erst mal bleiben ... Nach weiteren drei Wochen durfte ich nach Hause. Ein Zuhause, das in späteren Jahren zur unausweichlichen Hölle werden würde. Die Hölle auf Erden.
Oder war es in der Hölle nicht so schlimm? Später würde ich noch zweifeln, wo es besser ist. Mein Vater hatte inzwischen die Taufe und Weiteres organisiert. So bekam ich den Namen Jürgen und wurde getauft. Meine Mutter hatte ihr neues Spielzeug bekommen. Mich. Jetzt hatten fast alle Ruhe vor ihr und mit ihr. Die Anfälle wurden seltener, bis sie ganz ausblieben. Sie fing an, mich zu untersuchen und zu beobachten, ob ich auch gesund bin.
Ständig jedoch fand sie Symptome und Anzeichen aller möglichen Krankheiten in ihrem großen blauen Gesundheitsbuch, das sie sich extra hatte kommen lassen und das eigentlich mehr für Ärzte gedacht war. Immer wieder fand sie neue Anzeichen von Krankheiten bei mir.
Zumindest bildete sie es sich ein. Sie war ständig zu allen Leuten unterwegs, um zu berichten, wie schwer krank ich war. Dass ich kerngesund war, bekam keiner mit. Es handelt sich bei ihr um die im Jahr 1977 erkannte Geisteskrankheit „MünchhausenStellvertreterSyndrom“. Eine mittlerweile anerkannte Form der Kindesmisshandlung, bei der Mütter, um im Mittelpunkt zu stehen, ihren Kindern Krankheiten andichten. „Mutter“, sagte sie zu meiner Oma und Gerda immer wieder, „seht doch mal, Jürgen ist wieder krank.“
„Das glaube ich nicht, Marlies. Er hatte doch nichts und sieht ganz gesund aus.“ „Ja“, sagte Gerda, „er ist gesund“. „Ihr versteht mich nicht“, sagte sie daraufhin, „ich gehe mit ihm zum Arzt.“ Das tat sie auch über Jahre hinweg. Wieder und immer wieder. Immer neue Ärzte, Fachärzte. Wenn einer an ihren Worten zweifelte oder zu viele Nachfragen hatte, kam der nächste. Es gab einen Arzttourismus ohnegleichen. Von Arzt zu Arzt. Von Krankenhaus zu Krankenhaus. Sie war perfekt im Beschreiben von Krankheitssymptomen. Sie ist eine gute Rednerin und hat eine enorme Überzeugungskraft sowie eine hervorragende Rhetorik. Außerdem hatte sie Grundwissen aus ihrem großen blauen Gesundheitsbuch.
Alle glaubten ihr. Die arme Frau, die rührend um das Wohl ihres Kindes besorgt war. Ich bekam Medikamente, die ich gar nicht brauchte. Sie bekam Mitleid von allen Seiten und stand im Mittelpunkt. Sie, die arme Mutter. Der einzige, der hier arm dran war, war ich. Aber das sah keiner. Wie auch.
Wenn ich weinte oder schrie, führte man das auf meine diversen (nicht vorhandenen) Krankheiten zurück. So verging die Zeit, bis ich fast vier Jahre alt war. Ich glaube heute, dass kein Kind so viele Medikamentennamen und Ärzte kannte wie ich. Ständig landete ich im Krankenhaus Bardenberg, um untersucht zu werden. Ich wurde auf der Station abgegeben und meine Mutter ging. Sie ging einfach, ohne einen Blick zurück zu werfen. Ich verstand immer mehr und kannte es immer besser. „Du schaffst das schon“, sagte sie immer. Wenn sie alleine aus dem Krankenhaus zurückkam, wurde sie noch mehr bemitleidet, als sie es eh schon wurde. Genau in solch einer Kinderkrankenhausfreizeit (wie ich es nenne) lernte sie den damals so genannten Gastarbeiter Giovanni, einen Italiener, kennen, der ebenfalls in der Grube Gouley arbeitete. Mein Vater hatte sich bereits ein Stück von meiner Mutter entfernt. Auch durch das angefangene Bergwerksstudium, das ihn erst mal mehr interessierte als alles andere.
„Gerda“, sagte meine Mutter, „ich habe jemand ganz Tolles kennen gelernt. Er kommt aus Italien und sieht gut aus. Er ist immer da und ganz nett.“ „Wo ist Jürgen?“, fragte Gerda.
„Bei Mama. Ich hole ihn gleich, wenn ich Zeit habe.“
Meinem Opa Peter gefiel das gar nicht. Die Nachbarn fingen doch schon an zu reden und zu tuscheln. Er sprach ein Machtwort, das jedoch in der Luft verpuffte. Meine Mutter ging mit ihrer neuen „Bekanntschaft“ aus und woanders hin. Oder besser: woanders rein ... ins Bett. Sie wurde schwanger. „Gerda, Gerda, ich glaube, ich bin schwanger.“
„Wir müssen mit Mutter reden“, sagte Gerda. „Vielleicht weiß sie Rat. Bloß nichts dem Vater sagen.“ „Was, wenn Horst davon erfährt?“ „Das darf nicht sein“, sagte Gerda, „wir finden eine Lösung.“ „Mutter, Marlies ist schwanger, aber nicht von Horst.“ „Oh Gott“, sagte meine Oma. „Was, wenn die Leute das erfahren? Ich weiß eine Lösung: Das Ungeborene muss weg. Ich weiß eine Engelmacherin.“ (So wurden früher die Frauen genannt, die illegal Abtreibungen vornahmen.) Das Schlafzimmer meiner Eltern lag vor meinem Kinderzimmer, d. h. um in mein Zimmer zu gelangen, musste man durch das Schlafzimmer und umgekehrt. Meine Oma hatte im Handumdrehen eine Engelmacherin besorgt. Es musste schnell gehen. Der 4.
Monat war angebrochen. „Wir machen es bei dir zu Hause“, sagte meine Oma zu Marlies. „Gerda, du hilfst. Wir warten, bis Horst zur Arbeit ist, und dann machen wir es.“ „Und Jürgen?“, sagte Gerda. „Der muss eben in seinem Zimmer bleiben, so lange es dauert.“ „Jürgen, geh in dein Zimmer“, sagte meine Mutter mit zitternder Stimme zu mir, „und bleibe dort.“ „Komm nicht raus, bis wir dich rufen“, sagte Gerda. Der Klang ihrer Stimme machte mir Angst. Sie war hart und fest. Ich ging. Ich konnte nicht ahnen, dass das, was gleich folgen würde, Mutters Geisteszustand so beeinträchtigen würde, dass „meine Hölle“ begann und sie nicht nur ein ungeborenes Leben töten würde, sondern auch einen großen Teil von meinem gleich mit. 23.11.1965, 10 Uhr morgens Ich hörte laute Stimmen und Schreie.
Immer wieder, immer lauter. In meiner Angst und Unwissenheit tat ich, was ich besser gelassen hätte ... Ich öffnete die Tür. Meine Mutter lag auf dem Bett, die Beine weit geöffnet, wie ich von der Seite aus sehen konnte. Eine Frau kniete zwischen ihren Beinen. Meine Tante und meine Oma hielten meine Mutter an den Armen fest. Sie schrie wohl vor Schmerzen. Alles war voll Blut und „die Frau“ zog irgendwas aus ihr heraus. „Raus, raus, raus, geh in dein Zimmer“, schrie Gerda. Ich fuhr zusammen und sprang förmlich zurück in mein Zimmer. In das Zimmer, das für mich zum Gefängnis meiner Seele werden würde und an das ich jegliche Erinnerung verlieren sollte, bis zu meinem 38.
Lebensjahr. Aber dazu später. Mein Zimmer war nicht groß, acht Quadratmeter etwa. Ein Bett, ein Schrank und ein paar Spielsachen. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich dort auf meinem Bett in der Ecke gesessen habe, mit meinem Teddybären von Steiff, mit Knopf im Ohr. Der brummte, wenn man ihn vor und wieder zurück bewegte. Irgendwann kam Gerda und ich musste mit zu meiner Oma. Keiner sprach. „Wo ist Mama“, fragte ich. „Beim Arzt, sie kommt gleich.“ Nach zwei Tagen sah ich meine Mutter wieder. Im Schlafzimmer keine Spuren mehr von dem, was ich gesehen hatte und was geschehen war, von dem ich nicht wusste und begreifen konnte, was es war beziehungsweise was sich dort zugetragen hatte. „Du hast nichts gesehen von all dem“, sagte meine Oma immer wieder zu mir. „Warum, was war, wieso darf ich nichts sagen?“ „Weil nicht sein kann, was nicht sein darf“, sagte sie. „Es ist besser so. Hörst du? Jetzt frag nicht weiter.“ Meine Mutter sprach die nächsten Tage nicht mit mir. Ich musste früh ins Bett. Sonst blieben die Rollläden in meinem Zimmer immer ein Stück oben, damit von der Straßenlaterne ein wenig Licht in mein Zimmer kam. Jetzt wurden sie immer ganz geschlossen. Es war so dunkel. Ich konnte die Hand vor den Augen nicht sehen. „Können wir nicht ein wenig Licht hereinlassen?“, fragte ich meine Mutter. „Nein, können wir nicht.“ Sie gab mir, wie immer, irgendeinen Saft, wovon ich immer sofort ganz müde wurde. Dann legte sie mir meinen Bären in den Arm, nicht ohne ihn vorher brummen zu lassen, und dann ging sie und die Tür ging zu. Es wurde dunkel. Ich hörte durch die geschlossene Türe meinen Vater. Sie schrien sich an. Ich hatte ihn seit Tagen nicht gesehen. Aber diese Tür jemals wieder ohne Aufforderung zu öffnen, traute ich mich nicht. Nie wieder. Der Anfang vom Ende Eines Nachts wurde ich wach. Ich wusste nicht, was los war, und hatte Angst. Es war dunkel. Ich konnte nur ganz wenig durch die ein wenig geöffnete Kinderzimmertür sehen. Meine Mutter saß am Bettrand in der Mitte meines Bettes. Sie hatte keine Kleidung mehr an. Jetzt erst merkte ich, dass mein Schlafanzug weg war. Sie hatte ihn mir ausgezogen, während ich schlief. Ich hatte es nicht gemerkt. Ich traute mich nicht, etwas zu sagen oder zu fragen. Sie stöhnte ganz komisch und fummelte an mir rum. Ich hatte Angst und es ging mir nicht gut. Aber ich brachte kein Wort über meine Lippen. Ich weiß nicht, wie lange es dauerte. Mir tat alles weh und mein Herz klopfte. Dann stand sie auf und sagte: „Schlaf jetzt, sonst holt dich der Teufel. Und zu keinem ein Wort, sonst kommst du weg und nie wieder.“ Sie ließ den Teddybären wieder brummen und ging. Die Tür schloss sich und es war wieder dunkel. Ich war alleine und hatte Angst.
Im Dunkeln fand ich meinen Schlafanzug nicht mehr. Ich hatte Schmerzen und irgendwann schlief ich weinend ein.
Ich wusste nicht genau, was passiert war, aber ich hatte Angst und ein komisches Gefühl. Ich konnte damals nicht ahnen, dass es sich fast jede Nacht wiederholen würde.
Immer wieder das Gleiche. Mittlerweile konnte ich nicht mehr schlafen, weil ich voller Angst auf ihr Kommen wartete. Immer in der Hoffnung, sie kommt nicht. Aber sie betrat jede Nacht mein Zimmer und verging sich an mir. Ich blieb nun wach und hörte auf jedes Geräusch, in dem festen Glauben, wenn ich wach bleibe, passiert mir nichts. Welch dummer Trugschluss eines Kindes. Der gleiche Ablauf.
Absolute Dunkelheit. Da. Ein Geräusch, sie kommt. Die Tür geht auf. Ein wenig Licht fällt in das Zimmer herein. Sie hat nichts mehr an, zieht meinen Schlafanzug, mit Teddybären drauf, aus und fasst mich an. Es tut weh. Ich habe Angst, Panik. Sie stöhnt. Dann die gleichen Worte. „Wenn du was sagst, holt dich der Teufel und du kommst weg.“ Dann geht sie wieder, den brummenden Teddybären mir in den Arm legend. Der Grundstein für meine Angst im Dunkeln, Angst vor engen, kleinen Räumen und vor allem die Angst vor dem Einschlafen war gelegt. Einzementiert in meinem Kopf. Der Kampf um das Überleben hatten nun endgültig begonnen.
Ich sollte wie andere Kinder in den Kindergarten. Meine Mutter wollte das nicht. Sie kam seit über einem Jahr fast jede Nacht. Sie schleifte mich wieder von Arzt zu Arzt.
Diesmal sah ich auch sehr schlecht aus und hatte abgenommen. Ich bekam etwas gegen Schlafstörungen. Das half mir super, nämlich überhaupt nicht. Es gab immer mehr Streit. „Jürgen muss in den Kindergarten“, sagte Gerda eines Tages im Beisein meiner Oma aus Aachen, der Mutter meines Vaters. Der Streit wurde immer lauter und ich musste nach draußen. Meine Mutter nahm mich abends beiseite und versuchte mir zu erklären, dass ich, wenn mich jemand fragt, sagen muss, dass ich nicht in den Kindergarten gehen will und es mir nicht gut gehen würde.
Ich sagte, dass ich aber gerne mit anderen Kindern spielen würde, denn Freunde hatte ich ja fast keine. Das zu sagen, stellte sich sehr schnell als Fehler heraus. Viele Familien hatten früher sogenannte Kartoffelkisten im Keller.
Holzverschläge oder besser Kisten, oben offen, wo die Kartoffeln reinkamen, die man dann unten wieder herausholen konnte. Die Holzlatten hatten immer einen kleinen Abstand dazwischen. Die meisten hatten Einheitsgrößen. 1,5 Meter hoch, 1 Meter breit, 60 Zentimeter tief und immer gut gefüllt mit Kartoffeln. „Wenn du nicht das tust, was ich sage, kommst du morgen den ganzen Tag in die Kartoffelkiste.“ Das glaubte ich nun wirklich nicht. Warum auch. Ich hätte ihren Worten glauben sollen. Am nächsten Morgen sagte sie: „So, ab in die Kartoffelkiste, damit du weißt, was kommt, wenn du was sagst.“ Mich überkam Panik. Der Keller, der dunkle, kalte Keller. Ich hatte Angst. Angst, die für lange Zeit mein Begleiter werden sollte, mich jedoch auch vorsichtig und überlegt machte. Ich musste erst auf einen Stuhl steigen und von da aus dann in die Kiste. Ein Deckel mit Schloss sicherte die Kiste nach oben ab. Als ich drin war, schloss sie den Deckel und ging. Erst kurz bevor mein Vater von der Arbeit kam, holte sie mich, immer noch im Schlafanzug, wieder nach oben und ich musste dann sofort ins Bett. „Wo ist Jürgen?“, hörte ich meinen Vater fragen. „Im Bett, er ist krank, wie immer.“ „Was der Arme aber auch immer hat.“
Wie gerne wäre ich zu ihm gegangen und hätte alles erzählt.
Aber dazu hatte ich keinen Mut. Immer öfter blühte mir die Kartoffelkiste. Wenn jemand überraschend kam und nach mir fragte, hieß es, ich sei bei der Nachbarin. Einer älteren Frau, Josefine Breuer, der das Haus gehörte. Sie wohnte im Erdgeschoss und wir auf der ersten Etage. Sie war es auch, die mich in der Kartoffelkiste fand und meine Mutter zur Rede stellte. Die erklärte, mich schon den ganzen Tag gesucht zu haben, ich scheine wegen meiner diversen Krankheiten auch nicht mehr ganz richtig im Kopf zu sein.
Bestimmt hätte ich ihr lauter Lügengeschichten erzählt.
„Nein“, sagte sie. „Er sagt gar nichts. Ich möchte Ihren Mann sprechen, Frau Albers, wenn er zu Hause ist. Ich hoffe, wir haben uns verstanden.“ Jetzt, dachte ich, jetzt kannst du deinem Vater alles erzählen. Er wird dir helfen. Aber da hatte ich die Rechnung ohne meine Mutter gemacht! Als Frau Breuer weg war, holte sie unseren Teppichklopfer hoch in die Wohnung. Ein Stab, meist aus Bambus. Oben mit einem breiten Schild, um Teppiche auszuklopfen. Ich musste mich ausziehen. „Nur damit du weißt, was du sagst, wenn dein Vater gleich kommt. Du hast dich aus Versehen selber in die Kiste eingeschlossen und bist nicht mehr rausgekommen. Damit das klar ist.“ Dann schlug sie zu. Mit solch einer Wucht, dass ich fast das Bewusstsein verlor. Ich musste mich vorwärts über einen Stuhl beugen, damit sie besser zuschlagen konnte. Wie viele Schläge es waren, weiß ich nicht mehr. Ich brach irgendwann über dem Stuhl zusammen. Sie zog mich an und brachte mich ins Bett. Ich erwachte erst wieder am nächsten Tag. Wenigstens blieb mir ihr nächtlicher Besuch erspart. Oder hatte ich es nur nicht bemerkt? Ich konnte vor Schmerzen nicht laufen.
Sitzen konnte ich schon gar nicht. Zum Arzt durfte ich nicht.
Das war aber auch nicht nötig, denn wir hatten ja noch das große blaue Gesundheitsbuch ... Ich hatte nur noch eine Möglichkeit: Gerda. Als sie ihre Mutter besuchte, versuchte ich ihr zu sagen, was in meinem Kinderzimmer fast jede Nacht geschah. Ich schämte mich und hatte Angst. Ich versuchte es trotzdem. „Tante Gerda“, sagte ich, „mir tut da unten immer alles weh.“ Ich sagte ihr so gut es ging, was immer geschah. Verständnislos sah sie mich an. Dann schrie sie mich in einer mir unbekannten Lautstärke an: „Was redest du? Erzähle nicht so etwas. Sag so was nie wieder. Du lügst. Ich sage das deiner Mutter. Du bist ja nicht normal.
Geh. Geh bloß und halte den Mund. Was glaubst du, wenn Fremde deine Lügen hören. Sag nie, nie wieder so etwas.“
Ich erfuhr in späteren Jahren, dass alle aus der Familie es wussten oder zumindest ahnten. Aber keiner half. So hatten alle wenigstens Ruhe vor ihr. Von dem Tag an habe ich nie wieder jemandem versucht zu erzählen, was passiert. Zu groß war die Scham und die Angst vor meiner Mutter. Mein Leben bestand nun hauptsächlich darin, die Kartoffelkiste zu besuchen (wenn sonst niemand mehr im Haus war) oder die Wartezimmer aller Ärzte der Region. Nachts verging die Zeit (oder auch nicht) damit, darauf zu warten, dass die Kinderzimmertür aufging. Mittlerweile war ich in der Lage, immer so lange wach zu bleiben, bis es vorbei war. Egal wie lange es dauerte. Inzwischen war ich sechs Jahre alt und hatte in etwa drei Tagen, in Begleitung meiner Mutter, den Kindergarten besucht. Dann kam der Tag meiner Einschulung. Juli 1967 Grundschule St. Balbina Schule Würselen/Morsbach: Meine Klassenlehrerin, Frau Delhey, wurde von meiner Mutter wohl sofort über meinen ach so schlimmen Gesundheitszustand in Kenntnis gesetzt. Ich konnte sehen, während alle Kinder bei ihren Eltern standen und meine Mutter sich mit ihr unterhielt, dass sie immer wieder zu mir schauten und hektisch mit den Armen ruderten. Ich stand derweil abseits von allen (wie auch den größten Teil meines weiteren Lebens) und betrachtete stumm die Situation. Am nächsten Tag. Der erste Schultag.
Er sollte wegweisend für viele weitere Tage meiner Zukunft sein. Meine Mutter brachte mich zur Schule. Der Weg zu Fuß dauerte etwa 15 Minuten. An der Schule musste ich abseits von allen anderen warten, bis meine Mutter mit Frau Delhey gesprochen hatte. Wenn man das Gelände der Schule betrat, sah man geradeaus auf die große Kirche, die auf dem Schulhof lag. Auf der rechten Seite lag meine Schule, auf der linken Seite ein weiteres Gebäude. Der Schulhof war recht groß, mit Bänken und Bäumen besetzt, sowie dem kleinen Pfarrhaus. Meine Mutter kam wieder und brachte mich an den anderen Kindern vorbei ins Klassenzimmer. Dann ging sie nach draußen und wartete auf die erste Pause, damit ich meine Medikamente bekommen konnte. Sie setzte sich auf die Bank gegenüber meinemKlassenzimmer, sodass ich sie fast immer sehen konnte und die anderen Kinder natürlich auch. Man machte sich sofort über mich lustig, was aber nicht so tragisch war.
Ich war Schlimmeres gewohnt. In jeder Pause stand sie schon vor der Tür und nahm mich bei seite. Jedes Mal das gleiche. Irgendwelche Säfte oder Medikamente in Tablettenform. Dann saß ich mit ihr auf der Bank, bis die Pause vorüber war. Besonders geeignet, um Freunde zu finden, war das Ganze wohl nicht. Ich interessierte mich sehr für alles Neue. Meine Mutter war während der Stunden nicht mehr da. Jedoch regelmäßig zu den Pausen stand sie wieder mit ihren Medikamenten draußen an der Bank direkt unter einem Baum. In der Schule schlief ich immer öfter zwischendurch ein. Ich musste ja mit etwa drei Stunden Schlaf jede Nacht auskommen, da die nächtlichen Besuche nicht ausblieben. Was schlimmer wurde, waren ihre Drohungen, dass ich wohl den Rest meines Lebens in der Kartoffelkiste verbringen müsse oder, noch schlimmer, dass ich ganz wegkommen würde (was wohl das Bessere gewesen wäre). Mittlerweile hatte sie wohl Angst bekom men, ich könnte etwas von dem, was geschah, erzählen. Alle Kinder mieden mich, was auch kein Wunder war. So war ich immer mehr der Einzelgänger und Außenseiter. Wer wollte schon mit jemandem spielen, der so krank war. Frau Delhey verstand nicht, wieso ich immer müde war und einschlief.
Meine Mutter schob es auf die Wirkung der Medikamente, die ich wegen meiner Krankheiten nehmen musste. Sie wurde bedauert und gelobt zu gleich: wie sie sich rührend um ihren ach so kranken Sohn küm mert und das alles so gut meisterte. Nach ein paar Monaten fehlte ich immer öfter in der Schule, da wir von Arzt zu Arzt zogen. Ich bekam Schwierigkeiten, alles zu lernen. Ich schaffte es aber immer wieder, das Versäumte aufzuholen. So verging das erste Schuljahr. Jetzt musste ich den Gottesdienst in der Kirche mitbesuchen, da es wohl auf die Kommunion zuging. So kam ich doch das ein oder andere Mal alleine weg. Kontakt wollte keiner mit mir. Andere Kinder waren immer vor Beginn des Kommunionunterrichts da. Ich kam immer genau, wenn es losging. Was sollte ich auch da alleine rumstehen. Nach Ende des Unterrichts blieb ich einige Male etwas länger, was mir zu Hause Ärger einbrachte. Aber die Neugier und das In teresse, was andere so machten, waren einfach zu groß. Das hätte ich wohl besser gelassen. Anfangs rief man nur „Mut tersöhnchen“ und „du armer Kranker.“
Was soll's. Dann jedoch versperrte man mir zum ersten Mal den Weg nach Hause. „Na, Kleiner“, sagte der Junge vor mir.
„Heute ohne Mama?“ Ich sagte nichts. Nicht aus Angst, es war mir einfach egal. „Los: Sag bitte, bitte, dann lass ich dich vorbei.“ Ich dachte gar nicht daran. Alle um uns Herumstehenden lachten. „Na los, sonst bekommst du richtig Prügel.“ Auch das war mir egal. Ich konnte mich nicht beugen, etwas, das mich mein Leben lang begleiten und mir oft Schwierigkeiten einbringen sollte, aber mich immer davor bewahrt hatte, vor mir selber zu verlieren. („Denn biegst du einen starken Ast mit großer Hand, geht er zurück wenn der Druck genommen, aber er brechet nicht“) Es kam, was kommen musste. Ich bezog Prügel ohne Ende. Ich fiel immer wieder von vielen Schlägen zu Boden. Irgendetwas zwang mich jedoch immer wieder aufzustehen. „Sag bitte, bitte oder bleib liegen, du Idiot.“ Ich stand wieder und wieder auf. Irgendwann gingen sie einfach alle. Ich muss schlimm ausge sehen haben, denn als ich nach Hause kam, bekamen alle einen Riesenschreck und selbst Gerda und mein Vater waren für einen Arztbesuch. Gerda kannte einen guten Chirurgen, da sie selbst wohl öfter so aussah wie ich jetzt. Ihr erster Mann, Herr Strauch, trank wohl etwas viel und schlug sie öfter. Nach ein paar Tagen, die ich dann auch in der Schule fehlte, besuchten wir Freunde meiner Eltern.
Sie hatten auch Kinder, mit denen ich ausnahmsweise dann auch mal spielen konnte. Ihr Vater Gerd Shaper war Profiboxer. Leider bekam er Lungenkrebs und starb viel zu früh. „Jürgen, Jürgen, du musst noch viel lernen.“ Meine Eltern dachten, ich spiele im Garten. In Wirklichkeit brachte er mir die Grundbergriffe des Boxens bei. Alles Sachen, die mir später mal das Überleben sichern sollten. Zumindest zum Teil. Das große Fest der Kommunion kam. Mich interessierte das wenig. Ein paar Geschenke. Meine Oma Morsbach (die Mutter meiner Mutter, von mir so genannt, weil sie eben in WürselenMorsbach wohnte) räumte ihr Schlafzimmer aus für die Feier. Mir war das irgendwie alles egal. Nicht egal waren die Schläge, die ich bekommen hatte.
Am Kom munionstag ging es nachmittags noch mal in die Kirche. Da, da war er. Sein kleiner Bruder ging auch zur Kommunion. Ich stand vor der Kirche und wartete mit meinen Eltern. Er ging vorbei und grinste. Er grinste einfach nur. Ich ging einfach auf ihn zu. Er grinste immer noch. Alles ging mir auf einmal durch den Kopf. Die Schläge, das, was Gerd Shaper mir beigebracht hatte. Alles. Und ich schlug zu.
Mitten in den Ma gen. Er krümmte sich nach vorn, der Kopf kam näher und wie ich es gelernt hatte, schlug ich mit aller Kraft zu. Rechts, links, wieder rechts, links, auf die Rippen und wieder zurück. Und er fiel. Wie ich gefallen war. Nur sah er noch schlimmer aus als ich. Jetzt ging es mir besser.
Keiner wusste warum, da ich nie sagte, wer mich so zugerichtet hatte. Alle stürmten auf mich zu und nahmen mich zur Seite. Selbst der Herr Pfarrer verstand es nicht. „Er ist krank“, rief meine Mutter. „Er ist krank. Das muss an den Medikamenten liegen“, schrie sie immer wieder. Die Kirche war für mich erledigt und auf der Feier hatte man was zu diskutieren. Es war die erste Nacht, in der meine Mutter nicht kam. Ich lag wach, bis es hell wurde. Dann schlief ich ein. Nichts geschah. Ich konnte nicht ahnen, dass sie begriffen hatte, dass ich mich wehren konnte. Sie befürchtete wohl auch, dass ich mich mit Wor ten hätte wehren können. Meine Leistungen in der Schule waren trotz Fehlzeiten noch als „gut“ zu bezeichnen. Meine Tante Gerda hatte sich inzwischen von ihrem ersten Mann getrennt und sich neu verliebt. Herbert Schütt. So wie Gerd Shaper mir das Boxen beibrachte, brachte er mir das Reden bei. So, wie er reden konnte, hätte er Politiker werden sollen. Er brachte mir bei, auf die Betonung zu achten und dass die Bewegungen des Körpers zu den Worten passen mussten, verschiedene andere Sachen zusammenpassten mussten und dass es nicht nur alleine auf die Sprache an sich ankam.
Es sollte mir später mehr als nützlich sein. Sie kam nie wieder nachts in mein Zimmer. Schlafen konnte ich trotzdem nie wieder. Vor 4 Uhr morgens war ich nicht in der Lage, Schlaf zu finden. Bis sich dies ändern würde, sollten wohl 35 Jahre vergehen. Auch wusste ich schon gar nicht mehr, wie es sich anfühlte, ein mal in den Arm genommen zu werden. Mein Vater war kühl und reserviert wie der Rest der Familie. Bei meiner Mutter war ich froh, dass sie es nicht tat. So wurde auch ich immer kälter und reservierter. Eiszeit für Kinderseelen. Sommer 1967 Mein Vater rief mich und meine Mutter ins Wohnzimmer. Er war an dem Tag früher zu Hause als sonst. In der Regel sah ich ihn gar nicht oder nur selten. Zu sehr war er mit seiner Arbeit beschäftigt und wohl auch froh, nicht da sein zu müssen. „Ich habe die Stelle an der Grube Emil Mayrisch in Siersdorf bekommen. Wir können dort über den Eschweiler Bergwerksver ein auch ein Haus günstig kaufen. Wir ziehen also in circa acht bis zehn Monaten hier weg nach Siersdorf.“ Meine Mutter fing an zu zittern und weinte. „Nein, nein, ich gehe hier nicht weg.
Meine Familie ist hier! Dort kenne ich keinen.“ Mein Vater hatte die Sache längst beschlossen. Ich hörte sie die nächste Zeit immer öfter streiten, meine Mutter weinen und es kam immer mehr Panik auf, je mehr es auf den Umzugstermin zuging. Dass das Leben durch den Umzug für mich zum endgültigen Schrecken werden sollte, wie sollte ich es wissen? Ich konnte auch nicht wissen, dass ich von dem neuen Zuhau se nicht viel haben würde. Kurz vor dem Umzug fuhren wir nach Siersdorf. Ein 3.000SeelenDorf bei Jülich. Aber mit Grund und Hauptschule und einem Schwimmbad. Das weiß gestrichene Eckhaus in der Altenbiesenstraße 1 machte einen freundlichen Eindruck. In der ersten Etage – zwei und ein Dachgeschoss waren vorhanden – bekam ich mein neues Kinder zimmer. Mein Herzschlag wurde schneller und die Hoffnung auf das endgültige Vergessen wurde immer größer. Am Tag des Umzuges wurde meine Mutter von endlosen Wein krämpfen geschüttelt. Das muss der Tag gewesen sein, als ihr rest licher Verstand wohl ganz verloren ging. Zu groß war wohl der Schmerz des Umzugs und die damit verbundene, zumindest von der Entfernung her, weitere Trennung von Gerda und ihren Eltern. Sie hatte Heimweh. Ein Wort, das für mich bald an Bedeutung verlieren sollte. Außerdem wuchsen auch ihre Befürchtungen, ich könnte immer noch etwas erzählen. Auch ahnte ich nicht, dass ich bald jegliche Erinnerung an das Geschehene und das Kinderzimmer verlieren sollte. Vorüber gehend. Ich versteckte die ganze Erinnerung in der hintersten Ecke meines Gedächtnisses.
Dass sie da nur abgelegt war und im Dunkeln nur vor sich hinschlummerte und wuchs, weil ich alles nur verdrängte, war mir nicht klar. Aber es sollte wieder aus dem Unterbewusstsein hochkommen und mein Leben so beeinflussen wie nichts zuvor. Meine Arztbesuche hatten nicht auf gehört, aber sie waren weni ger geworden. Jetzt, wohl durch den Umzug und die Folgen, ging es erst richtig los. Wieder von Arzt zu Arzt und von Krankenhaus zu Krankenhaus. In der Grundschule wurde ich angemeldet.
Natürlich nicht ohne den Hinweis auf meine diversen Krankheiten. Meine Freude über alles Neue wurde schnell durch die Pausenbesuche meiner Mutter zum Medikamente einnehmen gebremst. Ich saß in meiner neuen Klasse als Einziger auf der letzten Bank. Alleine, wie immer. Man hatte wohl beschlossen, mich zu ignorieren, da auch in den Pausen niemand etwas mit mir zu tun haben wollte. Meine Mutter kam mit den Tabletten und diversen Säften und ging dann wieder. Sie, die arme Frau, die sich rührend um ihr krankes Kind kümmerte, wurde wieder bedauert, stand im Mittelpunkt und wurde beachtet. Immer mehr fehlte ich im Unterricht, da die Arztbesuche immer länger und aufwendiger wurden. Als ich mich von einer – meiner Meinung nach normalen – Grippe wieder erholt hatte, zogen wir von einem HalsNasenOhrenArzt zum nächsten. Endlich fand sie dann wohl den „richtigen“, der ihr bestätigte, dass ich eine chronische Kieferhöhlenvereiterung hatte und man mich wohl besser operieren sollte. Das war dann ihr endgültiger Durchbruch des Bemitleidetwerdens: Das arme Kind wird ope riert. Die Sensation. Für mich sollte es ein tragisches und unvergessliches Erlebnis werden. So sollte ich im Alter von mittlerweile neuneinhalb Jah ren operiert werden. Frühjahr 1971. Kreiskrankenhaus Jülich, 2. Etage. Morgens 10 Uhr Krankenhäuser kannte ich ja. Sie machten mir keine große Angst mehr. Sie bereiteten mir nur noch Unbehagen. Das sollte sich bald ändern. „Das ist mein Sohn“, sagte meine Mutter zur Stationsschwester. „Er bleibt hier für eine Operation.“ Dann ging sie. Ich machte mir keine großen Gedanken. Sie muss te wohl einige neue Bekannte treffen, um sich noch etwas bedauern zu lassen. Ich war allein in dem großen Zimmer mit den hohen Decken, wo wohl mindesten 4 Leute mehr reingepasst hätten. Ich durfte ab 18 Uhr nichts mehr essen oder trinken. Ich stand an einem der riesigen Fenster und sah nach draußen. „Schlaf etwas“, sagte die Nachtschwester. „Ich gebe dir etwas zum Schlafen.“ Durch das Verdrängen von Teilen meiner Kindheit konnte ich ja sowieso nicht schlafen. Warum? Da dachte ich nicht mehr drüber nach. Es war eben so. Ein seltsames Gefühl der Angst beschlich mich. So verbrachte ich die ganze Nacht. Mit dem seltsamen Gefühl und mit mir alleine sah ich aus dem Fenster. So gegen sechs kam eine Schwester ins Zimmer und sagte: „Wun derschönen guten Morgen. Ich habe hier eine Tablette für dich. Bitte einnehmen.“ Irgendeine große, blaue Tablette. Ich nahm sie. „Leg dich lieber hin, junger Mann“, sagte sie. „Du wirst etwas müde davon.“ Ich saß am Bettrand und wurde immer müder. Ich legte mich hin und schlief ein. Plötzlich war ich wach. Hellwach. Ich hatte Angst und Panik und wollte weg.
Es ging nicht. Mein Verstand hellwach, aber ich konnte gerade mal ein Auge aufhalten. Ich wollte aufstehen. Weg.
Nur weg. Der Gedanke an Flucht wurde übermächtig. Aber ich konnte nichts tun. Gar nichts. Ausgeliefert. 7.30 Uhr. Ich wurde mit dem Bett durch mehrere Flure gefahren. Dann musste ich auf ein anderes Bett oder besser gesagt auf den OPTisch. Dieser Tag sollte sich in meinen Kopf einbrennen.
Ich be kam eine Spritze. Jemand sagte: „Keine Angst. Wird schon nicht so schlimm.“ Dann war ich weg. Wie lange, weiß ich nicht. Auf einmal hörte ich Stimmen aus der Ferne, die immer lauter wurden. Meine Augen, meine Augen, wieso kann ich meine Augen nicht öffnen? Was ist los? Diese Schmerzen. Unerträgliche Schmerzen. Will schreien.
Weglaufen. Nichts geht. Wieso tut niemand was. Es tut so weh. Schläge. Schläge, als wenn ein Hammer auf einen Mei ßel trifft. Hierzu muss man wissen, dass seinerzeit bei solchen Operatio nen der Oberkiefer aufgemeißelt wurde.
Aufhören, schrie ich in Gedanken. Stopp! Diese Schmerzen.
Eine Ewigkeit. „Ich glaube, er ist wach“, hörte ich jemanden sagen. „Nachset zen, schnell!“ Dann hörte ich die Stimmen nur noch von Weitem. Die Schmer zen wurden weniger.
Dann versank alles in Dunkelheit. Nachher würde sich herausstellen, dass ich während der 2Stun denOP fast 5 Minuten bei Bewusstsein war. Diese Gefühle der Angst und Panik sollten mich die nächsten 30 Jahre begleiten. Als ich gegen 16 Uhr aufwachte, war sie da. Die Panik, die Angst.
„Alles vorbei“, sagte jemand. „Hast du Schmerzen?“ Die Schwes ter gab mir ein Schmerzmittel. Die Tür ging auf. Der Arzt vom OPTeam kam herein. „Na“, sagte er. „Da ist er ja wieder. Du hast uns ganz nett erschreckt.“ Wieso, konnte ich mir ja denken. Dann ging er wieder vor die Tür, wo meine Mutter wartete. Ich konnte jedes Wort verstehen: „Wer hat Ihren Sohn mit der Diagno se hier eingeliefert? Die OP wäre nicht nötig gewesen. Wir haben uns auf Dr. Brend und auf seine Diagnose verlassen. Auch laut Ihren Aussagen war er immer krank und hatte ständig Schnupfen. Wir haben es zu spät gemerkt. Die OP war völlig überflüssig.“ Seine Stimme war mittlerweile laut geworden und überschlug sich fast.
„Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, Frau Albers. Der Junge tut mir leid.“ Nach fünf Tagen allein auf dem Zimmer wurde ich entlassen. Endlich nach Hause, dachte ich. So weit stimmte das auch. Aber nicht für lange, sollte ich doch von zu Hause, oder von dem, was ich dafür hielt, schneller wegkommen, als ich für möglich hielt. Nach zwei Wochen holte mich meine Mutter aus dem Unterricht ab. In der Zwischenzeit hatte ich von der Grund auf die Haupt schule gewechselt, da es mir immer gelang, Versäumtes aufzuholen und ich mit dem Lernen und Begreifen schnell nachkam. „Jürgen, kommst du bitte mal“, sagte unser Schuldirektor. Ich sah meine Mutter neben ihm stehen. Ich dachte und fühlte, dass jetzt nichts Gutes kam. Ich sollte Recht behalten. Und wie. Mein Vater wartete im Auto vor der Schule. „Wo fahren wir hin?“, fragte ich ihn aufgeregt.
„Wir müssen nach Köln“, sagte meine Mutter. „Du musst für ein paar Tage ins Krankenhaus zur Beobachtung.“ Ich sagte nichts. Keine Fragen, keine Gedanken. Nur noch Lee re im Kopf. Spätsommer 1971 UniKlinik KölnLindenthal, Pestalozzi Station für schwererzieh bare Kinder und Jugendliche sowie Kinder und Jugendpsychiatrie. Diese „Fachabteilung“ hatte den Charakter eines Internats. Ärzt liche Betreuung zum einen, Schulunterricht und Erziehung zum anderen. (zu Pestalozzi siehe Seite 31) Wir fuhren über das Gelände der UniKlinik. Fast jede Fachab teilung hatte ein eigenes Gebäude. Die Pestalozzi Station war ein Flachbau in TForm.
Entfernt von den anderen Gebäuden. Wir hielten und stiegen aus. Mich beschlich ein ungutes Gefühl. Die Tür war verschlossen. Von innen kam eine Ordensschwester und öffnete. Meine Eltern gingen in ein Zimmer, um mit einem Erzieher zu reden. Ich bekam ein kleines, etwa zehn Quadratme ter großes Zimmer gezeigt, das für die nächsten neun Monate mein Zuhause oder, treffender ausgedrückt, die Hölle auf Erden sein würde. Das Zimmer war ganz in Weiß mit zwei „Krankenhausbetten“. Die Tür ging auf und meine Mutter kam rein. „Wo ist mein Vater?“ Schon damals konnte ich meine Eltern nicht mehr Mama oder Papa nennen. Das sollte sich auch nie wieder ändern. Ich weiß nicht, wann ich aufgehört habe, sie so zu nennen, oder aus welchem Anlass. Ich brachte diese Worte nie wieder über meine Lippen. „Er ist schon zum Auto. Wir müssen nach Hause. Du weißt ja, du musst für ein paar Tage hier bleiben zur Beobachtung.“ „Wa rum? Was habe ich jetzt schon wieder?“ „Es ist nur zu deinem Besten. Glaube mir. Ich habe alles immer nur zu deinem Besten getan. Du warst immer die Nr. 1 für mich.“ Dann drehte sie sich um und ging. Ich stand regungslos in dem Zimmer. Draußen startete ein Auto. Ich bekam Panik, mein Herz raste, ich lief hinter ihr her bis zur Tür. Ich zog an dem Griff. Zu. Verschlossen. Ich konnte nicht raus. Hinter mir sagte eine männliche Stimme: „So, das war es dann.“ Ich drehte mich langsam um und vor mir stand ein Mann, Mitte 40 vielleicht, nicht sehr groß, aber kräftig. Seines Zeichens Dipl.Psychologe. „Geh auf dein Zimmer und bleib da. Gleich wird dir jemand die Hausregeln bringen, die du bis morgen früh auswendig kannst. Hast du das verstanden?“, schrie er mich jetzt an. Ich konnte nichts sagen und er hob die Hand und schlug zu. Mitten ins Gesicht. Die Wucht des Schlages ließ mich nach hin ten mit dem Kopf an die Tür schlagen. Das Blut lief mir das Kinn hinunter und tropfte auf mein TShirt. Schwester Ursula vom hiesigen Kloster, die uns die Tür geöffnet hatte, kam aus einem der hinteren Zimmer. „Nun mal langsam. Dafür ist immer noch Zeit.“ Es gab zwölf Zimmer mit jeweils zwei Betten, einen großen Gemeinschaftsraum und ein Arztzimmer. Im anderen Trakt des T waren die Schulräume.
In dem weite ren die Zimmer des weiteren Personals, das aus Ordensschwestern und Erziehern bestand. Normale Krankenschwestern gab es nur zwei im Tagesdienst.
Nachdem ich es schaffte aufzustehen und der werte Herr Erzie her gegangen war, zeigte mir Schwester Ursula – sie war eine gro ße, fast hagere Frau mit grauen Haaren – die Schulräume für den nächsten Tag. Sie hatte eine angenehme Stimme. Das war, wie ich bald erfuhr, das Einzige, was angenehm war. Jetzt hatte ich fast alles gesehen außer den noch vorhandenen Kellerräumen, in denen sich Sachen zutrugen und zutragen soll ten, die an Grausamkeit und Unmenschlichkeit kaum zu über treffen waren. Die Pestalozzi Station ist zu einem späteren Zeitpunkt geschlos sen worden, nachdem dort schwerste Misshandlungen an den Pa tienten, Kindern und Jugendlichen, festgestellt worden sind. Für mich zu spät, viel zu spät. Sie wurde nie wieder geöffnet und über die Gründe der Schließung wurde eisern geschwiegen. Meine erste Nacht blieb ich wach, bis es hell wurde. Zu groß waren meine Angst und mein Unbehagen. Ich wusste nicht warum, aber das alles hier konnte nichts Gutes verheißen. Auf jedes Geräusch lauschend, lag ich auf meinem Bett. Unbequem.
Ein altes Krankenhausbett eben. Der Nachttisch war passend zum Bett, ebenfalls aus altem Krankenhausbestand. Die Fenster waren fest geschlossen.
Die Tür vom Zimmer auch? Noch war zu viel Lärm auf dem Flur, aber ich würde es gleich wissen. Essen gab es keins mehr. Ich hatte Bauchschmerzen vor Hunger. Ein Glas Wasser auf dem Nachttisch war alles, was da war. Ich hatte auch nichts mit, keine Erinnerungen in irgendeiner Form.
Außer Anziehsachen hatte ich nichts mit. Wie lange ich wohl hier bleiben musste? Wann kamen meine Eltern wieder? Fragen, Fragen nur Fragen. Keine Antworten. Ich kam mir so verlassen vor, als wäre ich am Ende der Welt. Vielleicht war ich da ja auch. Nach einiger Zeit stand ich auf und öffnete die Tür zum Flur. Sie ging tatsächlich auf. Damit hatte ich nicht gerechnet. Vorsichtig sah ich den Flur auf und ab.
Keiner da. Also dann mal sehen, ob ich noch was zu essen finde. Langsam ging ich durch den halbdunklen Flur Richtung „Büro für Personal“, wie auf dem Schild stand. Kei ner da. Aber ein Kühlschrank. Ich machte ihn auf und sah hinein. Alles da. Auf einem Teller daneben Brot. Ich machte mir zwei Riesenbrote. Als ich fertig war und umdre hen wollte, um zurück in mein Zimmer zu kommen, lief ich direkt dem nächsten Erzieher in die Arme. „Was glaubst du denn, wo du hier bist?“, schrie er und schlug mir mit der linken Hand den Teller aus der Hand und mit der Rechten mir mitten ins Gesicht. Halb bewusstlos fiel ich zu Boden, sah ihn an und sagte: „Das wird je mand merken.“ „Wer denn?“, lachte er. „Erst mal ist für Neue hier drei Monate Besuchsverbot. Aber du denkst, du kannst machen was du willst? Dann warte mal ab.“ Er packte mich an den Beinen und zog mich hinter sich her bis zum Zimmer der Erzieher.
Hier lernte ich den Schlafstrafraum kennen. Ein dunkel gestriche nes Büro mit alten Büromöbeln aus Holz. Mitten drin ein Metall bett. „Du glaubst, nicht in deinem Bett liegen zu müssen?“, sagte er grinsend. „Gut, dann bleibst du hier.“
Ich sollte meine Kleider ausziehen, die eh nur noch aus einem Schlafanzug der Station bestanden. „Nein“, sagte ich. „Warum?“ „Du hast hier nicht zu fragen, nur zu gehorchen.“ Mit verschränkten Armen stand ich vor ihm. Den Schlag und die darauffolgenden Tritte sah ich nicht kommen. Das war wohl nicht sein erstes Mal und er verstand sein Hand werk. Ohne nachdenken zu können, verlor ich das Bewusstsein. Als ich wieder zu mir kam, lag ich ohne Sachen auf dem Bett. An einer Decke fehlte es auch. Meine Hände waren an die Gitterstäbe gefesselt, ebenso meine Füße. Alles tat mir weh.
Am Ende des Bettes stand mein Peiniger, immer noch mit einem Grinsen im Gesicht. „Du brauchst gar nicht zu schreien. Es wird dich keiner hören. Bist ja ganz nett. Da werden ja alle viel Spaß mit dir haben.“ Dann ging er, machte das Licht aus und schloss die Tür. Dunkel, absolute Dunkelheit. Wenn ich meine Hände hätte be wegen können, hätte ich sie vor den Augen nicht sehen können. Ich hörte mein Herz wie wild schlagen, das Blut rauschte in meinen Ohren. Das einzige was ich hören konnte, war das Knurren und Blubbern meines Magens. Da, jemand schrie auf.
Woher kam das? Was passierte? Keine Johann Heinrich Pestalozzi (* 12. Januar 1746 in Zürich; † 17. Februar 1827 in Brugg, Kanton Aargau) war ein Schweizer Pädagoge.
Außerdem machte er sich als Philanthrop, Schul und Sozialreformer, Philosoph sowie Politiker einen Namen.
Sein Ziel war es, „den Menschen zu stärken“ und ihn dazu zu bewegen, „sich selbst helfen zu können“. Besonderes Augenmerk richtete er auf die Elementarbildung der Kinder, welche schon vor der Schule in der Familie beginnen sollte.
Dabei kam es ihm darauf an, die intellektuellen, sittlichreligiösen und handwerklichen Kräfte der Kinder allseitig und harmonisch zu fördern. Heute würde man sagen, Pestalozzi vertrat einen ganzheitlichen Ansatz. Seine pädagogischen Ideen, die er 1801 in seinem Buch „Wie Gertrud ihre Kinder lehrt“ erstmals systematisch darlegte, setzte er ansatzweise schon in seiner frühen Armenanstalt auf dem Neuhof (1774–1780) um, spezifischer dann im Waisenhaus in Stans (1799) und systematisch in seinen Instituten in Burgdorf (1800–1804) und Yverdon/Iferten (1804–1825). Antworten. Nur Dunkelheit. So lag ich ohne Sachen auf dem Bett und versuchte jedes Geräusch zu orten. Aber nichts mehr. Was hatte er wohl damit gemeint: den anderen zu gefallen? Ich sollte es schneller herausfinden, als mir lieb war. Am nächsten Morgen, ich war vor Erschöpfung irgendwann in den Morgenstunden mal kurz eingeschlafen, um jedoch alle paar Sekunden wieder aufzuwachen, ging die Tür auf. Schwester Ursu la stand im Türrahmen. Was kam jetzt?, dachte ich. „Na, schon Bekanntschaft mit unserem Sonderzimmer gemacht?“, fragte sie. „Es bindet dich gleich jemand los, dann geh auf dein Zimmer und zieh dich an. Es gibt gleich Frühstück.“ Eine „normale“ Schwester betrat das Zimmer und band mich los.
Ich wollte mich anziehen, doch sie nahm den Schlafanzug und ging mit den Worten: „Das gehört mit zur Strafe. Du musst ohne Sachen auf dein Zimmer.“ Ich sah vorsichtig um die Ecke den Flur entlang. Jede Menge Kinder. Jungen und Mädchen. Auch das noch. Und jetzt? Es half nichts. Aus dem Zimmer und den Flur entlang. Ohne Sachen. Aber ich schaute nicht zu Boden wie alle die, die an mir vorbeiliefen.
Ich sah geradeaus und hatte den Kopf erhoben. Mein Herz schlug bis zum Hals herauf. Als ich mein Zimmer erreichte, zog ich mich an und ging zum Essensraum. Dort hatten wir alle zwei Minuten nach Ertönen des Gongs zu sein. Wer zu spät kam, für den gab es nichts mehr. Eine UForm aus Tischen. Jedes Kind hatte, das fiel sofort auf, einen großen Becher mit Tabletten vor sich stehen. Zwei Erzieher wachten darüber, dass alles genau eingenommen wurde.
Einer der Mitschüler weigerte sich, sie einzunehmen. Sofort packte ein Er zieher ihn im Genick und schlug seine Stirn auf die Tischplatte. So also funktionierte das hier. Keiner sprach.
Alle aßen schwei gend weiter. Der Schulbesuch war nicht besonders geistreich gestaltet. Vorle sen, ein paar Rechenaufgaben, Ende. Schule war von 8.15 Uhr bis 13.30
Uhr. Um 14 Uhr Mittagessen, irgendwas, das aussah wie grüner Brei. Ohne Geschmack. Trockenes Brot. Ende. Zu trinken gab es Milch. Abendessen war um sechs. Für jeden zwei Scheiben Brot mit etwas Käse. Wieder Milch, das war alles. So vergingen einige Tage. Man redete kaum. Andere Kinder redeten später mit mir, wenn kein Erzieher in der Nähe war. Arno, mein Zimmernachbar in dem Zimmer links neben mir, ein Junge in meinem Alter mit dunklen Locken, sagte: „Mach bloß alles, was sie wollen. Du hast keine Wahl.
Und pass vor dem Keller auf. Das ist neben dem Tod das Schlimmste hier. Ich war schon zweimal im Keller“, sagte er und fing an zu weinen. „Was heißt neben dem Tod?“, fragte ich ihn. Er erklärte es mir. „Es wird eine geheime Versammlung abgehalten“, sagte er. „Alle von uns werden in den Essensraum gerufen. Nur nicht der, um den es sich handelt, der bestraft werden soll. Dann wird der Name von dem gesagt, den es trifft. Wenn man zu viel fragt oder Ärger macht, ist man fällig.“ Er sprach immer leiser, flüsterte fast.
„Alle anderen müssen dann eine ganze Woche so tun, als gäbe es dich nicht. Keiner darf mit dir reden, keiner dich ansehen. Du musst dir Essen selber vom Wagen nehmen.
Keiner tut was für dich. Du bist wie ein Geist. Tot eben. Nicht mehr da. Jeder, der sich nicht daran hält, ist der nächste.
Mich hat es auch schon getroffen. Nur weil ich gefragt hatte, wann ich mal nach Hause darf.“ „Wie lange bist du schon hier?“, fragte ich. „Fast drei Monate“, sagte er. „Es ist furchtbar und macht mir Angst“. „Was ist denn mit dem Keller? Kannst du was sagen?“ Er weinte fürchterlich und brachte kein Wort heraus. Ich sollte es bald selber herausfinden. Ich hatte nur einen Gedanken. Weg! Aber das konnte ich wohl vergessen. Eines Nachts, alle schliefen, nur ich nicht, da wir noch nicht 4 Uhr hatten und an meinem Nichtschlafen sich nichts ge ändert hatte. Plötzlich ging ganz langsam die Tür des Zimmers auf, in dem ich wohnte.
Mittlerweile hatte ich einen Mitbewohner bekommen.
Einen dün nen, blassen, fast schneeweiß aussehenden Jungen mit hellblonden Haaren wie ich. Er war wohl ein Jahr jünger. Der Pfarrer kam herein und ich versuchte den Eindruck zu ma chen, als würde ich schlafen. Mit ganz leicht geöffneten Augen beobachtete ich ihn. Mit mehr zusammengekniffenen als offenen. Er ging rüber zu Klaus.
Er zog sich aus und legte sich zu ihm ins Bett. Jetzt begriff ich, was gemeint war mit „gefallen“. Regungslos, unfähig mich zu bewegen, lag ich in meinem Bett. Nur einen Gedanken im Kopf: Wann bist du dran? Wann? Das durfte nicht sein. Ich hörte einen leisen Schrei, dann ein Stöhnen.
Worte des Pfar rers, die ich nicht verstehen konnte. Es muss eine Ewigkeit gewesen sein. Zumindest kam es mir so vor.
Dann verließ er das Zimmer. Im Vorbeigehen blieb er kurz an meinem Bett stehen und sagte: „Ich weiß, dass du nicht schläfst. Hat das Zusehen Spaß gemacht?“ In dem Moment dachte ich, mein Blut wäre in meinen Adern gefroren, und ich atmete noch nicht mal mehr, bis er weg war. Klaus lag weinend und zitternd ohne Schlafanzug in seinem Bett. Ich versuchte mit ihm zu reden. Es ging nicht. Am nächsten Morgen versuchte ich mit dem Mädchen aus dem Nachbarzimmer zu reden. Über das, was geschehen ist. Ich wusste mir sonst nicht zu helfen. Ich musste mit jemandem reden. Meine Angst wurde immer größer. Sie war schon 13 und hieß Claudia. Seit drei Jahren war sie schon hier. „Ja“, sagte sie, „sie kommen jede Nacht. Die Erzieher, der Pfarrer, alle. Manchmal bringen sie Freunde von außen mit. Das ist besonders schlimm. Hüte dich vor dem Keller. Wenn wir was sagen, geben sie uns eine Spritze und wir sind tot, sagen sie. Außerdem würde uns sowieso keiner glauben, wir sind ja alle nicht umsonst hier.“ Dann ging sie, aus Angst, beim Reden erwischt zu werden. Einige Tage später musste ich beim Abräumen helfen. Mir fiel ein Glas runter. Sofort war einer der Erzieher zur Stelle und schrie mich an. „Du bist wohl zu blöde für alles, was? Na warte, dir bringen wir Benehmen bei. Los, ab in den Keller. Jetzt sofort. Vorher zeige ich dir noch, was passiert, wenn man hier nicht gehorcht.“ In einem der hinteren Zimmer war ein Raum mit Hamstern und Meerschweinchen sowie einem weißen Hasen. Das sollte wohl zu Therapiezwecken dienen. Damit hatte ich Recht, nur nicht mit der Form der Therapie. Er holte eines der Meerschweinchen heraus, zeigte es mir und fragte: „Willst du es mal streicheln?“ Er lachte. Dann holte er aus und warf das Meerschweinchen mit aller Wucht vor die Wand. Zweimal, dreimal, bis es platzte. Alles war voller Blut und Innereien. Ich war wie erstarrt. Dann sah er zu mir und sagte: „Und willst du es immer noch streicheln? Das passiert, wenn du nicht hörst. Jedes Mal mache ich eins kaputt.“ Was jetzt passierte, war merkwürdig. Ich wurde ruhig, ganz ruhig und immer ruhiger. Keinerlei Angst, nur Ruhe. Ein Umstand der bleiben sollte, sodass ich, je mehr Stress es gab und je gefährlicher es für mich werden sollte, immer ruhiger und überlegter wurde. Wieso? Ich habe keine Ahnung. Der Keller Es ging einige Stufen runter in den Keller. Was würde mich erwar ten? Unten angekommen, standen wir vor einer grauen Eisentür. An einem Schlüsselbund waren zwei Spezialschlüssel, mit denen er die Tür aufschloss. Dahinter lag ein langer Gang mit weiteren Eisentü ren rechts und links. Eine der Türen stand offen und ich musste hinein gehen. Keine Ahnung, was jetzt passiert.
Die Tür fiel mit einem dumpfen Knall ins Schloss. Es war stockdunkel. Man sah die Hand nicht vor Augen. Nach ewiger Zeit, jedenfalls kam es mir so vor, ging die Tür wieder auf. Ich bekam etwas zu essen und musste ein paar Tabletten schlucken. Ich wurde müde. Konnte mich nicht mehr bewegen, etwas wie Blei in meinen Gliedern, so kam es mir vor, aber ich bekam alles mit. Ich konnte alles sehen und hören. Leider. Viele Leute waren in dem Kellerraum. Es war ein großer Raum, fast wie ein Wohnzimmer eingerichtet. Er sah nach allem aus, aber nicht nach einem Kellerraum. Ich konnte durch einen Spalt der nächsten Tür in einen weiteren Raum sehen. Komische Instrumente hingen dort an der Wand und Ketten von der Decke herab.
Ich sah mich um, soweit es ging. Claudia, da lag Claudia auf dem Boden. Ich wurde ausgezogen und neben sie gelegt.
Dann ging es los. Eine Filmkamera stand dort. Einige Leute, ich weiß nicht mehr wie viele, machten Fotos. Immer wieder Blitzlicht. Immer mehr Fotos. Dann beschäftigte sich der Herr Pfarrer und einige andere Männer mit Claudia. Ich konnte alles sehen, was geschah. Sie tat nichts. Regungslos lag sie auf dem Rücken und sah zu mir rüber. Tränen liefen über ihr Gesicht. Einige Frauen und Männer kamen auf mich zu. Sie fassten mich an. Der Mann mit der Filmkamera kam näher. Jetzt raste mein Herz. Aber ich war ruhig. Ich nahm all meine Kraft zusammen und versuchte aufzustehen. Mit einem Aufschrei gelang es mir und ich versuchte loszurennen. Ohne Orientierung rannte ich vor den Türrahmen und brach bewusstlos mit einer riesigen Kopfwunde zusammen. Als ich aufwachte, lag ich in meinem Bett und es war Mittag. Was war geschehen? Ich versuchte aufzustehen, als ich merkte, dass ich mit Lederriemen an das Bett gefesselt war. Ich fing an zu schreien und wollte nie mehr aufhören. Schwester Ursula kam herein und sagte: „Das hat Folgen. Du hast den ganzen Abend ruiniert. Das war nicht umsonst. Diese Menschen kommen von weit her, nur um euch zu sehen. Beim nächsten Mal kommst du nicht so davon.“ Nach einiger Zeit kam Claudia in mein Zimmer und band mich los. Ich sah sie nur an, keines Wortes fähig.
Sie lächelte und sagte nur: „Nicht so schlimm, ich kenne es ja.“ Ich habe nie erfahren was weiter passiert ist oder nicht passiert. Noch heute bin ich der Überzeugung, dass die Filme und Bilder irgendwo existieren. Oft habe ich befürchtet, sie würden noch heute über das Internet verbreitet. Es war das letzte Mal, dass ich Claudia sah. Ich wollte sie fragen, was weiter passiert war. Sie war weg.
Einfach weg. Ich hatte nicht den Mut zu fragen, wo sie hin ist. Erst viel später habe ich erfahren, dass sie versucht hat sich umzubringen. Sie kam daraufhin wohl in eine geschlossene Anstalt für geisteskranke Jugendliche. In das geschlossene JugendpsychiatrieZentrum nach Süchteln. So verging einige Zeit, ohne dass etwas geschah. Als ich morgens nach circa drei Monaten durch den Flur ging, war es seltsam. Alle sahen weg, als ich kam. Keiner sprach. Da begriff ich, diesmal war ich der, der tot sein sollte.
Ausgegrenzt, nicht mehr zu sehen. Die ersten drei Tage gingen, dann fing man wirklich an zu überlegen ob man noch „da“ war oder nicht. Es beschlich einen ein beklemmendes Gefühl der Angst. Unheimlich, nicht in Worte zu fassen. Am sechsten Tag rempelte mich eines der anderen Kinder an. Ich war ja nicht da. Na warte, dachte ich, ich werde dir jetzt zeigen, wie ich noch da bin. Ich drehte ihn an der Schulter herum und schlug zu. Drei, vier, fünfmal hintereinander. Die nächsten drei Tage verbrachte ich gefesselt und angebunden im Strafzimmer. Ohne Kleidung, nackt auf dem Bett, angebunden an den Eisenstäben. Ohne Licht, ohne Essen, ohne Trinken, ohne Toiletten.
Irgendwann liegt man nur noch da. Ohne Gefühle, ohne alles. Die Tür ging auf, Schwester Ursula. Sie band mich los.
„Deine Eltern kommen übermorgen für eine Stunde zu Besuch. Du weißt, was du zu tun hast. Kein falsches Wort.
Du bekommst eine Spritze zur Beruhigung. Wenn du deinen Eltern was sagst, bekommst du noch eine Spritze und du bist tot. Hast du das verstanden? Ob du das verstanden hast?“ Ich konnte nur noch nicken. Ich brauchte die nächsten zwei Tage nicht in die Schule. Dann kamen meine Eltern. Vorher bekam ich eine Spritze mit was auch immer. Sie wirkte schnell. Wir gingen durch den Park der Klinik. Ich konnte mich nur langsam vorwärtsbewegen, sprach wie in Zeitlupe.