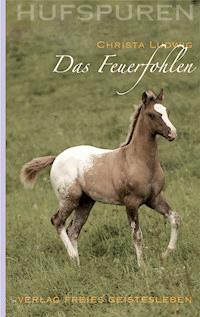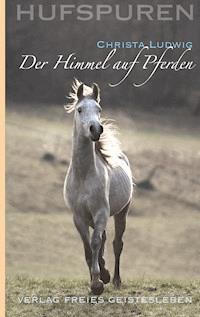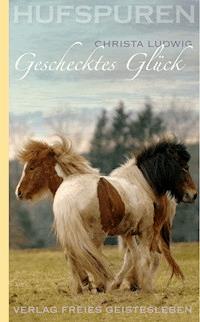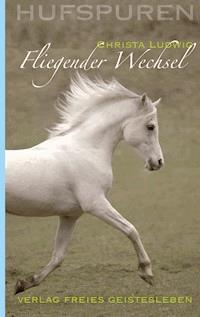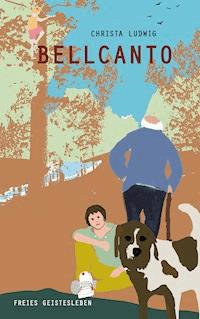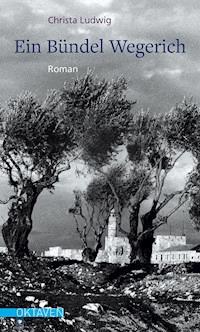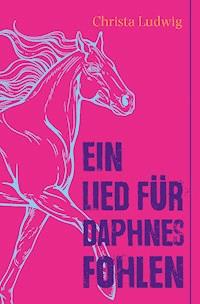
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Freies Geistesleben
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Pan ruft! Der bocksfüßige griechische Gott konnte mit den Tönen seiner Flöte Wesen betören. In Christa Ludwigs zauberhafter Geschichte ist es die kleine Hirtin Phoebe, die mit ihrer Flöte ein Fohlen zum Tanzen bringt. Und das ist nicht irgendeines: Es gehört dem Königssohn Alexander von Makedonien. Aber wird es Phoebe auch gelingen, Alexander in den Bann zu ziehen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christa Ludwig
EIN LIED FÜR DAPHNES FOHLEN
Eine Geschichte um Alexander den Großen
Verlag Freies Geistesleben
INHALT
Vorwort
Die Flöte
Phoebe
Olympias, die Königin
Die Pferde
Verkleidung
Dionysosfeier
Schuhe
In Pella
Die Stuten des Diomedes
Schlangenmutter – Löwensohn
Daphne Lorbeerbaum
Pferdepflege
In einer Höhle schläft Endymion
Schimmel braucht der König
Ochsenkopf
Die Mondgöttin
Sommersonnenschatten
Opferschimmel
Gestutzte Flügel
Die Schmucklose
Der Trinkmeister
Abschiedslied
Der Flötentausch
Phoebe kauft ein
Endymions Entschluss
Athenas Zeichen
Bunte Kiesel für den Königssohn
Todesfahrt
Endymion, der Schläfer
Ein Pferd für die Morgensonne
Kalais darf ein Schimmel werden
Namen und Begriffe
Plutarch über Bukephalos
Griechenland zur Zeit König Philipps (Karte)
Makedonien zur Zeit König Philipps (Karte)
Über den Autor
Impressum
Leseprobe
Newsletter
VORWORT
Im August des Jahres 356 vor Christus erhielt König Philipp von Makedonien an einem Tag drei gute Nachrichten:
– einer seiner Feldherren hatte ihm eine wichtige Schlacht gewonnen;
– eines seiner Pferde wurde Sieger bei den Olympischen Spielen;
– eine seiner Frauen hatte ihm einen Sohn geboren. Es heißt, Philipp habe nicht gewusst, welche dieser Nachrichten die wichtigste war.
Im April des Jahres 347 vor Christus beginnt diese Geschichte. Da wusste König Philipp, welche jener drei Nachrichten die wichtigste war: Sein Sohn Alexander war ein besonderes Kind. Alles ging schnell mit ihm: Er lernte schnell, dachte schnell, handelte schnell, er lief schnell, er ritt schnell – aber er wuchs langsam. Ein schönes Kind sei er gewesen. Er hatte weiche, fast mädchenhafte Gesichtszüge, lange blonde Locken, er hatte die Angewohnheit, den Kopf leicht nach links geneigt zu halten, und er hatte seltsam verschiedenfarbene Augen. Nur seine Beine waren zu kurz. Wahrscheinlich brauchte er deshalb so bald ein großes, prächtiges Pferd. Um jene Zeit wurde irgendwo – wir wissen nicht genau wo – jenes Pferd gezeugt, von dem diese Geschichte erzählt.
Ungefähr im Jahr 344 vor Christus brachte Philoneikes, ein Pferdezüchter aus Thessalien, ein Pferd nach Pella an den makedonischen Königshof, einen heftigen schwarzen Hengst, den niemand reiten konnte …
All das steht in den Geschichtsbüchern. Nichts steht in den Geschichtsbüchern von den anderen Freunden, die das außergewöhnliche Pferd hatte. Und doch sind sie wichtig. Wäre Alexander wirklich Alexander der Große geworden, wenn er nicht solch ein Pferd gehabt hätte? Und hätte er ein solches Pferd bekommen, wäre da nicht Phoebe gewesen, die kleine Rinderhirtin mit der Flöte, die sich unter die Pferdejungen an Philipps Hof mischte und ein Lied spielte für Daphnes Fohlen …
DIE FLÖTE
Wenn König Philipp von Makedonien mit seinem einzigen Sohn in der Aprilsonne auf die Jagd ritt, änderten alle Geräusche im Land ihren Klang: Der Wind rauschte in den Zweigen, als griffe er in die Saiten einer Äolsharfe, der Bach plätscherte über die Kiesel wie über hell klingende Edelsteine, Steinbrocken sprangen die Berge hinab und schlugen auf den Fels wie Schlegel auf ein Xylophon, wenn König Philipp von Makedonien mit seinem Lieblingssohn auf die Jagd ritt …
Und dennoch war der König traurig.
Wie sehr sich Wind, Fels und Bach auch mühten, nichts konnte die Klänge ersetzen, die vor drei Monaten im Königspalast gestorben waren. Thersites, der Flötenspieler, war tot. Stumm waren die Abende geworden, leer die Feste und Gastmahle. Viel schwerer zu ertragen war jedoch das Wiehern von des Königs Lieblingsstute. Daphne, die fuchshelle, leichtfüßige, sollte seit Tagen zum Hengst geführt werden, um ihr erstes Fohlen zu empfangen, und es fehlte Thersites, der Flötenspieler, der einzige Flötenspieler in Makedonien und Griechenland, der bei der Begegnung von diesem Hengst und dieser Stute hätte spielen können. Denn ein Fohlen wird so schön wie das Flötenspiel, das bei seiner Zeugung erklingt. Alexander, der Königssohn, war noch keine neun Jahre alt. Er hatte geweint, als Thersites starb, als hätte er den alten Mann geliebt. Kein anderer durfte die Flöte spielen, wenn sie Daphne zu Areion, dem schwarzen Kampfhengst seines Vaters, führten, denn Daphnes Fohlen sollte sein Fohlen werden. Daphne, so hatte er beschlossen, würde das Pferd gebären, mit dem er die Welt erobern wollte. Er musste einen Flötenspieler finden, solange die Stute rossig war und nach dem Hengst schrie.
Wenn Alexander, der Königssohn, etwas Bestimmtes hören wollte, mussten alle anderen Geräusche schweigen.
In raschem Galopp ritten der König und sein Gefolge auf ihren schnellen Jagdpferden heim. Hufe schlugen auf felsigen Boden, aber Alexander lauschte auf etwas anderes, und er wollte nichts hören als das, was er hören wollte. Da verhielt der Wind vor der Äolsharfe, da verharrte der Bach über den Edelsteinen, still lagen die Felsen am Hang.
Und Alexander hörte, was er hören wollte.
Er zog die Zügel an und parierte sein Pferd aus dem Galopp. Die anderen ritten weiter. Dem König gelang es als Erstem, sein Pferd zu wenden. Verwundert schaute er auf seinen Sohn. Dem klebten die verschwitzten blonden Locken im Gesicht, er hielt den Kopf schief, leicht nach links geneigt, die blauen Augen leuchteten hell, das linke kühl wie der Winterhimmel, das rechte dunkler, tiefblau, wie manchmal in der Ferne der Himmel, aber nur selten eines Menschen Auge ist. Und da hörte Philipp es auch:
Unten in der Senke, jenseits des Felsens, spielte jemand Flöte.
«Wenn mein Fohlen so schön wird, wie dieser da Flöte spielt», flüsterte Alexander, «so will ich zufrieden sein.»
Und es kam selten vor, dass er zufrieden war.
Er wendete sein Pferd und galoppierte in die Senke.
Der Vater folgte ihm, aber der Abstand zu seinem Sohn wurde größer. Philipp wusste, er selber würde stürzen bei solch einem Ritt, sein Sohn nicht. Der jagte am Abgrund entlang, durch einen frühlingsbrausenden Bach, den Steilhang hinunter. Und wenn er wirklich, wirklich einmal stürzte, er würde auf jenes weiche Moospolster fallen zwischen Gestein und Geröll – zu viele Möglichkeiten, den Hals zu brechen, hatte Alexander schon ergriffen und überlebt.
Der König ritt langsam hinab, fand schließlich den Sohn entsetzt, erstarrt.
«Vater», sagte er, «wie wird der spielen, wenn er noch zehn Jahre lang geübt hat? Aber ich will doch mein Fohlen jetzt, sofort.»
Alles lernte Alexander schnell, nur nicht warten, das nicht. Sie hatten geglaubt, einen alten Hirten zu finden. Was sie aber da mit offenem Mund anstarrte und neben dem Bergbach über der Rinderherde die Doppelflöte in der Hand hielt, das war ein Kind.
Und –
«Bei Zeus und allen Göttern», sagte der König, «das ist ein Mädchen.»
PHOEBE
Phoebe hatte Angst.
Nicht weil der König gesagt hatte, er wolle sie mitnehmen nach Pella und sie solle dort Flöte spielen. Zum Königshof gehen wollte sie gern, und Flöte spielen – das konnte sie. Die Töne sprangen aus ihrer Flöte wie neugeborene Kälber über die Frühlingsweide. Oder sie zog Melodien aus den Stäben der Syrinx, die besänftigten die wildesten Stiere. Schon im letzten Jahr, als man dem schäumenden Meergott Poseidon das Opfer brachte, war sie es gewesen, die den tobenden jungen Opferstier mit ihrer Musik zum Altar begleitet hatte. Des Königs Worte: «Du sollst für uns Flöte spielen», schreckten sie nicht, aber –
«Wir müssen ihr die Augen verbinden!»
Das hatte der Königssohn gesagt, und zitternd hatte Phoebe versucht, die Flöte in ihren Kleidern zu verbergen.
«Komm», sagte Philipp, und Phoebe stieß sich vom Felsen ab. Einem König muss ein Hirtenmädchen gehorchen, auch wenn es Angst hat. Er fasste sie unter den Armen und setzte sie vor sich auf sein Pferd. Dass er nur ein Auge hatte, wussten alle im Land. Ein thrakischer Bogenschütze hatte ihm das linke Auge ausgeschossen. Philipp trug ein goldenes Band schräg über der Stirn, es verdeckte die leere linke Augenhöhle, das rechte Auge aber blickte klar und hell, kühlblau wie der Winterhimmel, und das linke war gewiss genauso gewesen, die Einäugigkeit des Königs war nicht so verwirrend wie die zweifarbenen Augen seines Sohnes. Den konnte Phoebe nicht anschauen wie einen einfachen, einzelnen Menschen. Ihr Blick irrte von dem einen Auge zu dem anderen, von dem klaren, hellblauen linken zu dem dunkelblauen rechten.
Sie hatte einen großen Bruder, der fuhr mit einem Kaufmann über das Meer, und immer, wenn er heimkam, sagte er zu ihr: «Es gibt ein Blau, ein seltsam tiefes Blau, das ist immer in der Ferne. Du erreichst es nie. Es ist immer da, wo du nicht bist. Du segelst ihm nach, und wenn du hinkommst, wo es war, so ist es schon wieder in der Ferne. Du bist traurig, weil es fort ist, aber du bist auch glücklich, weil du da sein darfst, wo es vor kurzer Zeit noch gewesen ist.»
Oh, wenn ihr großer Bruder doch einmal in das rechte Auge des Prinzen blicken dürfte …
Was wäre, wenn Alexander zwei solche Augen hätte …
Er hielt den Kopf etwas schief, leicht nach links geneigt. Phoebe schaute hin und her, von dem hellen Auge des Königssohnes zu dem dunklen. Es kam ihr vor, als sähe sie zwei Gesichter von zwei verschiedenen Menschen, und sie wusste nicht:
Welchem von diesen beiden musste sie gehorchen?
Wer erschreckte sie mehr?
Wen verehrte sie mehr?
Und:
Welcher von diesen beiden hatte gesagt: «Wir müssen ihr die Augen verbinden»?
OLYMPIAS, DIE KÖNIGIN
Sogar die Griechen, die das Wilde verabscheuten, mussten zugeben, dass Olympias schön war. Siebzehn Jahre war sie gewesen, als König Philipp sie sah und sich bald darauf mit ihr vermählte. Eine Glücksheirat. Sie war eine Prinzessin aus Epiros, dem westlichen Nachbarland von Makedonien – Wilde, Barbaren, sagten die Griechen. Die Verbindung brachte Philipp Frieden mit seinen westlichen Nachbarn. Eine Glücksheirat.
Philipps erste Frau war bei der Geburt ihrer Tochter gestorben. Seine zweite Frau Phila blieb kinderlos. Aber ein König braucht Kinder, und Söhne müssen es sein. Nach makedonischem Recht durfte der König mehrere Frauen gleichzeitig haben. So heiratete er die junge Prinzessin aus Epiros, und Olympias gebar – achtzehn Jahre alt – Alexander. Eine Glücksheirat! Wirklich? Philipp, der Makedonier, war trotz seiner vielen Feldzüge und Eroberungen ein besonnener Mann. Nur einmal, urteilten seine späteren Geschichtsschreiber, habe er sich mehr vorgenommen, als er bewältigen konnte. Das war, als er Olympias zur Frau nahm. Die Prinzessin aus Epiros zog ein in den Königshof von Pella mit ihren Löwen, Leoparden und Schlangen.
König Philipp hatte das Hirtenmädchen noch vor sich auf dem Pferd, als die Jagdgesellschaft in den Palasthof trabte. Phoebe krallte die Hände in die Mähne des Pferdes. Zwar hielt Philipp sie fest, aber sie wagte es nicht, sich an einen König anzulehnen. Immerhin, sie hatten ihr bislang nicht die Augen verbunden.
Die weißen Stufen von der Säulenhalle des Palastes hinunter schritt Olympias, die Königin, Alexanders Mutter.
«Sieh», rief Philipp ihr entgegen, «wir haben einen Ersatz für Thersites gefunden. Das Mädchen spielt Flöte wie Apoll die Leier.»
Olympias schaute Phoebe prüfend an. Sie hielt den Kopf etwas schief, nach links geneigt –
Wie der Prinz, dachte Phoebe erschrocken. Warum hatte sie solche Angst vor dieser Frau? Die sagte gar nicht: Wir müssen ihr die Augen verbinden. Sie sagte: «Wir werden sie baden in Thymianöl. Wir geben ihr Kleider und Schmuck …»
Das alles wollte Phoebe gern. Davor hatte sie keine Angst: schöne Kleider, wie die Königin sie trug, einen langen Chiton aus weichem, fließendem Stoff, an beiden Schultern gehalten von großen goldenen Spangen – Schmuck, wie die Königin ihn trug, ein goldenes Diadem mit getriebenen Rankenmustern in den blonden Locken, große Ohrgehänge aus feinstem, zu Rosetten gebogenem Golddraht, einen langen Armreif, der sich wie eine grüngoldene Schlange ihren rechten Arm hinauf ringelte – Phoebe starrte gebannt auf den Armreif. Hatte sie richtig gesehen? Die kleine, grüngoldene Schlange bewegte sich. Der flache Schlangenkopf öffnete sich weit, winzige, smaragdgrüne Augen funkelten Phoebe an, zwischen den offenen Kiefern zitterte eine dünne, gespaltene Zunge.
Phoebe wich zurück und drückte den Rücken erschreckt an die Brust des Königs.
Olympias lachte.
Ihre linke Hand fasste die Schlange am Kopf, zog sie sacht vom Arm, legte sie sich um den Hals. Aus dem schmalen Schlitz des geschlossenen Maules züngelte die gespaltene Zunge.
«Nicht solchen Schmuck bekommst du», sagte Olympias. «Ich gebe dir Armreifen aus echtem Gold. Ketten aus echten Schlangen trage nur ich.»
DIE PFERDE
Sklaven gossen Wasser auf den Sandplatz im Innenhof der Pferdeställe.
«Nicht zu viel», sagte der König. «Die Pferde dürfen nicht rutschen. Aber sie sollen auch keinen Staub aufwirbeln, sonst muss unsere Flötenspielerin husten, und das wäre schlimm.»
Phoebe lehnte am Brunnen der Pferdetränke und duftete nach Myrrhe und Thymian. Sklavinnen der Königin hatten sie gebadet und mit Ölen eingerieben, sie trug ein langes weißes Gewand, die goldenen Schulterspangen waren ihr zu groß und zu schwer, um ihre Fesseln klingelten goldene Fußreifen.
Zwei Pferdeknechte brachten Daphne, die fuchshelle Lieblingsstute des Königs. Sie lösten das schmale Lederhalfter und ließen das Pferd frei laufen. Daphne schüttelte sich, scharrte mit dem Vorderhuf im kühlfeuchten Sand.
«Treibt sie!», rief der König. «Sie soll sich nicht wälzen.»
Pferdeknechte sprangen herbei, unwillig trabte die Stute davon, ihre lange Mähne flatterte leicht. Sie kam zur Tränke, tauchte die schmale Nase kurz in das Wasser und schaute dann zu, wie die kräuselnden Wellen sich wieder beruhigten. Auch Phoebe blickte in den Brunnen. Sie sah ihr eigenes Gesicht, fremde Spangen im Haar, und das Maul der Stute, die das Wasser wieder kräuselte. Daphne hatte keinen Durst, sie spielte nur, drückte ihr feuchtes Maul Phoebe in den Nacken und prustete. Sie war ausgiebig getränkt und gründlich geputzt worden, aber sie hatte Hunger. Zuchtstuten sollen im Frühjahr mager sein, das hatten die Makedonier, die kaum selber Pferde züchteten, von den Thessaliern gelernt. Die Stute sei vor dem Decken mager, der Hengst gut genährt, so lehrten die Pferdezüchter aus Thessalien an der südlichen Grenze. Daphne warf den Kopf hoch und wieherte, wie Sprühregen eines Wasserfalls fiel es auf Phoebe herab. Durch die offene Stalltür entsprang den Pferdeknechten Areion, der schwarze Kampfhengst des Königs.
Auch er scharrte im Sand, aber es sah nicht so aus, als ob er sich wälzen wollte. Er hob den Kopf ganz hoch und zog die Oberlippe hoch, entblößte die Schneidezähne und sog die Luft ein. Das sah lustig aus. Phoebe musste lachen. Alexander trat neben sie.
«Du sollst nicht lachen. Du sollst spielen», sagte er. Aber da lachte Phoebe schon gar nicht mehr. Allerdings spielte sie auch nicht.
«Oh», sagte sie, «oh …», und starrte den Hengst an, der in einem großen Kreis wiehernd um den Sandplatz trabte.
«Vater», schrie Alexander, «wir müssen ihr die Augen verbinden! Sonst steht sie nur da und guckt und spielt nicht!»
«Nein», sagte Philipp, «sie soll spielen, was sie sieht. Sie soll mit ihrer Musik erzählen, was sie sieht. Spiel, Mädchen, spiel endlich.»
Phoebe setzte die Doppelflöte an die Lippen. Ihre rechte Hand hielt die Bassflöte, die linke die Sopranflöte. Die rechte soll für den Hengst spielen, dachte Phoebe, die linke für die Stute.
Und sie spielte.
«Siehst du, mein Sohn», flüsterte Philipp und legte dem Jungen die Hände auf die zitternden Schultern, «hörst du, mein Sohn? Siehst du, was du hörst, und hörst du, was du siehst? Das Mädchen hat uns Apoll geschickt, und Daphnes Fohlen wird ein Götterpferd.»
Der Hengst rieb seinen dunklen Kopf an dem hellen Hals der Stute. Die schnaubte, wendete, lief davon, aber wartete, dass er ihr folgte. Acht Pferdehufe klangen knirschend im feuchten Sand, vier rhythmisch stampfend wie die Finger auf der Bassflöte, vier fliegend leicht wie Phoebes linke Hand.
Dann aber blieb Areion mitten auf dem Sandplatz stehen. Er wölbte den Hals unter dem mächtigen Kamm seiner dunklen, geschorenen Mähne, er trat auf der Stelle, und er hob die Beine so hoch, als sollten sie niemals wieder den Boden berühren. Im kleinen Kreis trabte um ihn die Stute, Daphne, mit wehendem Schweif und fliegender Mähne, mit langsamen Tritten hob sie die Hufe, als hätten sie niemals den Boden berührt.
Mit einem langen Klagelaut sank Phoebe die Flöte von den Lippen. Oh, dachte sie, hätten sie mir doch die Augen verbunden.
«Spiel!», schrie Alexander und trat ihr heftig in den Rücken. Wahrscheinlich tat es weh. Sie spürte es kaum. Sie hob die Flöte – wie war die plötzlich schwer – und blies hinein, erschrak vor den krächzenden Tönen.
«Dies ist keine Krähenhochzeit!», schrie der Prinz. «Spiel! Ich will ein Götterpferd, keinen Rabenbastard.»
Phoebe schloss die Augen. An daheim denken. An die ruhigen, sanft gewellten Wiesen. An die stillen, flachen Augen wiederkäuender Ochsen. Oder an Poseidons Opferstier vom letzten Jahr. Auch der war ein prachtvolles Tier gewesen. Damals hatte sie spielen können. Aber hier? Das konnte sie nicht. Das war hoffnungslos. Warum hatte sie niemand darauf vorbereitet, wie sich zwei Pferde bewegen, die einander gefallen wollen? Eine leichte Hand legte sich auf ihre Schulter, und sie hörte die Stimme des Königs.
«Versuch es doch, Kind. Deine Musik ist so schön wie diese Pferde. Du kannst es.»
Phoebe hielt die Augen fest geschlossen, dachte an ihre Ochsen und spielte.
«Das taugt nichts!», schrie der Prinz. «So bringt doch den Hengst fort von der Stute!»
«Lasst», sagte der König, «das schafft keiner mehr.»
Alexander war wutrot im Gesicht, seine Stimme überschlug sich. «Schickt sie zurück zu ihren Ochsen! Sie hat alles verdorben.»
VERKLEIDUNG
Still blickten die schläfrigen Augen der wiederkäuenden Ochsen. Müde von durchtanzten Nächten, hatte Pan, der Gott der Hirten – bocksbeinig, ziegenbärtig –, mit trägen Armen das Aprilgrün über die sacht gewellten Hügel gebreitet.
Die Hainbuchen standen gerade so weit auseinander, dass jede Baumnymphe ihren eigenen Schlaf träumte, und sie waren sich eben so nah, dass jede, erwachend, sich reckend und in die Äste sich streckend, der nächsten kichernd zupfeifen konnte, welcher Satyr – spitzohrig, stumpfnasig – sie in der Nacht verfolgt und wieder nicht erreicht hatte.
Phoebe lehnte am Hang zwischen den blitzenden Augen besonnter Eidechsen. Zum ersten Mal spürte sie die Ruhe ihrer Rinderweide, die schläfrige Gelassenheit des Hains. Sie bemerkte die Stille, weil sie ihr fehlte. Ihre Finger stolperten über die Doppelflöte. Sie versuchte die Panflöte, aber ihre Lippen zitterten auch über den Röhren der Syrinx. Sie empfand mit dem übervollen Frühlingsbach. Der hatte gestern brausend und springend den wilden Ritt des Königssohnes angespült und ihn schäumend vor ihre Füße geworfen: Alexander – verschwitzte blonde Locken in der Stirn, den Kopf nach links geneigt, das rechte Auge, das sehnsuchtsblaue, damit höher in den Himmel gehoben, unnötig hoch, blieb es doch schon auf Erden ewig fern. Sie musste fort, hier konnte sie nicht mehr bleiben.
Die Mutter wollte das zehnjährige Kind nicht allein nach Pella zum Königshof gehen lassen, aber Thamyris war da, ihr Bruder, und der wusste, wer einmal das ferne Blau gesehen hat, der muss ihm folgen.
«Alexander», sagte er, «ist kein gewöhnlicher Mensch, nicht einmal ein gewöhnlicher Königssohn, ja nicht einmal für den großen König Philipp ist er ein gewöhnlicher Königssohn. Er ist noch keine zehn Jahre alt, und schon reden sie von ihm drüben in Asien. Denn am Tage seiner Geburt brannte in Ephesos der Artemistempel ab, das Feuer sprengte die Steine, die Decke stürzte ein, die Säulen fielen um, Priester und Volk rannten schreiend durch die Straßen von Ephesos, und die Seher prophezeiten, an diesem Tag würde der Untergang der Stadt geboren. Und Artemis eilte nicht herbei, ihr Heiligtum zu schützen. Sie weilte in Pella und diente der jungen Königin Olympias als Hebamme, sie hörte den ersten Schrei des Knaben Alexander, sie wusch ihn, und wahrscheinlich war sie die Erste, die seine zweifarbenen Augen sah.»
«Aber der König hat Phoebe fortgeschickt», sagte die Mutter, «er will sie nicht als Flötenspielerin an seinem Hof haben.»
«Ich will auch nicht zum König», sagte Phoebe. Ich will in den Ställen arbeiten wie ein Pferdejunge. Ich will für die trächtige Stute spielen, das Fohlen formen in ihrem Leib mit meiner Musik.»
«Und wie willst du vorgeben, dass man dich für einen Jungen hält?»
«Ich bin doch zu jung für einen Bart. Wenn ich eine Chlamys trage wie die Männer, wer soll dann sehen, dass ich ein Mädchen bin?»
«Aber», sagte die Mutter, «du bürstest einem Pferd die Beine, du bückst dich, um ihm die Hufe zu reinigen, dein Chiton verrutscht – und jeder sieht, dass du ein Mädchen bist.»
«Sie hat helle Haut und helle Haare», sagte der Bruder, «wir verkleiden sie als Thraker.»
So ein Kleidungsstück, wie er es nun vor ihnen ausbreitete, hatten sie noch nie gesehen. Phoebe wickelte die zwei langen Schläuche um den Bauch, vorn hing ein breiteres Teil herab –
«So?»
Thamyris lachte.
Phoebe schlang die Schläuche um Brust, Schultern und Hals. Wie immer sie dieses seltsame Stück Stoff wand und wickelte, niemals deckte es ihren Körper. Der Bruder befreite sie aus dem Geschlinge, hob eines ihrer Beine, schob es in den einen Schlauch, das zweite in den anderen, hielt alles mit einem Strick um den Leib –
«… und niemand wird sehen, dass du ein Mädchen bist. Sie nennen es Hosen. Die Thraker und die Skythen tragen das viel. Auch andere Reitervölker. Ich schenke meiner Schwester eine Hose und leihe ihr meinen Namen. Du nennst dich Thamyris, so heißen viele Männer in Thrakien. König Philipp hat weite Teile des Landes erobert. Es gibt viele Waisen, die Arbeit suchen, und die Thraker verstehen sich auf Musik und auf Pferde.»
Phoebe ließ sich auf den Boden fallen, spreizte die Beine, rollte auf den Rücken, reckte die Füße hoch, zappelte, strampelte, kullerte durch die Hütte, lachte, sprang auf, der Mutter in die Arme.
«Ich werde selber vergessen, dass ich ein Mädchen bin. Wenn das Fohlen geboren ist, komme ich wieder. Vielleicht wächst mir dann schon ein Bart.»
DIONYSOSFEIER
Thamyris hatte sie gewarnt. Thamyris hatte gesagt: «Wenn du Musik hörst, Cymbeln, Pauken, Flöten, so flieh, flieh in das tiefste Dickicht der Wälder. Lauernde Luchse und Leoparden, sprungbereit in den Zweigen und Ästen, sind nicht halb so wild wie die berauschten Mänaden, die tobenden Frauen bei den Dionysosfesten.»
Hatte sie das vergessen?