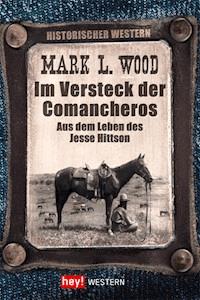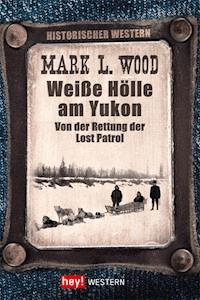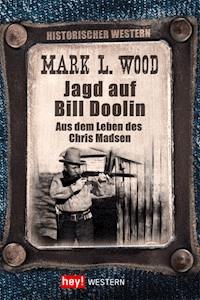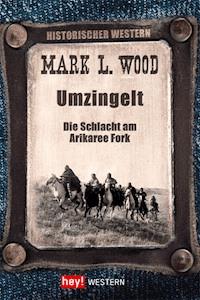4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HEY Publishing GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zuerst will es keiner glauben. Ein greiser Apache und knapp sechzig Krieger führen die zahlenmäßig weit überlegene US-Kavallerie monatelang an der Nase herum. Sie ziehen eine blutige Spur durch New Mexico und töten einsame Farmer, Schafzüchter und Goldsucher. Keiner sieht die Apachen, und Tote können nicht mehr reden. Erst als es zu ersten Scharmützeln zwischen der Armee und den Indianern kommt, erkennt man die Wahrheit. Der siebzigjährige Nana hat die letzten Apachen in den Krieg geführt. Ein hinkender Greis, vor dem jeder weiße Mann verächtlich ausspucken würde. Aber jetzt ergreifen sie die Flucht vor ihm, denn dieser alte Mann fürchtet sich vor niemandem, und kein weißer Mann scheint ihm gewachsen zu sein. Der nach historischen Tatsachen verfasste Roman über eines der blutigsten Kapitel aus der Zeit der Apachenkriege. Unter dem Pseudonym »Mark L. Wood« schrieb Thomas Jeier zahlreiche Western. Als erstem deutschen Autor gelang es ihm, zwei Romane über den amerikanischen Westen in den USA zu platzieren. Die Gesellschaft zum Studium des Western der Uni Münster zeichnete ihn mit dem Elmer-Kelton-Preis für sein Gesamtwerk aus. Zur Blütezeit des Western war er Herausgeber der angesehenen Heyne-Westernreihe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Mark L. Wood
Ein Mann von siebzig Wintern
1
Die Sonne brannte auf seinen Rücken, seit einer halben Stunde schon, aber er rührte sich nicht von der Stelle und blieb wie versteinert auf dem Felsvorsprung stehen. Seine langen grauen Haare bewegten sich im Wüstenwind. Er war ein hochgewachsener und sehr kräftiger Mann, dem man nicht ansah, dass er von Rheuma und einer schmerzenden Wunde am Bein geplagt wurde. In seinem linken Oberschenkel steckte die Kugel eines mexikanischen Banditen. Er trug schmutzige Leinenhosen und ein buntes Hemd, das von einem Patronengürtel zusammengehalten wurde. Seine n'deh b'keh, die hochschäftigen Mokassins der Apachen, waren fleckig. Die Winchester in seinen Händen stammte aus einem Waffentransport, den sie im Frühjahr überfallen hatten.
Viele seiner Stammesbrüder nannten ihn Ca-Si-Still, aber bei den Weißaugen und Mexikanern war er nur als Nana bekannt, das ließ sich leichter aussprechen und passte auch besser zu dem alten Krieger. Siebzig Winter hatte er bereits erlebt, mehr als jeder andere Mann in seinem Stamm, und die Leiden jedes einzelnen Monats hatten sich in sein Gesicht gegraben. Es war ein faltiges, von Wind und Wetter gegerbtes Gesicht mit einer breiten Nase und einem schmalen Mund, dessen Unterlippe beinahe trotzig nach vorn geschoben war. Über den hohen Backenknochen spannte sich die dunkle Haut. Seine Augen lagen tief in den Höhlen und verrieten so viel eisernen Willen, dass sogar Victorio ihrem Blick ausgewichen war. Nur wenige Weißaugen, die in diese Augen geblickt hatten, waren noch am Leben, ganz zu schweigen von den Mexikanern, die schon eine Kugel oder eine Klinge im Leib gehabt hatten, bevor sie etwas gesehen hatten.
Nana wusste längst, dass die Weißaugen keinen Frieden wollten, dass sie das Land für die vielen Siedler brauchten, die aus dem Land der aufgehenden Sonne kamen. Sie trieben stählerne Bänder durch die Wüste und schickten das Feuerross in die alten Jagdgründe der Apachen. Überall entstanden Häuser aus Stein und befestigte Dörfer, in denen die Blauröcke wohnten und ihre heimtückischen Pläne ausheckten. Es gab keine Hoffnung mehr für die Apachen, sie kämpften gegen eine gewaltige Übermacht, gegen die auch die tapfersten Krieger unterlegen sein mussten. Das hatten Cochise und Delshay und Eskiminzin erkennen müssen, und das hatten er und Victorio erfahren, als sie nach San Carlos gebracht worden waren. Reservation nannten die Weißaugen den schäbigen Flecken Land. Nana wusste nicht, was dieses Wort bedeutete, aber er wusste dafür umso besser, dass er den Rest seines Lebens nicht im schäbigsten Teil des Landes verbringen wollte. Er wollte die Freiheit atmen und lieber im Kampf sterben als in Gefangenschaft auf elende Weise zu Grunde gehen.
Auch Victorio hatte diesen Wunsch gehabt, aber er war jünger als Nana gewesen und hatte sich vor dem Sterben gefürchtet. Er hatte von einer Zukunft geträumt, die es nicht geben konnte. Er hatte geglaubt, gegen die Übermacht von blassen Männern ankämpfen und sie aus dem Land vertreiben zu können. Und er hatte mit seinem Leben für diese Träume bezahlt. Er hatte sein Leben in den Bergen ausgehaucht, die von den Mexikanern Tres Castillos genannt werden. Ausgerechnet die verdammten Mexikaner hatten seinem Leben ein Ende gesetzt.
Nana blickte in die Senke hinab und kämpfte gegen Schmerz und Verzweiflung an. Mehr als siebzig tote Apachen lagen auf dem steinigen Boden. Tapfere Krieger, die noch vor wenigen Tagen an seiner Seite geritten waren, aber auch Frauen und Kinder. Sie waren gestorben, weil sie keine Munition mehr gehabt hatten und Nana und seine Krieger zu spät gekommen waren. Sie waren den mexikanischen Soldaten hilflos ausgeliefert gewesen.
„Dich trifft keine Schuld“, erriet Kaytennae die Gedanken seines Anführers. „Wir konnten die Munition nicht schneller beschaffen. Unsere Pferde waren müde, und der Weg zur Farm war weiter als wir dachten.“
Nana blickte auf den jungen Krieger, der neben ihn getreten war. Zwischen ihnen bestand eine seltsame Vertrautheit, obwohl sie nicht miteinander verwandt waren. Aber der schlanke Krieger mit der keilförmigen Narbe über der linken Augenbraue erinnerte ihn an seinen Sohn, und Kaytennae respektierte den alten Nana als tapferen Krieger und klugen Taktiker.
„Er hat fest damit gerechnet, dass wir rechtzeitig mit der Munition kommen!“ Nana sprach den Namen des toten Victorio nicht aus, wie es bei den Apachen üblich war.
„Aber er musste wissen, dass wir die Patronen nicht so schnell auftreiben konnten, nantan.“
Nana antwortete nicht und ging zu seinem Pferd zurück. Mit einer Handbewegung forderte er zwei seiner Krieger auf, um die Senke herumzureiten und nach den Spuren der mexikanischen Truppen zu suchen. Es war zwar nicht damit zu rechnen, dass noch Soldaten in der Nähe waren, aber Nana wollte ganz sichergehen. Er war bei manchen Kriegern als übervorsichtig verschrien, aber er war am Leben, und das war im Land der Apachen der beste Beweis dafür, dass man den richtigen Weg ging.
„Blanco!“, rief er einen seiner besten Krieger herbei.
Der untersetzte Apache trieb sein Pferd an und zügelte es neben seinem Anführer. Blanco ritt seit vielen Jahren mit Nana und hatte sich besonders durch seine Kaltblütigkeit ausgezeichnet. Während eines Überfalls verzog er keine Miene, und auch jetzt war er der gefassteste von allen. Die anderen Apachen mochten ihn nicht besonders, weil er sich immer abseits hielt und kaum ein Wort sprach. Sie wussten nicht einmal, von welchem Stamm er war. Er war vor ein paar Jahren in ihr Lager geritten und hatte seitdem an ihrer Seite gekämpft. Über seine Vergangenheit war nie etwas bekannt geworden.
„Nantan?“
„Nimm dir ein paar Krieger und suche nach Überlebenden“, sagte Nana zu dem wortkargen Apachen, „vielleicht haben sich ein paar von unseren Leuten hinter dem Felsen verkrochen.“
Blanco wendete wortlos sein Pferd, gab drei Kriegern ein Zeichen und ritt mit ihnen auf die felsigen Berge zu. Während des Reitens zog er sein Gewehr aus der Sattelschlinge.
Nana nickte zufrieden und lenkte seinen Braunen auf den schmalen Pfad, der in die Senke hinab führte. Die anderen Apachen folgten ihm. Sie hielten den Kopf gesenkt und starrten in stummer Trauer auf den Boden, wie sie es schon lange nicht mehr getan hatten. Die letzten Wochen waren ein einziger Triumphzug gewesen. Sie hatten die Pferdesoldaten an der Nase herumgeführt und viele Siedler und Goldsucher getötet, und einige Krieger hatten schon geglaubt, unverletzbar zu sein. Für sie war der Anblick der Toten besonders niederschmetternd.
„Yusn hat uns verlassen“, flüsterte ein Krieger.
Blanco fuhr wütend zu ihm herum. „Wenn wir nicht jammern und Rache an den niederträchtigen Mördern nehmen, wird er wieder an unserer Seite sein.“
Nana hörte die Worte seines jungen Stammesbruders, aber er stimmte nicht in das wütende Geheul seiner Krieger ein. Er war zu niedergeschlagen und zu erschüttert, um jetzt schon an Rache zu denken. Zuerst musste er sich um die möglichen Überlebenden und die Toten kümmern. Die Schwachen und Verwundeten brauchten dringend Hilfe, und die Toten mussten begraben werden, wenn sie jemals das Ewige Reich sehen wollten, in dem es keine Krankheit und keinen Schmerz und keinen Krieg und keinen Tod mehr gab.
In der Senke zügelte Nana sein Pferd. Er nahm sein Stirnband ab und band es sich vors Gesicht, aber selbst der feste Leinenstreifen, den er aus dem Hemd eines ermordeten Mexikaners gerissen hatte, hielt den Gestank der Toten nicht ab. Der heiße Wüstenwind wehte dem alten Mann genau ins Gesicht und brachte ihn beinahe dazu, sein Pferd zu wenden und davonzureiten.
Nana war dem Tod viele hundert Male begegnet. Er hatte ihn als Kind gesehen, als weiße Goldsucher im Whiskyrausch über zwei seiner Kusinen hergefallen waren, und er hatte ihn als junger Krieger kennengelernt, als er mit vier Stammesbrüdern auf die Jagd geritten und als einziger zurückgekehrt war. Und während der letzten zwanzig Winter war der blasse Mann auf seinem Geisterpony ständig an seiner Seite geritten. Er hatte Männer, Frauen und vor allem Kinder sterben sehen, und ihre Schreie hatten ihn bis in den Schlaf verfolgt.
Die Weißaugen glaubten, dass die Apachen wilde Tiere waren. Gefühllose Bestien, die weder lachen noch weinen konnten und unfähig waren, ihre Gefühle zu zeigen. Nana wusste es besser. Obwohl er den Reiter auf dem Geisterpony besser als jeder andere Mann kannte, spürte er, wie seine Kehle eng wurde und Tränen in seine Augen traten. Tränen des Schmerzes und der Verzweiflung, die über sein faltiges Gesicht rannen und von dem schmutzigen Tuch aufgesogen wurden, das er über Mund und Nase gebunden hatte. Er war dankbar für diese Tränen. Sie schafften ihm Erleichterung und verwischten die Konturen der Toten, die in seltsamer Verrenkung auf dem Boden lagen.
Die Mexikaner hatten ganze Arbeit geleistet. Sie waren wie ein Sturmwind über das Lager hinweggebraust, hatten die verdutzten Apachen mit Kugeln aus ihren Revolvern und Gewehren durchsiebt und dann mit ihren Säbeln auf sie eingedroschen. Überall lagen abgetrennte Köpfe und Gliedmaßen herum, und der Sand war rot vom Blut. In den gebrochenen Augen der Toten lag das ganze Entsetzen, das sie beim Auftauchen der Mexikaner empfunden haben mussten. Sie hatten höchstens noch acht oder neun Patronen in ihren Gewehren gehabt und waren den mexikanischen Soldaten hilflos ausgeliefert gewesen. Sie waren wie Vieh gestorben, ohne Hoffnung und ohne Chance.
Nana ritt langsam zwischen den Toten herum. Sein trüber Blick glitt über die toten Apachen, blieb an zwei von Pferdehufen zerstampften Kindern hängen und wanderte zu einigen alten Frauen, die in die Felsen hatten entkommen wollen und vorher eingeholt worden waren. Ihr Blut klebte an einem Dornenstrauch, dessen Zweige leicht im Wind zitterten. Keine fünf Meter von ihnen entfernt lag ein zehnjähriger Junge, der sich ebenfalls in die Felsen hatte retten wollen.
„Nantan!“
Nana zügelte seinen Braunen und wischte sich die Tränen vom Gesicht. Sein Blick suchte Kaytennae, der vom Pferd gestiegen war und sich über einen Toten beugte.
„Nantan! Hier liegt der, der gestorben ist!“
Auch Kaytennae hielt sich an das ungeschriebene Gesetz, dass man den Namen eines Toten nicht aussprach, aber Nana wusste auch so, wer gemeint war. Er lenkte sein Pferd mit einem heftigen Hackendruck zu Kaytennae hinüber und griff ihm heftig in die Zügel. Mit starrem Blick schaute er auf den Toten hinab.
Beduiat!
Victorio, wie ihn die Weißaugen genannt hatten. „Der, der gestorben ist!“
Obwohl Nana gewusst hatte, dass Victorio den mexikanischen Soldaten unmöglich entkommen sein konnte, fühlte er neues Entsetzen in sich aufsteigen. Der Anblick des blutüberströmten Körpers traf ihn härter als der Tod der vielen Kinder, weil Victorio zu den wenigen Apachen gehört hatte, die den Weißaugen nicht nur mit Mut und Entschlossenheit, sondern auch mit Weisheit und einer gerissenen Taktik begegneten. Cochise und Mangas Coloradas waren solche Männer gewesen, aber sie waren schon lange tot, und Nana hatte alle Hoffnung in den jungen Victorio gesetzt. Jetzt war nur noch er übrig, und er würde nicht mehr lange genug leben, um diesem Krieg eine entscheidende Wende zu geben. Der Tag war nicht mehr fern, an dem der blasse Reiter auf dem Geisterpony neben ihm auftauchen und ihn ins Ewige Reich holen würde.
Kaytennae erriet die trüben Gedanken seines Anführers. „Du bist stark genug, um uns in den Krieg gegen die Weißaugen und Mexikaner zu fuhren“, sagte er. „Du wirst den, der gestorben ist, auf blutige Weise rächen und rechtfertigen!“
„Ich werde alt, Kaytennae.“
„Du bist ein di-yin, ein Schamane. Die Macht der Wildgänse wird dir helfen, die Pferdesoldaten zu schlagen!“
Nana blickte in die leeren Augen des toten Victorio und fühlte plötzlich eine dumpfe Leere in seinem Körper. Auch der junge Anführer hatte über geheimnisvolle Kräfte verfügt, auch er hatte als unbesiegbar gegolten, und doch war er gestorben wie alle anderen, die auf diesem Schlachtfeld in ihrem Blut lagen. Die Macht der mexikanischen Soldaten war stärker gewesen, und nichts hatte Victorio retten können.
„Wir wollen ihn begraben“, sagte Nana. Er wandte den Blick von dem toten Anführer. „Ihn und die anderen.“
„Wir haben wenig Zeit, nantan.“
„Schichtet Steine über ihre Körper, das dauert nicht so lange und hält die Geier von ihnen fern. Ich will, dass sie unversehrt im Ewigen Reich ankommen.“
„Enju“, gehorchte Kaytennae. Er gab den Befehl an die anderen Apachen weiter und hob einige Felsbrocken auf, die er über den Körper des toten Victorio schichtete. Seine Lippen zuckten nervös, als er das Gesicht des Toten bedeckte. Auch er schämte sich nicht der Tränen, die über sein Gesicht liefen. „Du wirst ihn rächen, nicht wahr?“, sagte er, als er fertig war.
Nana hatte im Sattel gesessen und den jungen Krieger stumm beobachtet. „Der Tag wird kommen, Kaytennae!“
„Wie lange müssen wir warten, nantan?“
„Hab Geduld!“
Kaytennae wollte etwas erwidern, aber der alte Anführer hatte seinem Pferd bereits in die Zügel gegriffen und wandte sich den beiden Kriegern zu, die nach den Spuren der mexikanischen Soldaten gesucht hatten und in diesem Augenblick in die Senke geritten kamen. „Wo sind die Mörder?“, fragte Nana bitter.
Einer der beiden Krieger deutete aufgeregt nach Süden. „Sie sind alle fort“, meldete er, „seit heute Morgen schon. Sie haben die jungen Frauen und einige Kinder mitgenommen.“
Nana nickte. „Als Sklaven. Sie werden verkauft.“
„Willst du sie befreien?“
„Nein“, antwortete der alte Mann hart, „wir sind nur achtzehn Krieger stark und kommen gegen die vielen Mexikaner nicht an. Wegen ein paar Frauen und Kinder kann ich nicht das Leben der letzten freien Krieger aufs Spiel setzen.“
Die beiden Krieger waren geschockt durch die Antwort, aber sie wussten natürlich, dass Nana so entscheiden musste. Das harte Gesetz der Apachen schrieb vor, dass nur solche Gefangene befreit wurden, die dem Stamm noch von Nutzen sein konnten. Frauen und Kinder waren während eines Kriegszugs nur im Weg. Nur wenn die Krieger bei der Befreiung kein Risiko zu fürchten hatten, durften sie den Feind verfolgen.
„Es sind viele Frauen und Kinder, nantan.“
„Ich weiß“, zeigte sich Nana geduldig, „aber sie haben es bei den Mexikanern besser als bei uns. Uns stehen harte Zeiten bevor, und viele von uns werden sterben.“
„Enju“, stimmten die Krieger zu.
„Helft den anderen, die Toten zu begraben“, trug Nana den beiden Männern auf. „Und beeilt euch! Auch wenn die Soldaten nicht mehr in der Nähe sind, dürfen wir keine Zeit verlieren. Bald wird es in dieser Gegend von Weißaugen und Mexikanern wimmeln, und wir sind noch zu schwach, um gegen ihre Feuerwaffen und ihre donnernden Rohre anzukommen.“
Die beiden Krieger nickten und stiegen von den Pferden, um ihren Stammesbrüdern bei der traurigen Arbeit zu helfen. Auch Nana wäre sich nicht zu schade dafür gewesen, aber sein Rheuma war in der letzten Stunde wieder schlimmer geworden, und er wagte nicht aus dem Sattel zu steigen. Stattdessen lenkte er seinen Braunen an den Rand der Senke, um nach Blanco und dessen drei Begleitern Ausschau zu halten. Die vier Krieger waren schon seit einer Stunde unterwegs, und er wurde langsam ungeduldig. Vielleicht waren sie von einer Nachhut der mexikanischen Soldaten überrascht worden?
Nanas Sorge war unbegründet. Er wartete keine fünf Minuten, als Hufschlag erklang und Blanco zwischen zwei Felsen auftauchte. Er war allein.
Der alte Apache blickte ihn fragend an.
„Überlebende“, berichtete Blanco knapp, „sie lagern in einem ausgetrockneten Flussbett, nicht weit von hier.“
„Wie viele?“
„Dreizehn. Mangus ist bei ihnen.“
Mangus war der Sohn des legendären Anführers Mangas Coloradas und galt bei einigen Apachen als legitimer Nachfolger des toten Victorio. Nana hielt nicht viel von dein jungen Krieger, lieber noch hätte er den verschlossenen Blanco oder den bedächtigen Kaytennae an der Spitze des Stammes gesehen, aber er hatte nie mit den Kriegern über dieses Thema diskutiert und auch selbst keinen Anspruch geltend gemacht. Er hatte sich während der vergangenen Jahre nicht in die Stammespolitik eingemischt und wollte es auch weiter so halten.
„Auch Nahilzan und mein Bruder Suldeen sind am Leben“, sagte Blanco, „sie sind beide unverletzt.“
„Wie viele Krieger?“
„Fünf“, antwortete Blanco. „Fünf Krieger, sechs Frauen und zwei Kinder. Viele sind verletzt. Zwei Frauen und ein Kind sind wahrscheinlich schon tot, während ich dies sage.“
„Ist Lozen bei den Frauen?“
Lozen gehörte zu den wenigen Frauen, die mit den Männern auf den Kriegspfad gingen und an den Beratungen der erfahrenen Männer teilnahmen. Sie verfügte über besondere Kräfte und hatte vor dein Massaker als unverletzbar gegolten.
„Die Medizinfrau ist nicht da“, vermied es Blanco, den Namen der Frau auszusprechen, ein sicheres Zeichen dafür, dass er sie für tot hielt. „Niemand hat sie gesehen.“
Nana senkte betrübt den Kopf. „Ich werde ihre Gebete vermissen, ihre Gebete und ihre heiligen Lieder.“
„Was haben ihr diese Gebete und Lieder genützt?“, fragte Blanco sarkastisch. „Die Mexikaner haben sie getötet.“
„Ich habe sie nicht bei den Toten gesehen.“
Blanco deutete in die Senke hinab. „Viele Körper sind verbrannt“, erwiderte er, „sie ist von uns gegangen.“
„Du hast recht“, sagte Nana leise. Er schwieg ein paar Sekunden lang und fuhr dann fort: „Hast du deine Begleiter bei den Verwundeten gelassen?“
Blanco nickte nur.
„Enju“, meinte Nana. Er hob den Kopf. „Wenn die Sonne hinter den Bergen versinkt, reiten wir zu ihnen.“
Diesmal machte sich Blanco nicht einmal die Mühe zu nicken. Er trieb sein Pferd mit einem leichten Schenkeldruck an und lenkte es zu den anderen Kriegern in die Senke. Dort stieg er ab und zündete sich eine Zigarre aus Eichenblättern an, bevor er ihnen half, die Toten mit Steinen zu bedecken.
Nana blickte ihm nicht nach. Seine Augen suchten den rosafarbenen Himmel über den fernen Bergen. Irgendwo dort oben schwebte Yusn, der allmächtige Gott der Apachen, und lenkte das Schicksal seines Volkes. Hatte er sich wirklich von ihnen abgewendet, wie einer der jüngeren Krieger behauptet hatte? Oder spielte er nur ein seltsames Spiel, das seine irdischen Kinder nicht verstanden? Nana wusste keine Antwort.
2
Helles Mondlicht lag über den Hügeln, als Nana und seine Krieger aus der Senke ritten. Sie hielten sich im Schatten der Felsen und blieben auf der Spur der mexikanischen Soldaten, damit ihre Verfolger nicht herausbekamen, in welche Richtung sie geritten waren. Nana war viel zu lange auf dem Kriegspfad, um nicht zu wissen, dass die Amerikaner auch vor der mexikanischen Grenze nicht haltmachten. Immer wieder hatten die Blauröcke versucht, ihr Versteck in der Sierra Madre ausfindig zu machen. Die Apachenscouts der Armee würden zwar früher oder später auf die Spuren der Überlebenden stoßen, aber dann wollten Nana und seine Leute schon so viel Vorsprung haben, dass sie nicht mehr eingeholt werden konnten.
Blanco ritt an der Spitze, weil er wusste, wo sich die Überlebenden des Massakers befanden. Seine Miene war grimmig, und er beherrschte sich nur mühsam. Am liebsten wäre er den mexikanischen Soldaten sofort gefolgt, um sie anzugreifen und für den Mord an Victorio zu bestrafen. Aber er wusste genauso gut wie alle anderen, dass die Mexikaner einen zu großen Vorsprung hatten und weit in der Übermacht waren. Er würde seinen Zorn an irgendwelchen Siedlern oder Schafhirten auslassen, die sie auf ihrem Weg in die Sierra Madre trafen.
Nach einer halben Stunde erreichten sie das ausgetrocknete Flussbett, in dem die Überlebenden lagerten. Mangus begrüßte seine Stammesbrüder stumm und deutete auf zwei leblose Gestalten neben einem Felsbrocken. „Eine Frau und ein Kind sind gestorben“, sagte er, „sie hatten zu viel Blut verloren.“
„Wie geht es den anderen?“, fragte Nana.
„Suldeen ist an der Schulter verletzt“, antwortete der junge Krieger, „aber es ist nicht schlimm. Sonst sind alle gesund. Aber wir haben keine Pferde.“
Nana deutete auf die schattenhaften Umrisse seiner Krieger. „Ihr könnt bei uns aufsitzen. Wir reiten in die Schlucht der flüsternden Winde und bereiten uns auf den Krieg vor.“
„Du willst dich an den Mexikanern rächen?“
„An allen Weißaugen.“
„Wann reiten wir auf den Kriegspfad?“
„Wenn die Kakteen blühen.“
Blanco ritt neben seinen Anführer. Seine Augen blitzten, und seine rechte Hand umklammerte den Sharps-Karabiner, den er quer über dem Sattel liegen hatte. „Warum nicht früher? Warum willst du warten, bis die Mexikaner in ihr Versteck zurückgekehrt sind?“
„Wir brauchen Pferde“, erwiderte Nana, „wir brauchen Vorräte und Munition. Kein tsi-he-nde soll mehr sterben, weil er schlecht ausgerüstet auf den Kriegspfad geritten ist.“
„Woher willst du Pferde und Munition bekommen?“ fragte Blanco, obwohl er die Antwort schon wusste.
Nana lächelte. „Von den Mexikanern.“
„Enju“, sagte Blanco, „ich werde den ersten Trupp führen. Ich werde diesen Mexikanern zeigen, was es heißt, wehrlose tci-he-nde wie Tiere abzuschlachten.“
„Sobald wir die Frauen und das Kind ins Versteck gebracht haben“, meinte Nana. Er brannte selbst darauf, die Mexikaner für das Massaker zu bestrafen, hatte sich aber besser unter Kontrolle als der junge Blanco. Im ersten Zorn war noch nie ein erfolgreicher Angriff geführt worden, dazu musste man ausgeruht sein. In zwei, drei Tagen, wenn der Schmerz abklang und der erste Zorn verraucht war, wollte er den ersten Trupp auf den Kriegspfad schicken, um Pferde und Vorräte zu besorgen. In den Krieg gegen die Amerikaner wollte er erst ziehen, wenn Ausrüstung und Vorräte für ein paar Monate reichten. Und wenn die Amerikaner am wenigsten damit rechneten.
Mangus weckte die schlafenden Frauen und das Kind und bedeutete ihnen, zu den Kriegern in den Sattel zu steigen. Er brauchte ihnen nicht zu sagen, dass sie sich ruhig verhalten sollten, sie lebten lange genug in der Wildnis, um das selbst zu wissen. Obwohl einige Späher die Gegend nach feindlichen Soldaten abgesucht hatten, war es immer noch möglich, dass sich einige Mexikaner in der Nähe aufhielten, und die wollte man nicht unbedingt im Rücken wissen. In ihrer jetzigen Verfassung wäre ein Kampf nicht gut für die Apachen gewesen.
Sie ritten einer hinter dem anderen aus dem ausgetrockneten Flussbett. Bis zu den Ausläufern der Sierra Madre waren es ungefähr fünfzig Meilen und zur Schlucht der flüsternden Schatten weitere zwanzig, aber sie hofften, das Versteck am frühen Morgen zu erreichen. Sie ritten nicht so langsam wie die Weißaugen, selbst wenn die Pferde schwerer zu tragen hatten, und niemand kannte sich in den Bergen so gut aus wie die Apachen.
Der Ritt verlief ohne Zwischenfälle. Sie begegneten keinem Menschen und erreichten die Sierra Madre mit der Sonne im Rücken. Sie zogen durch Schluchten und Täler und rasteten nur einmal an einer versteckten Quelle, um ihre Wasserflaschen aufzufüllen. Keiner sprach, alle waren in Gedanken versunken, trauerten um Victorio und seine Krieger oder verzehrten sich in wilden Rachegedanken wie Blanco, der selbst an der Quelle im Sattel blieb und sich nur kurz nach vorn beugte und die Flasche füllte. Er wollte keine Zeit verlieren und so schnell wie möglich das Versteck erreichen. Wenn die Sonne zum zweiten Mal aufging, wollte er einige Krieger um sich sammeln und einige Farmen der Mexikaner überfallen. Er brannte darauf, sein Messer in die Kehle eines Feindes zu stoßen.
Im Versteck wurden sie von Juh und einigen Familien empfangen, die den Winter in der Sierra Madre verbringen wollten. Juh war ein untersetzter Krieger, der schon mehrmals auf den Kriegspfad geritten war und zu den erfahrensten Kämpfern der Apachen gehörte. Er wusste noch nichts von dem Massaker in den Tres Castillos und zog sich verbittert in sein wickiup zurück, als Nana und seine Leute davon berichteten. Einige Frauen warfen sich zu Boden und stimmten Klagelieder an.