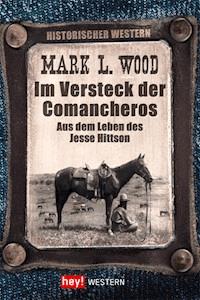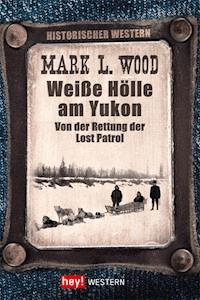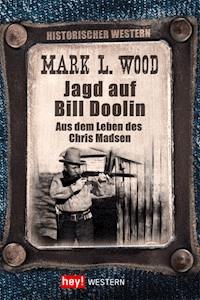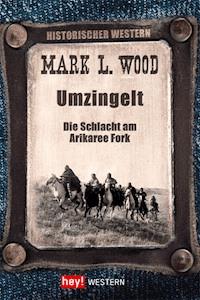1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HEY Publishing GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historische Western
- Sprache: Deutsch
Baylis John Fletcher weiß nicht, worauf er sich einlässt, als er sich von dem Rancher Tom Snyder und seinem Trailboss als Cowboys anheuern lässt. Weil es in Texas noch keine Eisenbahn und Verladebahnhöfe gibt, haben sie vor, zweitausend Rinder über den Chisholm Trail nach Kansas und über den Western Trail weiter nach Wyoming zu treiben. Ein wagemutiges Unternehmen, das einige Männer das Leben kosten wird. Doch einen Abenteurer wie Fletcher schrecken die Gefahren nicht ab. Wenn er einen Job annimmt, führt er ihn auch zu Ende, auch dann, wenn er es unterwegs mit einigen gefährlichen Banditen zu tun bekommt. Der historische Western setzt dem jungen Baylis John Fletcher, einem Draufgänger aus Kansas, und allen anderen Cowboys ein Denkmal.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 150
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mark L. Wood
Treibt sie nach Norden!
Copyright der eBook-Ausgabe © 2013 bei Hey Publishing GmbH, München.
Originalausgabe © 2006, BASTEI, Bergisch Gladbach. Erschienen in der Reihe Western-Legenden.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Mark L. Wood wird vertreten durch die Verlagsagentur Lianne Kolf.
Covergestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Coverabbildung: FinePic®, München
Autorenfoto: © privat
ISBN: 978-3-942822-48-0
Besuchen Sie uns im Internet:
www.heypublishing.com
www.facebook.com/heypublishing
Baylis John Fletcher weiß nicht, worauf er sich einlässt, als er sich von dem Rancher Tom Snyder und seinem Trailboss als Cowboys anheuern lässt. Weil es in Texas noch keine Eisenbahn und Verladebahnhöfe gibt, haben sie vor, zweitausend Rinder über den Chisholm Trail nach Kansas und über den Western Trail weiter nach Wyoming zu treiben. Ein wagemutiges Unternehmen, das einige Männer das Leben kosten wird. Doch einen Abenteurer wie Fletcher schrecken die Gefahren nicht ab. Wenn er einen Job annimmt, führt er ihn auch zu Ende, auch dann, wenn er es unterwegs mit einigen gefährlichen Banditen zu tun bekommt.
Der historische Western setzt dem jungen Baylis John Fletcher, einem Draufgänger aus Kansas, und allen anderen Cowboys ein Denkmal.
Der bullige Fremde stieß die Pendeltüren des Saloons auseinander und blickte sich herausfordernd um. Er trug die blaue Militärjacke der Nordstaatler und eine Sergeantenmütze. Seine rechte Hand schwebte über dem Army Colt in seinem Holster. Abfällig musterte er den jungen Cowboy am Tresen. »Ich hab gehört, hier treibt sich ein stinkender Texaner rum, der mit den Snyders eine Herde nach Norden treiben will!«
Die Bemerkung reichte, um Baylis John Fletcher das Blut ins Gesicht zu treiben. Selbst sein Vater und sein Großvater, die beide Prediger gewesen waren, hätten sich eine solche Beleidigung nicht gefallen lassen. Schon gar nicht, wenn sie von einem arroganten Yankee kam, der noch nicht gemerkt zu haben schien, dass der Bürgerkrieg seit vierzehn Jahren vorbei war.
»Das Einzige, der hier stinkt, hat einen blauen Rock an und erinnert mich an das Wildschwein, das mir vor zwei Wochen in der Brasada vor der Flinte gelaufen ist!«, konterte der 19-Jährige. Er war ein hagerer Mann mit kantigen Gesichtszügen und tief liegenden Augen. »Wissen Sie eigentlich, wo Sie hier sind, Mister? Sie sind in Texas. San Felipe, Texas. Und hier trägt man weder einen blauen Rock noch spricht man wie ein verdammter Yankee.« Er zwang sich zu einem Grinsen. »Es sei denn, man will sich eine deftige Abreibung holen!«
Der Yankee brauchte keine weitere Einladung. Mit einem Aufschrei zog er seinen Colt. »Das wirst du mir büßen, du verdammter Rebell!«
Doch darauf hatte Fletch nur gewartet. Mit der Rechten schlug er dem Angreifer die Waffe aus der Hand. Der Colt polterte über den harten Boden.
Fletch setzte nicht sofort nach, sondern nutzte die Schrecksekunde des Yankees, um seinen Waffengurt abzuschnallen. Er reichte ihn dem Wirt, einem blassen Mann mit sorgfältig gescheitelten Haaren, und ließ seinen Widersacher dabei nicht aus den Augen.
Der Wirt nahm ihn widerwillig und duckte sich hinter den Tresen. »Heilige Mutter Gottes!«, betete er leise. Er bekreuzigte sich und schloss die Augen.
Ohne Vorwarnung wirbelte Fletch herum und drosch dem Yankee eine rechte Gerade auf die Kinnspitze. Doch der bullige Mann war wendiger, als er gedacht hatte, und drehte sich rechtzeitig weg, sodass ihn der Hieb nur streifte. Die Linke, die Fletch seiner Geraden folgen ließ, traf die Deckung des Yankees und richtete kaum Schaden an.
Der Mann lachte ihn aus. »Für einen verdammten Rebellen bist du nicht mal übel«, stieß er gehässig hervor. »Aber um mich von den Beinen zu holen, musst du schon früher aufstehen!«
Sein Lachen verschwand, und in seine Augen trat blanke Mordlust. Ihm schien es nichts auszumachen, dass einige Finger seiner rechten Hand von dem heftigen Stiefeltritt, den er abbekommen hatte, bluteten. Mit einem wütenden Grunzlaut stürzte er sich auf Fletch. Mit beiden Fäusten drosch er auf den Texaner ein. Wie die Hiebe eines Vorschlaghammers trafen seine Schläge das Gesicht des Cowboys.
Fletch steckte einige schwere Treffer ein und taumelte gegen den Tresen. Blut lief ihm von der rechten Augenbraue über die Wange. Er keuchte schwer.
Instinktiv duckte sich Fletch unter einer harten Rechten hinweg. Durch den Schwung verlor der Yankee den Halt und stolperte ihm entgegen. Fletch empfing ihn mit zwei harten und gezielten Schwingern, die gegen den Kiefer des Mannes krachten.
Der Yankee blieb stehen, als wäre er gegen eine Wand gelaufen. Im nächsten Augenblick schüttelte er sich wie ein Stier, dem man ein Lasso übergeworfen hat, und ging erneut auf Fletch los. Sein Gesicht war vor Wut verzerrt.
Doch diesmal war der Texaner besser vorbereitet. Er empfing den Yankee mit erhobenen Fäusten, blockte zwei Schläge ab und ging seinerseits zum Angriff über. Mit zwei Hieben blieb er in der Deckung hängen, aber sein dritter Schlag traf den Mann erneut am Kinn.
Der Yankee prallte rückwärts gegen einen Stuhl, riss ihn um und stürzte auf den Lehmboden. Nur wenige Schritte neben seinem Revolver blieb er liegen.
Beinahe zu spät erkannte Fletch die drohende Gefahr. Nur der viel zu langsamen Reaktion des Mannes verdankte er sein Leben. Denn als der Yankee den Colt entdeckte und danach griff, war Fletch bereits bei ihm und trat ihm die Waffe aus der Hand. Der Army Colt schlidderte quer durch den Raum.
Fletch wartete geduldig, bis sich sein Gegner vom Boden hochgestemmt hatte. Im rechten Auge des Yankees war Blut, und er konnte kaum noch sehen. Um dem Spiel möglichst bald ein Ende zu bereiten, legte Fletch seine ganze Kraft in die nächsten Schläge. Er landete einige harte Treffer an der linken Wange und der Stirn des Yankees. Stöhnend wankte der Mann nach hinten, kaum noch fähig, aufrecht zu stehen. Fletch schlug noch einmal zu und schickte ihn endgültig auf die Bretter.
Vollkommen erledigt wankte er anschließend zum Tresen. Auch er hielt sich kaum noch auf den Beinen. Er griff nach dem nassen Lappen, den der Wirt ihm reichte, und wischte sich vorsichtig das Blut aus den Augen.
»Verdammt! Der Yankee hat einen harten Schlag!«, keuchte er. »Geben Sie mir ein Bier!«
Der Wirt schob ihm ein volles Glas hin. Seine Miene war besorgt. »Hier, mein Freund! Das geht aufs Haus!« Er berührte seufzend seinen Schnurrbart. »Und dann würde ich so schnell wie möglich aus San Felipe verschwinden!« Er deutete auf den bewusstlosen Yankee. »Wissen Sie, wer das ist?«
»Ein Yankee, was sonst?«
»Das ist Toby Larimer, der älteste Sohn von John W. Larimer!« Er nahm sein Geschirrtuch und tupfte sich den Schweiß von der Stirn. »Und da Sie anscheinend nicht aus dieser Gegend stammen und nicht wissen, wer John W. Larimer ist, will ich Ihnen was erzählen: Larimer kam vor zehn Jahren aus New York und übernahm die Rafter L Ranch. Einer dieser reichen Yankees, die nach dem Bürgerkrieg nach Texas zogen und nur darauf warteten, dass einige Rancher unter ihrer Schuldenlast zusammenbrachen. Er bekam die Rafter L für einen Spottpreis. Der frühere Besitzer der Ranch schoss sich einige Tage später eine Kugel in den Kopf.«
Fletch nickte stöhnend. Er hielt den feuchten Lappen auf seine Platzwunde gepresst und trank mit der anderen sein Bier. »Solche Storys kenne ich. Der Ranch, auf der mein Onkel arbeitete, ging's genauso. Das waren schlimme Zeiten!«
»Sind es immer noch, mein Freund.
Manchmal kommt es mir so vor, als wäre der Krieg noch immer nicht vorbei. Aber gegen John Larimer kommt niemand an. Nur die Snyders behaupten sich gegen ihn. Deshalb versucht Larimer mit allen Mitteln, sie in die Knie zu zwingen. Er hat eine Mannschaft von Halsabschneidern und Viehdieben angeworben, um sie in den Bankrott zu treiben, und ich weiß nicht, wie lange die Snyders noch durchhalten können!«
»Ich hab' keine Angst vor ihm!«, erwiderte Fletch trotzig. »Ich hab' vor niemand Angst, schon gar nicht vor einem stinkreichen Yankee! Wenn ihm was nicht passt, soll er nur kommen!«
»Ich würde trotzdem verschwinden. Wenn er hört, dass Sie seinen Sohn zusammengeschlagen haben, hetzt er den Sheriff auf Sie, und dann haben Sie nichts zu lachen! Der Sheriff und der Richter tanzen nach seiner Pfeife!«
»So ist es doch immer«, wusste Fletch aus Erfahrung. »Einer befiehlt, und die anderen tun das, was er will.« Er trank sein Bier aus und warf den blutigen Lappen ins Spülwasser. »Gibt's in diesem verdammten Nest einen Arzt?«
»Schräg gegenüber, gleich neben der Schmiede.« Der Wirt reichte Fletch den Waffengurt und beobachtete, wie der Texaner ihn um die Hüften schlang und die Gürtelschnalle schloss. Aus der Wunde an seiner Stirn tropfte Blut. »Seien Sie vorsichtig!«, warnte der Wirt. »Larimer ist gefährlich! Und Junior, sein jüngster Sohn, ist ein Hitzkopf, der kriegt bei jeder Lappalie einen Tobsuchtsanfall! Außerdem hat er einen Killer in seiner Mannschaft. Wesley Moss. Ein ehemaliger Anwalt, der seine Verlobte umgebracht haben soll. Aber das konnte ihm niemand beweisen. Der Kerl schießt besser als Billy the Kid!«
»Ich werde mich vorsehen«, versprach Fletch und verließ den Saloon.
Es war Mittag, und auf den Gehsteigen waren kaum Leute, als Fletch die Straße überquerte. Aber er konnte erkennen, wie sich einige Vorhänge bewegten. In einem Nest wie San Felipe war selten etwas los, und jeder Fremde erregte Aufsehen, auch wenn noch niemand wissen konnte, dass er Toby Larimer bewusstlos geschlagen hatte.
Er erreichte das Haus des Arztes, ein schmuckloses Gebäude, von dem schon die Farbe abblätterte, und klopfte . Neben der Tür hing ein weißes Schild mit der Aufschrift »Jack McAllister, Doctor, M. D. Alle Krankheiten.«
Ein Mädchen öffnete. Sie war höchstens achtzehn und so hübsch, dass ihm der Atem wegblieb. Das konnte natürlich auch daran liegen, dass er die letzten paar Monate als Zureiter für die Armee gearbeitet und kaum ein Mädchen zu Gesicht bekommen hatte. Ihr Gesicht war lebhaft, die Lippen voll und sinnlich, und ihre Augen so dunkel, dass er sich kaum von ihrem Anblick losreißen konnte. Ihr schwarzes Haar trug sie zu einem Knoten gebunden.
Nach einer Schrecksekunde nahm er seinen Hut ab. »Entschuldigen Sie, Ma'am! Ist der Doktor zu Hause?«
Sie sah seine Platzwunde und das Blut, das immer noch aus der Öffnung quoll, und erschrak. »Um Himmels willen! Das sieht ja furchtbar aus!« Sie schüttelte den Kopf. »Nein, meine Eltern sind bei Mrs. Bannister, die bekommt Zwillinge. Meine Mutter ist Hebamme.« Sie zog die Tür auf. »Aber kommen Sie doch rein, ich kümmere mich um Sie!«
Fletch folgte ihr zögernd. Es schickte sich nicht, zu einer Dame ins Haus zu gehen, wenn sie allein war. So hatte er es bei der Tante gelernt, bei der er aufgewachsen war. Einer etwas altmodischen Lady, wie er inzwischen wusste, aber in diesem Punkt war sie immer sehr bestimmt gewesen.
»Kommen Sie!«, ermunterte ihn das Mädchen. »Ich beiße nicht.« Ein amüsiertes Lächeln brachte ihre Augen zum Strahlen. »Setzen Sie sich, Mister!«
Er betrat das Behandlungszimmer, einen nüchternen Raum mit einem Medizinschrank, einem Regal mit Fachbüchern und einer Liege, und setzte sich auf einen der beiden Stühle, die neben dem Schrank an der Wand standen.
Sie nahm einen Tupfer aus einem Behälter und träufelte etwas Jod darauf. Vorsichtig säuberte sie die Wundränder. »Tut mir Leid, aber das muss ich nähen«, kündigte sie leise an. »Keine Angst, ich helfe meinem Vater sehr oft. Ich weiß, wie man so etwas macht.«
Mit gemischten Gefühlen beobachtete er, wie sie Nadel und Faden aus dem Wandschrank holte. »Und Sie sind sicher, dass Sie das können, Ma'am?«
»Lassen Sie das alberne Ma'am und sagen Sie Ella zu mir«, erwiderte sie fröhlich. Sie musterte ihn. »Sie sehen wie ein Cowboy aus, Mister. Arbeiten Sie auf einer Ranch in der Gegend?«
»Baylis John Fletcher«, stellte er sich vor. »Fletch … das klingt besser. Stimmt, ich bin Cowboy. Die letzten paar Monate hab ich Pferde für die Armee zugeritten. Aber jetzt ist endlich wieder Frühjahr, und die Rancher stellen neue Leute ein. Wenn alles klappt, hab ich in ein paar Tagen wieder eine Stellung. Die Snyders wollen auf den Trail gehen.«
»Das stimmt«, antwortete Ella. »Meine Eltern sind mit Tom Snyder befreundet. Der Rancher will eine große Herde nach Wyoming treiben.« Sie beugte sich mit der Nadel über ihn. Als sie den beunruhigten Ausdruck in seinen Augen sah, lächelte sie aufmunternd. »Keine Angst! Ich bin vorsichtig. Nur ein paar Stiche, dann haben Sie's überstanden!«
Sie machte sich an die Arbeit. Es tat höllisch weh, und Fletch hätte am liebsten wie ein wilder Stier gebrüllt, aber er wollte sich nicht vor dem Mädchen blamieren und biss die Zähne zusammen. Mit geschlossenen Augen hielt er durch, bis sie die feine Naht mit einem Knoten verschloss und seufzte: »Fertig! War doch gar nicht so schlimm, oder?«
Fletch hatte Tränen in den Augen. Doch die Wunde blutete nicht mehr, und er fühlte sich wesentlich besser. »Haben Sie einen Schluck Whiskey im Haus?«
Sie griff in den Arzneimittelschrank und reichte ihm eine Flasche. »Unsere Spezialmedizin«, erklärte sie vieldeutig, »die gibt es nur für tapfere Patienten, die nicht gleich in Ohnmacht fallen!«
Er nahm einen tiefen Schluck und leckte sich über die Lippen. »Wenn das so ist, lasse ich mir häufiger einen Schlag verpassen!« Er gab ihr die Flasche zurück und deutete auf die Wunde. »Das haben Sie wirklich gut gemacht, Ella, vielen Dank!«
Sie errötete leicht, stellte die Flasche zurück und brachte einen Handspiegel zum Vorschein. Sie hielt ihn Fletch vors Gesicht. »Na, wie gefallen Sie sich?«
Fletch betrachtete sein wettergebräuntes Gesicht mit dem kantigen Kinn und der hohen Stirn und grinste. Die Naht über seinen dunklen Augen ließ ihn verwegener als sonst erscheinen. »Einen Schönheitspreis werde ich damit wohl nicht gewinnen.«
»Ich hab Männer gesehen, die sahen wesentlich schlimmer aus als Sie«, erwiderte Ella. Mit ihren geröteten Wangen sah sie noch verführerischer aus.
»Wo? Auf dem Schlachtfeld?« Fletch lachte heiser und wurde verlegen, als er merkte, dass sie es ernst gemeint hatte. »Was bin ich Ihnen schuldig?«
Sie nannte einen Preis, und er drückte ihr eine Münze in die Hand. »Es … es war mir ein Vergnügen, Ella«, zwang er sich zu sagen. Er blickte ihr in die Augen, und sie erröteten beide. Verdammt, dachte er, sie ist das hübscheste Mädchen, das mir je über den Weg gelaufen ist! »Darf ich wiederkommen?«
Sie senkte den Blick und wartete ein paar Sekunden mit der Antwort. »Gern, Fletch! Aber nur, wenn Sie mir versprechen, dass ich Sie dann nicht nähen muss! Möchten Sie einen Kaffee?«
Er dachte an die Larimers, und was für einen Ärger es geben würde, wenn sie ihn im Haus des Doktors fanden, und schüttelte den Kopf. »Nein, vielen Dank, Ella. Aber ich komme wieder, das verspreche ich Ihnen! Sie sind …« Er wusste nicht, wie er sich ausdrücken sollte. »Ach, ich glaube,
ich werde Sie irgendwann heiraten, Ella!«
Fletch ging zur Tür und öffnete sie. Er hatte das Gefühl, eine große Dummheit begangen zu haben, aber zu seiner Überraschung sagte sie: »Ich werde auf Sie warten, Fletch! So long!«
Er ging zu seinem Pferd und war erleichtert, dass niemand aus dem Saloon gestürmt kam. Anscheinend war Toby Larimer noch immer bewusstlos. Als er in den Sattel gestiegen war und am Haus des Doktors vorbeiritt, sah er Ella im Türrahmen stehen. Sie lächelte …
An einem schmalen Nebenfluss des Guadalupe Rivers schlug Fletch sein Nachtlager auf. Die Sonne war bereits untergegangen, als er seine Decken unter einigen Cottonwoods ausrollte. Er kochte Kaffee über einem kleinen Feuer und briet das Kaninchen, das er unterwegs erlegt hatte. Die Zügel seines Wallachs hatte er um einen Weidenast am nahen Flussufer gebunden.
Das Zwielicht des schwindenden Tages lag über dem Land. Dunkle Schatten krochen über die Hügel. Über den Fluss wehte frischer Wind und raschelte im Mesquite und in den Blättern der Cottonwoods.
Fletch nahm den Kaffee vom Feuer und goss sich einen Becher ein. Seine Gedanken waren bei Ella. Er war immer ein Satteltramp gewesen und von einer Ranch zu nächsten geritten. Sie war das erste Mädchen, für das er bereit war, sein ruheloses Leben aufzugeben.
Plötzlich erklang dumpfer Hufschlag. Er stand auf und trat ein paar Schritte vom Feuer weg. Vier Männer kamen über einen Hügelkamm geritten. Obwohl ihre Gesichter im Schatten der breiten Hutkrempen lagen und in der Dämmerung kaum zu erkennen waren, ahnte er, um wen es sich handelte.
Die Larimers!
Seine Hand zuckte zum Colt, aber da waren die Männer schon heran. Sie zügelten ihre Pferde und richteten ihre Waffen auf Fletch, bevor er ziehen konnte. Aus ihren Augen sprach Verachtung. Man sah ihnen an, dass sie Fletch am liebsten umgelegt hätten. Nur einer verzog keine Miene.
Der Älteste hatte seine Winchester scheinbar achtlos auf den Oberschenkeln liegen und machte sich nicht die Mühe, den Texaner damit zu bedrohen.
»Zieh mit zwei Fingern den Revolver und wirf ihn zur Seite!«, befahl er.
Das muss John W. Larimer sein, der gefürchtete Rancher, dachte Fletch.
Der Mann war tadellos gekleidet und wirkte selbst im Sattel wie ein Gentleman. Sein Gesicht war knochig, die grauen Augen kalt und leblos. Er trug einen schwarzen Bowlerhut, der ihn auf den ersten Blick wie einen verwöhnten Stadtfrack aussehen ließ, aber der Eindruck täuschte. Der Mann aus Virginia war härter als mancher Westmann.
Fletch sah keine Chance. Langsam zog er die Waffe und schleuderte sie einen Meter zur Seite.
»Ist er das?«, fragte der Rancher.
»Das ist er«, bestätigte sein Sohn Toby. Er hatte die Sergeantenmütze weit nach vorn gezogen, ohne die Spuren der Schlägerei verstecken zu können. Sein Grinsen wirkte gequält. »Das ist der verdammte Rebell, der mich reingelegt hat! Soll ich ihn erschießen, Pa?«
»Nein«, erwiderte der Rancher. Er sah seinen Sohn nicht an. »Steck deinen Revolver ein und hol seinen Gaul!«
»Aber …«
»Tu, was ich dir sage!«
Toby Larimer gehorchte. Er stieg aus dem Sattel, ging zum Ufer und band den Wallach los. Der Blick, den er Fletch zuwarf, hätte einen Sioux töten können. Er spuckte abfällig ins Gras.
»Warum knallen wir ihn nicht ab?«, rief Junior, der jüngste Sohn des Ranchers. Seine Stimme war hoch und schrill und passte zu seinem kindlichen Gesicht. »Jede Wette, dass ich ihn mitten zwischen die Augen treffe!«