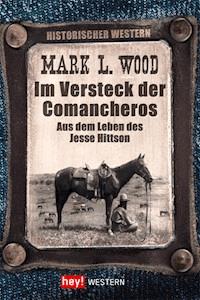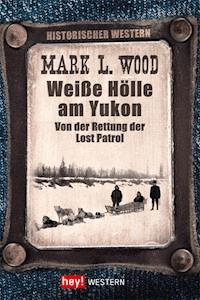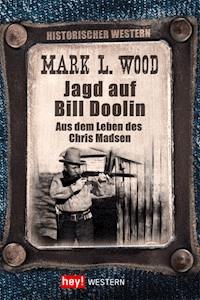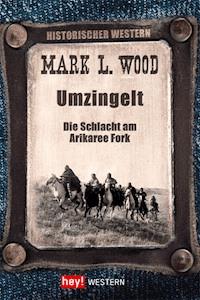1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HEY Publishing GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Apachenbanden terrorisieren Arizona. Apache Kid, ein ehemaliger Scout, hat den Mörder seines Vaters erschossen und wird zu sieben Jahren Zwangsarbeit in Yuma verurteilt. Mit ihm werden drei Stammesbrüder verhaftet. Auf dem Weg ins Gefängnis gelingt es ihnen, zwei Strafvollzugsbeamte zu töten und zu fliehen. Fast gleichzeitig machen vier andere Apachen das Land unsicher. Sie ermorden einen Rancher und setzen sich in die nahe Wüste ab. Sheriff John Henry S. Thompson nimmt die Verfolgung auf, obwohl er weiß, wie schlecht seine Chancen im Kampf gegen die zu allem entschlossenen Apachen stehen. Der authentische Roman schildert den scheinbar aussichtslosen Kampf von Sheriff John Henry S. Thompson im Sommer 1890.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mark L. Wood
Menschenjagd
Copyright der eBook-Ausgabe © 2013 bei Hey Publishing GmbH, München.
Originalausgabe © 2006, BASTEI, Bergisch Gladbach. Erschienen in der Reihe Western-Legenden.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Mark L. Wood wird vertreten durch die Verlagsagentur Lianne Kolf.
Covergestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Coverabbildung: FinePic®, München
Autorenfoto: © privat
ISBN: 978-3-942822-47-3
Besuchen Sie uns im Internet:
www.heypublishing.com
www.facebook.com/heypublishing
Zwei Apachenbanden terrorisieren Arizona. Apache Kid, ein ehemaliger Scout, hat den Mörder seines Vaters erschossen und wird zu sieben Jahren Zwangsarbeit in Yuma verurteilt. Mit ihm werden drei Stammesbrüder verhaftet. Auf dem Weg ins Gefängnis gelingt es ihnen, zwei Strafvollzugsbeamte zu töten und zu fliehen. Fast gleichzeitig machen vier andere Apachen das Land unsicher. Sie ermorden einen Rancher und setzen sich in die nahe Wüste ab. Sheriff John Henry S. Thompson nimmt die Verfolgung auf, obwohl er weiß, wie schlecht seine Chancen im Kampf gegen die zu allem entschlossenen Apachen stehen.
Der authentische Roman schildert den scheinbar aussichtslosen Kampf von Sheriff John Henry S. Thompson im Sommer 1890.
Gene Middleton hielt die Zügel in beiden Händen und spuckte einen Priem vom Kutschbock. »Mir wäre wohler, wir hätten die roten Halsabschneider schon in Yuma abgesetzt! Ich hab das verdammte Gefühl, die versuchen was!«
Sheriff Glenn Reynolds schlug mit der flachen Hand auf den Kolben seiner Schrotflinte. »Keine Angst! Wir haben sie mit Ketten gefesselt. Holmes passt auf sie auf! Und wenn alle Stricke reißen, hab ich noch meine Remington.«
Hinter ihm in der Kutsche saßen dreißig Jahre Yuma. Apache Kid und seine drei Komplizen waren jeder zu sieben Jahren und der mexikanische Pferdedieb zu zwei Jahre im Territorialgefängnis von Arizona verurteilt worden. Die Apachen hatten im Tiswin-Rausch zwei Stammesbrüder erschossen: »Einer der beiden hat meinen Vater ermordet«, hatte Apache Kid behauptet.
Die verurteilten Apachen waren dem Galgen nur um Haaresbreite entkommen. Einer der Gefangenen hatte Al Sieber, dem Chefscout der Generäle Crook und Miles, ins Fußgelenk geschossen und ihn für den Rest seines Lebens gezeichnet. Ausgerechnet Apache Kid sollte den Schuss abgefeuert haben. Der ehemalige Sergeant der Apachenscouts, der mit Sieber in den Krieg gegen Geronimo gezogen und von ihm öffentlich gelobt worden war.
Vor einer starken Steigung in den Pinal Mountains hielt Gene Middleton die Kutsche an. Sheriff Reynolds rief: »Aussteigen! So viele Leute schaffen die Pferde nicht!« Er sprang vom Kutschbock und öffnete die Tür. »Vorwärts ! Ausruhen könnt ihr in Yuma!«
Er wartete, bis Deputy Holmes mit zwei Apachen und dem Pferdedieb aus der Kutsche gestiegen war, und wandte sich an Apache Kid und Hos-cal-te. Sie waren am gefährlichsten und als einzige an Armen und Beinen gefesselt. »Ihr bleibt in der Kutsche!« Er überprüfte ihre Ketten und nickte zu frieden. »Fahr weiter, Gene!«, rief er dem Kutscher zu.
Die Kutsche mit Apache Kid und Hos-cal-te rumpelte die Steigung hinauf. Auf dem holprigen Trail schwankte sie bedenklich. Die schweren Räder wirbelten Kieselsteine da von.
»Heya! Heya! Vorwärts, ihr faulen Biester!«, trieb Gene Middleton die Zugpferde an.
In der Kutsche grinste Hos-cal-te zuversichtlich. »Yusn hat die Weißaugen mit Dummheit geschlagen«, dankte er dem Gott der Apachen. »Sonst würden sie nicht darauf warten, dass unsere Krieger ihnen die Ohren abschneiden!«
»Sheriff Reynolds ist ein guter Mann«, widersprach Apache Kid. Er hieß eigentlich Hash-ky Bay-nay-ntayl, aber das war selbst den meisten Apachen zu kompliziert. »Holmes allerdings ist ein Narr.«
W.A. »Hunkeydory« Holmes war der Deputy von Sheriff Reynolds, ein junger Mann mit wenig Erfahrung, der die wilden Apachen um Geronimo und Victorio nur aus den Erzählungen seines Vaters kannte. Vielleicht machte er deshalb den Fehler, Say-es den Kolben seiner Winchester in den Rücken zu stoßen.
»Vorwärts!«, fauchte er den Apachen an. »Oder muss ich dir erst Beine machen?«
Say-es war mit dem alten Nana auf den Kriegspfad geritten und wusste, wie man sich aus einer misslichen Lage befreite. Er fuhr blitzschnell herum und riss Holmes die Winchester aus der Hand. Auch mit gefesselten Händen gelang es ihm, dem verdutzten Deputy den Lauf über den Kopf zu schlagen.
Holmes sank benommen zu Boden und blieb winselnd liegen. Er war zum ersten Mal in einen Kampf auf Leben und Tod verwickelt und nahe daran, die Nerven zu verlieren. Er zitterte wie Espenlaub und starrte den Apachen an.
Sheriff Reynolds riss sofort die Remington hoch. Er hatte bereits den Finger am Abzug und wollte abdrücken, war aber zu langsam für den wieselflinken El-cahn. Der Apache trat ihm mit voller Wucht gegen das Knie und entwand ihm die schussbereite Flinte.
Say-es erkannte, dass ihm von Holmes keine Gefahr drohte und legte auf den Sheriff an. Die Kugel fuhr krachend aus dem Lauf und traf Sheriff Reynolds in die Brust. Er sank stöhnend zu Boden und starb mit dem Gedanken an seine Eltern und Geschwister.
Als Say-es den Lauf auf Holmes richtete, bemerkte er verwundert, dass der Deputy tot war. Er war aus Angst, von den Apachen gefoltert zu werden, an einem Herzschlag gestorben. »Herz versagen aus unbekannter Ursache«, würde der Coroner einige Tage später in seinem offiziellen Bericht vermerken.
»Feigling!«, schimpfte Say-es.
Er kniete neben dem Deputy nieder und kramte die Schlüssel aus dessen Jackentasche. Hastig befreiten die Apachen sich gegenseitig von den Handschellen. Mit einem verächtlichen Blick, weil er ihnen nicht geholfen hatte, öffnete Say-es auch die Fesseln des mexikanischen Pferdediebs. »Verschwinde!«, fauchte Say-es ihn an.» Vamonos!«
Mit dem Gewehr und der Schrotflinte rannten die befreiten Apachen hinter der Kutsche her. »In den Wald!«, befahl Say-es hastig. »Der Kutscher darf uns nicht sehen! Er hat einen Revolver!«
Sie rannten parallel zur Kutschenstraße zwischen den Bäumen hindurch und erreichten die Passhöhe, auf der Gene Middleton die Kutsche angehalten hatte. Nervös beobachteten die Krieger, wie der Kutscher verwundert vom Bock stieg.
»He, Sheriff!«, hörten sie ihn rufen. »Gibt es Ärger? Haben Sie einen der Mistkerle erschossen?«
Aus dem Wald kam keine Antwort. Nur das Rauschen des Windes in den dicht stehenden Kiefern war zu hören.
»Sheriff? Alles in Ordnung?«
Als wieder keine Antwort kam, griff der Kutscher nach seinem Revolver. Er hatte ihn nicht einmal halb aus dem Holster, als Apache Kid und Hos-cal-te gemeinsam aus der Kutsche sprangen und ihn zu Boden warfen. Die Waffe entglitt seinen Händen und fiel in den Dreck. Der kehlige Kriegsruf der Coyotero-Apachen schallte durch den Wald.
Say-es und Hos-cal-te rannten auf den Trail zurück und stellten den Kutscher, bevor er aufspringen und sich ins Unterholz davonmachen konnte.
»Ugashe!«, sagte Say-es. Er lud das Gewehr durch und jagte dem zu Tode erschrockenen Kutscher eine Kugel ins Gesicht. Der weiße Mann sank schwer verwundet zu Boden, lebte aber noch.
Das Echo des Schusses verhallte in der kalten Luft. Obwohl die Wüste nur wenige Stunden entfernt war, wurde es in den Bergen im November bitter kalt. Mit dem leisen Wind wehten so gar einige Schneeflocken über den Bergpass.
Say-es schloss die Fesseln von Apache Kid und Hos-cal-te auf und warf die Schlüssel in die Kutsche. Grinsend hob er den Stetson des Kutschers auf und stülpte ihn sich auf den Kopf. Erst jetzt erkannte er, dass der weiße Mann noch lebte. Grinsend griff er nach einem Stein. Der Kutscher war es nicht wert, dass man eine weitere Kugel an ihn verschwendete. »Stirb!«, rief er laut.
Er holte aus und wollte den Stein auf den wehrlosen Kutscher nieder sausen lassen, aber Apache Kid hielt ihn zurück. »Dah«, stieß der ehemalige Scout hervor, »nein. Er ist es nicht wert.«
»Du willst ihn am Leben lassen?«, fragte Say-es erstaunt. »Geronimo hätte diesem Mann das Herz aus dem Körpern gerissen und davon gegessen!«
»Geronimo sitzt im Haus mit den Gitterstäben«, sagte Apache Kid trocken.
»Lass ihn«, bekräftigte auch El-cahn. »Er lebt sowieso nicht mehr lange. Er soll den Soldaten sagen, wie dumm der Sheriff und sein Gehilfe gewesen sind.«
Hos-cal-te massierte seine schmerzenden Handgelenke und wandte sich an Say-es. »Soll ich die Zugpferde aus spannen, nantan?«, fragte er. Wie El-cahn erkannte auch er Say-es als Anführer an. »Sobald die Weißaugen merken, dass wir geflohen sind, rufen sie die Soldaten. Sie werden uns jagen! Alle Weißaugen werden uns jagen! Es wird eine Belohnung geben!«
»Nein«, bestimmte Say-es, »die Kutschenpferde sind schlecht. Viel zu schwer und zu träge. Ohne Pferde sind wir schneller. Und wir hinterlassen weniger Spuren.« Er schulterte die Winchester des Deputys. »Gehen wir!«
Apache Kid machte keine Anstalten, die beiden Krieger zu begleiten.
»Was ist mit dir?«, fragte Say-es verwundert. »Willst du warten, bis die Soldaten kommen und dich aufhängen?«
»Ich gehe einen anderen Weg«, entschied der ehemalige Scout. »Ich bin Apache Kid, First Sergeant der Apachenscouts, und habe versprochen, niemals mehr Krieg zu führen. Adios!«
Ohne seine Stammesbrüder eines weiteren Blickes zu würdigen, hob er den Revolver des verwundeten Kutschers auf, steckte ihn in aller Seelenruhe in seine Tasche und ging davon.
Die anderen Apachen waren sprachlos und starrten ihm nach, bis er zwischen den Bäumen verschwunden war.
»Was soll das?«, fragte El-cahn verwundert. »Wie will er in diesem Land leben, ohne Krieg gegen die Weißaugen zu führen? Was hat er vor, Brüder?«
»Er ist verrückt«, sagte Say-es.
»Mucho loco«, bestätigte Hos-cal-te auf spanisch, der zweiten Muttersprache der meisten Apachen.
Dann verließen auch er und seine Begleiter den Trail. Nur das Wimmern des Kutschers erinnerte noch daran, was auf dem Pass geschehen war.
John Henry Thompson trat vor sein Blockhaus, die Winchester in beiden Händen, und bückte nervös auf die vier Pferde im Corral. Irgendetwas stimmte nicht. Die Pferde waren unruhig und liefen schnaubend in der Koppel um her.
Auch Dusty, sein zottiger Hund, benahm sich anders als sonst. Er war kein besonders guter Wachhund, schlief meist, bis ihm die Sonne ins Gesicht schien, und erhob sich erst, wenn er frisches Wasser und sein Fressen bekam. An diesem Morgen stand er neben dem Brunnen, die Ohren aufgestellt und den Blick auf die Felsen jenseits des Webber Creeks gerichtet.
Selbst die Hühner vor der Scheune gackerten so nervös, als wäre ein fremder Hahn auf dem Hof erschienen. Sie liefen ständig im Kreis und stoben ängstlich davon, als Dusty leise knurrte.
Thompson kehrte ins Blockhaus zurück. Er war ein schlanker Mann mit einem schmalen Gesicht und wachen Augen. Seine Haare waren kurz geschnitten. Er trug einfache Baumwollhosen, ein gemustertes Hemd und Stiefel. Außer seiner Frau hatte ihn selten jemand lachen gesehen, und auch jetzt war ihm nicht danach zumute. »Da stimmt irgendwas nicht«, sagte er leise.
Seine Frau Carrie lebte lange genug im Apachenland, um nicht die Nerven zu verlieren. »Apachen?«, fragte sie nur.
»Kann ich mir nicht vorstellen«, antwortete er. »Seitdem Diablo im Gefängnis sitzt, gibt es kaum noch Ärger. Die meisten Apachen sind in San Carlos, im Reservat. Andererseits...« Er ging zur Kommode und holte Patronen aus der Schublade. »Vielleicht Pferdediebe.«
Carrie war bereits dabei, die Fensterläden zu schließen. Bei den Apachen konnte man nie wissen. Diablo war schon zweimal aus San Carlos geflohen, und es hätte sie nicht überrascht, wenn er es noch einmal versucht hätte.
Wenn er mit einer Kriegerschar anrückte, blieb ihnen nur die Möglichkeit, sich im Haus zu verbarrikadieren. Ihr Blockhaus war stabil, und die Fenster waren eigentlich Schießscharten.
»Hier«, sagte Thompson und warf seiner Frau den Revolver zu, einen sechsschüssigen Colt mit vernickeltem Lauf. »Schieß nur, wenn ich es sage.«
Carrie fing den Colt auf und nickte stumm. Sie war nicht besonders schön. Ihr Gesicht war hager, der Mund zu schmal, und ihr blondes Haar von der Sonne gebleicht und fast weiß. Aber in ihren Augen war ein lebendiges Funkeln, das Thompson schon bei ihrer ersten Begegnung fasziniert hatte. Diese Frau verstand es, sich in einem harten Land wie Arizona zu behaupten.
Thompson, den seine Frau »Henry« und jeder andere nur »Mr. Thompson« oder »Rimrock« nannte, weil er direkt unter den Felsen des Mogollon Rim seine kleine Ranch errichtet hatte, trat ans Fenster und blickte durch die Schießscharte. Im Hof hatte sich nichts verändert. Dusty stand wie erstarrt neben dem Brunnen und blickte auf die Felsen. Die Hühner gackerten nervös. Und im Corral schnaubten die Pferde.
»Apachen«, erkannte Thompson. »Es müssen Apachen sein. Bei Weißen oder Mexikanern hätte Dusty längst gebellt.« Er tauschte einen Blick mit Carrie, die am anderen Fenster stand. Sie hielt den Colt mit beiden Händen fest.
»Ich habe keine Angst«, erwiderte sie. »Mein Vater war schon hier, als Cochise die Gegend unsicher machte. Er hat mehr Apachen erschossen als mancher Soldat.« Sie lächelte schwach. »Ich habe einiges von ihm geerbt, Henry.«
Einige Zeit war Stille zwischen ihnen. Nur das Gackern der Hühner und das Schnauben der Pferde waren zu hören. »Meinst du, die Apachen sind wieder auf dem Kriegspfad?«, fragte sie dann. »Diablo? Massai? Apache Kid? Einer dieser Halunken, über die sie in der Zeitung geschrieben haben? Ich dachte, die Armee hätte alles fest im Griff.«
Thompson blickte in den Hof hinaus. »Keine Ahnung. Vielleicht nur ein paar junge Krieger, die sich einen Spaß machen wollen. Dem alten Turner haben sie letzten Monat zwei Pferde gestohlen. Alte Mähren, aber immerhin.«
»Henry! Der Hund!«, rief Carrie plötzlich. »Was hat er denn auf ein mal?«
Jetzt sah es auch Thompson. Dusty bewegte sich vom Brunnen weg, machte sich mit eingezogenem Schwanz davon. Er knurrte oder winselte nicht einmal, so verschreckt war er. Als hätte er den Leibhaftigen persönlich gewittert.
Der Leibhaftige hieß Say-es und war gerade dabei, sich auf den Rücken eines der Pferde zu schwingen. Seine Bewegungen waren so fließend und geschmeidig, dass Thompson ihn erst sah, als es schon beinahe zu spät war.
»Apachen! Bei den Pferden!«, rief er.
Er nahm die Winchester hoch und zog den Abzug durch. Neben ihm bellte der Colt seiner Frau auf. Wie Hornissen zirpten die Kugeln über den Ranchhof.
Aber die Bewegungen des Apachen waren zu schnell, sodass die Kugeln daneben gingen. Tief geduckt über den Hals des Pferdes ritt er durch das offene Corralgatter davon. Die Kugeln der Thompsons pfiffen wirkungslos über ihn hinweg und bohrten sich ins Gras.
Hinter ihm schwangen sich El-cahn und Hos-cal-te auf zwei der anderen Pferde. Das vierte Pferd jagten sie eben falls aus dem Corral. Dicht hinter Say-es sprengten sie über den Hof. Ihre Körper verschmolzen mit den Pferden. In einer Staubwolke ritten sie davon, durch den schmalen Fluss und zu den rettenden Felsen am anderen Ufer.
Als Thompson erkannte, dass er es mit nur drei Apachen zu tun hatte, riss er die Tür auf und rannte nach draußen. Wütend schoss er hinter den Pferdedieben her.
»Ihr verfluchten Schweine!«, schimpfte er. »Das habt ihr nicht umsonst getan! Ich hetze euch die Armee auf den Hals! Sie schicken euch nach Florida in die Sümpfe wie Geronimo und seine verdammten Krieger!«
Aber die Apachen hatten sich längst in Sicherheit gebracht. Sie tauchten zwischen den Felsen unter und verschwanden. Ihr Hufschlag verklang als vielfaches Echo in der kühlen Bergluft.
Thompson kehrte aufgebracht ins Haus zurück und warf die Winchester auf den Tisch. »Ich hab mich benommen wie ein verfluchter Esel!«, schimpfte er. »Es waren nur drei Krieger! Drei verdammte Krieger! Hätte ich besser auf gepasst, wäre nichts passiert.«
»Und du wärst tot oder schwer verletzt«, seufzte Carrie. »Nein, du hast alles richtig gemacht, Henry. Gegen drei Apachen wärst du niemals angekommen! Überlass die Sache der Armee!«
Thompson schnappte sich einen Stuhl und setzte sich. Er griff dankbar nach dem Becher Kaffee, den ihm seine Frau reichte. »Das ist es ja gerade, Carrie. Wir lassen die Armee die ganze Arbeit machen. Aber das hier ist unser Land. Wir alle sind für die Sicherheit der Bürger verantwortlich.« Er seufzte leise. »Manchmal denke ich daran, mich zum Sheriff wählen zu lassen. Mit dem Stern könnte ich dabei helfen, das Unrecht in diesem Land zu bekämpfen. Abtrünnige Apachen, weiße Banditen, mexikanische Pferdediebe... es wird Zeit, dass wir dieses Territorium befrieden, sonst werden wir nie ein Staat.«
Carrie reichte ihm den Colt zurück und schenkte sich selbst Kaffee ein. »Du willst in die Stadt ziehen, Henry?«
»Nicht für immer, Carrie. Wir könnten die Ranch behalten. Als Sheriff verdiene ich genug Geld, um einen Verwalter einzusetzen. Was hältst du da von?«
»Ich weiß nicht, Henry«, antwortete sie ehrlich. »Manchmal sehne ich mich nach einer Stadt wie Globe oder Prescott. Dort könnten wir in ein Restaurant oder zum Tanzen gehen, und ich könnte schöne Kleider tragen. Aber Sheriff... ich müsste mich jeden Tag um dich sorgen und wüsste nie, ob du noch am Leben bist, wenn ich irgendwo einen Schuss höre. Die Arbeit ist gefährlich.«
»Einer muss sie tun, Carrie«, erwiderte er, »sonst wird es niemals Frieden geben. Und gefährlich ist es hier auch.«
Carrie trank einen Schluck von ihrem Kaffee. Sie stand auf und wischte sich die Hände an der Schürze ab. »Das ist wahr. Aber jetzt will ich das Essen machen. Du hast doch sicher Hunger...«
»Apache Kid ist nicht bei ihnen« meldete Al Sieber, als er das Lager der Soldaten erreichte. Er stieg von seinem Braunen und hielt die Zügel in einer Hand. »Der Halunke hat sich in Luft aufgelöst!«
»Woher wollen Sie das wissen?«, fragte Major Chaffee. Er lagerte mit einem Trupp der Sechsten Kavallerie auf einer Lichtung, wenige Meilen von der Kutschenstraße nach Payson entfernt.
»Ich habe sie gesehen«, antwortete Al Sieber mit seinem harten Akzent.
Der beinahe fünfzigjährige Chefscout war schon vor dem Bürgerkrieg aus Deutschland eingewandert, hatte auf Seiten der Union gekämpft und in den Apachenkriegen als Chefscout unter den Generälen Crook und Miles gedient. Vor allem ihm war es zu verdanken, dass Chief Geronimo endlich gefasst worden war. Er war ein ernster Mann mit dunklen Haaren, dunklen Augen und einem dichten Schnurrbart.
»Sie haben die Halsabschneider gesehen?«, rief der Major so laut, dass sich einige Soldaten neugierig umdrehten. »Und Sie haben keinen Alarm gegeben? Diese Apachen gehören zu den meistgesuchten Verbrechern des Landes! Es wäre Ihre Pflicht gewesen...«