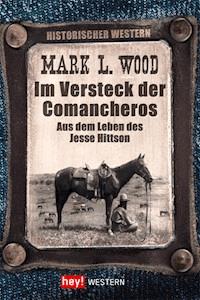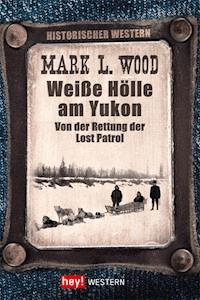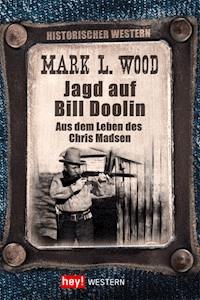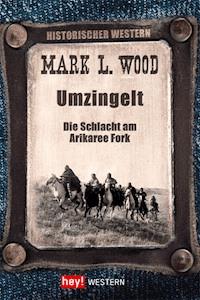1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HEY Publishing GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historische Western
- Sprache: Deutsch
Jesse Robinson, ein junger Arzt aus Tennessee, wundert sich selbst über seine erstaunlichen Schießkünste. Nur weil er sich als Naturtalent mit einer Schusswaffe heraustellt, kann er eine junge Indianerin vor einigen mordlustigen Büffeljägern retten. Doch die rauen Burschen lassen sich nicht abwimmeln und bleiben ihm dicht auf den Fersen, selbst dann, als er sich einem Wagenzug nach Westen anschließt, weil er im fernen Oregon eine Praxis eröffnen will. Doch das ist nicht die einzige Gefahr, die auf ihn lauert. Die Fahrt über den Oregon Trail ist ein halsbrecherisches Abenteuer, das mit Naturkatastrophen und feindlichen Indianern wartet. Dr. Jesse Robinson gehörte zu den vielen Siedlern, die Mitte des 19. Jahrhunderts über den Oregon Trail nach Westen zogen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 150
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mark L. Wood
Die Zukunft liegt im Westen
Copyright der eBook-Ausgabe © 2013 bei Hey Publishing GmbH, München.
Originalausgabe © 2006, BASTEI, Bergisch Gladbach. Erschienen in der Reihe Western-Legenden.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Mark L. Wood wird vertreten durch die Verlagsagentur Lianne Kolf.
Covergestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Coverabbildung: FinePic®, München
Autorenfoto: © privat
ISBN: 978-3-942822-33-6
Besuchen Sie uns im Internet:
www.heypublishing.com
www.facebook.com/heypublishing
Jesse Robinson, ein junger Arzt aus Tennessee, wundert sich selbst über seine erstaunlichen Schießkünste. Nur weil er sich als Naturtalent mit einer Schusswaffe herausstellt, kann er eine junge Indianerin vor einigen mordlustigen Büffeljägern retten. Doch die rauen Burschen lassen sich nicht abwimmeln und bleiben ihm dicht auf den Fersen, selbst dann, als er sich einem Wagenzug nach Westen anschließt, weil er im fernen Oregon eine Praxis eröffnen will. Doch das ist nicht die einzige Gefahr, die auf ihn lauert. Die Fahrt über den Oregon Trail ist ein halsbrecherisches Abenteuer, das mit Naturkatastrophen und feindlichen Indianern wartet.
Dr. Jesse Robinson gehörte zu den vielen Siedlern, die Mitte des 19. Jahrhunderts über den Oregon Trail nach Westen zogen.
Die Schreie kamen vom Flussufer. Die verzweifelten Rufe einer jungen Frau, die sich in höchster Gefahr befinden musste. Gleich darauf hörte man das Klatschen einer Hand und heftiges Schluchzen.
»Hast wohl gedacht, du könntest mir die ganzen Vorräte klauen und heimlich verschwinden, was?«, blaffte eine männliche Stimme. »So nicht, mein Täubchen! Wenn du was von mir willst, musst du es dir verdienen. Sei ein bisschen nett zu dem alten Zeb, und ich lasse mit mir reden. Heh, was soll das, du verdammtes Biest?«
Jesse Robinson zögerte keine Sekunde. Er lenkte seinen Wallach zum Flussufer hinunter und stieg aus dem Sattel. Mit ein paar Schritten war er bei den Bäumen, die ihn von den Hilferufen der Frau trennten. Er schlich gebückt näher und blieb im Unterholz stehen.
Was er dann sah, ließ ihm das Blut in den Adern gefrieren. Bei einem kleinen Lagerfeuer, das zwischen einigen Steinen brannte, rangen zwei Menschen miteinander. Ein bärtiger Bursche in speckiger Wildlederkleidung und eine junge Indianerin. Sie war höchstens achtzehn, vielleicht sogar jünger, und wehrte sich mit Händen und Füßen. Verzweifelt versuchte sie, sich aus der Umklammerung zu befreien.
Jesse kam aus Tennessee und war es gewohnt, eine Frau höflich und respektvoll zu behandeln. Selbst einem schwarzen Dienstmädchen hätte sich ein Mann von seiner Herkunft niemals auf diese Weise genähert. Der Bärtige dachte anders. Er schien großen Spaß daran zu haben, die Indianerin zu quälen, lachte nur, als sie ihm gegen das Schienbein trat, und warf sie zu Boden.
Abseits der Uferböschung schnaubte ein Pferd. Jesse sah einen angehobbelten Falben bei einigen Büschen stehen. Daneben stand ein Kastenwagen mit hohen Seitenwänden, wie Büffeljäger ihn benutzten. Er war leer. Der kühle Morgenwind trug den Duft von frischem Salbei herüber. Die Sonne stand weit im Osten und verbreitete rotes Licht.
Ein Büffeljäger, dachte Jesse.
Er hatte von den rauen Männern gehört und wusste, wie gefährlich sie waren. Er hatte noch die Worte eines Händlers in St. Louis im Ohr: »Halten Sie sich von den Kerlen fern! Die kennen keine Verwandten, wenn man ihnen in die Quere kommt, und sie stinken wie die Pest!«
»Jetzt reicht's mir aber!«, fuhr der Büffeljäger die Indianerin an. Er kniete sich auf ihre Oberschenkel, packte ihre Handgelenke und drückte beide Arme in das feuchte Gras. »Wenn du nicht hören willst, musst du eben fühlen!« Er zog ein Messer hinter seinem Gürtel hervor und hielt die Klinge vor ihre Augen. »Nun, gehorchst du mir jetzt?«
Der Anblick der verzweifelten Indianerin war zu viel für Jesse. Entschlossen griff er nach seinem neuen Colt Navy. Bisher hatte er nur auf dem Schießstand damit geschossen. Er war kein Revolvermann. Als junger Arzt bemühte er sich eher darum, die Menschen zu heilen. Er hatte die Waffe nur gekauft, weil ihm einige Freunde und Bekannte dazu geraten hatten, wegen der »Wilden« und der anderen Gefahren, die im Westen auf ihn warteten.
Doch als Gentleman aus dem Süden war er nicht gewillt, tatenlos zuzusehen, wenn ein Schurke wie dieser Büffeljäger eine hilflose Indianerin belästigte.
Mit dem Revolver in der rechten Hand trat er aus seinem Versteck. »Lassen Sie das Mädchen in Ruhe!«, fuhr er den Büffeljäger an. »Sie haben kein Recht, ihr Gewalt anzutun. Treten Sie zur Seite und lassen Sie sie gehen!«
Der Büffeljäger hielt mitten in der Bewegung inne und wandte sich zu Jesse um. Als er den schlanken Mann im dunklen Anzug eines Städters sah, begann er zu grinsen. »Sie? Sie wollen mir vorschreiben, was ich mit dieser Diebin anstelle? Sie ist eine Squaw! Eine verdammte Pawnee, die mich bestehlen wollte!« Sein Grinsen verstärkte sich. »Oder haben Sie es selbst auf das rote Täubchen abgesehen? Sie wollen Sie für sich haben, hab ich Recht?«
Jesse Heß sich nicht beirren. Er wusste, dass er in dem Anzug und mit dem schmalkrempigen Derby-Hut wie ein Stutzer aussah. Wahrscheinlich erkannte der Büffeljäger auch, dass sein Revolver und der Waffengut neu waren. »Lassen Sie das Messer fallen und stehen Sie auf!«, sagte Jesse. Seine Stimme kam ihm selbst fremd vor. »Die Indianerin wollte doch nur etwas zu essen!«
Der Büffeljäger erkannte, dass er um einen Kampf nicht herumkam, und stand langsam auf. Er kümmerte sich nicht um die Indianerin, die Jesse einen erstaunten Blick zuwarf, etwas sagte, das Jesse nicht verstand, und dann hastig davonrannte.
»Lassen Sie das Messer fallen!«, wiederholte Jesse. Er spannte den Revolver mit beiden Daumen. Der Colt Navy 1851 war eine neue Waffe, die gerade erst in die Läden gekommen war und auf vierzig Meter genau schießen sollte. »Damit trifft selbst ein Greenhorn«, hatte ihm der Verkäufer versichert.
Der Bärtige hörte das Klicken, dachte aber nicht daran, sein Messer fallen zu lassen. »Sie wollen sich also mit mir anlegen«, spottete er. Ohne dass Jesse es bemerkte, legte er sich das Messer wurfbereit in die Hand. Er hatte schon so manchen Gegner auf diese Weise getötet. »Worauf wartest du noch, Stutzer? Leg endlich los! Oder hast du plötzlich den Mut verloren? Schieß doch! Ich lasse dir sogar den Vortritt!«
Jesse dachte nicht daran, einen Menschen kaltblütig über den Haufen zu schießen. »Ich denke nicht daran, mich mit Ihnen zu duellieren. »Werfen Sie das Messer weg und verschwinden Sie, dann will ich den Vorfall vergessen. Wenn nicht, melde ich Sie dem Sheriff!«
Der Bärtige prustete los und schlug sich beinahe auf die Schenkel vor Lachen. Doch im selben Augenblick ließ er das Messer aus der Hand sausen. Die Klinge schoss beinahe so schnell wie eine Kugel auf Jesse zu. Kalter Stahl blitzte in der Morgensonne.
Jesse reagierte instinktiv und blitzschnell. In einer fließenden Bewegung sprang er zur Seite und drückte den Stecher durch. Die Kugel schoss aus dem Lauf und schleuderte den überraschten Büffeljäger ins Feuer. Reglos blieb er in den Flammen liegen. Hinter ihm schnaubten die nervösen Pferde.
Noch bevor Jesse realisiert hatte, was in den vergangenen Sekunden geschehen war, steckte er den Colt wieder im Holster. Ungläubig blickte er auf den Toten und das Messer, das sich hinter ihm in einen Baum gebohrt hatte. Wie hatte er es geschafft, der Klinge auszuweichen? Und wie hatte er sein Ziel getroffen, obwohl er kaum gezielt hatte?
Er zog den Colt Navy erneut aus dem Holster und betrachtete ihn wie einen Fremdkörper. Ungläubig steckte er ihn zurück. Also war der Treffer auf dem Schießstand doch kein Zufall gewesen. Er war ein zielsicherer Schütze, und er reagierte so rasend schnell, wie er es selbst nicht vermutet hätte.
Erst nachdem er sich von seinem Schrecken erholt hatte, wurde ihm bewusst, dass er einen Menschen umgebracht hatte. Mit trockener Kehle blickte er auf den Büffeljäger hinab. In dessen Stirn klaffte ein rotes Loch, die Augen blickten starr zum Himmel. Die Flammen hatten seine Lederjacke angesengt und waren dann erloschen.
Jesse bedeckte den Toten mit Steinen vom Flussufer und sprach ein kurzes Gebet. »Ich konnte nicht anders«, schloss er leise. »Er hätte die arme Indianerin vergewaltigt. Herr, nimm dich seiner verdorbenen Seele an. Amen.«
Dann kehrte er zu seinem Wallach zurück und ritt weiter. Die beiden Männer, die auf der anderen Seite des Flusses über die Hügel geritten kamen und auf das Ufer zuhielten, sah er nicht.
»Wir schnappen uns den verdammten Kerl!«, schwor Noah Cheney am Grabhügel seines Freundes. »Wir binden ihn an einen Pfahl und ziehen ihm die Haut in Streifen vom Körper! So wie es die Cheyenne mit mir machen wollten! Ach was, ich reiße ihm das Herz raus und werfe seinen stinkenden Kadaver den Schweinen zum Fraß vor!«
»So machen wir es, Noah«, bestätigte Harvey Preston. Der stämmige Bursche mit den dunklen Locken war niemals zur Schule gegangen und hatte als kleiner Junge vom selbst gebrannten Whiskey seines Vaters getrunken. Seitdem funktionierte sein Verstand nicht mehr richtig.
Cheney blickte ihn von der Seite an. Er war nur mit dem einfältigen Hillbilly zusammen, weil der doppelt so schwer wie jeder andere Mann heben konnte und einen feindlichen Indianer zehn Meilen gegen den Wind roch. »Steig auf deinen Gaul und komm!«, befahl Cheney. »Wenn wir den Burschen erwischen wollen, müssen wir gleich los!«
»Aber wir können Zeb doch nicht allein lassen«, jammerte Preston. »Er war dein Freund, nicht wahr? Er hat dir mal das Leben gerettet. Als die Cheyenne unser Lager überfielen und mit dir davonritten. Er hat den Häuptling mit einem Schuss erledigt, so war's doch?«
Cheney stieg in den Sattel. Er war ein drahtiger Mann mit einem harten Gesicht und langen Haaren. »Ja, so war es, Harvey. Aber jetzt ist Zeb tot, und wir können nichts mehr für ihn tun. Willst du mir nun helfen, seinen verdammten Mörder zu finden, oder willst du hier bleiben und Trübsal blasen?«
»Was ist mit den Büffeln?«, fragte Preston besorgt. »Ich dachte, wir wollten auf die Jagd gehen. Willst du auf das viele Geld verzichten? Ich will mir Whiskey und Tabak kaufen und die schöne Louise vom Saloon!«
»Zu der kommst du noch früh genug«, antwortete Cheney, »die will sowieso keiner außer dir. Aber bis die Herden kommen, haben wir den Kerl längst erledigt. Komm jetzt! Ich hab keine Lust, die Spur des Burschen zu verlieren!«
»Aber unser Wagen«, zögerte Preston immer noch. »Willst du ihn hier lassen? Was ist, wenn ihn jemand stiehlt?«
»Eine leeren Wagen stiehlt keiner, Harvey. Und wenn, holen wir ihn zurück. Wir können den Wagen nicht mitnehmen. Damit sind wir zu langsam.«
»Wenn du meinst, Noah. Hauptsache, ich kriege meine Dollar. Ich hab drei Wochen nicht mehr in einem Bett geschlafen. Ich will ein heißes Bad nehmen, Noah, und dann will ich im Hotel übernachten, so wie die feinen Leute, und die schöne Louise kommt mit und bringt mir Whiskey und Zigarren.«
»Kriegst du alles«, erwiderte Cheney geduldig, »aber zuerst schnappen wir uns die Ratte, die Zeb auf dem Gewissen hat.« Er deutete auf den Fetzen vom Kleid der Indianerin. »Sieh dir das an. Zeb hat sich die Squaw geangelt, die wir am Flussufer gesehen haben. Möchte wissen, warum ein Weißer sich da einmischt. Die Spuren stammen eindeutig von einem Weißen.« Er trieb seinen Braunen an und folgte den Abdrücken im Gras. »Er hat sich nicht mal die Mühe gemacht, seine Spuren zu verwischen. Wo bleibst du, Harvey?«
Preston saß bereits im Sattel und folgte ihm. »Ich komme, Noah. Ich bin dicht hinter dir. Und wenn wir den Kerl haben, helfe ich dir, ihm die Haut in Streifen vom Körper zu ziehen!« Er lachte laut. »Das wird ein Spaß, Noah.«
Der Mann war leicht zu verfolgen. Die Huf abdrücke seines Pferdes hatten sich tief in das feuchte Gras gegraben und führten zu der Wagenstraße, die Jefferson City mit Independence verband. Der Mann wollte nach Westen, das stand außer Zweifel.
»Ich wette, er will sich bei einem der Wagenzüge verstecken«, sagte Cheney, »aber so weit lassen wir es nicht kommen. Wir schnappen uns den Burschen vorher. Wo bleibst du, Harvey?«
»Hier, Noah. Ich bin hier.«
»Siehst du die Spuren?«, fragte Cheney, als sie eine sandige Stelle erreichten. Hier waren die Abdrücke des Pferdes besonders gut zu erkennen. »Von einem der Hufeisen fehlt ein Stück. Als ob er uns einen Gefallen tun wollte.«
»Einen Gefallen? Warum denn?«
»Vergiss es, Harvey«, winkte Cheney ab. »Aber den Gaul finde ich unter tausenden. Und wenn ich ihn mitten in Independence suchen muss.«
Sie erreichten die Stadt am frühen Abend. Die Siedlung war nicht besonders groß und bestand hauptsächlich aus Bretterbuden und Zelten. Nur zu beiden Seiten der breiten Hauptstraße ragten einige feste Gebäude hervor, darunter mehrere Saloons, Hotels und Läden, eine Kirche und zwei Mietställe. Von den wenigen Gehsteigdächern hingen flackernde Öllampen.
Vor dem größten Mietstall stiegen sie aus dem Sattel. Sie stellten ihre Pferde unter und bezahlten bei dem buckligen Schwarzen, der auf die Pferde aufpasste. Cheney hatte seinen Colt Dragoon und Preston seinen schweren Whitneyville-Walker im Holster stecken.
Cheney fragte, welche Pferde zuletzt untergestellt worden waren, und sah sich die Hufe an. Erbrauchte nicht lange, um den Falben zu finden.
»Wem gehört dieser Gaul?«, fragte er den Schwarzen. »Und wo steckt der Kerl?«
Der Schwarze war schlau genug, sich nicht gegen den Büffeljäger aufzulehnen. Er betrachtete den Falben und erinnerte sich. »Seinen Namen hat er nicht gesagt, Mister, aber er hat nach einem Hotel gefragt, und ich hab ihm das Overlander's genannt, gleich gegenüber. Ein schlanker Bursche, ist wie ein Stadtfrack gekleidet... schwarzer Anzug, Krawatte und ein Derby-Hut.«
Cheney hielt es nicht nötig, sich zu bedanken. Er winkte Preston zu. »Gehen wir.«
Jesse stand am offenen Fenster seines schäbigen Hotelzimmers und blickte auf die geschäftige Hauptstraße hinab. In seinem Zimmer war es viel zu stickig, und er genoss die frische Abendluft.
Jenseits der Häuser, Baracken und Zelte waren die unzähligen Feuer der Overlanders zu sehen. So nannte man die Siedler, die mit den Wagentrecks nach Oregon oder Kalifornien zogen.
Auch Jesse hoffte, bald zu den Siedlern zu gehören. Er hatte etwas Geld gespart und wollte sich bei einem der Wagenzüge einkaufen. Wenn er sich an den Kosten beteiligte, nahm ihn vielleicht eine Familie in ihrem Wagen mit.
Im fernen Oregon würde er eine Praxis aufmachen. Dort wurden Ärzte gebraucht. Chattanooga war ihm längst über den Kopf gewachsen. Er brauchte die endlose Weite des Westens, das wusste er seit seiner Kindheit, als er den Geschichten seine Vaters über die »dunklen und blutigen Jagdgründe« der Indianer gelauscht hatte. Er wollte dabei sein, wenn der Westen erobert wurde. Er wollte helfen, ihn zu zivilisieren.
Sein Blick wanderte auf die Straße, und er entdeckte zwei Männer, die ihn auf fatale Weise an den toten Büffeljäger erinnerten. Auch sie trugen speckige Wildlederkleidung.
»Büffeljäger!«, entfuhr ihm. Ob sie den Toten kannten?
Jesse hatte den Tod des Büffeljägers nicht gemeldet. Es war Notwehr gewesen, aber das wusste nur er. Selbst wenn das Messer noch im Baum steckte, war das kein Beweis. Er hatte sich entschlossen, den Vorfall zu verdrängen und nach Westen zu verschwinden. Dort würde niemand nach ihm suchen. Warum sollte er schlafende Hunde wecken? Einen Schurken wie den toten Büffeljäger vermisste sowieso niemand. Oder waren die beiden Männer auf der Straße seine Freunde? Waren sie gekommen, um ihn zu rächen?«
Die Büffeljäger blieben unter seinem Fenster stehen. Jesse duckte sich unwillkürlich. Ihre Stimmen drangen bis zu ihm herauf. »Hier wohnt der Mistkerl«, sagte der eine. »Ist dein Revolver geladen, Harvey?«
Einen Augenblick war Stille, dann erklang die schleppende Antwort: »Natürlich, Noah. Meinst du, ich laufe mit einem leeren Colt herum?«
Nachdem sie wieder eine Weile geschwiegen hatten, sagte Noah: »Wir schnappen uns den Kerl und schleppen ihn aus der Stadt, verstanden? Komm ja nicht auf die Idee, ihm eine Kugel in den Wanst zu jagen. Wir erledigen ihn draußen, wo es niemand sieht. Bist du so weit?«
»Natürlich, Noah. So machen wir es. Ich jage ihm nur einen Schrecken ein, nicht wahr?«
Für einen Augenblick war Jesse unfähig, sich zu bewegen. Sie hatten es auf ihn abgesehen! Sie waren gekommen, um ihn zu töten! Sie wollten ihren toten Freund rächen! Jesse ging vom Fenster weg. Warum war er nicht zum Sheriff gegangen und hatte ihm alles gestanden? Wenn er jetzt bei ihm auftauchte, geriet er bestimmt in den Verdacht, nur seine Haut retten zu wollen.
Auf der Treppe waren Schritte zu hören. Die Büffeljäger kamen nach oben.
»Ein Doktor«, war Noahs polternde Stimme zu hören. Es war ihm anscheinend egal, dass ihn jeder hören konnte. »Doktor Jesse Robinson. Ein Doktor hat Zeb erschossen!« Seine Stimme wurde lauter. »Heh, Doc! Wo stecken Sie?«
Jesse war bereits dabei, seine Satteltaschen zu packen. Er reiste mit wenig Gepäck, denn er wollte erst einkaufen, wenn er einen Wagenzug gefunden hatte. Hastig griff er nach seinem Waffengurt und der Springfield-Muskete, die ein Büchsenmacher vor seiner Abreise auf Perkussionszündung umgestellt hatte.
Mit seiner wenigen Habe kletterte er durch das Fenster auf das Vorbaudach.
Hinter ihm krachte es. Die Büffeljäger hatten die Tür zum Nebenzimmer aufgestoßen. Eine Frau schrie.
»Verdammt! Wo steckt der Bursche?«, rief Noah wütend. »Warum stand seine Zimmernummer nicht im Gästebuch?«
Jesse erkannte, dass ihm nicht mehr viel Zeit blieb. Er huschte geduckt über das Vorbaudach und sprang auf die Straße. Ohne dass sich jemand um ihn kümmerte, rannte er zum Mietstall auf der anderen Seite. Auch um diese Zeit waren noch viele Menschen auf der Straße, und er fiel kaum auf. Independence war der Startpunkt des Oregon Trails und wimmelte von Overlanders.
Im Hotel krachte ein Schuss. Einige Männer schrien wild durcheinander, und er hörte Rufe wie »Der verdammte Kerl will mich umbringen! Er hat mir ins Bein geschossen!« Eine anderer Mann rief: »Da laufen sie! Haltet die beiden!«
Jesse blieb stehen und beobachtete zufrieden, wie einige Männer die tobenden Büffeljäger packten und sie aus dem Hotel schleppten.