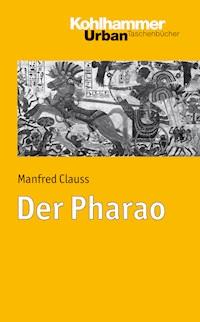29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Eine Sekte wird zur Weltreligion – Manfred Clauss' große Geschichte des frühen Christentums Als vor Jerusalem ein Wanderprediger am Kreuz starb, ahnte niemand, dass damit ein neues Zeitalter anbrach. Vier Jahrhunderte später wurde das christliche Bekenntnis zur römischen Staatsreligion. Manfred Clauss erzählt die aufregende Geschichte dieses frühen Christentums – von den versprengten Urgemeinden bis ins 6. Jahrhundert – und entwirft ein überraschendes, archaisch-schillerndes Panorama: Da wird aus heidnischen Sonnwendfeiern das Weihnachtsfest, Märtyrer sehnen sich nach dem Tod, ein neues, prägendes Lebensideal der Askese bildet sich heraus. Streiter für ihre Kirche wie Paulus und Augustinus propagieren ihre Lehre, schreiben gegen falsche Propheten an – und Gruppierungen wie Arianer und Doketisten bekämpfen sich bis aufs Blut. Denn es war nicht nur die Liebesbotschaft des Evangeliums, die den Erfolg brachte: Das Christentum, wie wir es heute kennen, ist nicht zuletzt das Ergebnis von Eifer, Gewalt und politischem Kalkül. Manfred Clauss zeichnet ebenso mitreißend wie gelehrt ein neues Bild unserer abendländisch-christlichen Anfänge. Die Wiederentdeckung eines verschütteten Ursprungs, der uns heute in vielem fremd ist – und doch die wechselvolle Geschichte der letzten zweitausend Jahre in Europa geprägt hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 697
Ähnliche
Manfred Clauss
Ein neuer Gott für die alte Welt
Die Geschichte des frühen Christentums
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Eine Sekte wird zur Weltreligion – Manfred Clauss’ große Geschichte des frühen Christentums.
Über Manfred Clauss
Inhaltsübersicht
Vorwort Quo vadis? Der lange Weg zu den Christentümern
«Quo vadis?», wohin gehst du, lautet in der Schlüsselszene des gleichnamigen Filmes und Buches die Frage, die Petrus an Christus und letzlich auch an sich selbst richtet. Der Apostel hat Rom verlassen und befindet sich bereits auf der Via Appia außerhalb der Stadt, wo ihm Christus erscheint. Auf dessen Antwort hin, er gehe nach Rom, um sich erneut kreuzigen zu lassen, dreht Petrus um: Er kehrt zurück in die Hauptstadt des damaligen Weltreichs und versinnbildlicht damit jene entscheidende Wende der Christen von der Distanzierung zur Welt hin zur Bereitschaft, sich in ihr einzurichten.
Quo vadis? Diese Frage stellt sich an jeder Wegscheide, und der lange Weg des Christentums von den Anfängen einer kleinen Gruppe bis hin zur Staatskirche aus mehreren christlichen Konfessionen weist unzählige Gabelungen auf. Daher ist es für den heutigen Betrachter weder möglich, sämtlichen Verzweigungen zu folgen, noch einen Blick in die zahllosen Sackgassen zu werfen. Um noch einen Moment beim Bild des Weges zu verharren: Auch das Phänomen des Kreisverkehrs lässt sich beobachten. Nachdem die Christen die Feier des Geburtstags lange Zeit vehement bekämpft hatten, begannen die Kirchenväter seit Mitte des 3. Jahrhunderts, mit aufwendigen Berechnungen und Rekonstruktionen das Tagesdatum der Geburt Jesu zu ermitteln, bis man im 4. Jahrhundert alle bisherigen Überlegungen beiseiteließ und sich auf den Tag der Wintersonnenwende und den Geburtstag des Sonnengottes verständigte, den 25. Dezember, der schließlich zu einem der höchsten christlichen Feiertage wurde.[1]
In der Entwicklung der christlichen Glaubensrichtungen von den ersten Jesus-Jüngern bis zum Ausgang der Antike gibt es unendlich viele Wegpunkte, an denen die eine Gruppierung diese, die andere jene Richtung einschlug. Ihre Entscheidung rechtfertigten diese Gruppen in Auseinandersetzungen mit den jeweils anderen. Es ist in vielen Fällen schwer zu benennen, was «Christentum» war, denn gerade an den Rändern nahezu aller Gruppen waren die sozialen und religiösen Bedingungen offen. Es galt, im Streit mit und vor allem in Abgrenzung von den anderen Gruppen den eigenen Kern zusammenzuschweißen. Diese Selbstvergewisserung erfolgte durch die stetig neu vorgenommene Bestimmung des «Anderen» oder des «Fremden», durch die Ausgrenzung und schließlich durch die Bekämpfung dieses Anderen und Fremden, die bis zur Ausrottung gehen konnte.
Zum Verständnis dieser Geschichte des antiken Christentums ist eine längere Vorbemerkung notwendig. Sie betrifft den christlichen Fundamentalismus, das von Anfang an herrschende Selbstverständnis, das alleinige Wissen um die Wahrheit zu besitzen. Zwar legten mehr oder weniger große christliche Gruppen sehr unterschiedliche Strecken zurück, dabei waren sich jedoch alle in einem Punkt einig: Jede Gruppierung glaubte, der von ihr eingeschlagene Weg sei der richtige – ein Konzept, das die Christen vom Judentum übernommen hatten. Und so schätzte jede christliche Gruppierung ihren eigenen Standpunkt als orthodox (rechtgläubig) und alle anderen als heterodox (falschgläubig) oder häretisch ein.
Es geht mir in dieser Darstellung vor allem darum, die Vielgestaltigkeit des frühen Christentums vor Augen zu führen. Denn die Vorstellung, das antike Christentum sei geschlossen aufgetreten, ist ebenso verbreitet wie falsch.
Als Ulrich Kahrstedt vor einhundert Jahren seine Geschichte der Karthager schrieb, äußerte er sich auch zu seiner Kenntnis der Forschung: «Da ich noch nicht hundert Jahre alt bin, habe ich die einschlägige Literatur noch nicht ganz gelesen.»[2] Ich schließe mich dieser Feststellung im Hinblick auf mein Thema an. Die Literatur zum frühen Christentum ist längst unüberschaubar, und ich halte es für wichtiger, die antiken Zeugnisse zu kennen.
Die Quellenlage zur Geschichte des antiken Christentums ist verglichen mit anderen Bereichen der Alten Geschichte außergewöhnlich gut – so gut, dass die beste Einführung in die antike christliche Literatur davon spricht, dass kein Forscher allein mehr alle antiken Texte zum Thema überblicken könne.[3] Für den heutigen Historiker liefern die Darstellungen der antiken Kirchengeschichtsschreiber verschiedener christlicher Konfessionen den roten Faden, der jeder Geschichte des frühen Christentums zugrunde liegt. Die Kirchenväter befassten sich mit den allgemeinen Bedingungen christlicher Existenz oder behandelten spezielle Themen wie Ehe, Buße oder Jungfräulichkeit. Märtyrerakten und Heiligenviten verraten ebenso viel über Propaganda wie über Volksfrömmigkeit. Für viele innerkirchliche Auseinandersetzungen, an denen die Antike nicht arm war, haben wir eine Fülle von Konzilsakten, die endlose Diskussionen über scheinbare Nichtigkeiten dokumentieren, wobei wir verstehen müssen, dass auch die kleinste Abweichung in theologischer Hinsicht in die Abgründe der Hölle führen konnte.
Überliefert sind zudem Massen von Predigten, die gelegentlich schwer zu ertragen sind, auch wenn wir sie heute nicht stehend hören müssen, sondern bequem am Schreibtisch lesen können. Diese Predigten geben immer wieder Einblicke in den gelebten Alltag antiker Christen. Wir besitzen Zehntausende von christlichen Inschriften, darunter über fünfzigtausend lateinische, die bequem in einer Datenbank zugänglich sind;[4] für die griechischen Texte liegt ein solches Hilfsmittel noch nicht vor. Es sind vor allem Grabinschriften, die von der Gewissheit der Menschen künden, in den Himmel zu kommen oder bereits dort zu sein. Noch detailliertere Informationen liefern die Papyri, wobei sie uns in Briefen, persönlichen Aufzeichnungen oder magischen Texten vor allem den Alltag in Ägypten vor Augen führen. Schließlich lässt auch die Ausstattung der Kirchengebäude mit Wandgemälden oder Mosaiken ein Bild des antiken Christentums entstehen.
Wir haben also viele Texte aus unterschiedlichen christlichen Perspektiven und erfahren aus ihnen eine Menge über die Christentümer der Antike. Sehr viel weniger wissen wir freilich über die anderen Kulte, die das Christentum als «heidnisch» bezeichnet und rigoros verfolgt hat. Die Quellenlage zur Geschichte des antiken Christentums ist das Ergebnis von Säuberungs- und Vernichtungsaktionen, des religiösen Fanatismus der Sieger.
Die Entstehung der antiken christlichen Glaubensrichtungen fällt in das Römische Reich der Kaiserzeit und der Spätantike. Während der Regierung des ersten Kaisers Augustus ([43] 27 v. Chr.–14) wurde Jesus geboren, unter seinem Nachfolger Tiberius (14–37) wurde er hingerichtet. Für die ersten Jahrhunderte christlicher Existenz, bis etwa 250, kann die Geschichte des Reiches allerdings vernachlässigt werden. Die christlichen Gemeinden wuchsen langsam, und wir erfahren nicht, wie die Christen auf die jeweiligen Herrscher und ihre Politik reagierten. Abgesehen von wenigen Ausnahmen lässt sich daher erst seit der Mitte des 3. Jahrhunderts, seit der Regierung des Kaisers Decius (249–251), Reichsgeschichte und Kirchengeschichte miteinander verknüpfen.
Begeben wir uns also auf den Weg, den das frühe Christentum zurückgelegt hat. Der im Titel des Buches verwendete Singular «Christentum» kann einerseits als Sammelbegriff verstanden werden, unter dem die zahlreichen Christentümer zusammengefasst werden; andererseits deutet er an, dass es für alle christlichen Gruppierungen nur ein Christentum gab: das jeweils eigene.
Wir werden auf dem Weg vor allem die großen Kirchen kennenlernen; die jeweils bestimmenden christlichen Gruppierungen wechselten je nach Zeit und Ort. In Nordafrika etwa dominierten im 4. Jahrhundert lange Zeit die Donatisten, die die Ansicht vertraten, die Gültigkeit eines Sakraments hänge vom Gnadenstand des Spenders ab. Reichsweit hatten in der Mitte dieses Jahrhunderts wahrscheinlich die Arianer die Mehrheit, die einen strikten Monotheismus vertraten, wobei sie dem Gott-Vater allein sämtliche Gottesprädikate zugestanden. Im Westen des Römischen Reiches bestand seit dem Ende des 4. Jahrhunderts eine Staatskirche, die man katholisch nennen kann und die sich im Laufe des 5. Jahrhunderts im Osten in zwei große Gruppen spaltete.
Neben diesen Großkirchen existierte eine Fülle von kleineren christlichen Gemeinschaften, die oft erstaunlich lange Bestand hatten, wie die Novatianer, die um das Jahr 250 entstanden, sich über das gesamte Reich ausbreiteten und eine rigorose Kirchendisziplin vor allem gegenüber den vom Glauben Abgefallenen vertraten. Eine von den Großkirchen abweichende Ansicht von der Taufe vertraten die Messalianer in Kleinasien. Sie glaubten, nur im unablässigen Gebet liege die Hoffnung, den Teufel aus dem Menschen austreiben zu können. Genaue Angaben über die Ausbreitung und Größe dieser wie vieler anderer Gruppen lassen sich allerdings nicht machen.
Am Ende führt der Weg zu jenem Ziel, das alle Christen vor Augen hatten, in den Himmel – oder aber in die Hölle, wo sich nach Ansicht des Kirchenvaters Augustinus weitaus mehr Christen wiederfinden werden.
«Ich bin die Wahrheit» – der christliche Fundamentalismus
Um die Wende vom 4. zum 5. Jahrhundert entspann sich ein Streit zwischen zwei Theologen, die zu den bekanntesten Gestalten ihrer Zeit und der antiken Kirchengeschichte zählen.[1] Es handelt sich auf der einen Seite um Augustinus (354–430)[2], Bischof von Hippo in Nordafrika, einen der bedeutendsten lateinischen Kirchenväter der Spätantike; auf der anderen um Hieronymus (347–419), Klostergründer und Verfasser der Vulgata, der lange Zeit maßgeblichen Bibelübersetzung in die lateinische Sprache. Die beiden Theologen stritten um die Auslegung einer Stelle aus einem der Paulusbriefe. Aufschlussreich ist dabei die Form der Auseinandersetzung.[3]
Es war ein Streit auf hohem literarischem Niveau, daher waren die jeweiligen Vorwürfe noch einigermaßen geistreich. Hieronymus vermutete, Augustinus wolle sich durch die Angriffe auf ihn, der damals zweifellos der Bekanntere war, einen Namen machen, und sah sein ambitioniertes Programm der Bibelübersetzungen in Gefahr. Im Gesprächsangebot des Bischofs sah er «ein mit Honig bestrichenes Schwert», hatte Augustinus ihn doch als «Anwalt der Lüge» bezeichnet und – das probateste Mittel der persönlichen Verunglimpfung – seine Rechtgläubigkeit in Zweifel gezogen.[4] Dagegen konnte sich Hieronymus am besten wehren, indem er Augustinus seinerseits der Häresie bezichtigte. Die beiden fanden schließlich in dem britischen Mönch Pelagius einen gemeinsamen, selbstverständlich häretischen Gegner und kamen dadurch zu einer einigermaßen sachlichen Diskussion.
Woher kommt diese Bereitschaft der christlichen Denker zum Streit und vor allem zur persönlichen Diffamierung des Andersdenkenden? Der Christ verachtete grundsätzlich alle diejenigen, die seine eigene Glaubensüberzeugung nicht teilten und damit Ungläubige waren. Nach christlichen Vorstellungen konnte solch ein Ungläubiger niemals der Freund eines Christen werden. So schreibt der Mailänder Bischof Ambrosius im 4. Jahrhundert: «Es darf nicht sein, dass der Glaube um der Freundschaft willen zerstört wird. Denn keiner kann eines Menschen Freund sein, der Gott die Glaubenstreue bricht.» Freunde dagegen sind alle diejenigen, die die christliche Wahrheit verkünden, wie es ein anderer Bischof einmal formuliert hat.[5] Aus der Gemeinschaft der Gläubigen, der sich diese Autoren selbstverständlich zugehörig fühlen, fallen die unterschiedlichen Gruppierungen der Ungläubigen heraus.
Wahrheit – das ist der Begriff, um den es vor allem geht. Im Bereich der Religion gab es in der vorchristlichen Antike keine dogmatisch geschlossenen Systeme, die universale Geltung beanspruchten und «Wahrheit» von «Irrlehre» kanonisch unterschieden. In der heidnisch-antiken Tradition sah man den religiösen Grundkonsens durch unterschiedliche Kulte nicht in Frage gestellt. Oder um es mit Augustinus zu sagen: «Jene [Heiden] verehren die vielen falschen Götter auf die gleiche Weise.»[6]
Der Kirchengeschichtsschreiber Sokrates (381–439) überliefert den Ausspruch eines heidnischen Philosophen, es habe in der Mitte des 4. Jahrhunderts mehr als dreihundert verschiedene pagane Kulte gegeben, weil, so dessen Begründung, «Gott auf unterschiedliche Weise verehrt werden möchte»[7]. Die Vielzahl an Kulten stellte gleichsam ein Angebot an die Menschen dar, die auf dem «Markt» der Götter auswählten; je nach Zeit, Geld und Interesse konnte man sich etwa in der einen oder anderen Mysteriengemeinschaft engagieren. Es war eine der Grundüberzeugungen jener Heiden, dass es mehr als nur einen Weg zur Erkenntnis des Göttlichen oder zur Wahrheit gebe, wie es Symmachus, der Stadtpräfekt von Rom, gegen Ende des 4. Jahrhunderts als Replik auf christliche Ansprüche formulierte.[8]
Das christliche Wahrheitsverständnis war dagegen ein völlig anderes. Man kann es anhand eines Spruches verdeutlichen, der Jesus zugeschrieben wird: «Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben», so heißt es im Johannes-Evangelium.[9] Der entscheidende Aspekt ist dabei, dass Wahrheit personalisiert wird. «Ich bin die Wahrheit» bedeutet in der Diskussion der Christen mit anderen oder untereinander: Ich habe recht. Aufbauend auf der christlichen Überzeugung von der Richtigkeit der eigenen Lehre war schnell das Modell der Orthodoxie und deren Gegenpol, der Heterodoxie beziehungsweise der Häresie, etabliert. Wahrheit war Orthodoxie, und Orthodoxie war Wahrheit. Der wahre Christ war orthodox, allein der Orthodoxe war ein wahrer Christ. Darauf konnten sich gewiss alle Christen verständigen.
Hier tut sich jedoch ein Problem auf. Wir sprechen heute – beispielsweise – von Christen, Juden und Heiden. Lassen wir die Heiden einmal beiseite und konzentrieren uns auf Christen und Juden. Wir können diese Gruppen unterscheiden, aber damit treffen wir nicht das antike Verständnis, jedenfalls nicht das christliche. Nur die Christen waren der eigenen Ansicht nach die wahren Juden, ihnen standen die falschen Juden gegenüber, jene also, die immer noch nicht begriffen hatten, dass der Messias längst gekommen war.
Die Jesus-Anhänger waren Juden, und sie blieben aus ihrer Sicht Juden, mochten die anderen Juden dies auch anders sehen und diese Bezeichnung weiter für sich reklamieren. Es dauerte lange, bis sich die Christen nicht mehr als Juden verstanden. Der erste lateinische Kirchenschriftsteller Tertullian weist um 200 darauf hin, dass die Juden sich wesentlich von den Christen unterschieden: in der Ablehnung bestimmter Speisen, im Feiern der Festtage, in der Praxis der Beschneidung, schließlich auch dem Namen nach. Aber noch Augustinus muss zweihundert Jahre später jene Christen zurechtweisen, die sich noch immer Juden nennen; sie sollten sich lieber «Israel» nennen, auch wenn den anderen Juden dieser Name eher zustehe.[10] Für Augustinus war der Begriff «Juden» als theologische Kategorisierung durchaus tragbar. Er war jedoch zugleich eine soziale Kategorie, von der sich der Kirchenvater strikt abgrenzen wollte. Wenn auch die Christen die wahren Juden waren, so konnte dies doch zu so vielen Missverständnissen und Verwechslungen führen, dass Augustinus den anderen Juden gerne die Bezeichnung überließ. Es ist sicherlich kein Zufall, dass der Kirchenvater diese Klarstellung zu einer Zeit trifft, in der die christlichen Kaiser beginnen, durch ihre Gesetze zunehmend Häretiker, Heiden und Juden pauschal zu diskriminieren. Erst die staatlichen Judengesetze brachten die Christen seit dem beginnenden 5. Jahrhundert zu der Erkenntnis, dass sie zwar die wahren Juden seien, dies aber nicht laut sagen sollten.
Wir fassen hier einen Kern des christlichen Selbstverständnisses. «Wahr» und «falsch» sind Kategorien, deren Zuordnung dem rationalen Diskurs entzogen sind. Die Irrationalität ist Kennzeichen des Christentums.[11] Das Eigene ist wahr, alles andere ist falsch, doch nur, wenn die staatliche Macht ins Spiel kommt, kann die Orthodoxie – beziehungsweise die Wahrheit – definiert und durchgesetzt werden. Dann kann es passieren, dass diejenigen, die sich dieser staatlich definierten und aufgezwungenen Wahrheit nicht beugen, ihr Leben lassen müssen.
Die Christen sprachen die Sprache der damaligen Zeit und mussten folglich eine Begrifflichkeit für ihre eigene Sicht der Dinge finden. Dies führte zu einer Inflation des «Wahren». Nehmen wir nur das Phänomen Gott. Lange vor der Geburt Jesu war der Kaiser Augustus Gott gewesen, und zugleich war er der Sohn eines Gottes, seines Adoptivvaters Julius Caesar: Gott von Gott. Um später Christus zu charakterisieren, fügte man jeweils das «wahr» hinzu: So wurde Jesus wahrer Gott von wahrem Gott. Wenn der christliche Autor Tertullian an unterschiedlichen Stellen «Religionsfreiheit» fordert, dann ist entscheidend, was er unter «Religion» versteht. Jeglicher Duldungsgedanke im modernen Sinne ist ihm fremd, da es für ihn nur eine «Religion» gibt, die, da der Begriff seit Jahrhunderten anderweitig besetzt ist, bei ihm die «wahre Religion des wahren Gottes» heißt. Dieser wahren Religion entspricht ebenso eine wahre Irreligiosität; sie findet sich bei all denen, die nicht Christen sind.[12] Die Römer unterschieden seit langem zwischen «Religion» und «Aberglauben», falscher oder übertriebener Frömmigkeit.[13] Wenn es aber aus christlicher Sicht nur eine Religion, nur eine wahre Religion gibt, ist alles andere Aberglaube. Die wahre Religion ist die christliche, allerdings nur diejenige, die Tertullian für die richtige hält.
Nach Laktanz (250–325), der als Erzieher der Söhne des Kaisers Konstantin erheblichen Einfluss auf deren Religionspolitik ausübte, verteidigt der Christ «seine wahre und fundierte Freiheit». Auch für diesen Kirchenvater gibt es nur eine wahre Religion, die eigene. An alle anderen wendet er sich mit unmissverständlichen Worten: «Falls ihr noch einen Rest Verstand besitzt, lernt, dass die Menschen deshalb schlecht und ungerecht sind, weil [viele] Götter verehrt werden, und dass alle Übel aus dem Grund die menschlichen Dinge von Tag zu Tag mehr belasten, weil [der wahre] Gott, der Schöpfer dieser Welt und deren Lenker, völlig vernachlässigt wird, weil man entgegen dem, was göttliches Recht ist, gottlose Religionen angenommen hat.»[14] Damit ist die Ablehnung aller falschen, paganen Weisheit vorbereitet.
Dem Wahren steht das Falsche gegenüber, ja die Welt ist voll vom Falschen. So wie es falsche Götter gibt, gibt es auch falsche Christen, falsche Apostel, «eingeschlichene Falschbrüder»[15] und so fort. Paulus spricht ferner von Menschen, die ein anderes Evangelium verkünden, von Überaposteln, betrügerischen Arbeitern, Dienern des Satans und Hunden.[16] Etwa zwei Jahrhunderte später ist bereits von falschen Bischöfen, «Pseudobischöfen» oder, wie es in den älteren, vom christlichen Geist des 19. Jahrhunderts geprägten deutschen Übersetzungen heißt, «Afterbischöfen» die Rede.[17] Orthodoxe werden mit heiligem Wasser getauft, das die Sünden abwäscht, andere durch «unreines und unheiliges Wasser besudelt»[18] – und was der Gegensätze mehr sind. All das sind nicht nur definitorische Phänomene; denn alle Häretiker, Gotteslästerer, falschen Apostel oder Ränkeschmiede, die die Wahrheit untergraben, sind wie Schwert, Gift und Pest; darauf wird noch zurückzukommen sein.
Christen wurden schon in den frühesten Texten dazu ermahnt, sich von Andersgläubigen abzugrenzen. Sie sollten nicht Gemeinschaft haben mit Heiden, also Unzüchtigen, Habgierigen, Götzendienern, Lästerern, Trunkenbolden oder Räubern; mit solchen Leuten sollten Christen nicht einmal essen.[19] Zum Problem konnte es werden, wenn man, den Mahnungen des Apostels Paulus folgend, jeden Kontakt mit Heiden vermeiden wollte. Man durfte Nichtchristen nicht ins Haus lassen, ja nicht einmal grüßen.[20] All diese Verbote erhielten mit den rasch um sich greifenden Häresien, von denen der Kirchenvater Augustinus zu Beginn des 5. Jahrhunderts einmal achtundachtzig auflisten sollte, neue Aktualität.
Wie keine andere antike religiöse Bewegung hat das frühe Christentum nämlich «Häresien» produziert, die von «orthodoxen» Gegnern als solche bezeichnet und deren Legitimität und Daseinsberechtigung damit bestritten wurde. Von Anfang an vertraten die christlichen Gruppierungen Geltungsansprüche, die sie gegenüber anderen durchzusetzen versuchten. Die Identitätsansprüche der verschiedenen Gruppen waren mit Herrschaftsansprüchen verbunden, die Abweichungen nicht gelten ließen. Was solche Häresie bewirkte und bedeutete, machte man in drastischen Bildern klar. Richtige Christen wurden von Häretikern verführt, vor allem einfache Gemüter, die nicht gründlich genug über ihren Glauben nachdachten – wie Kühe von sexuell aggressiven Bullen.[21] Bisweilen verglich man Häretiker auch mit kläffenden Hunden, die in einem bestimmten Punkt Bullen nicht nachstanden. So konnte sich auch der einfachste Bauer ein Bild von einem Häretiker machen.
Häresie war wie Ehebruch und musste wie Ehebruch behandelt werden. Der Bischof Optatus von Mileve gesteht um 360 zwar zu, dass es ein Gebot gibt wie «Du sollst nicht töten», er verweist aber gleichzeitig auf das Buch Numeri des Alten Testaments, nach dem Pinehas, ein Enkel des Priesters Aaron, einem ehebrecherischen Paar einen Spieß durch den Bauch stieß. Zwar sei Mord eine schlechte Tat, schreibt der Bischof, aber sie geschehe hier im Namen eines größeren Gutes. Optatus rechtfertigt so staatliche Hinrichtungen von Häretikern.[22]
Die wahrscheinlich in allen christlichen Gruppierungen verbreitete Überzeugung, dass es nur eine Wahrheit, folglich nur einen Weg zur Wahrheit, nur eine christliche Kirche, nur einen Körper Christi, nur einen Weg zum Heil gebe – diese Überzeugung stand jeglichem Kompromiss entgegen. Die Konsequenz aus der Tatsache, dass es innerhalb des heute so verstandenen antiken Christentums ebenso viele Gruppierungen gab wie außerhalb desselben, war allerdings nicht die Anerkennung der Vielfalt, sondern ein Beharren auf der eigenen Position, eine fanatische Rechthaberei, eine Verleumdung aller Andersdenkenden, letzten Endes ein Kampf aller Christen gegen alle. Dieser Kampf wurde wie viele andere Auseinandersetzungen auch auf der Straße ausgetragen: «Der da ist ein Verräter und der da auch!» – so ging ein Christ durch seine Stadt und zeigte auf Häretiker.[23] Ein Verräter war vor allem jeder, der es gewagt hatte, von der einen zur anderen christlichen Glaubensrichtung zu wechseln. Dabei konnte man Geschichten hören wie die folgende: Bei den eigenen Christen sei der Betroffene Diakon gewesen, aber wegen Ehebruchs seines Amtes enthoben worden; nun sei er bei den anderen Bischof.[24] So diffamierten sich die Gruppen gegenseitig.
Der Weg der Wahrheit war für jeden Christen schmal, sehr schmal, und die Wahrheit hing mitunter an einem einzigen Wort, an einem einzigen Buchstaben, dem richtigen Wort nämlich und dem richtigen Buchstaben. Die Gefahren, die abseits dieses schmalen Weges drohen, schildert Gregor von Nazianz anschaulich: «Uns [wahren Christen] aber – denn die Wahrheit zu sagen ist unser Ziel –, uns muss es angst sein, ob es sich wirklich so verhält, wie wir sagen, oder nicht. Der Weg führt nämlich zwischen Abgründen hin, und von ihm abstürzen heißt ohne Frage abstürzen in die Pforten der Hölle. Darum müssen wir sehr auf unsere Worte achthaben, mit Verstand uns äußern und anderen zuhören; gelegentlich müssen wir uns aber von beidem zurückziehen und uns von der Furcht als Richtschnur leiten lassen.»[25]
Die vorgebliche Einheit der Christen war durch drei Dinge gefährdet, wie Augustinus später präzise formulieren sollte: «Häretiker, Juden und Heiden bilden eine Einheit gegen die Einheit.»[26] Auch hier kommt Augustinus nicht aus seinem christlichen Denkschema heraus. Weil Einheit eine zentrale Forderung der christlichen Orthodoxie ist, kann man sich den Gegner nicht anders als einheitlich vorstellen. So steht man dann gedanklich schnell allein gegen den Rest der Welt.
Beansprucht eine Religion für sich, im alleinigen Besitz der Wahrheit zu sein, ist es unmöglich, sich mit ihr argumentativ auseinanderzusetzen. Dies wiederum macht die heutige historische Betrachtung schwierig, da das logische Argument zu ihrem elementaren Rüstzeug gehört. Aber mögen andere auch Argumente bringen, schreibt Tertullian, die Wahrheit wird siegen.[27] Gegen die Wahrheit gibt es keine Argumente, was häufig genug bedeutete, dass nicht argumentiert, sondern diffamiert wurde.
Typisch für die Wortwahl christlicher Diskussion sind die kompromisslose Direktheit und die aggressive Schärfe, zu der auch die moralische und intellektuelle Diskriminierung gehört. Die anderen sind moralisch verwerflich und strohdumm. Denn das Leugnen der Wahrheit zeigt Unverstand, demonstriert Hartnäckigkeit, und diese Hartnäckigkeit wird das typische Kennzeichen der Unbelehrbaren: Ketzer, Schismatiker, Häretiker, Heiden und Juden. In einem Gesetzestext fragt der christliche Kaiser Theodosius II. (408–450) zunächst rhetorisch, wer denn so verblendet sei, hinter den Wundern der Natur nicht deren Urheber zu erkennen. Die Antwort gibt er dann selbst: «Wir erfahren, dass mit erblindeten Sinnen die Juden, Samaritaner, Heiden und die übrigen Arten monströser Häretiker dies wagen.»[28]
Der aus dem syrischen Raum stammende Christ Tatian wirft um 160 den heidnischen Mythen mangelnde Konsistenz und Logik vor. Dies erläutert er am Beispiel des Demeter-Mythos, aufgrund der Eleusinischen Mysterien sicherlich einer der bekanntesten der Antike: Als ihre Tochter Persephone durch den Gott Hades entführt worden war, machte Demeter die Erde unfruchtbar, bis Zeus einwilligte, dass Persephone zwei Drittel des Jahres wieder bei der Mutter verbringen dürfe. Fortan schenkte Demeter den Menschen reiche Ernten und Wohlstand. Sie galt daraufhin als Göttin des Ackerbaus und Wohltäterin für alle Menschen. «Warum hat sie sich denn nicht schon vor dem Verlust ihrer Tochter als Wohltäterin der Menschen betätigt?», fragt Tatian.[29] Er hätte sich wohl kaum gefragt, weshalb Gott so lange gewartet hat, bis er seinen Sohn, den Messias, schickte.
Ein weiterer Wesenszug christlicher Argumentation besteht darin, für Motive, Denkstrukturen oder Handlungsweisen gleichsam ein Eigentumsrecht einzufordern. Finden diese sich auch anderswo, handelt es sich zweifellos um Diebstahl, aber immer um den Diebstahl der anderen. Zeigen lässt sich das etwa bei Clemens von Alexandria (140/50–220). Er stammte aus Athen und war als erwachsener Mann Christ geworden. Gegen Ende des 2. Jahrhunderts lehrte er in Alexandria und war zeitweise Leiter der Katechetenschule, einer der frühesten theologischen Bildungsstätten, bis er in Konflikt mit dem dortigen Bischof geriet und nach Kleinasien ging. Sein «Protreptikos» ist eine Werberede, die gebildete heidnische Leser voraussetzt, die er für seine neue «Philosophie», das Christentum, gewinnen will. Clemens setzt sich in diesem Zusammenhang mit dem griechischen Mythos auseinander und weist zunächst einmal allgemein darauf hin, dass Griechen gewohnheitsmäßig geistigen Diebstahl betrieben haben und betreiben. Wenn aber die Griechen alles stehlen, dann fällt es nicht schwer zu beweisen, dass sie auch vor den Weisheiten der Bibel nicht haltgemacht haben, die älter als die griechischen Mythen sein sollten. «Es lässt sich nachweisen, dass sie [die Griechen] nicht nur ihre Lehren von den Barbaren nehmen, sondern auch die wunderbaren Taten, die bei uns von alter Zeit her aufgrund der göttlichen Macht durch heilig lebende Männer zu unserer Bekehrung vollführt wurden, mit den unglaubhaften Erzählungen der griechischen Mythologie nachahmen.»[30]
Wer auch immer, und sei es nur annäherungsweise, mit dem Christentum in Berührung kam, übernahm dessen jüdisches Erbe – die Auffassung, das auserwählte Volk zu sein, allein und exklusiv die Wahrheit gefunden zu haben, von Feinden und vom Bösen umgeben zu sein. Die christliche Sicht des Lebens in der Welt als eines ständigen Kampfes, christlich gegen heidnisch, christlich gegen jüdisch, gut gegen böse oder orthodox gegen häretisch, lud geradezu dazu ein, alle Konfliktsituationen religiös zu verbrämen und dadurch zu radikalisieren. Man konnte Nebenbuhler anschwärzen, Konkurrenten ausstechen und so fort.
«Den Feind seines Freundes nimmt niemand als Freund auf. Niemand will, dass sein Freund Feinde hat. Niemand nimmt den Feind seines Bruders als seinen Freund auf […]. Das sind die Gründe, weshalb du deinen Feind hassen musst, wenn du dem Herrn gefallen willst. Wenn du aber seinen Feind liebst, wirst du mit diesem Mann am Tag des Jüngsten Gerichts die Strafe zahlen.»[31] Bei Johannes Chrysostomus, Bischof von Konstantinopel (349–407), ist nichts zu finden von Vergebung und Feindesliebe. Es zählt vielmehr der Psalmspruch: «Ich jage meinen Feinden nach und kehre nicht um, bis sie völlig vernichtet sind.»[32] Die Auseinandersetzung um den wahren Glauben kennzeichnet vor allem eine aggressive Sprache.[33] Der Bischof Augustinus ist ein Meister der verbalen Diskriminierung: «Es werden diejenigen, die in der Kirche Christi ungesunden und verkehrten Ansichten huldigen, zu Häretikern, wenn sie sich der Zurechtweisung, die sie zum Gesunden und Richtigen zurückführen möchte, hartnäckig widersetzen und ihre verderben- und todbringenden Lehren nicht aufgeben wollen.»[34] Das Lieblingsbild des Bischofs Epiphanius von Salamis (310/20–403) in seinem «Arzneikasten gegen alle Häresien» sind Schlangen und Skorpione, mit denen er die Häretiker vergleicht. Dazu zieht er die Stelle des Neuen Testaments heran, in der Jesus befiehlt, den Schlangen die Köpfe zu zertreten.[35]
Was den Begriff «häretisch» im breiten Bewusstsein so belastete, waren die moralischen Vorurteile, die den Häretiker trafen. Wenn er von der Norm christlichen Glaubens abwich, musste er auch auf sämtlichen anderen Gebieten von der Norm abweichen, vor allem auf dem Gebiet der im Christentum streng reglementierten Sexualität. Der Vor-wurf sexueller Perversion gehörte zum Standardrepertoire. In einem Prozess gegen zwei Häretikerinnen Anfang des 5. Jahrhunderts kam Folgendes – unter Folter – «zutage»: Zu zweit hatten sie ein Paar beim Geschlechtsverkehr beobachtet. Den Boden des Zimmers unter dem Paar hatten sie mit Mehl bestreut, damit der Same nach dem Akt aufgefangen werden konnte. Er wurde dann von anderen Mitgliedern der Sekte verzehrt.[36] Typisch häretisch!
Den falschen Christen konnte man alles erdenkbar Schlechte vorwerfen. Eine kleine Blütenlese aus den Briefen Cyprians, Mitte des 3. Jahrhunderts Bischof von Karthago: Die falschen Christen unterschlagen Geld, schänden Jungfrauen, brechen Ehen; glaubt man Cyprian, war Ehebruch übrigens eine der Lieblingsbeschäftigungen der Pseudobischöfe. Paulus hatte mit dieser unheiligen Litanei im Römerbrief angefangen, sie betrifft in seinem Fall Juden und Heiden: «[S]ie sind erfüllt mit jeglicher Art von Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll von Neid, Mord, Streit, Betrug, Arglist; sie sind Einflüsterer, Verleumder, Gottesfeinde, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder von Bosheiten.»[37]
Für die Kirchenväter war klar: Alle, die nicht Christen sind, sind ansteckend und unheilbar krank. Der Bischof Paulinus von Nola (355–431) sah in jedem, der ihm nicht in Christus verbunden war, einen Feind, von dem man sich wie von einem kranken Körperteil trennen musste.[38] Bisweilen versuchte man, den Irrenden auf den rechten Pfad zurückzuführen, reichte man dem Kranken geistliche Mittel zur Heilung. In seiner Streitschrift «Gegen Eunomius» betont der Bischof Gregor von Nyssa Ende des 4. Jahrhunderts jedoch, dass Heilmittel bei unheilbar Kranken nutzlos seien, ja manchmal sogar als Auslöser schlimmerer Krankheiten angesehen werden müssten.[39]
Der römische Staat, dem Paulus mit dem Römerbrief eine wunderbare Waffe an die Hand gegeben hatte, verfügte über andere Möglichkeiten, mit Häretikern umzugehen. Nachdem Kaiser Theodosius (379–395) das Christentum zur Staatsreligion erklärt hatte, begann man, Häretiker zu bedrängen oder zu verfolgen, und die Palette staatlicher Repression war lang: Beschlagnahme von Häusern und Kirchen, Versammlungsverbot, Verbannung, Verbot von Amtsweihen, Werbung und Unterricht sowie der Errichtung von Kirchen, ferner Bücherverbrennung, Entzug diverser Bürgerrechte, Geldstrafe, Aufenthaltsbeschränkung, Todesstrafe. Allein die Masse der Häretiker, die schließlich auch Steuerzahler waren, bewahrte sie vor der allzu exzessiven Anwendung des zuletzt genannten Mittels.
Längst war Gewalt gegen Andersdenkende für Christen gerechtfertigt, wenn sie, wie Augustinus feststellt, aus Liebe geschah. Liebe bedeutet in diesem Fall, dass man um das Seelenheil des anderen bemüht war und ihn notfalls mit Gewalt zu diesem Heil zwingen musste – weil man ihn liebte. Die Durchsetzung des christlichen Glaubens war inzwischen Aufgabe des Kaisers, der seine Macht von Gott auch dafür erhalten hatte, dass er die Verbreitung des richtigen Glaubens mit Gewalt beförderte. Es gibt eine gerechte, also erlaubte Verfolgung. Optatus von Mileve rechtfertigt die Bestrafung der Häretiker mit dem Beispiel des Moses, der dreitausend Abtrünnige getötet habe, weil sie das Goldene Kalb verehrten. Diese Menschen widersetzten sich Gottes Willen, und dies täten die Häretiker auch. Das Töten sei gewiss schlecht, aber die Getöteten trügen selbst die Schuld.[40]
Die Ausübung von Gewalt als Mittel der Bekehrung zum wahren Glauben wurde immer wieder mit positiv klingenden Ausdrücken kaschiert. So ist etwa von Ermahnungen, Heilmitteln, Besserung oder Erziehung von Kindern die Rede. Derjenige, der Gewalt anwendet, wird zum strengen Lehrer, zum ernsten Vater, zur sorgenvollen Mutter. Der christliche Staat ist folglich der Erzieher der Häretiker oder Heiden, wobei er im Sinne Gottes, des strengen Vaters, handelt. Gott straft mit seiner väterlichen Peitsche, aber es geschieht, damit es dem so Bestraften gut geht. Und wie im Gleichnis vom großen Gastmahl der Herr am Ende die Leute zwingt, in sein Haus zu kommen, so muss man es auch mit allen Nichtchristen tun.[41] Einige der Verfolgten entgegneten: «Warum erlaubt ihr nicht, dass jeder seinem freien Willen folgt, da doch Gott der Herr selbst den Menschen den freien Willen gegeben hat?»[42] Es war das Argument einer Minderheit, die ihre vergebliche Hoffnung auf die Duldung durch die Mehrheit richtete.[43]
Christen waren stets von Gegnern umgeben. War ihnen zunächst die Welt überhaupt fremd oder gar feindlich, so waren es später lange Zeit die Heiden, die ihnen feindlich gegenüberstanden, wie die Christen nicht müde wurden zu formulieren. Rasch traten konkurrierende christliche Gruppen hinzu, die die jeweils anderen als Gegner begriffen. Besonders deutlich wird dies in einer Rede Gregors von Nazianz über den Heiligen Geist, in der er sich mit einer bestimmten Gruppe von Häretikern auseinandersetzt. Diese, so heißt es dort, zeichneten sich durch ein Übermaß an Gottlosigkeit aus, sie handelten gesetzwidrig, seien erbärmliche Kreaturen, Irre und Sünder, sie täten Böses, hielten es mit der jüdischen Weisheit, phantasierten sich alte Possen und Fabeln über Gott zusammen, seien schändlich, stumpfsinnig und nicht bei Verstand; ihre vorgeblichen Argumente seien Haarspaltereien, nichts als überflüssiges Geschwätz. Gregor von Nazianz ist sicher, den Sieg davonzutragen, und fragt daher diejenigen, die sich zu Unrecht Christen nennen: «Warum sollen wir euch menschenfreundlich behandeln?» Schließlich benähmen sie sich selbst «wie ein besonders wütender Eber […], der ins offene Messer läuft, bis er den Todesstoß empfängt».[44]
In den Auseinandersetzungen zwischen den christlichen Gruppierungen ging es im Wortsinn um Leben und Tod. Diese christliche Feindschaft, die Feindschaft eines Christen gegen jeden anderen, ging über den Tod hinaus. Als Hieronymus 410 die Nachricht vom Tod seines Gegners erhielt, schrieb er triumphierend, nun liege der Skorpion plattgedrückt unter der Erde, nun endlich höre die vielköpfige Hydra auf zu zischen.[45]
Ein ganzes Buch christlicher Freude über den Tod der Gegner bietet Laktanz mit seinem Werk «Über die Todesarten der Verfolger». Ich zitiere einige Sätze über den Tod des Galerius (305–311), jenes Kaisers, der das Christentum zur erlaubten Religion erklärt hatte, für Laktanz aber der schlimmste aller antiken Herrscher war: «Es bilden sich Würmer im Leibe. Der Geruch dringt nicht nur durch den Palast, sondern verbreitet sich über die ganze Stadt. Und das ist auch kein Wunder, denn die Ausgänge des Afters und des Harns waren schon nicht mehr zu unterscheiden. Galerius wird von Würmern zerfressen, und unter unerträglichen Schmerzen löst sich der Leib in Fäulnis auf. An das sich auflösende Gesäß werden gekochte Tierchen in warmem Zustand gelegt. Bei der Wegnahme des Verbandes quoll ein unschätzbarer Schwarm hervor, hatte doch das in der Zersetzung der Eingeweide so fruchtbare Übel eine noch weit größere Fülle hervorgebracht. Die Krankheit hatte bereits den Teilen des Körpers ihr Aussehen genommen. Der obere Teil bis zur Wunde war zusammengeschrumpft. Der untere Teil hatte nicht mehr die Gestalt der Füße, sondern war nach Art von Schläuchen aufgetrieben und auseinandergegangen.»[46]
Dies war Unterhaltung der spezifisch christlichen Art.
1. Kapitel: Die Anfänge
Und es begab sich in jenen Tagen, dass durch ein Wunder auf einem öffentlichen Platz in Rom der Welt angekündigt wurde, es werde dem römischen Volk ein König geboren werden. Daraufhin beschloss der Senat in seiner Angst, entmachtet zu werden, alle Neugeborenen töten zu lassen.[1] Der römische Senat setzte sich allerdings nicht durch; das Kind, gezeugt von einem Gott mit einer irdischen Mutter, wurde geboren und wuchs heran. Zum Mann gereift, wurde er, Sohn eines Gottes, selbst Gott und wirkte zahlreiche Wunder. Sein Geburtstag wurde mit dem Beginn aller Dinge verglichen. Es sind Evangelien, gute Nachrichten, die von den Taten dieses Gott-Menschen berichten. Als Gott und Mensch war er der «Retter der ganzen Menschheit», der Soter, der Heiland.
Dieser Heiland ist keineswegs Christus – sondern der römische Kaiser Augustus ([43] 27 v. Chr.–14), der mehr als ein halbes Jahrhundert lang die Geschicke des römischen Staates bestimmte. In dieser Zeit entstand jenes Imperium Romanum, das im Westen beinahe ein halbes Jahrtausend und im Osten nochmals hundert Jahre länger existieren sollte.
Bereits zu Lebzeiten des Augustus pries man nach einem Jahrhundert der Bürgerkriege die innenpolitische Ruhe und Stabilität, die Wohlstand und Frieden brachten. Über die römische Oligarchie erhob sich nun endgültig eines ihrer Mitglieder und begründete die Monarchie, nicht ohne dem gefügigen Teil des alten Adels Anteil am Regiment zu geben. Augustus hatte das Heer reformiert und unter seinem Oberbefehl zum Garanten des äußeren und inneren Friedens gemacht. Er hatte das Verwaltungssystem des Reiches neu geordnet, das unter ihm erheblich vergrößert wurde; vor allem die Annexion Ägyptens erbrachte jene finanziellen Möglichkeiten, die es erlaubten, aus Rom eine Stadt aus Marmor zu machen.
Mit Augustus beginnt die Kaiserzeit, zu deren grundlegenden Kennzeichen die Größe des Reiches und mithin des zu kontrollierenden Gebiets gehört. In diesem riesigen Raum bilden Einheit und Vielfalt ein permanentes Spannungsfeld. Da gab es die Einheit der Sprache – als Verwaltungssprache das Latein, als Verkehrssprache vor allem die Allerweltssprache Griechisch, die Sprache der literarischen Beziehungen und des Handels, lange Zeit die Sprache der Kirche. Ferner finden wir eine Einheit der Kultur, der Wirtschaft, der Währung sowie der Religion im Kaiserkult. Dem gegenüber steht die Vielfalt an regionalen Sprachen, Kulturen, Wirtschaftsräumen und Religionen. Dem Reich gelingt es, den Frieden mehr oder weniger zu garantieren; es ist eine Klammer für die etwa zweitausend Städte, auf denen es basiert. Entscheidend ist, dass dieses Imperium alle in sich aufnehmen will, alle Götter, alle Völker, alle Menschen. Und wie Rom alle aufnehmen will, so wollen alle aufgenommen werden: Die allermeisten waren stolz darauf, Römer zu sein oder werden zu können.
Dieses Imperium Romanum war ein Reich mit hoher Mobilität. Neben den zahlreichen Straßen, die es durchzogen, waren das Mittelmeer und die darin mündenden Flüsse die wichtigsten Verkehrsadern. Mit den Menschen reisten auch ihre Gewohnheiten, ihre Gedanken und vor allem ihre religiösen Einstellungen. Da die Antike zudem eine Zeit intensiver Religiosität war, die das Leben bei allen Gelegenheiten prägte, gingen mit den Menschen zahlreiche Kulte auf Reisen. Die Religion war mobil, weil es ihre Anhänger waren. Wie Mithras, Isis, Sarapis oder Silvanus, um nur einige Gottheiten zu nennen, profitierte auch Christus von den seit Augustus bestehenden Reisemöglichkeiten innerhalb des Römischen Reiches. Im augusteischen Zeitalter vollzog sich ein gewaltiger Wandel im gesamten Mittelmeerraum. Der von den Römern herbeigeführte Friede förderte allerorten eine Aufbruchsstimmung, die den Handel ebenso betraf wie die Welt der Ideen und der Religionen.
Als der als Heiland apostrophierte Augustus im Jahre 14 starb, wuchs im äußersten Osten des Römischen Reiches ein Mann heran, dem man vieles zuschrieb, was auch von Augustus berichtet wurde: Mit diesem anderen Heiland, mit Jesus, beginnt die Geschichte der Christentümer.
Jesus von Nazareth – die Erfindung des Messias
Wer war Jesus? Was tat Jesus? Was wollte Jesus? Die Antwort auf all diese Fragen ist ein und dieselbe: Wir werden es nie erfahren. Jede Zeit dachte und denkt sich ihren Jesus, entwarf und entwirft ihr eigenes Bild von den Anfängen des Christentums. Und weil man den Anfang nicht kannte und in unserem heutigen wissenschaftlichen Sinn auch nicht daran interessiert war – symbolisch für dieses Desinteresse mag der Geburtstag Jesu sein, von dem noch zu reden sein wird –, war der Interpretation des wenigen, das man wusste, Tür und Tor geöffnet. Die Konzilien von Nicäa im Jahre 325 und von Konstantinopel 381 haben ein Glaubensbekenntnis verabschiedet, dessen wesentliche Aussagen über Jesus lauten: Jesus Christus, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Die Geburt, der Prozess und der Tod sind die Ereignisse im Leben Jesu, die gesichert sind. Ebenso sicher war den antiken Christen, dass ihr Heiland von den Toten auferstanden ist.
Die entscheidenden Quellen für das Leben Jesu sind diejenigen Evangelien, die die spätere Kirche als kanonisch ansehen wird: Markus, Matthäus, Lukas und Johannes. Für den Historiker sind es Quellen wie alle anderen auch. Seit Generationen wird über die zeitliche Einordnung der Texte diskutiert. Als gesichert kann gelten, dass Markus der früheste Autor ist, an dem sich Matthäus und Lukas – ob auch Johannes, ist umstritten – orientierten. Mit der Mehrheit der Forscher gehe ich davon aus, dass Markus um das Jahr 70 geschrieben hat, Lukas sein Evangelium und die Apostelgeschichte zehn bis zwanzig Jahre später; Ähnliches gilt für Matthäus. Nochmals später, um die Wende vom 1. zum 2. Jahrhundert, entstand das Evangelium des Johannes.
Die Geburt
Das Evangelium des Lukas legt die Geburt Jesu genau in das Jahr, in dem die Römer einen Zensus in Judäa durchführten. Es kann nur jener Zensus des Jahres 6 gemeint sein, als Judäa römische Provinz wurde. Gleichzeitig gibt Lukas an, das Geburtsjahr Jesu sei in die Zeit des Königs Herodes gefallen, der im Jahr 4 v. Chr. verstarb. Er hat sich also um zehn Jahre verrechnet oder aber mit Bedacht diese widersprüchlichen Angaben gewählt. Da der zeitliche Abstand des Evangelisten zu den Ereignissen nicht so groß gewesen sein kann, dass er sich um ein ganzes Jahrzehnt verrechnete, fällt ein Irrtum wohl aus. Unterstellt man dagegen eine Absicht, können wir versuchen, diese zu ermitteln.
Im damaligen Judentum war die Sehnsucht nach dem verheißenen Messias weit verbreitet, allerdings eher aus politischen als aus religiösen Motiven. Seit mehr als einem halben Jahrhundert kontrollierten die Römer die Region, und sie waren gerade auch deshalb verhasst, weil ihre Herrschaft lange Zeit von Herodes ausgeübt worden war. Herodes war für die Juden ein Fremder, da er als Idumäer keinem der im Alten Testament genannten jüdischen Stämme angehörte. Obwohl er sich an die jüdischen Regeln und Riten hielt, warfen ihm die Juden vor, ihre religiösen Gefühle immer wieder verletzt zu haben, seitdem er im Jahre 37 v. Chr. Jerusalem erobert hatte. Auch nach seinem Tod beruhigte sich die Lage nicht; er hatte sein Reich unter drei Söhnen aufgeteilt. Neuerliche Unruhen führten dazu, dass Rom schließlich Judäa einem Präfekten unterstellte. Dieser war für die militärische und wirtschaftliche Kontrolle der Region verantwortlich, während das Synedrion, eine jüdische Behörde unter Vorsitz des Hohepriesters, für die inneren Angelegenheiten der Juden zuständig war. Dass römische Truppen in Jerusalem stationiert waren und die Römer die Steuer festsetzten, war für das Volk eine erhebliche Belastung.
So manchem Juden dürfte damals der Psalm 17 in den Sinn gekommen sein: «Herr, lass ihnen wiederum erstehen ihren König, den Sohn Davids, zu der Zeit, die du erwählst, Gott, dass Israel, dein Knecht, dir diene. Und gürte ihn mit Kraft, dass er ungerechte Herrscher zerschmettere, Jerusalem reinige von den Heiden, die es so kläglich niedertreten! […] Dann wird er ein heiliges Volk versammeln, das er gerecht regiert, und richten die Stämme des vom Herrn, seinem Gott, geheiligten Volkes […]. Und er hält die Heiden unter seinem Joch, dass sie ihm dienen, und den Herrn verherrlichen offen vor der ganzen Welt. Er macht Jerusalem rein und heilig, wie es zu Anfang war […]. Und in seinen Tagen geschieht kein Unrecht unter ihnen, weil sie alle heilig sind, und ihr König der Gesalbte des Herrn ist.»[1] Dieser Psalm drückt die Sehnsucht nach einem Messias aus, und die Hoffnungen trogen nicht: Bald gab es in Judäa Heilsbringer im Überfluss.
Das Jahr 6 hatte für die Region eine kaum zu überschätzende Bedeutung. Judäa-Samaria wurde zur Provinz Syrien geschlagen und von einem Präfekten mit Sitz in Caesarea verwaltet. Der erste Zensus unter dem syrischen Statthalter Quirinius, verbunden mit der Direktverwaltung durch den Präfekten, führte aus römischer Sicht sicherlich zu einer effektiveren Verwaltung. Die Juden klagten dagegen über eine Zunahme der Steuerlast: Zu der Abgabe der seit Herodes’ Zeiten zu zahlenden Bodensteuer trat nun eine Kopfsteuer, die einkommensunabhängig war und vor allem bei strenggläubigen Juden auf erbitterten Widerstand stieß. Messianische, sozialrevolutionäre und antirömische Strömungen fanden zunehmend Anhänger, wobei die Grenzen zum Banditentum leicht verwischten.
Messias-Gestalten schossen in Palästina wie Pilze aus dem Boden. Die Messias-Erwartung war sprichwörtlich. Der jüdische Autor Flavius Josephus (37–100), der mit Kaiser Titus (79–81) nach Rom gegangen war, fasste die Zustände im Land aus der Perspektive seiner römischen Herren wie folgt zusammen: «Judäa war voll von Räubereien, und man scharte sich aufs Geratewohl um jemanden, der als König auftrat.»[2]
In Peräa, einem Gebiet östlich des Jordan, hatte sich nach dem Tod des Herodes der Sklave Simon das königliche Diadem aufgesetzt und die Paläste des Herodes niedergebrannt; eine Episode, auf die auch der römische Geschichtsschreiber Tacitus (58–120) aufmerksam wurde.[3] Der damalige Statthalter Varus beendete diese messianische Hoffnung. Im Jahr des Zensus, so berichtet wiederum Flavius Josephus, habe sich ein gewisser Judas aus Galiläa zusammen mit dem Pharisäer Sadduk an die Spitze der nach Guerillataktik operierenden Banditenbanden gesetzt und ihnen eine politische Zielsetzung gegeben: den Kampf gegen Rom.[4] Flavius Josephus schildert die Ereignisse jenes Jahres als den Anfang zahlloser Aufstände und Kriege sowie unermesslichen Leids; während der Unruhen gingen sogar Teile des Tempels in Flammen auf. Diese Zerstörung gibt ihm Anlass, auf die Gründung einer neuen Gruppierung durch jenen Judas hinzuweisen: die Zeloten, die neben die bereits bekannten Pharisäer, Sadduzäer und Essener traten. Die neue Gruppe stimmte weitgehend mit den Pharisäern überein, unterschied sich von ihnen aber dadurch, dass sie mit großer Zähigkeit an der Freiheit hing und Gott allein als ihren Herrn und König anerkannte. Um der Freiheit willen ermordeten sie sogar nahe Verwandte und Freunde und waren bereit, jederzeit selbst in den Tod zu gehen.
Für die Römer war auch der sogenannte passive Widerstand nicht harmlos, konnte er doch jederzeit in Aggression umschlagen – zumal wenn die Leute bewaffnet waren. Zu Beginn der vierziger Jahre griffen die Römer ein, als der Messias Theudas seine Anhänger über den Jordan führen wollte. Er gab sich als Prophet aus und behauptete, er könne durch sein Machtwort wie seinerzeit Moses die Fluten des Stromes teilen. Bevor es dazu kommen konnte, wurde er von dem Präfekten Judäas verhaftet und enthauptet.[5] Während der Regierungszeit Neros (54–68) ließ der damalige Statthalter Felix das Militär gegen mehrere Personen vorgehen, die unter dem Vorwand göttlicher Sendung auf Umwälzung und Aufruhr hinarbeiteten. Er wertete schon die Tatsache, dass diese charismatischen Führer die Menge in die Wüste führen wollten, als ersten Schritt zu einem Aufstand und ließ die Männer töten.[6]
Ebenfalls in die Zeit Neros fällt der Auftritt eines wohl jüdischen Propheten aus Ägypten in Jerusalem. Der namenlos gebliebene Messias sammelte seine Anhänger in der Wüste und führte sie dann wie Jesus auf den Ölberg. Von dort wollte er in gut alttestamentlicher Manier die Mauern Jerusalems zum Einsturz bringen – sein Vorbild war Jericho –, um so seinen bewaffneten Banden Zugang zur Stadt zu verschaffen. Wiederum war es Felix, der dem Angriff zuvorkam, wobei er einmal mehr von jüdischen Kollaborateuren unterstützt wurde. Die meisten Anhänger des Ägypters wurden niedergemacht, der Prophet selbst entfloh und wurde «unsichtbar», wie Flavius Josephus etwas rätselhaft vermerkt. War dies für seine noch verbliebenen Anhänger Anlass genug, auf seine Rückkehr zu hoffen?
Das Jahr 6 war für Judäa also ein Epochenjahr des Widerstands gegen Rom, der in dem großen Aufstand der Jahre 66 bis 70 gipfelte – und in genau dieses Jahr datiert Lukas die Geburt Jesu. Dass dieses Ereignis in eben jenes Jahr fällt, in dem der organisierte Widerstand gegen Rom begann, sollte möglicherweise deutlich machen, dass Jesus gleichsam der personifizierte Widerstand war. Ein Widerstand, der sich vor allem und immer wieder gegen den Zensus richtete, gegen die Besteuerung. Doch gehörte Jesus später zu denen, die den Widerstand predigten?
Die Kreuzigung war keine Hinrichtungsform für harmlose Prediger der Liebe und des Friedens, sondern für Aufständische. Einige der Jünger Jesu gehörten der Zelotenbewegung an: etwa Simon, genannt der Zelot.[7] Der Einzug Jesu in Jerusalem war eine Provokation und rief messianische Erwartungen hervor – und das sollte er wohl auch. Nach Matthäus fordert Jesus seine Jünger auf, ihm eine Eselin und deren Fohlen zu bringen, damit er auf diesem in Jerusalem einziehe und sich so das Wort des Propheten Sacharja erfülle: «Frohlocke laut, Tochter Zion! Jauchze, Tochter Jerusalem! Siehe dein König kommt zu dir; milde und siegreich ist er! Demütig ist er und reitet auf einem Esel, auf dem Füllen einer Eselin.»[8]
Der provozierende Einzug Jesu in Jerusalem, hier dargestellt auf einem römischen Sarkophagrelief aus dem 4. Jahrhundert. Im Baum sitzt Zachäus, ein jüdischer Zollpächter aus Jericho, der Jesus später bewirtet haben soll. (Lk 19, 1–10)
Ob Jesus all dies tat oder nicht – entscheidend ist, dass es später Gruppen gab, die ihn so verstanden oder sehen wollten. Wer die von Matthäus zitierte Sacharja-Stelle kannte, wusste: Es geht in der Prophezeiung des Sacharja wie in der Beschreibung des Einzugs in Jerusalem um den Sieg über die Feinde Israels. Und wie sollte man den entsprechenden Text des Johannes verstehen? «Hosanna! Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn und der der König Israels ist.»[9] Schließlich fordert Jesus im Evangelium des Lukas seine Jünger auf, sich ein Schwert zu beschaffen.[10] Sollten diese Waffen lediglich der Selbstverteidigung dienen, wie manche heutigen Interpreten meinen?[11] Welchen Jesus sollte dann eine solche Episode zeigen? Einen ängstlich um seine Sicherheit bedachten Mitbürger?
Als Jesus auf dem Ölberg festgenommen wurde, waren die Jünger bewaffnet.[12] Alle vier Evangelisten sind sich in diesem Punkt einig. Die Jünger besitzen nicht nur Schwerter, sondern sind auch bereit, sie einzusetzen. Wenn dabei einer der Abgesandten des Hohepriesters sein Ohr einbüßt, heißt dies, dass er einen auf den Kopf gerichteten Schlag erhalten hat. Lukas ist die Angelegenheit offensichtlich so unangenehm, dass er Jesus das Ohr wieder ansetzen lässt. Überhaupt waren Jesu Tun und Worte vieldeutig. Was sollte man mit folgender Sentenz anfangen? «Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen, und wie sehr wünschte ich, es wäre schon entfacht. Ich muss mit einer Taufe getauft werden, und wie bin ich bedrückt, bis sie vollendet ist. Meint ihr, ich sei gekommen, Frieden auf der Erde zu schaffen? Nein, sage ich euch, sondern Zwiespalt.»[13] Die entsprechende Stelle bei Matthäus lautet: «Glaubt nicht, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert.»[14]
Exegeten werden nicht müde, solche Sätze metaphorisch zu deuten. Aber konnte man sie nicht so konkret verstehen, wie es offenbar die Jünger Jesu taten, als ein Dorf in Samaria ihnen die Unterkunft verweigerte: «Herr, willst du, dass wir Feuer vom Himmel fallen und sie vernichten lassen?»[15] Lukas lässt Jesus dies ablehnen, aber aus Passagen wie dieser geht hervor, dass eine Aggressionsbereitschaft in seinem Umfeld vorhanden war. Spätere christliche Gruppen waren gar der Meinung, nicht nur Jesus, sondern auch seine Jünger verfügten über die Fähigkeit, ganze Städte in Flammen aufgehen zu lassen, eine Fähigkeit übrigens, die christliche Heilige die gesamte Antike hindurch nie einbüßten.[16]
Lukas’ Datierung der Geburt Jesu ist also widersprüchlich; er wollte das Ereignis wohl bewusst in das Jahr 6 verlegen. Dass er es auch anders konnte, zeigt eine Datierung, die ganz dem Stil seiner Zeit entspricht und sehr präzise ist: «im fünfzehnten Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war, Herodes Tetrarch von Galiläa, sein Bruder Philippus Tetrarch von Ituräa und Trachonitis, Lysanias Tetrarch von Abilene, unter den Hohepriestern Annas und Kajaphas».[17] Was hier so exakt zeitlich bestimmt wird, ist allerdings kein Ereignis aus dem Leben seines Helden Jesus, sondern der Auftritt des Johannes, Sohn des Zacharias. Die Erzählungen über Johannes, den Täufer, bedienen also auch ein chronologisches Interesse. Ganz anders bei Jesus: Zu seinem Protagonisten verfügt Lukas über kein einziges verlässliches Datum. Als das erwähnenswerte Leben Jesu beginnt, ist er für seinen Historiker «ungefähr dreißig Jahre alt».[18]
In diesem Fall zeigen heutige Exegeten übrigens eine merkwürdige Tendenz, die Angabe ernst zu nehmen. Warum eigentlich? Sie ist ebenso wenig präzise wie das aus einer Bemerkung bei Johannes zu entnehmende Alter: «Du bist noch nicht fünfzig Jahre alt und willst Abraham gesehen haben?»[19] Man schätzte die Menschen nach ihrem Aussehen ein, und Jesus sah, als er öffentlich auftrat, offenbar aus wie ein Mann zwischen dreißig und fünfzig.
Man kannte also das Alter Jesu nicht, weil es die frühen Christen nicht interessierte, und genauso wenig wusste man über die Umstände seiner Geburt – sie mussten allerdings wunderbar gewesen sein. Die Bausteine für die Berichte der Evangelisten stammten aus der antiken Überlieferung, die für die Geburt vieler berühmter Persönlichkeiten spannende Erzählungen bereithielt; hinzu kamen die Traditionen des Alten Testaments, dessen Prophezeiungen die Christen in Jesu Leben und Handeln erfüllt sahen.
So ist beispielsweise die Reihe der außergewöhnlich gezeugten antiken Personen lang; an Plato (427–347 v. Chr.) möchte ich erinnern und noch einmal an Augustus. Platos nomineller Vater Ariston war von seiner schönen Gemahlin eines Abends abgewiesen worden, als er mit ihr verkehren wollte. Da erschien ihm noch in der Nacht Apollo und gebot ihm, sich zehn Monate lang zu enthalten, bis seine Frau das Kind zur Welt bringen würde. Wie Platos Vater erschien auch Joseph ein Bote Gottes und erläuterte ihm, was mit Maria geschehen war. «Und Joseph wohnte ihr nicht bei, bis sie einen Sohn geboren hatte.»[20]
Wie in der Sage nach Augustus überlebt auch der Säugling Jesus bei Matthäus; dabei besaß der Evangelist keine Skrupel, Herodes den Kindermord anzudichten, wohl weil dieser jüdische König ohnehin Hunderte auf dem Gewissen hatte. Ein anderes mögliches Vorbild war der im Alten Testament geschilderte Kindermord durch den Pharao, der alle neugeborenen hebräischen Knaben umbringen lassen wollte, weil ihm prophezeit worden war, einer von ihnen werde seinem Haus den Untergang bringen.
Grund dafür, sich im weitesten Sinne mit der Geburt Jesu zu beschäftigen, war auch die Erwartung, dass Jesus der verkündete Messias sei. Ein frühes derartiges Bekenntnis findet sich bei Paulus: Im Römerbrief ist die Rede von «Christus Jesus, der dem Fleische nach aus dem Samen Davids geboren ist, aber eingesetzt ist zum Sohne Gottes».[21] Bei dieser Feststellung wird von altjüdischer Seite Widerspruch aufgekommen sein, und diesem wiederum begegneten die Neujuden, die Christen, indem sie eine lückenlose Genealogie für Jesus und das heißt für seinen Vater Joseph entwarfen. Ganz nach alttestamentlichem Vorbild, das auch in der Überschrift «Das Buch der Abstammung Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams» anklingt, entwarf Matthäus einen Stammbaum von je vierzehn Geschlechtern von Abraham bis David, weiteren vierzehn für einige Nachfolger Davids im Königreich Juda bis zum Exil und nochmals vierzehn bis zu Jesus, dem Christus.
Probleme bei dieser Ableitung bildete der, nennen wir es einmal «Übergang» von Joseph zu Jesus. Bei Matthäus heißt es in einer Fassung: «Jakob zeugte den Joseph, den Mann Marias, aus der gezeugt wurde Jesus, welcher der Christus genannt wird.»[22] Die Textvarianten zu dieser Stelle zeigen die mühevolle Auseinandersetzung der frühen Christen mit dem Problem, das ein Stammbaum und damit die Betonung einer menschlichen Herkunft schuf. In einer Reihe von Handschriften finden sich Formulierungen, die damit umzugehen versuchen: «Jakob zeugte Joseph, dem verlobt Maria [gelegentlich auch ‹Jungfrau› genannt] Jesus gebar, welcher der Christus genannt wird.» Oder: «Jakob zeugte Joseph; Joseph, dem die Jungfrau Maria verlobt war, zeugte Jesus, welcher der Christus genannt wird.»
Lukas verwendet als Abstammungsbegriff das übliche «Sohn», fügt aber hinzu, «wie man annahm», sei Jesus ein Sohn Josephs gewesen, während er im Vers zuvor bei der Taufe Jesu eine Stimme aus dem Himmel erschallen lässt: «Du bist mein geliebter Sohn.» Jesus war Gottes und Josephs Sohn zugleich; so steht es bei Lukas in zwei aufeinanderfolgenden Versen, und man sollte jahrhundertelang darum ringen, wie dies zu vereinbaren sei.
Aus jüdischer Tradition stammt auch die Angabe, Jesus komme aus Bethlehem, im Gegensatz zu den Evangelien, die Jesus aus Nazareth kommen lassen. Dahinter steht die Äußerung des Propheten Micha, der Messias werde aus Bethlehem kommen.[23] Man half sich damit, dass man die Geburt Jesu nach Bethlehem verlegte. Nach Matthäus lebt Joseph in Bethlehem und siedelt erst nach der Rückkehr aus Ägypten nach Nazareth über. Lukas lässt die Familie in Nazareth wohnen und erklärt durch den Zensus die Reise nach Bethlehem und die dortige Geburt.
Die Mutter Jesu spielt in den Evangelien eine jeweils unterschiedliche Rolle. Bei Matthäus ist es Joseph, der von einem Engel die Offenbarung erhält, dass Marias Schwangerschaft vom Heiligen Geist stammt; auch im weiteren Verlauf der Erzählung ist von Maria wenig die Rede. Lukas dagegen sieht in der göttlichen Zeugung Grund genug, den irdischen Vater zu einem Statisten zu degradieren. Bei ihm erhält Maria die Offenbarung durch den Engel vor der Empfängnis; von einem Mann hören wir dabei nichts. Maria ist die Trägerin des Geheimnisses der frohen Botschaft, und entsprechend reagiert sie: «Mein Geist jubelt über Gott, meinen Heiland, da er auf die Demut seiner Magd geschaut hat; denn von jetzt an werden mich alle Geschlechter selig preisen.»[24] Irgendwann sollten die Christen die Worte aufgreifen, die eine unbekannte Frau Jesus zuruft: «Selig der Leib, der dich getragen, und die Brüste, die du gesogen.»[25] Damit war dem späteren Marienkult der Boden bereitet.
In dem an Synoden und Konzilien so reichen 4. Jahrhundert fanden unter anderem in der damaligen kaiserlichen Residenz Sirmium mehrere Zusammenkünfte statt, nach deren Reihenfolge die jeweiligen unterschiedlichen Glaubensbekenntnisse nummeriert sind. In der zweiten Formel von Sirmium wird unter anderem festgehalten, «niemand kann von der Geburt des Sohnes erzählen».[26] Das werde auch ich nicht tun, jedenfalls nicht in dem Sinn, der hier gemeint ist, etwa um zu ergründen, wie aus dem Gott-Vater der Gott-Sohn «entstanden» ist.[27] Genauso wenig geht es mir darum zu ermitteln, wann Jesus geboren wurde. Ich weiß es nicht, und ich bin sicher, dass man es historisch nie herausfinden wird. Dagegen will ich im Folgenden schildern, wie die frühen Christen im Laufe von gut drei Jahrhunderten mit dem Phänomen der Geburt und des Geburtstags Jesu umgegangen sind, bis es zur Festlegung auf den 25. Dezember kam. An diesem Weg lassen sich bereits die Probleme aufzeigen, die das frühe Christentum in der Welt und mit der Welt hatte – und die Lösungen, die es fand.
Zu Beginn war es keineswegs ausgemacht, dass die christlichen Kirchen einmal so etwas Weltliches wie den Geburtstag ihres Gottes feiern würden. Am Anfang stand die Überzeugung vieler christlicher Gruppen, es gehe bald mit dieser Welt zu Ende, man müsse oder solle sich nicht in ihr einrichten. Behauptete man, das Reich Gottes sei nicht von dieser Welt, konnte das rasch dazu führen, dass man diese Welt ablehnte, wie es beispielsweise jene Christen taten, die Rom, die Hauptstadt der Welt, angezündet hatten oder sich zumindest dazu bekannten.[28] Viele Christen sahen sich als Fremde in der Welt, mit der sie folglich so wenig wie möglich zu tun haben wollten.
Doch das Ende verzögerte sich. Paulus und das Apostelkonzil hatten die Heidenmission beschlossen, und mit diesen Heiden kam deren Sprache, kamen deren Ideen, kamen deren Vorstellungen in die christlichen Gruppen. Um den Gefahren dieser Welt zu entgehen, musste sich der Christ von den zahllosen Götzen distanzieren, die überall lauerten und ihn zu verderben trachteten. Zu diesen Götzen, die Heiden sprachen von Göttern, gehörte der Schutzgott, der mit jedem Menschen geboren wird. Wenn der Mensch der Antike Geburtstag feierte, dann feierte er diesen seinen Schutzgott. Das aber war Götzendienst, folglich lehnten die Christen die Feier des Geburtstags ab, ja sie lehnten es sogar ab, den Geburtstag überhaupt zur Kenntnis zu nehmen.