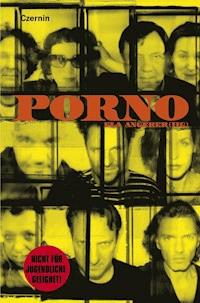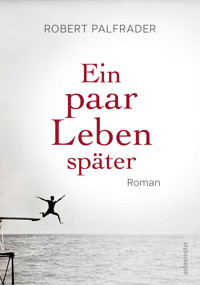
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Ueberreuter Verlag GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Sie machen sich keine Vorstellung davon, wie oft ich die Unwahrheit erzählen werde müssen, um die Geschichte der Familie meines Vaters glaubhaft erscheinen lassen zu können. Denn die ganze Wahrheit kann ich niemandem zumuten, dafür ist sie zu absurd." Eine Familie im ladinischen Teil Südtirols: Die eine Urgroßmutter überaus fromm und ihr Schicksal erduldend, die andere eine erfolgreiche Hundezüchterin, belesen und patent; der eine Urgroßvater geschäftstüchtig und geltungssüchtig, der andere ein geläuterter Rabauke; die Großmutter ein Küchenmädchen mit ausgeprägtem Freiheitsdrang, der Großvater schmächtig und ohne Zukunftsperspektive, der sein Glück in Argentinien sucht und vorübergehend findet, bis er, zurück in Südtirol, in die Wirren des Zweiten Weltkrieges gerät. Robert Palfrader erzählt eine fesselnde Familiengeschichte, in der Fiktion und Wahrheit gekonnt verflochten werden. Realität und Fantasie verschwimmen, wenn er ausdrucksstark und atmosphärisch die Erlebnisse mehrerer Generationen schildert, deren Weg von Südtirol über Argentinien bis nach Österreich führte. Klappentext Nach zwei Wochen, die der Franz ohne nennenswerte Körperpflege oder sinnvolle Gedanken verbracht hatte, raffte er sich auf und stellte sich unter die Dusche. Wusch sich alles vom Leib. Die López, das Hotel, die Feste der Rinderzüchter, die Hoffnungen, die Enttäuschungen, die Antriebslosigkeit und auch Argentinien. Er kaufte sich ein Ticket dritter Klasse nach Hamburg, ging zurück nach St. Vigil, um Fordi zu übernehmen. Der Bruder blieb.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Danke, dass Sie sich für unser Buch entschieden haben!
Sie wollen mehr über uns & unsere Bücher erfahren, über unser Programm auf dem Laufenden bleiben sowie über Neuigkeiten und Gewinnspiele informiert werden?
Folgen Sie
auch auf Social Media
& abonnieren Sie unseren Newsletter
Über das Buch
„Sie machen sich keine Vorstellung davon, wie oft ich die Unwahrheit erzählen werde müssen, um die Geschichte der Familie meines Vaters glaubhaft erscheinen lassen zu können. Denn die ganze Wahrheit kann ich niemandem zumuten, dafür ist sie zu absurd.“
Robert Palfrader präsentiert eine fesselnde Familiengeschichte, in der Fiktion und Wahrheit gekonnt verflochten werden. Realität und Fantasie verschwimmen, wenn er ausdrucksstark und atmosphärisch die Erlebnisse mehrerer Generationen vorstellt, deren Weg von Südtirol über Argentinien bis nach Österreich führte.
Klappentext
Nach zwei Wochen, die der Franz ohne nennenswerte Körperpflege oder sinnvolle Gedanken verbracht hatte, raffte er sich auf und stellte sich unter die Dusche. Wusch sich alles vom Leib. Die López, das Hotel, die Feste der Rinderzüchter, die Hoffnungen, die Enttäuschungen, die Antriebslosigkeit und auch Argentinien. Er kaufte sich ein Ticket dritter Klasse nach Hamburg, ging zurück nach St. Vigil, um Fordi zu übernehmen. Der Bruder blieb.
Für Gio
Inhalt
Vorwort
Urgroßmutter Angela Craffonara geb. Trebo, vulgo Angela dal Tabac
Urgroßvater Albert Craffonara
Urgroßeltern Albert und Angela Craffonara
Urgroßmutter Rosina Palfrader vulgo Findel
Urgroßvater Josef Palfrader vulgo Josef di Fordi
Urgroßeltern Rosina und Josef Palfrader
Großmutter Maria Palfrader geb. Craffonara
Großvater Franz Palfrader
Großeltern Maria und Franz Palfrader
Vorwort
Sie machen sich keine Vorstellung davon, wie oft ich die Unwahrheit erzählen werde müssen, um die Geschichte der Familie meines Vaters glaubhaft erscheinen lassen zu können. Denn die ganze Wahrheit kann ich niemandem zumuten, dafür ist sie zu absurd.
Es besteht natürlich auch die Gefahr, dass sie als bloße Fantasie eines offenbar Verrückten abgetan werden könnte, niemand mir Glauben schenken wird. Denn die Vorkommnisse erscheinen wie eine lächerliche Aneinanderreihung von Unwahrscheinlichkeiten, die nur dazu dienen sollen, die Eitelkeit des Erzählers zu befriedigen.
Und natürlich gibt es Leute, die Ihnen versichern werden, dass sie genau wissen, was damals passiert ist. Die behaupten werden, die beteiligten Personen gekannt zu haben, im Besitz von Beweisen zu sein. Mit ein Grund dafür, weshalb es so viele Versionen dieser Geschichte gibt.
Aber nur ich weiß, was wirklich passiert ist. Nur ich weiß, welch absurde Zufälle letztendlich zu meiner Existenz geführt haben.
Das ist die Geschichte meiner Familie. Also der Familie meines Vaters aus dem ladinischen Teil Südtirols. Aber weil das Volk der Ladiner nicht allzu bekannt ist, ein paar – ganz unwissenschaftliche – Worte über seine Geschichte. Denn die ist nicht ganz unwesentlich für diese Geschichte.
Die Ladiner sind ein kleines rätoromanisches Volk in den Dolomiten mit eigener Sprache. Eine Minderheit im nördlichen Italien, nicht mehr als 35.000 Leute.
Ihre Ortsnamen sind bekannter als das Volk selbst. Alta Badia, Gröden, Cortina d'Ampezzo sind, dank des Wintersports, weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Ursprünglich waren diese Orte von einem Mischvolk aus Kelten und Rätern bewohnt, über das man nicht viel weiß. Zumindest nicht über die Räter.
Vermutlich zum Teil Etrusker, die bei der Expansion Roms nach Norden in die Berge vertrieben wurden. Wie gesagt: So genau weiß man das nicht. Und die Tatsache, dass sie das etruskische Alphabet verwendet haben und auch deren Götter angebetet wurden, heißt ja nicht viel.
Die Wissenschaft vermutet aber, dass die ladinischen Worte für den Weg, die Mure oder die Gams und einige andere etruskischen Ursprungs sein müssen. Denn sie sind weder keltischer noch romanischer Herkunft.
Egal wer oder was die Räter waren, der große Marcus Tullius Cicero hat jedenfalls keine besonders hohe Meinung über sie gehabt, sie für das kriegerischste aller Völker, ein raubendes und mordendes Bergvolk gehalten. Angesichts der Tatsache, dass die Römer beim Erobern der damals bekannten Welt doch ein paar Völker näher kennengelernt haben, ein beachtliches, zumindest erwähnenswertes Urteil.
Wann der römische Einfluss auf die Räter begonnen hat, das Vulgärlatein, wie es die einfachen Soldaten gesprochen haben, sich mit der Sprache der Räter vermischt hat, kann man sehr genau festmachen. Also auch den Zeitpunkt, ab dem man von den Rätoromanen spricht.
15 v. Christus hat es Kaiser Augustus offensichtlich gereicht. Die ständigen Besuche der Räter in Verona und Umgebung, ohne dort jemals eingeladen gewesen zu sein und ohne jemals für die Dinge, die ihnen so gut gefallen haben, dass sie sie mitgenommen haben, zu bezahlen, wurden lästig.
Weshalb die Römer dort oben im Norden ein wenig für Ordnung sorgen wollten. Kurz: Rom ist dazu übergegangen, ihnen nicht nur auf die Finger zu klopfen, sondern ihnen kräftig eins auf den Schädel zu geben. Damit sie wissen, was Sache ist.
Und damit sich die Räter das auch merken, hat man sicherheitshalber nach dieser Disziplinierung ein Militärlager errichtet. Damit war Schluss mit Brandschatzen und Raubmorden und ungebetenen Besuchen in Verona und Umgebung.
Man hat es also den Römern zu verdanken, dass man heute im ladinischen Teil Südtirols kulinarisch bestens versorgt wird, wunderbar bergwandern oder Schi fahren kann. Ohne Angst haben zu müssen, dass man mit einem Bauchstich oder einer Schädelfraktur nach Hause fährt. Wobei es das eine oder andere Lokal geben soll, in denen die Pax Romana, der Augusteische Friede, noch immer nicht konsequent umgesetzt wird.
Wenn man sich vorstellen will, wie Rätoromanisch klingt, gibt es eine gute Referenz: die französische Sprache. Wie das Ladinische ist sie ebenfalls keltischen Ursprungs, ebenfalls ein Produkt der Romanisierung. Und das hört man, wenn man nicht ganz genau hinhört. Es gibt sogar einige Worte, die in Bedeutung und Klang nahezu ident sind.
So etwas wie politischen oder gar militärischen Einfluss hatten die Ladiner nie. Denn sie waren überwiegend Bergbauern, die den steilen Hängen eine Existenz abgetrotzt haben. Das Volk war auch viel zu klein und ihr Land gab kaum bis gar keine Bodenschätze her. Selbst der Ackerbau war, so hoch oben in den Bergen, sehr, sehr schwierig, mancherorts sogar unmöglich.
Bis auf den Handel mit Holz hat man der Welt da draußen also nicht viel zu bieten gehabt. Zu wenig jedenfalls, um sich gegen andere behaupten zu können. Weswegen die Ladiner unter dem Einfluss der Römer, später der katholischen Kirche, aber auch von Grafen und/oder Königen und auch von Kaisern standen. Je nachdem, wer gerade das Heft in der Hand hielt. Ladiner war jedenfalls keiner von denen, die das Sagen gehabt haben. Immer fremdbestimmt.
Offenbar wird so ein Volk stur, wenn über Jahrhunderte jemand von außen kommt und meint, Regeln aufstellen zu können. Denn im Laufe der Geschichte haben manche dieser Herrschenden versucht, das Sprechen des Ladinischen zu verbieten, was von wenig Erfolg gekrönt war.
Sie sprechen ihre Sprache noch immer. Was allerdings gelungen ist, ist die Umbenennung der Ortsnamen. Weswegen heute nahezu jedes ladinische Dorf drei Namen hat: einen ladinischen, einen deutschen und einen italienischen.
Unter der Regentschaft von Joseph II. wurden sogar einige Familiennamen eingedeutscht. Zu fremdländisch, zu italienisch hörten sich die Namen für die Beamten seiner Apostolischen Majestät an.
Um nur ein Beispiel von vielen zu nennen: Der Name Peraforada wurde von der Obrigkeit in Palfrader geändert. Seit damals trägt meine Familie diesen Namen.
Familie. Schwieriger Begriff. Denn wo Familie beginnt, ist leicht definiert, aber wo hört sie auf? Denn wenn man nur acht Generationen nach hinten blickt, sind das 256 direkte Vorfahren. Nicht, wenn man ein Habsburger ist, selbstverständlich. Da muss man mit der Hälfte zufrieden sein. Aber im Normalfall sind das 256 Leute, die ebenfalls aus ebenso vielen Familien stammen.
Welche dieser Familien ist jetzt die eigene? Oder sind es alle? Keine? Wie gesagt: schwierig! Und wer sind diese Leute, deren Schicksale, deren Entscheidungen, deren Glück und/oder Unglück dafür gesorgt haben, dass man ein paar Leben später – auf die eine oder andere Art – eine Existenz aufgezwungen bekommen hat?
Urgroßmutter Angela Craffonara geb. Trebo, vulgo Angela dal Tabac
Angela kam im Juli 1882 als jüngstes von fünf Geschwistern auf die Welt. Ein Sommer, den sie lange nicht vergessen haben, in St. Vigil. Drei Wochen hatte es durchgeregnet. Die Wiesen wurden überschwemmt und der Bach, der damals noch durch die Ortschaft floss und noch nicht reguliert war, riss die Heuernte mit sich. Das Wasser aus den Brunnen konnte man auch nicht mehr trinken, ohne es vorher abzukochen.
Auch das Geburtshaus der Angela hatte damals großen Schaden genommen. Die Ciasa dal Tabac. Auf Deutsch: das Tabakhaus. Es heißt immer noch so. Obwohl es dort schon eine halbe Ewigkeit keinen Tabak mehr zu kaufen gibt.
Das Haus liegt gleich neben der Kirche von St. Vigil. Das einzige Haus neben der Kirche, wohlgemerkt. Und an dessen Stelle stand angeblich schon ein Haus, bevor es dort überhaupt eine Kirche gegeben hat.
Zur Zeit der Geburt von Angela ein Bauernhaus. Wahrscheinlich das kleinste von St. Vigil. Kaum zum Ernähren einer Familie geeignet. Ein winziger Gemüsegarten hinter dem Haus, gerade mal ein paar Quadratmeter groß und eine kleine Futterwiese, die so wenig Heu abwarf, dass man maximal eine Kuh und eine Ziege durch den Winter bringen konnte.
Viel mehr hätte auch nicht in den Stall gepasst, der ein Teil des Hauses war. Wand an Wand mit dem Vieh hat man gelebt, mit entsprechender Geruchsbegleitung. Aber das störte niemanden, der dort wohnte. Man kannte es ja nicht anders.
Wie der Name verrät, wurde im Haus mit Tabak gehandelt. Geschäftsräumlichkeiten gab es nicht, nur ein kleines, lieblos gezimmertes Kästchen, das gleich neben der Eingangstür hing. Das war's. Aber immerhin konnte man dort Pfeifen-, Kau- und Schnupftabak erwerben. Tabak niedriger Qualität selbstverständlich. Den feinen, teuren Tabak, wie er in Bruneck verkauft wurde, hätte sich auch niemand leisten können oder wollen. Oft klopfte es noch spät in der Nacht, wenn einer im Vollrausch seinen Tabakbeutel verloren hatte.
Was für andere ein Zusatzeinkommen bedeutet hätte, von dem man sich die eine oder andere Extravaganz leisten konnte, war für die Familie von Angela überlebensnotwendig. Jeder Kreuzer, der mit Tabak verdient wurde, half, die Mägen zu füllen.
Vor allem die Winter stellten die Familie jedes Jahr vor eine Herausforderung. Denn dann musste man sich eine Kuh vom Nachbarn ausborgen, sonst wäre es im Stall zu kalt geworden. Eine Kuh allein hätte nie genug Körperwärme erzeugen können, um den Stall auf erträglicher Temperatur zu halten, wäre erfroren. Die Ziege gleich mit, ohne eine Gastkuh. Als Gegenleistung musste die geborgte Kuh gemolken und die Milch an den Besitzer abgeliefert werden.
Im Keller war eine Werkstatt eingerichtet, in der Angelas Vater Schlitten reparierte und auf Bestellung auch baute. Es waren die großen Heuschlitten, mit denen man im Winter Heu von den hoch gelegenen Wiesen herunterbrachte.
Das Heu wurde nach der Mahd in kleinen luftdurchlässigen Hütten, die direkt auf der Wiese standen, zwischengelagert, bis der Schnee ermöglichte, das Heu ohne größeren Aufwand in die unten gelegenen Höfe zu bringen. Eine nicht ganz ungefährliche Arbeit. Jedes Jahr gab es Verletzte, manchmal Tote zu beklagen. Denn so ein eingeschneiter großer Stein war leicht zu übersehen, der Schlitten schwer zu steuern und kaum zu bremsen. Da gab es eine Menge zu reparieren nach einem Winter.
„Vor dem Oktober brauch ich den Schlitten nicht, Tabac“, sagten die einen.
„Lass dir nur Zeit. Bezahlen tu ich, wenn ich ihn hol!“, die anderen. Und wieder: eine Nebeneinkunft, die nicht viel einbrachte.
Mit ihrem ältesten Bruder, Paul, hat die Angela nur ein paar Jahre verbracht. Er war um fast neun Jahre älter als sie und hat, sobald es ihm möglich war, das Haus verlassen. Offenbar war ihm klar, dass hier nichts zu holen sein würde, er besser dran wäre, würde er sein Glück in der Welt da draußen suchen.
„Pass auf auf dich! Und ich werde jeden Tag beten für dich, damit dir nichts passiert“, hat die Angela zum Abschied gesagt.
Mit dem Geld, das er sich als Hilfsarbeiter bei einem Bäcker in St. Lorenzen verdient hatte, ging er nach Triest. Alle paar Wochen kam ein kurzer, ziemlich lieblos formulierter und auch nicht besonders informativer Brief von ihm. „Es geht mir gut, habe Arbeit und ein sauberes Zimmer.“
Dann kam gar nichts mehr. Ein Jahr lang hat man nicht gewusst, ob er noch lebt, und wenn ja, wo und wie. Jeden Tag nach der Schule lief die Angela zur Post und fragte, ob ein Brief vom Paul gekommen wäre. Nach ein paar Wochen klopfte sie nur noch an eines der Fenster, bekam ein Kopfschütteln als Antwort und ging in die Kirche, um für ihren Bruder zu beten.
Sein erstes und gleichzeitig letztes Lebenszeichen kam in Form eines Briefes aus der Kolonie Assab. Eine italienische Kolonie am ostafrikanischen Südufer des Roten Meeres, im heutigen Eritrea.
Der Ton des Briefes war ganz anders als bisher. Detailreich beschrieb der Bruder die Gegend, seine Arbeit, die Leute, Gerüche, Speisen und Pflanzen und wie glücklich er jetzt wäre. Er wisse zwar noch nicht wann, aber er würde sicher in ein paar Jahren nach Hause kommen, nachdem er sein Glück gemacht haben werde. Und demnächst würde er für alle Geschenke schicken.
Die Angela legte diesen Brief unter ihr Kopfkissen. Voll der Vorfreude auf die Geschenke und die Rückkehr des Bruders. Aber da kam nichts mehr. Kein Brief. Auch keine Geschenke. Nur eine Todesnachricht. Offenbar wurde er in einer Spelunke von einem Italiener im Streit erstochen, wie Zeugen berichteten. Der wäre dann geflüchtet, wurde nie gefunden.
Der Gedanke, dass ihr Bruder jetzt tot war und – in ihrer Vorstellung – mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Himmel, beruhigte die Angela. Sie wusste jetzt, wo er war und wie es ihm ging. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Was sollte ihm schon passieren?
„Er ist jetzt bei den Engeln“, sagte die Mutter.
„Amen!“, sagte die Angela.
Denn dass der Bruder jetzt im Himmel war, war der Angela Information genug, um froh für ihren Bruder zu sein.
Als die Angela neun Jahre alt war, erkrankten sie, ihr jüngerer Bruder Carlo und ihre beiden älteren Schwestern nicht nur zeitgleich, sondern auch gleichzeitig an Diphtherie und Scharlach. In den Wochen, die folgten, wurde die Sterbeglocke oft geläutet. Fast die Hälfte aller Kinder soll gestorben sein, in St. Vigil und auch in Enneberg.
Nicht nur, weil die Bevölkerung geschrumpft war, auch weil einige vom Glauben abgefallen waren, war die Kirche am Sonntag nicht mehr so gut besucht wie vor dem Ausbruch der Krankheit. Und die, die die Kirche besuchten, waren leise. Als wären die Ruhe und ihr Schweigen eine Art Vorwurf an einen Gott, der so etwas zulässt. Ein lautloser Protest gegen den da oben.
Die Angela konnte das viele Sterben nicht davon abhalten, jeden Tag zum Gebet und sonntags zur Messe zu gehen. Wahrscheinlich, weil sie überlebt und bei ihr das Rosenkranzbeten funktioniert hatte. Auch, als ihre beiden Schwestern starben, blieb ihr Glaube unerschütterlich.
„Die werden nicht genug gebetet haben. Wenn das Beten nicht fürs Überleben gereicht hat, reicht das dann fürs Himmelreich?“, fragte sich die Angela.
Ihr Bruder Carlo überlebte ebenfalls. Allerdings nur knapp. Die Diphtherie hinterließ schwere Schäden an der Herzmuskulatur und den Nieren. Und diese Schäden begleiteten ihn für den Rest seines kurzen Lebens. Bei der Angela war die Krankheit ohne irgendwelche Folgen vorübergegangen.
Vielleicht war es der Tod des älteren Bruders in Afrika, vielleicht auch der Tod der Schwestern, die Angela zu einem tiefgläubigen Menschen gemacht haben. Vielleicht beides.
Jedenfalls wurde in ihr ein durch nichts und niemanden zu erschütterndes Vertrauen geweckt, dass der Allmächtige in seiner Gerechtigkeit, Güte und Weisheit immer einen Plan hatte, jedes Ereignis schon seinen Grund haben würde. Einen Grund, den der Mensch ihrer Meinung nach weder hinterfragen konnte noch sollte.
Ihr daraus resultierender Gleichmut wurde – nicht nur von ihrer Familie – als Gleichgültigkeit wahrgenommen, als Ignoranz allem und allen gegenüber. Damit tat man ihr aber unrecht. Sie sah das Leben einfach als Aufgabe, die man – so gottgefällig wie möglich – zu erledigen hatte, um sich der Belohnung durch ein ewiges Leben würdig zu erweisen. Nicht mehr und nicht weniger.
Dass ihr bei der Erledigung dieser Aufgabe deshalb zu wenig Zeit blieb, um auf die Gefühle anderer zu achten, war nur logisch.
„Sie macht es sich zu einfach, mit ihrem Glauben“, sagten die einen.
„Sie macht es sich einfach zu schwer, mit ihrem Glauben“, die anderen.
Nachdem sie die Schule gleichermaßen mit einem Minimum an Talent wie Einsatz zu Ende gebracht hatte, bekam sie eine Stelle als Kindermädchen bei einem Richter in Bruneck. Die Frau des Richters war die einzige Tochter eines Notars und hatte ein Vermögen in die Ehe eingebracht. Entsprechend nobel war der Lebensstil, man hatte Personal für jeden Handgriff.
Angela bewunderte die Dame des Hauses, wie sie sprach, wie akribisch sie sich mit dem Messer einen Bissen auf ihrer Gabel richtete, mit nur einem Blick die Stubenmädchen tadelte. Die Angela begann, die Richtersgattin zu imitieren. Zuerst nur die Art, wie sie ging oder Türen öffnete. Später auch ihre Frisur und wie sie sprach. Das fiel aber nicht weiter auf, denn außer zu den Kindern hatte sie kaum Kontakt zu den anderen Bewohnern des Hauses. Auch nicht zu den Angestellten, denn die behandelten sie als Teil der Familie und mit entsprechender Distanz.
Nur der Richter hatte ihr hin und wieder etwas zu sagen. Allerdings brüllte er sie dann an. Was nicht weiter verwunderlich war, denn seine Kinder wussten sehr schnell und sehr genau, wie sie die Angela manipulieren, sie überlisten konnten, um ihren Willen durchzusetzen. Gegen jede im Haus geltende Regel. Was zunehmend zu einem Problem wurde und den Hausherrn von Mal zu Mal zorniger werden ließ.
Eines Tages eskalierte die Situation. Die Schokolade, die Angela den Kindern zu essen gegeben hatte, wäre für eine Geburtstagstorte bestimmt gewesen und wurde von der Köchin verzweifelt gesucht. Dass der gesamte Vorrat in den Zimmern der Kinder verschwunden war, fiel erst auf, als sich die Kinder mehrmals übergeben mussten und die Mutter Nachschau hielt, was sie gegessen hatten.
Der Richter war außer sich. Mehr als zwei Kilogramm Schokolade hatte die Angela den Kindern gegeben. Die Erklärung der Angela, warum sie ihnen so unglaublich viel Schokolade gegeben hatte, machte den Richter sprach- und fassungslos. Sog ihm jede Kraft aus dem Körper.
Die Kinder hätten ihr erzählt, sie hätten zur Himmelsmutter gebetet, dass ihnen eine besonders fromme Frau Schokolade geben solle. Und sie neugierig wären, ob es in ihrem Haus eine wirklich fromme Frau gäbe, die es auch schaffen könnte, dass ein Gebet erhört werde. Deshalb habe sie auch nicht anders handeln können und musste ihnen die Schokolade geben.
Die Angela bat den Richter, doch einzusehen, dass Gebete, die nicht erhört werden, schlecht für alle wären. Nicht nur für die Kinder! Für alle im Haus! Ein bisschen Schokolade sei doch kein hoher Preis dafür, dass man den Teufel vom Haus ferngehalten habe. Nur ein erhörtes Gebet sei ein gutes Gebet!
„Verschwinde“, sagte der Richter leise, aber so bedrohlich, als hätte der Teufel doch noch einen Weg ins Haus gefunden. Er konnte das religiöse Gerede dieses Mädels nicht mehr länger ertragen und setzte die Angela noch in derselben Minute vor die Türe.
Die Angela hat das nicht sonderlich gestört, sie wehrte sich nicht gegen die Entlassung. Im Gegenteil. Sie wollte ohnedies nicht mehr dort bleiben. Die Dame des Hauses konnte sie mittlerweile perfekt imitieren, hier gab es für sie nichts mehr zu lernen. Und viel zu wenig gebetet wurde dort!
„Und so jemand richtet? Nur Gott darf und kann richten! Nur er kann in die Herzen der Menschen schauen, weiß, wer in der Hölle brennen wird oder zumindest im Fegefeuer“, hat sich die Angela gedacht.
Angst vor der Zukunft, Sorgen, wie es mit ihr weitergehen sollte, hatte sie nicht. Sie vertraute ganz auf Gott. Sie war mittlerweile 18 Jahre alt, und was sie im Spiegel sah, gefiel ihr.
„Eitelkeit ist zwar keine Todsünde, aber mit dem Hochmut eng verwandt. Und Hochmut ist eine Todsünde! Jedenfalls gehört es sich nicht, eitel zu sein. Aber was ich da im Spiegel sehe, könnte anderen auch gefallen!“, hat sich die Angela gedacht. Eine Untertreibung. Denn die Angela war wunderschön und es war ihr auch bewusst. Ihr war klar, dass da demnächst eine Menge Kandidaten vorstellig werden würden, sie sich aussuchen würde können, wen sie heiraten würde.
Still ist es geworden, wenn sie sonntags nach der Kirche die Gaststube des Hotel Post betreten hat. Und Tritte gegen die Schienbeine der Männer hat es gegeben. Von den Frauen, die genau sahen, wie ihre Männer die Angela beobachtet haben.
Nur kurz, nachdem sie die Stelle beim Richter verloren hatte und wieder ins Elternhaus zurückgekehrt war, ist der Vater verstorben. Unten in der Werkstatt. Offenbar zu viel vom Schnaps getrunken, den er hinter dem Regal mit den Stecheisen versteckt hatte. Oder zumindest glaubte, vor den Augen der Familie verstecken zu können.
Er muss an der Werkbank gestanden sein, denn die Flasche und das Glas standen noch genau dort. Er nicht, er ist gelegen. Muss kerzengerade, starr wie ein Brett nach hinten gefallen sein.
„Wenn es nicht das Herz war, dann der Aufprall des Schädels“, haben die einen gesagt.
„Ob Herz oder Schädel, tot ist tot“, die anderen.
„Er ist im Himmel bei den Engeln!“, sagte die Angela.