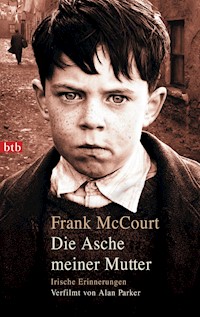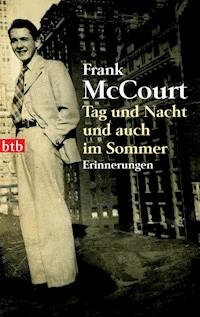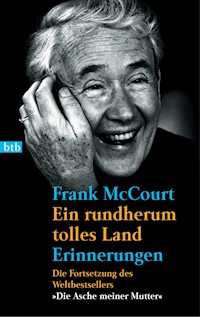
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
„‘Die Asche meiner Mutter‘ ist so gut – sie verdient eine Fortsetzung.“ So schrieb die New York Times über Frank McCourts Bestseller. Mit dem vorliegenden Buch erfüllte der Autor nicht nur den Wunsch seines Rezensenten, sondern auch die Hoffnungen der Millionen von begeisterten Lesern und schrieb seine Geschichte fort. „Ein rundherum tolles Land“ beginnt dort, wo der erste Teil endet: als Frank McCourt mit 19 Jahren an Bord eines irischen Schiffes nach Amerika kommt und nichts hat als die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Arm, mit schlechten Zähnen und entzündeten Augen, ohne jede nennenswerte Ausbildung, erreicht er das Land seiner Träume – und muss feststellen, dass er mit seinem Aussehen und seinem irischen Akzent ein Nichts ist. Wie er sich trotz aller Widrigkeiten einen Platz im Leben erkämpft, einen Platz „auf dem Bindestrich von Irisch-Amerika“, berichtet der große Erzähler McCourt in seiner unnachahmlichen Mischung aus Traurigkeit und Witz. Seine unglaublichen Geschichten über Priester und Jungfrauen, über irische Kneipen, bayrische Bierkeller und die merkwürdigen Sitten der Amerikaner im Allgemeinen verbinden sich zu einer augenzwinkernden Hommage an das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, in der „toll“ nicht nur „großartig“ bedeutet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 812
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Buch
»Die Asche meiner Mutter ist so gut – sie verdient eine Fortsetzung.« So schrieb die »New York Times« über Frank McCourts Bestseller. Mit »Ein rundherum tolles Land« erfüllte der Autor nicht nur den Wunsch seines Rezensenten, sondern auch die Hoffnungen der Millionen von begeisterten Lesern weltweit. Die Fortsetzung seiner Lebenserinnerungen beginnt dort, wo der erste Teil endet, auf einem irischen Schiff vor der Skyline von New York, und der Funkoffizier fragt den neunzehnjährigen Frank: »Ist das hier nicht ein rundherum tolles Land?« Eine augenzwinkernde Hommage an das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, in der »toll« nicht nur »großartig« bedeutet und die geprägt ist von Frank McCourts unnachahmlicher Mischung aus Traurigkeit und Witz.
Autor
Frank McCourt wurde 1930 in Brooklyn in New York als Kind irischer Einwanderer geboren, wuchs in Limerick in Irland auf und kehrte 1949 nach Amerika zurück. Dreißig Jahre lang hat er Englische Literatur und Sprache an New Yorker High Schools unterrichtet. Danach schrieb er die Erinnerungen an seine irische Kindheit auf, ein Buch, das er sein ganzes Leben lang schreiben wollte. »Die Asche meiner Mutter« wurde weltweit zum Bestseller, und Frank McCourt bekam dafür u.a. den Pulitzerpreis. Frank McCourt lebt mit seiner Frau Ellen in New York City.
Inhaltsverzeichnis
Für meine Tochter Maggie,weil sie so warmherzigund offen ist,und für meine Frau Ellen,weil sie ihr Leben mit demmeinen vereint hat.
PROLOG
Da hast du ja jetzt deinen Traum.
Das hat, als wir Kinder in Irland waren, meine Mutter immer gesagt, wenn einer unserer Träume wahr wurde. Einer, den ich immer wieder hatte, war der, in dem ich auf einem Schiff in den New Yorker Hafen einfuhr und ehrfürchtig die riesigen Wolkenkratzer bestaunte. Ich erzählte es jedesmal meinen Brüdern, und dann beneideten sie mich um meine Nacht in Amerika, bis sie anfingen zu behaupten, sie hätten diesen Traum ebenfalls gehabt. Sie wußten, daß sie sich damit interessant machen konnten, obwohl ich mit ihnen stritt, ihnen vorhielt, ich sei der Älteste, es sei mein Traum, und sie sollten gefälligst draußen bleiben, sonst könnten sie was erleben. Sie meinten ich hätte kein Recht, diesen Traum für mich allein zu beanspruchen, in der Weite der Nacht kann jeder von Amerika träumen, und ich könnte sowieso nichts dagegen tun. Ich sagte ihnen, ich kann euch sehr wohl daran hindern. Ich halte euch die ganze Nacht wach, dann habt ihr überhaupt keine Träume mehr. Michael war erst sechs und mußte lachen bei der Vorstellung, wie ich von einem zum anderen ging, um ihre Träume von den Wolkenkratzern in New York zu verhindern. Malachy meinte, gegen seine Träume kann ich nichts ausrichten, weil er in Brooklyn geboren ist und jederzeit von Amerika träumen kann, die ganze Nacht oder auch noch tief in den Tag hinein. Ich wandte mich an meine Mutter, das ist gemein, daß sich meine Brüder alle in meine Träume drängen, aber sie sagte, arrah, um der Liebe Christi willen, trink deinen Tee und geh zur Schule, mußt du uns ständig mit deinen Träumen triezen? Mein Bruder Alphie, der erst zwei war und jeden Tag neue Wörter lernte, schlug mit einem Löffel auf den Tisch und krähte, Täume tiezen, Täume tiezen, bis alle lachten, und da wußte ich, daß ich ihn jederzeit an meinen Träumen beteiligen konnte, also warum nicht auch Michael, warum nicht Malachy?
1
Als die Irish Oak im Oktober 1949 von Cork aus in See ging, dachten wir, in einer Woche wären wir in New York. Statt dessen hieß es nach zwei Tagen auf See, wir fahren nach Montreal in Kanada. Ich sagte dem Ersten Offizier, ich hätte nur vierzig Dollar, und ob mir die Irish Shipping die Eisenbahnfahrt von Montreal nach New York bezahlt. Er sagte, nein, dafür kann die Gesellschaft nichts. Er sagte, Frachter sind die Huren der Weltmeere, die sind jedem zu Willen. Man könnte auch sagen, ein Frachter ist wie Murphys alter Hund, er geht mit jedem Wanderer ein Stück des Wegs mit.
Zwei Tage später überlegte es sich die Irish Shipping anders, und wir vernahmen die frohe Botschaft, wir laufen New York an, aber wieder zwei Tage später bekam der Kapitän die Order, Albany anzulaufen.
Der Erste Offizier sagte mir, Albany sei eine Stadt weit oben am Hudson River, die Hauptstadt des Staates New York. Er sagte, Albany hätte den ganzen Charme von Limerick, ha, ha, ha, ein schöner Ort zum Sterben, aber keiner, wo man heiraten oder Kinder großziehen möchte. Er war aus Dublin und wußte, daß ich aus Limerick war, und wenn er sich über Limerick lustig machte, wußte ich nie, was ich tun sollte. Am liebsten wäre ich ihm mal richtig über den Mund gefahren, aber ich brauchte bloß in den Spiegel zu schauen, pickliges Gesicht, entzündete Augen und schlechte Zähne, und wußte, daß ich mich mit keinem anlegen konnte, schon gar nicht mit einem Ersten Offizier in Uniform und mit der Aussicht auf eine rosige Zukunft als Kapitän seines eigenen Schiffes. Dann sagte ich mir immer, kann mir doch egal sein, was irgendwer über Limerick sagt. Mir war es dort nur schlechtgegangen.
Und dann geschah das Seltsame. Ich saß in meinem Liegestuhl in der warmen Oktobersonne, rings um mich der herrliche blaue Atlantik, und versuchte mir New York vorzustellen. Ich sah die Fifth Avenue vor mir, den Central Park oder Greenwich Village, wo alle wie Filmstars aussehen, gesunde Bräune, strahlendweiße Zähne. Aber jedesmal stieß mich Limerick in die Vergangenheit zurück. Anstatt über die Fifth Avenue zu schlendern, mit der Bräune und den Zähnen, war ich auf einmal wieder in den Gassen von Limerick, Frauen standen schwatzend an der Haustür und zogen ihre Tücher enger um die Schultern, Kinder mit marmeladenbrotverschmierten Gesichtern spielten und lachten und riefen nach ihren Müttern. Ich sah Leute Sonntag morgens in der Messe, wo ein Tuscheln durch die Reihen lief, wenn jemand vom Hunger geschwächt in der Bank zusammensank und hinausgetragen werden mußte von den Männern, die hinten in der Kirche standen und zu allen sagten, zurücktreten, zurücktreten, um Christi willen, ihr seht doch, wie sie nach Luft schnappt, und ich wollte auch so ein Mann sein, der den Leuten sagt, sie sollen zurücktreten, denn dann durfte man draußen bleiben, bis die Messe aus war, und man konnte ins Pub gehen, was überhaupt nur der Grund war, warum man mit all den anderen Männern ganz hinten stand. Die Männer, die nicht tranken, knieten immer direkt vorn am Altar, um zu zeigen, was für gute Menschen sie sind und daß sie nichts dagegen hätten, wenn die Pubs bis zum Jüngsten Gericht geschlossen blieben. Sie kannten die Antwortstrophen besser als jeder andere und bekreuzigten sich und standen auf und knieten nieder und seufzten beim Beten, als ob sie den Schmerz unseres Heilands stärker spürten als die übrige Gemeinde. Manche von ihnen hatten dem Trunk vollends abgeschworen, und das waren die schlimmsten, ständig predigten sie von den Übeln der Trunksucht und schauten auf die anderen herab, die ihr noch verfallen waren, als wüßten nur sie den rechten Weg in den Himmel. Sie taten so, als würde der Herrgott jedem den Rücken kehren, der sich mal ein Bier genehmigte, dabei wußte doch jeder, daß es kaum einen Priester gab, der das Bier oder die, die es tranken, von der Kanzel herab verdammte. Die Männer mit dem Durst blieben hinten, damit sie sofort zur Tür rauswischen konnten, sobald der Priester sagte, ite, missa est, gehet hin in Frieden. Sie blieben hinten, weil sie eine trockene Kehle hatten und zu demütig waren, um da vorn bei den Nüchternen zu sein. Ich stand auch an der Tür, weil ich hören wollte, wie die Männer sich leise über die langsame Messe beklagten. Sie gingen bloß hin, weil es eine Todsünde ist, nicht zur Messe zu gehen, aber man konnte sich fragen, ob es nicht eine schlimmere Sünde ist, mit seinem Nebenmann zu scherzen, wenn der nicht ein bißchen schneller macht, muß ich auf der Stelle jämmerlich verdursten. Wenn Pfarrer White herauskam, um die Predigt zu halten, scharrten sie mit den Füßen und stöhnten über seine Predigten, die langsamsten der Welt, und er verdrehte die Augen himmelwärts und erklärte, wir seien alle verdammt, außer wir änderten unseren Lebenswandel und gäben uns ganz der Jungfrau Maria anheim. Die Männer lachten hinter vorgehaltener Hand, wenn mein Onkel Pa Keating seinen Spruch losließ, ich will mich ja gern der Jungfrau Maria anheimgeben, wenn sie mir ein schönes Glas schaumiges schwarzes Porter bringt. Ich wünschte mir, als Erwachsener in langen Hosen zusammen mit meinem Onkel Pa Keating da hinten bei den Männern mit dem großen Durst zu stehen und hinter vorgehaltener Hand zu lachen.
Ich saß also in dem Liegestuhl und schaute in meinen Kopf hinein, wo ich mich selbst sah, wie ich mit dem Fahrrad in Limerick herum und hinaus aufs Land fuhr, Telegramme zustellen. Ich sah mich frühmorgens über Landstraßen radeln, wo der Nebel aus den Feldern stieg und Kühe mich anmuhten und Hunde auf mich losgingen, bis ich sie mit Steinwürfen verjagte. Ich hörte kleine Kinder in Bauernhäusern nach der Mutter weinen und Bauern ihre Kühe nach dem Melken mit dem Knüttel wieder auf die Weide treiben.
Und manchmal weinte ich ein bißchen vor mich hin in diesem Liegestuhl, rings um mich den herrlichen Atlantik und vor mir New York, die Stadt meiner Träume, wo ich eine goldene Bräune und blendendweiße Zähne haben würde. Ich fragte mich, was um Himmels willen mit mir nicht stimmte, daß ich jetzt schon Heimweh nach Limerick hatte, der Stadt des grauen Elends, dem Ort, wo ich von meiner Flucht nach New York geträumt hatte. Und dann hörte ich die warnenden Worte meiner Mutter, der Teufel, den man kennt, ist besser als der Teufel, den man nicht kennt.
Ursprünglich sollten wir vierzehn Passagiere sein, aber einer hatte storniert, und so mußten wir mit einer Unglückszahl auslaufen. Am ersten Abend stand der Kapitän beim Abendessen auf und hieß uns willkommen. Er lachte und sagte, er sei nicht abergläubisch wegen der Anzahl der Passagiere, aber da wir schon mal einen Priester an Bord hätten, wäre es doch schön, wenn Hochwürden ein Gebet sprechen könnte, um uns vor jeglichem Übel zu bewahren. Der Priester war ein kleiner Dicker, in Irland geboren, aber schon so lange in seiner Pfarrei in Los Angeles, daß er keine Spur mehr von einem irischen Akzent hatte. Als er aufstand, um das Gebet zu sprechen, und sich bekreuzigte, ließen vier Passagiere ihre Hände im Schoß liegen, und da wußte ich, das sind Protestanten. Meine Mutter sagte immer, Protestanten erkennt man schon von weitem an ihrem reservierten Gehabe. Der Priester bat den Allmächtigen, mit Liebe und Barmherzigkeit auf uns herabzuschauen, und was immer auf diesen stürmischen Gewässern geschehen mag, wir sind bereit, uns ganz seiner unendlichen Güte anzubefehlen. Einer der Protestanten, ein älterer Mann, nahm die Hand seiner Frau. Sie lächelte und schüttelte den Kopf, und er lächelte ebenfalls, wie um zu sagen, sei unbesorgt.
Der Priester saß beim Essen neben mir. Er flüsterte mir zu, die beiden alten Protestanten seien sehr reich, weil sie reinrassige Rennpferde in Kentucky züchten, und wenn ich nur einen Funken Verstand hätte, wäre ich nett zu ihnen, man weiß ja nie.
Ich hätte ihn gern gefragt, wie man es anstellt, nett zu reichen Protestanten zu sein, die Rennpferde züchten, traute mich aber nicht, aus Angst, der Priester könnte mich für einen Dummkopf halten. Ich hörte die Protestanten sagen, die Leute in Irland sind so reizend und ihre Kinder so bezaubernd, daß man kaum merkt, wie arm sie sind. Ich wußte, wenn ich jemals mit den reichen Protestanten sprach, würde ich lächeln und meine kaputten Zähne zeigen müssen, und das wäre das Ende vom Lied gewesen. Sobald ich in Amerika ein bißchen Geld verdient hätte, mußte ich gleich zu einem Zahnarzt, mir mein Lächeln richten lassen. In Illustrierten und in Filmen konnte man ja sehen, wie das Lächeln einem Tür und Tor öffnet und die Mädchen in Scharen anlockt, und ohne so ein Lächeln konnte ich genausogut nach Limerick zurückfahren und auf der Post in einem dunklen Hinterzimmer Briefe sortieren, wo sich keiner darum scheren würde, ob ich überhaupt einen Zahn im Mund hatte.
Vor dem Schlafengehen servierte der Steward im Salon Tee und Kekse. Der Priester sagte, für mich einen doppelten Scotch, lassen Sie den Tee, Michael, der Whisky hilft mir einzuschlafen. Er trank seinen Whisky und flüsterte mir wieder zu, hast du mit den reichen Leuten aus Kentucky gesprochen?
Nein.
Verdammt. Was ist eigentlich los mit dir? Willst du denn nicht im Leben vorankommen?
Doch.
Na also, warum sprichst du dann nicht mit den reichen Leuten aus Kentucky? Vielleicht bist du ihnen ja sympathisch, und sie geben dir Arbeit als Stallbursche oder so, und du könntest dich hocharbeiten, statt nach New York zu gehen, das ein einziger großer Anlaß zur Sünde ist, ein Pfuhl der Verderbtheit, wo ein Katholik Tag und Nacht darum kämpfen muß, seinen Glauben zu behalten. Also, warum kannst du nicht mit den netten reichen Leuten aus Kentucky reden und was aus dir machen?
Immer wenn er die reichen Leute aus Kentucky aufs Tapet brachte, flüsterte er, und ich wußte nicht, was ich sagen sollte. Wenn mein Bruder Malachy hier wäre, würde er schnurstracks zu den reichen Leuten hingehen und sie um den Finger wickeln, und sie würden ihn wahrscheinlich adoptieren und ihm ihre Millionen vermachen mitsamt Stallungen, Rennpferden, einem großen Haus und Dienstmädchen, die es sauberhalten. Mein Lebtag habe ich mit keinen reichen Leuten gesprochen, außer um zu sagen, Telegramm, Madam, und dann hat es geheißen, geh ums Haus herum zum Dienstboteneingang, das hier ist die Vordertür, weißt du denn nicht, was sich gehört?
Das wollte ich dem Priester gern sagen, aber mit dem konnte ich auch nicht sprechen. Von Priestern wußte ich nur, daß sie die Messe und alles andere auf lateinisch sagten, daß sie sich meine Sünden auf englisch anhörten und mir auf lateinisch vergaben, im Namen des Herrn, der sowieso allwissend ist. Es muß seltsam sein, wenn man Priester ist und am Morgen aufwacht, im Bett liegt und weiß, daß man die Macht hat, Leuten zu vergeben oder ihnen nicht zu vergeben, je nach Lust und Laune. Wer Latein kann und Sünden vergibt, ist mächtig und unnahbar, weil er die dunklen Geheimnisse der Welt kennt. Mit einem Priester zu sprechen ist, wie mit Gott selbst zu sprechen, und sagt man was Falsches, ist man verdammt.
Es war keine Menschenseele an Bord, die mir hätte sagen können, wie man mit reichen Protestanten oder fordernden Priestern spricht. Mein angeheirateter Onkel Pa Keating hätte es mir sagen können, aber der war daheim in Limerick, wo er sich keinen Fiedlerfurz um irgendwas scherte. Ich wußte, wenn er hier wäre, hätte er sich rundweg geweigert, mit den reichen Leuten zu reden, und dann hätte er dem Priester gesagt, er kann ihn mal an seinem königlich-irischen Arsch lecken. So wäre ich auch gern gewesen, aber da war gar nicht dran zu denken, so kaputt wie meine Augen und meine Zähne waren.
In der Schiffsbibliothek gab es ein Buch, Schuld und Sühne, und ich dachte, das könnte eine spannende Kriminalgeschichte sein, obwohl es von verwirrenden russischen Namen wimmelte. Ich versuchte, es in einem Liegestuhl zu lesen, aber ich fühlte mich komisch bei der Geschichte, einer Geschichte von einem russischen Studenten, Raskolnikow, der eine alte Frau umbringt, eine Geldverleiherin, und dann redet er sich ein, er hat ein Recht auf das Geld, weil sie nutzlos für die Welt ist und er von ihrem Geld an der Universität studieren kann, um Anwalt zu werden und überall Männer seines Schlags zu verteidigen, die alte Frauen wegen ihres Geldes umbringen. Ich fühlte mich komisch wegen der Zeit in Limerick, als ich mir ein bißchen was damit verdiente, daß ich Drohbriefe für eine alte Geldverleiherin schrieb, Mrs. Finucane, und als sie in ihrem Sessel starb, hatte ich mir etwas von ihrem Geld genommen, um meine Überfahrt nach Amerika bezahlen zu können. Gut, ich hatte Mrs. Finucane nicht umgebracht, aber ich hatte ihr Geld gestohlen, und damit war ich fast so schlecht wie Raskolnikow, und wäre ich in diesem Augenblick gestorben, er wäre der erste gewesen, dem ich in der Hölle begegnet wäre. Ich könnte es dem Priester beichten und meine Seele retten, aber obwohl er die Sünden angeblich in dem Moment vergißt, wo er die Absolution erteilt, hätte er Macht über mich und würde mir komische Blicke zuwerfen und mir sagen, ich soll hingehen und mich bei den reichen Protestanten aus Kentucky einschmeicheln.
Ich schlief über dem Buch ein, und ein Matrose, ein Decksmann, weckte mich plötzlich auf und sagte, Ihr Buch wird naß in dem Regen, Sir.
Sir. Hier saß ich, ein Junge aus einer Gasse in Limerick, und da steht ein Mann mit grauem Haar und sagt Sir zur mir, obwohl er eigentlich kein Wort mit mir sprechen dürfte wegen der Vorschriften. Der Erste Offizier sagte mir, ein einfacher Matrose darf niemals mit Passagieren sprechen, außer er wünscht ihnen einen guten Tag oder eine gute Nacht. Er erzählte mir, der Matrose mit den grauen Haaren war früher mal Offizier auf der Queen Elizabeth, wurde aber entlassen, weil man ihn mit einer Erste-Klasse-Passagierin in ihrer Kabine erwischte, und was die beiden da machten, sei beichtwürdig gewesen. Der Mann hieß Owen, und das Besondere an ihm war, daß er seine ganze Zeit unter Deck mit Lesen verbrachte, und wenn das Schiff anlegte, nahm er ein Buch mit an Land und las in einem Café, während die anderen von der Besatzung sich sinnlos betranken und in Taxis zum Schiff zurückgekarrt werden mußten. Unser Kapitän hatte solche Achtung vor ihm, daß er ihn manchmal in seine Kabine einlud, und da tranken sie dann Tee und sprachen von der Zeit, als sie zusammen auf einem englischen Zerstörer gedient hatten, der torpediert wurde, worauf die beiden sich an ein Floß im Atlantik geklammert und bibbernd von der Zeit geschwärmt hatten, wo sie wieder daheim in Irland vor einem gepflegten Bier und einem Berg Kohl mit Speck sitzen würden.
Owen sprach mich am nächsten Tag an. Er sagte, ich weiß, daß ich gegen die Vorschrift verstoße, aber wenn jemand an Bord Schuld und Sühne liest, muß ich einfach mit ihm reden. Es gibt zwar auch unter der Besatzung Leseratten, aber die kommen nie über Edgar Wallace oder Zane Gray hinaus, und ich würde alles dafür geben, über Dostojewski plaudern zu können. Er wollte wissen, ob ich Die Dämonen oder Die Brüder Karamasow gelesen hätte, und schaute traurig drein, als ich sagte, ich hätte nie davon gehört. Er sagte, sobald ich in New York bin, soll ich auf der Stelle in eine Buchhandlung gehen und mir Dostojewskis Bücher besorgen, dann würde ich nie wieder einsam sein. Er sagte, egal, welches Buch von Dostojewski du liest, er gibt dir immer etwas, woran du zu kauen hast, besser kann man sein Geld gar nicht anlegen. Das sagte Owen, aber ich hatte keinen blassen Schimmer, was er damit meinte.
Dann kam der Priester an Deck, und Owen entfernte sich. Der Priester sagte, hast du mit diesem Mann gesprochen? Sag nichts, ich hab’s gesehen. Also, ich muß dir sagen, das ist kein Umgang für dich. Das siehst du doch ein, nicht wahr? Ich weiß alles über ihn. Mit seinen grauen Haaren schrubbt er Decks, in seinem Alter. Es ist schon merkwürdig, daß du mit einem Decksmann ohne jede Moral reden kannst, aber wenn ich dich bitte, mit den reichen Protestanten aus Kentucky zu sprechen, hast du keine Zeit.
Wir haben nur über Dostojewski gesprochen.
Dostojewski, hat man Worte. Der wird dir viel nützen in New York. Du wirst nicht viele Aushilfe-gesucht-Schilder sehen, wo Kenntnisse über Dostojewski verlangt werden. Ich krieg dich nicht dazu, mit den reichen Leuten aus Kentucky zu reden, aber du sitzt stundenlang hier und quasselst mit Matrosen. Halt dich von alten Matrosen fern. Du weißt doch, was das für welche sind. Sprich mit Leuten, die dir was nützen können. Lies Das Leben der Heiligen.
Am New Jerseyer Ufer des Hudson River lagen Hunderte von Schiffen dicht bei dicht am Kai. Owen, der Matrose, sagte, das sind die Liberty-Schiffe, die im Krieg und danach Lebensmittel nach Europa gebracht haben, und es ist traurig, daß man sie jetzt bald in Werften schleppen und abwracken wird. Aber so ist die Welt, sagte er, und ein Schiff hält nicht länger als das Stöhnen einer Hure.
2
Der Priester fragt mich, ob mich jemand abholt, und als ich sage, nein, niemand, sagt er, ich kann mit ihm im Zug nach New York fahren. Er wird ein Auge auf mich haben. Als das Schiff angelegt hat, fahren wir mit einem Taxi zu der großen Union Station in Albany, und während wir auf den Zug warten, trinken wir Kaffee aus großen dicken Tassen und essen Torte von dicken Tellern. Es ist das erste Mal in meinem Leben, daß ich Zitronenbaisertorte esse, und ich denke mir, wenn man in Amerika immer so etwas zu essen kriegt, werde ich nie mehr Hunger haben und fein fett werden, wie man in Limerick sagt. Ich werde Dostojewski für die Einsamkeit haben und Torte für den Hunger.
Der Zug ist nicht wie der in Irland, wo man sich ein Abteil mit fünf anderen Leuten teilt. Dieser hat lange Waggons, in denen Dutzende von Menschen sitzen, und er ist so voll, daß manche stehen müssen. Kaum sind wir eingestiegen, stehen Leute auf und bieten dem Priester ihren Platz an. Er sagt, ich danke Ihnen, und zeigt auf den Platz neben sich, und ich denke mir, die Leute, die ihre Plätze geräumt haben, werden nicht erbaut sein, wenn ich mich auf einen davon setze, weil doch jeder sieht, daß ich niemand bin.
Weiter vorne im Waggon singen und lachen welche und rufen nach dem Kirchenschlüssel. Der Priester sagt, das sind Collegestudenten, die übers Wochenende nach Hause fahren, und der Kirchenschlüssel ist der Öffner für die Bierflaschen. Er sagt, wahrscheinlich sind sie ganz nett, aber sie sollten nicht so viel trinken, und er hofft, ich werde mal nicht so, wenn ich in New York lebe. Er sagt, ich soll mich unter den Schutz der Jungfrau Maria stellen und sie bitten, sich bei ihrem Sohn für mich zu verwenden, damit ich rein und nüchtern bleibe und keinen Schaden nehme. Er wird für mich beten da drüben in Los Angeles und extra für mich eine Messe lesen am achten Dezember, dem Fest der Unbefleckten Empfängnis. Ich würde ihn gern fragen, warum ausgerechnet an diesem Festtag, aber ich lasse es bleiben, weil er sonst womöglich wieder mit den reichen Protestanten aus Kentucky anfängt.
Er redet, aber ich träume davon, wie es wäre, irgendwo in Amerika Student zu sein, an einem College wie die in den Filmen, wo es immer einen weißen Kirchturm ohne Kreuz gibt, damit man weiß, daß es ein protestantischer ist, und die jungen und Mädchen mit dicken Büchern unterm Arm über den Campus schlendern und einander anlächeln mit Zähnen wie Schneeglöckchen.
Als wir an der Grand Central Station ankommen, weiß ich nicht, wohin. Meine Mutter hat gemeint, ich könnte es bei einem alten Freund versuchen, Dan MacAdorey. Der Priester zeigt mir, wie man das Telefon benutzt, aber bei Dan nimmt keiner ab. Tja, sagt der Priester, ich kann dich ja nicht einfach hier an der Grand Central Station stehenlassen. Er sagt dem Taxifahrer, daß wir zum New Yorker Hotel wollen.
Wir tragen unser Gepäck in ein Zimmer, in dem nur ein Bett steht. Der Priester sagt, laß das Gepäck hier. Wir gehen was essen unten im Coffee Shop. Magst du Hamburger?
Ich weiß nicht. Ich hab noch nie einen gegessen.
Er verdreht die Augen und sagt der Kellnerin, sie soll mir einen Hamburger mit Pommes frites bringen und in der Küche Bescheid sagen, daß der Hamburger gut durch sein soll, weil ich Ire bin und wir alles zerkochen. Was die Iren mit Gemüse anstellen, schreit zum Himmel. Er sagt, wenn man in einem irischen Restaurant errät, um welches Gemüse es sich handelt, wird man Saalkönig. Die Kellnerin lacht und sagt, sie weiß schon. Sie ist Halbirin, mütterlicherseits, und ihre Mutter ist die schlechteste Köchin der Welt. Ihr Mann war Italiener, und der hat wirklich kochen können, aber sie hat ihn im Krieg verloren. In the war.
Wah, sagt sie. Sie meint eigentlich war, aber wie alle Amerikaner hat sie keine Lust, ein r am Wortende zu sprechen. Sie sagen cah statt car, und man fragt sich, warum sie die Wörter nicht so aussprechen können, wie Gott sie geschaffen hat. Ich mag Zitronenbaisertorte, aber ich mag’s nicht, daß die Amerikaner das r am Wortende weglassen.
Wir essen unsere Hamburger, und der Priester sagt, ich werde die Nacht noch bei ihm bleiben müssen, und morgen sehen wir dann weiter. Ich finde es komisch, mich vor einem Priester auszuziehen, und ich überlege, ob ich mich hinknien und so tun soll, als ob ich bete. Er sagt, wenn ich will, kann ich duschen, und es ist das erste Mal in meinem Leben, daß ich dusche, mit jeder Menge warmem Wasser und Seife, soviel ich will, einem Stück für den Körper und einer Flasche für den Kopf. Als ich fertig bin, trockne ich mich mit dem dicken Handtuch ab, das über dem Badewannenrand liegt, und ziehe meine Unterwäsche wieder an, bevor ich ins Zimmer zurückgehe. Der Priester sitzt mit einem Handtuch um den dicken Bauch auf dem Bett und telefoniert. Er legt auf und starrt mich entgeistert an. Mein Gott, wo hast du denn die langen Unterhosen her?
Aus Roche’s Stores in Limerick.
Wenn du diese Dinger aus dem Fenster da hängst, ergeben sich die Leute auf der Straße. Ein guter Rat, zeig dich vor Amerikanern nie in den Dingern. Die denken sonst, du kommst direkt von Ellis Island. Kauf dir Slips. Weißt du, wie Slips aussehen?
Nein.
Kauf dir trotzdem welche. Junge Leute wie du sollten Slips tragen. Du bist jetzt in den USA. Okay, ins Bett mit dir, und das wundert mich, weil er keine Anstalten macht zu beten, und das ist doch das erste, was man von einem Priester erwartet. Er geht ins Bad, aber kaum ist er drin, steckt er den Kopf raus und fragt mich, ob ich mich abgetrocknet habe.
Ja.
Aber dein Handtuch ist ja unbenutzt, womit hast du dich denn abgetrocknet?
Mit dem Handtuch auf dem Badewannenrand.
Was? Das ist kein Handtuch, das ist die Badematte. Da stellt man sich drauf, wenn man aus der Dusche kommt.
Ich sehe mich in einem Spiegel über dem Tischchen, und ich werde rot und frage mich, ob ich dem Priester sagen soll, daß es mir leid tut, oder besser den Mund halte. Woher soll man auch wissen, was man tun soll, wenn man an seinem ersten Abend in New York einen Fehler macht, aber sicher bin ich in kürzester Zeit ein echter Yankee, der alles richtig macht. Ich werde mir meine Hamburger selbst bestellen, mir angewöhnen, Fritten Pommes frites zu nennen, mit den Kellnerinnen scherzen und mich nie wieder mit der Badematte abtrocknen. Eines Tages werde ich war und car ohne r am Ende aussprechen, aber nicht, falls ich jemals wieder nach Limerick zurückkehre. Sollte ich jemals mit einem amerikanischen Akzent nach Limerick zurückkommen, würden die behaupten, ich will mich nur aufspielen, und mir sagen, ich hätte einen Fettarsch wie alle Yankees.
Der Priester kommt aus dem Badezimmer, mit einem Handtuch um die Hüften, und tätschelt sich mit beiden Händen die Wangen, und es riecht wunderbar nach Parfüm. Er sagt, es ist doch nichts so erfrischend wie ein Aftershave und ich kann auch etwas davon nehmen, wenn ich möchte. Es steht im Bad. Ich weiß nicht, was ich sagen oder tun soll. Soll ich sagen, nein, danke, oder soll ich aus dem Bett steigen und wieder bis ins Badezimmer gehen und mich mit Aftershave einreiben? In Limerick habe ich nie gehört, daß sich jemand nach dem Rasieren irgendwelches Zeug ins Gesicht geschmiert hat, aber in Amerika ist das wohl anders. Ich hätte mir ein Buch besorgen sollen, in dem steht, was man an seinem ersten Abend in New York mit einem Priester in einem Hotel tun soll, wo man sich garantiert auf Schritt und Tritt blamiert. Er sagt, na?, und ich sage, ach, nein, danke. Er sagt, wie du willst, und ich sehe ihm an, daß er ein bißchen verärgert ist, so wie auf dem Schiff, als ich nicht mit den reichen Protestanten aus Kentucky sprechen wollte. Er kann mich jederzeit rauswerfen, und dann stehe ich auf der Straße mit meinem braunen Koffer und habe nichts und niemanden in New York, wo ich hin kann. Das ist mir zu riskant, also sage ich, daß ich doch gern das Aftershave benutzen möchte. Er schüttelt den Kopf und sagt, bedien dich.
Ich seh mich im Badezimmerspiegel, wie ich mir das Aftershave ins Gesicht reibe, und schüttle den Kopf über mich, denn wenn das so weitergeht in Amerika, dann tut’s mir leid, daß ich überhaupt aus Irland weg bin. Es war auch so schon schwer genug, hierher zu kommen, auch ohne irgendwelche Priester, die an einem herumkritteln, weil man es nicht schafft, sich mit reichen Protestanten aus Kentucky anzufreunden, keine Ahnung von Badematten hat, unmögliche Unterwäsche trägt und nicht einsieht, wozu ein Aftershave gut ist.
Der Priester liegt im Bett, und als ich aus dem Bad komme, sagt er, okay, ins Bett. Morgen ist ein langer Tag.
Er hebt die Bettdecke an, um mich reinzulassen, und ich sehe entsetzt, daß er nichts anhat. Er sagt gute Nacht, knipst das Licht aus und fängt zu schnarchen an, ohne auch nur ein Ave-Maria oder ein Gebet zu sprechen. Ich dachte immer, Priester verbringen Stunden auf den Knien vor dem Schlafengehen, aber dieser Mann ist wohl in einem besonders hohen Stand der Gnade und hat überhaupt keine Angst vor dem Sterben. Ich frage mich, ob alle Priester sich nackt ins Bett legen. Man schläft nicht leicht ein, wenn neben einem ein nackter Priester schnarcht. Dann frage ich mich, ob der Papst auch in diesem Zustand ins Bett geht oder ob er sich von einer Nonne einen Pyjama in den päpstlichen Farben und mit dem päpstlichen Wappen bringen läßt. Ich frage mich, wie er aus diesem langen weißen Gewand kommt, das er trägt, ob er es über den Kopf zieht oder es auf den Boden fallen läßt und heraussteigt. Ein alter Papst wäre niemals imstande, es sich über den Kopf zu ziehen, und müßte wahrscheinlich einen vorbeikommenden Kardinal bitten, ihm zur Hand zu gehen, außer der Kardinal wäre selbst schon zu alt, und dann müßte der eine Nonne rufen, außer der Papst hätte unter dem weißen Gewand nichts an, was der Kardinal natürlich wüßte, weil es auf der ganzen Welt keinen Kardinal gibt, der nicht weiß, was der Papst anhat, weil sie nämlich alle selbst Papst werden wollen und es kaum erwarten können, daß der jetzige stirbt. Wenn eine Nonne hereingerufen wird, muß sie das weiße Gewand wegbringen, damit es gewaschen wird, drunten in den dampfigen Tiefen der vatikanischen Waschküchen, von anderen Nonnen und Novizinnen, die Kirchenlieder singen und den Herrn preisen für die Gnade, alle Kleider des Papstes und des Kardinalskollegiums waschen zu dürfen, bis auf die Leibwäsche, die in einem anderen Raum von alten Nonnen gewaschen wird, die blind sind und nicht in Versuchung geraten, sündige Gedanken zu denken wegen dem, was sie in der Hand haben, und was ich in der Hand habe, sollte man nicht in der Hand haben in Gegenwart eines Priesters im Bett, und einmal im Leben widerstehe ich der Sünde und drehe mich auf die Seite und schlafe ein.
Am nächsten Tag findet der Priester in der Zeitung ein möbliertes Zimmer für sechs Dollar die Woche und will wissen, ob ich mir das leisten kann, bis ich Arbeit finde. Wir fahren in die East 68th Street, und die Vermieterin, Mrs. Austin, geht mit mir die Treppe rauf und zeigt mir das Zimmer. Es ist das Ende eines Flurs, das mit einer Trennwand und einer Tür abgeteilt wurde und ein Fenster hat, das auf die Straße geht. Es ist kaum genug Platz für das Bett und eine kleine Kommode mit einem Spiegel und einen Tisch, und wenn ich die Arme ausstrecke, kann ich auf beiden Seiten die Wand berühren. Mrs. Austin sagt, es ist ein sehr schönes Zimmer und ich kann von Glück sagen, daß es mir nicht schon wer weggeschnappt hat. Sie ist Schwedin, und sie sieht mir an, daß ich aus Irland bin. Sie hofft, ich trinke nicht, und wenn doch, darf ich unter keinen Umständen Mädchen aufs Zimmer bringen, betrunken oder nüchtern. Keine Mädchen, kein Essen, keine Getränke. Kakerlaken riechen Essen meilenweit, und hat man sie einmal im Haus, kriegt man sie nie wieder los. Sie sagt, natürlich hast du in Irland nie einen Kakerlaken gesehen. Dort gibt’s ja auch nichts zu essen. Ihr trinkt doch bloß. Kakerlaken würden bei euch verhungern oder im Suff enden. Sag nichts, ich weiß Bescheid. Meine Schwester ist mit einem Iren verheiratet, der größte Fehler, den sie je gemacht hat. Iren sind toll zum Ausgehen, aber nichts zum Heiraten.
Sie nimmt die sechs Dollar und sagt, sie braucht noch sechs als Kaution, gibt mir eine Quittung und sagt, ich kann jederzeit einziehen, und sie vertraut mir, weil ich mit diesem netten Priester gekommen bin, obwohl sie selbst nicht katholisch ist, es reicht schon, daß ihre Schwester mit einem Katholiken verheiratet ist, einem Iren, und bei Gott, sie muß es teuer bezahlen.
Der Priester hält wieder ein Taxi an, das uns zum Biltmore Hotel bringt, gegenüber der Stelle, wo wir aus der Grand Central Station gekommen sind. Er sagt, es ist ein berühmtes Hotel, und wir gehen in die Zentrale der Demokratischen Partei, und wenn die keine Arbeit für einen jungen Iren finden, dann kann das niemand.
Ein Mann geht im Flur an uns vorbei, und der Priester flüstert, weißt du, wer das ist?
Nein.
Natürlich nicht. Wenn du nicht mal den Unterschied zwischen einem Handtuch und einer Badematte kennst, wie kannst du dann wissen, daß das der große Boss Flynn aus der Bronx ist, der mächtigste Mann Amerikas, gleich nach Präsident Truman.
Der große Boss drückt auf einen Knopf, und während er auf den Lift wartet, steckt er sich den Finger in die Nase, sieht nach, was er auf der Fingerkuppe hat, und schnippt es auf den Teppich. Meine Mutter würde das Goldgräberei nennen. So ist das in Amerika. Ich würde dem Priester gern sagen, meiner Meinung nach würde De Valera nie so in der Nase bohren, und man würde es auch nie erleben, daß der Bischof von Limerick im nackten Zustand ins Bett geht. Ich würde dem Priester gern sagen, was ich von der Welt im allgemeinen halte, wo Gott einen mit entzündeten Augen und schlechten Zähnen peinigt, aber ich bringe es nicht fertig, aus Angst, er fängt wieder von den reichen Protestanten aus Kentucky an und daß ich die Chance meines Lebens verpaßt habe.
Der Priester spricht mit einer Frau am Empfang in der Demokratischen Partei, und sie nimmt den Telefonhörer ab. Sie sagt ins Telefon, wir haben hier einen Jungen – frisch vom Schiff runter – hast du ein High-School-Zeugnis? – nein, kein Zeugnis – na ja, kein Wunder – die alte Heimat ist immer noch ein armes Land – ja, ich schicke ihn rauf.
Ich soll mich am Montag morgen bei Mr. Carey im einundzwanzigsten Stock melden, und er wird mir direkt hier im Biltmore Hotel Arbeit geben, und ob ich nicht ein Glückspilz bin, kaum vom Schiff runter und schon in Lohn und Brot. Das sagt sie, und der Priester sagt zu ihr, das ist schon ein tolles Land, und die Iren verdanken der Demokratischen Partei alles, Maureen, und Sie haben gerade wieder einen neuen Wähler für die Partei gewonnen, falls der Junge hier jemals zum Wählen geht, ha, ha, ha.
Der Priester sagt, ich soll in unser Hotel zurückgehen, und er holt mich dann zum Abendessen ab. Er meint, ich kann zu Fuß gehen, die Streets verlaufen von Osten nach Westen, die Avenues von Norden nach Süden, und ich finde bestimmt hin. Ich brauche bloß über die 42nd zur Eighth Avenue zu gehen und dann immer geradeaus nach Süden, bis ich zum New Yorker Hotel komme. Ich kann eine Zeitung oder ein Buch lesen oder auch duschen, wenn ich verspreche, die Finger von der Badematte zu lassen, ha, ha. Er sagt, wenn wir Glück haben, sehen wir sogar den großen Jack Dempsey persönlich. Ich sage, ich würde lieber Joe Louis sehen, wenn das möglich ist, aber da raunzt er mich an, lern du lieber, unter deinesgleichen zu bleiben.
Am Abend bei Dempsey’s lächelt der Kellner den Priester an. Jack ist nicht da, Hochwürden. Er ist drüben im Gaaden, sich einen Mittelgewichtler aus New Joisey ansehen.
Gaaden. Joisey. Da bin ich den ersten Tag in New York, und schon reden die Leute wie die Gangster in den Filmen, die ich in Limerick gesehen habe.
Der Priester sagt, mein junger Freund hier ist aus der alten Heimat und würde lieber Joe Louis sehen. Er lacht, und der Kellner lacht ebenfalls und sagt, na ja, so redet eben ein Grünschnabel, Hochwürden. Er wird’s schon noch lernen. Lassen Sie ihn erst mal sechs Monate hier sein, dann nimmt er die Beine in die Hand, sobald er einen Neger sieht. Und was darf ich Ihnen bringen, Hochwürden? Vielleicht einen kleinen Aperitif?
Ich nehme einen doppelten Martini dry, und zwar wirklich trocken und mit Zitronenschale.
Und der Grünschnabel?
Der kriegt ein – ja, was möchtest du denn?
Ein Bier, bitte.
Bist du schon achtzehn, Junge?
Neunzehn.
Sieht man dir zwar nicht an, ist aber sowieso egal, solang du mit Hochwürden hier bist. Stimmt’s, Hochwürden?
Stimmt. Ich passe schon auf ihn auf. Er kennt keine Menschenseele in New York, und ich sehe noch zu, daß er gut unterkommt, bevor ich die Stadt verlasse.
Der Priester trinkt seinen doppelten Martini und bestellt sich zum Steak noch einen. Er meint, ich sollte mal überlegen, ob ich nicht Priester werden will. Er kann mir eine Stelle in Los Angeles besorgen, und ich werde leben wie die Made im Speck, weil die Witwen sterben und mir alles hinterlassen, einschließlich ihrer Töchter, ha, ha, der Martini ist verdammt gut, Entschuldigung. Er ißt fast das ganze Steak auf und sagt dem Kellner, er soll zwei Stück Apfelkuchen mit Eiskrem bringen und für ihn noch einen doppelten Hennessy zum Runterspülen. Er ißt nur das Eis, trinkt die Hälfte von dem Hennessy und schläft ein, mit dem Kinn auf der Brust, und die geht immer auf und ab.
Dem Kellner vergeht das Lächeln. Verflucht, der hat noch nicht bezahlt. Wo hat er denn die gottverdammte Brieftasche? In der Gesäßtasche, Junge. Gib sie mir.
Ich kann doch einen Priester nicht beklauen.
Du beklaust ihn nicht. Er muß verdammt noch mal die Zeche bezahlen, und du brauchst ein Taxi, um ihn heimzuschaffen.
Zwei Kellner helfen ihm ins Taxi, und zwei Pagen im New Yorker Hotel schleifen ihn durch die Lobby, fahren ihn im Lift nach oben und schmeißen ihn aufs Bett. Die Pagen sagen, ein Dollar Trinkgeld wär nicht schlecht, ein Dollar für jeden, Kleiner.
Sie gehen, und ich frage mich, was ich mit einem betrunkenen Priester anfangen soll. Ich ziehe ihm die Schuhe aus, so wie sie es im Film machen, wenn jemand ohnmächtig wird, aber er setzt sich auf und rennt ins Bad, wo er sich lange übergibt, und als er wiederkommt, reißt er sich die Kleider vom Leib und wirft sie auf den Boden, Kragen, Hemd, Hose, Unterwäsche. Er fällt rücklings aufs Bett, und ich sehe, daß er im Zustand der Aufregung ist und Hand an sich gelegt hat. Komm her zu mir, sagt er, und ich weiche zurück. Ah, nein, Hochwürden, und er rollt sich aus dem Bett, lallend und nach Schnaps und Erbrochenem stinkend, und will meine Hand packen, damit ich ihn anfasse, aber ich weiche noch schneller zurück, bis ich durch die Tür auf den Gang hinaustrete, und er steht in der Tür, ein kleiner, dicker Priester, der mir zuruft, ach, komm doch zurück, mein Sohn, komm zurück, es war der Alkohol. Heilige Muttergottes, es tut mir so leid.
Aber der Aufzug ist offen, und ich kann doch zu den anständigen Leuten, die schon drin sind und mich anschauen, nicht sagen, daß ich’s mir anders überlegt habe, daß ich zu dem Priester zurückwill, der ja eigentlich nur wollte, daß ich nett zu den reichen Protestanten aus Kentucky bin, damit ich eine Anstellung als Stallbursche kriege, und der mir jetzt mit seinem Ding zuwinkt auf eine Art, daß es bestimmt eine Todsünde ist. Nicht daß ich selbst im Stand der Gnade wäre, nein, bin ich nicht, aber man würde doch von einem Priester erwarten, daß er mit gutem Beispiel vorangeht, statt so skandalös mit seinem heiligen Bimbam zu wedeln, an meinem zweiten Abend in Amerika. Ich muß in den Aufzug steigen und so tun, als hörte ich den lallenden, heulenden Priester nicht, der nackt in seiner Zimmertür steht.
Vor dem Hoteleingang wartet ein Mann mit einer Uniform wie ein Admiral, und er fragt, Taxi, Sir? Ich sage, nein, danke, und er sagt, wo kommst du her? Ach, Limerick! Ich bin aus Roscommon, aber schon vier Jahre hier.
Ich muß den Mann aus Roscommon fragen, wie ich in die East 68th Street komme, und er sagt mir, ich soll auf der 34th Street, die breit und hell beleuchtet ist, nach Osten gehen, bis ich zur Third Avenue komme, und ich kann die Hochbahn nehmen, oder wenn ich einigermaßen gut zu Fuß bin, kann ich geradeaus bis zu meiner Straße gehen. Er sagt, alles Gute, bleib unter deinesgleichen und nimm dich in acht vor den Puertoricanern, die haben alle ein Messer in der Tasche, das weiß jeder, die sind nun mal heißblütig. Halt dich im Hellen, und zwar außen am Bordstein, sonst springen sie dich aus dunklen Hauseingängen an.
Am nächsten Morgen ruft der Priester Mrs. Austin an, ich soll kommen und meinen Koffer holen. Er ruft, komm rein, die Tür ist offen. Er sitzt in seinem schwarzen Anzug auf der Bettkante, mit dem Rücken zu mir, und mein Koffer steht gleich an der Tür. Nimm ihn, sagt er. Ich gehe für ein paar Monate in ein Exerzitienhaus in Virginia. Ich will dich nicht ansehen, und ich will dich nie mehr wiedersehen, denn was passiert ist, war schrecklich, und es wäre nicht passiert, wenn du deinen Verstand gebraucht hättest und mit den reichen Protestanten aus Kentucky mitgegangen wärst. Ade.
Ich weiß nicht, was man zu einem schlechtgelaunten Priester sagt, der einem den Rücken zudreht und einem die Schuld an allem gibt, also bleibt mir nichts übrig, als mit meinem Koffer im Aufzug hinunterzufahren und mich zu fragen, wie ein solcher Mann, der Sünden vergibt, selbst sündigen und dann mir die Schuld geben kann. Ich weiß, wenn ich so was täte, mich betrinken und andere Leute belästigen, daß sie mich anfassen sollen, dann würde ich es auch zugeben. Ich hab’s getan. Punktum. Und wie kann er mir die Schuld in die Schuhe schieben, bloß weil ich mich geweigert habe, mit den reichen Protestanten aus Kentucky zu sprechen? Vielleicht werden Priester ja für so was ausgebildet. Vielleicht ist es schwer, sich tagein, tagaus die Sünden der Leute anzuhören, wenn es ein paar gibt, die man selber gern begehen möchte, und wenn man dann was getrunken hat, explodieren alle die Sünden in einem und man ist wie jeder andere. Ich könnte jedenfalls nie Priester sein und mir die ganze Zeit alle diese Sünden anhören. Ich wäre ständig im Zustand der Aufregung, und der Bischof hätte alle Hände voll zu tun, mich in das Exerzitienhaus in Virginia zu schicken.
3
Wenn man aus Irland ist und keine Menschenseele in New York kennt, und man geht die Third Avenue entlang, wo über einem die Hochbahn rattert, ist es sehr tröstlich, daß es kaum einen Block ohne eine irische Bar gibt: Costello’s, den Blarney Stone, die Blarney Rose, P. J. Clarke’s, das Breffni, das Leitrim House, das Sligo House, Shannon’s, Ireland’s Thirty-Two, das All Ireland. Ich habe mein erstes Bier in Limerick getrunken, als ich sechzehn war, und mir ist schlecht geworden, und mein Vater hat mit der Trinkerei fast meine Familie und sich selbst zugrunde gerichtet, aber ich bin einsam in New York und lasse mich anlocken von Bing Crosby, der in der Musikbox Galway Bay singt, und von blinkenden grünen Kleeblättern, wie man sie in Irland nirgendwo zu sehen bekommt.
Ein verärgerter Mann steht hinter dem Tresenende im Costello’s, und er sagt zu einem Gast, da geb ich keinen Pfifferling drauf, und wenn Sie zehnmal Doktor der Philosophie sind. Ich kenn meinen Samuel Johnson besser wie Sie Ihre Westentasche, und wenn Sie sich hier nicht anständig aufführen, fliegen Sie raus. Das ist mein letztes Wort.
Der Gast sagt, aber . . .
Raus, sagt der verärgerte Mann. Raus. In diesem Haus kriegen Sie nichts mehr zu trinken.
Der Gast stülpt sich den Hut über den Kopf und stakst hinaus, und der verärgerte Mann wendet sich mir zu. Und du, sagt er, bist du schon achtzehn?
Jawohl, Sir. Ich bin neunzehn.
Und warum soll ich das glauben?
Hier bitte, mein Paß, Sir.
Und was macht ein Ire mit einem amerikanischen Paß?
Ich bin hier geboren, Sir.
Er erlaubt mir, zwei Bier zu fünfzehn Cent zu trinken, und sagt, es würde mir besser bekommen, wenn ich meine Zeit in der Bibliothek verbrächte statt in Bars wie der Rest unserer elenden Rasse. Er sagt, Dr. Johnson hat vierzig Tassen Tee am Tag getrunken und bis zum Ende seiner Tage einen klaren Verstand behalten. Ich frage ihn, wer Dr. Johnson war, und er sieht mich finster an, nimmt mir mein Glas weg und sagt, verlaß sofort diese Bar. Geh auf der Zweiundvierzigsten bis zur Fünften. Da siehst du zwei große steinerne Löwen. Steig die Treppe zwischen den beiden Löwen hinauf, laß dir einen Leserausweis ausstellen, und sei nicht so ein Idiot wie alle die anderen Sumpfstiefel, die sich, kaum daß sie vom Schiff runter sind, um den Verstand saufen. Lies deinen Johnson, lies deinen Pope, und mach einen Bogen um die Iren, die sind alle Träumer. Ich will ihn noch fragen, wie er zu Dostojewski steht, aber er zeigt zur Tür. Laß dich hier nicht mehr blicken, bevor du nicht Die Lebensbeschreibungen der Dichter gelesen hast. Also los. Raus mit dir.
Es ist ein warmer Oktobertag, ich habe sonst nichts zu tun, und es kann ja nichts schaden, zur Fifth Avenue und den Löwen zu schlendern. Die Bibliothekarinnen sind freundlich. Natürlich kann ich einen Leserausweis bekommen, und wir freuen uns sehr, wenn die jungen Einwanderer die Bibliothek benutzen. Ich darf vier Bücher auf einmal ausleihen, wenn ich möchte, ich muß sie bloß wieder pünktlich zurückbringen. Ich frage, ob sie ein Buch mit dem Titel Die Lebensbeschreibungen der Dichter von Samuel Johnson haben, und sie sagen, sieh an, sieh an, du liest Johnson. Ich möchte ihnen sagen, daß ich noch nie Johnson gelesen habe, aber dann würden sie mich nicht mehr bewundern. Sie sagen mir, sieh dir ruhig alles an und geh auch mal in den Großen Lesesaal im zweiten Stock. Sie sind überhaupt nicht wie die Bibliothekarinnen in Irland, die nur Wache stehen und die Bücher vor Leuten wie mir beschützen.
Beim Anblick des Großen Lesesaals, der einen Nord- und einen Südteil hat, werden mir die Knie weich. Ich weiß nicht, ob es das Bier ist oder die Aufregung über meinen zweiten Tag in New York, aber ich bin den Tränen nahe, als ich die kilometerlangen Regale sehe, und weiß, daß ich niemals all diese Bücher lesen kann, und wenn ich bis zum Ende des Jahrhunderts lebe. Da sind endlose Reihen blitzblanker Tische, an denen alle möglichen Menschen sitzen und lesen, solange sie wollen, und das an sieben Tagen in der Woche, und niemand behelligt sie, außer sie schlafen ein und fangen an zu schnarchen. Es gibt Abteilungen mit englischen, irischen, amerikanischen Büchern Literatur, Geschichte, Religion, und mich überläuft es bei dem Gedanken, daß ich jederzeit hierherkommen und lesen kann, was und solange ich will, wenn ich nur nicht schnarche.
Mit vier Büchern unterm Arm spaziere ich zu Costello’s zurück. Ich will dem verärgerten Mann zeigen, daß ich Die Lebensbeschreibungen der Dichter habe, aber er ist nicht da. Der Barkeeper sagt, der mit dem Johnson, das muß Mr. Tim Costello selbst gewesen sein, und in dem Moment kommt der verärgerte Mann aus der Küche. Er sagt, bist du schon wieder da?
Ich hab Die Lebensbeschreibungen der Dichter, Mr. Costello.
Du hast Die Lebensbeschreibungen der Dichter vielleicht unter der Achsel, junger Mann, aber nicht im Kopf, also geh heim und lies.
Es ist Donnerstag, und ich habe nichts zu tun, bis am Montag die Arbeit anfängt. Weil kein Stuhl da ist, setze ich mich in meinem möblierten Zimmer aufs Bett und lese, bis Mrs. Austin um elf an meine Tür klopft und mir mitteilt, sie ist keine Millionärin und laut Hausordnung ist das Licht um elf auszumachen, damit ihre Stromrechnung nicht zu hoch wird. Ich mache das Licht aus und lausche New York, den schwatzenden und lachenden Menschen, und frage mich, ob ich jemals zu dieser Stadt gehören und da draußen schwatzen und lachen werde.
Es klopft noch einmal an der Tür, und ein junger Mann mit rotem Haar und irischem Akzent sagt, er heißt Tom Clifford und ob ich noch rasch ein Bier mit ihm trinken gehe, weil er in einem Gebäude an der East Side arbeitet und in einer Stunde anfangen muß. Nein, in eine irische Bar geht er nicht. Mit den Iren will er nichts zu tun haben, also gehen wir ins Rhinelander in der 86th Street, und dort erzählt mir Tom, daß er in Amerika geboren ist, aber nach Cork gebracht wurde und bei der ersten Gelegenheit abgehauen ist, um sich bei der amerikanischen Army zu verpflichten für drei schöne Jahre in Deutschland, wo man für eine Stange Zigaretten oder ein Pfund Kaffee zehn Nummern schieben kann. Im hinteren Teil des Rhinelander ist eine Tanzfläche und eine Kapelle, und Tom fordert ein Mädchen an einem der Tische zum Tanzen auf. Er sagt zu mir, komm schon. Forder doch ihre Freundin auf.
Aber ich kann nicht tanzen, und ich weiß nicht, wie man ein Mädchen zum Tanzen auffordert. Ich weiß überhaupt nichts von Mädchen. Wie könnte ich auch, wo ich doch in Limerick aufgewachsen bin. Tom bittet das andere Mädchen, mit mir zu tanzen, und sie führt mich hinaus auf die Tanzfläche. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Tom trippelt und wirbelt herum, und ich weiß nicht, ob ich vorwärts oder rückwärts gehen soll mit dem Mädchen im Arm. Sie sagt, ich trete ihr auf die Füße, und als ich mich entschuldige, sagt sie, ach, vergiß es, ich hab keine Lust, hier herumzustolpern. Sie geht an ihren Tisch zurück, und ich folge ihr mit glühendheißem Gesicht. Ich weiß nicht, ob ich mich an ihren Tisch setzen oder an die Bar zurückgehen soll, bis sie sagt, du hast dein Bier auf dem Tresen stehenlassen. Ich bin froh, daß ich eine Ausrede habe, sie allein zu lassen, denn ich wüßte nicht, was ich mit ihr reden sollte. Bestimmt würde es sie nicht interessieren, wenn ich ihr erzähle, daß ich stundenlang in Johnsons Lebensbeschreibungen der Dichter lese oder wie aufgeregt ich in der 42nd Street Library war. Vielleicht muß ich mir in der Bibliothek ein Buch suchen, in dem steht, wie man mit Mädchen redet, oder ich muß Tom fragen, der tanzt und lacht und keine Schwierigkeiten mit dem Reden hat. Er kommt zurück an die Bar und sagt, er wird sich krank melden, was bedeutet, daß er nicht zur Arbeit geht. Das Mädchen findet ihn nett und sagt, er darf sie nach Hause bringen. Er flüstert mir ins Ohr, daß er vielleicht eine Nummer schieben kann, was bedeutet, daß er vielleicht mit ihr ins Bett gehen kann. Das einzige Problem ist das andere Mädchen. Er nennt sie mein Mädchen. Na los, sagt er. Frag sie, ob du sie nach Hause bringen darfst. Wir setzen uns zu den beiden an den Tisch, dann kannst du sie fragen.
Das Bier tut seine Wirkung, ich bin mutiger geworden und scheue mich nicht mehr, mich zu den Mädchen an den Tisch zu setzen und ihnen von Tim Costello und Dr. Samuel Johnson zu erzählen. Tom stößt mich an und flüstert, laß um Himmels willen den Quatsch mit dem Samuel Johnson und frag sie. Als ich sie anschaue, sehe ich zwei und überlege, welche von beiden ich fragen soll, aber wenn ich zwischen die beiden schaue, sehe ich noch eine, und die frage ich.
Nach Hause? fragt sie. Du machst Witze. Selten so gelacht. Ich bin Sekretärin, Privatsekretärin, und du hast noch nicht mal die High School. Hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel gesehen? Sie fängt zu lachen an, und mein Gesicht glüht wieder. Tom nimmt einen kräftigen Schluck Bier, und ich weiß, ich richte bei diesen Mädchen nichts aus, also verlasse ich das Lokal und gehe die Third Avenue entlang, schaue ab und zu mein Spiegelbild in den Schaufenstern an und lasse alle Hoffnung fahren.
4
Am Montag morgen eröffnet mir mein Chef, Mr. Carey, daß ich Hausdiener sein werde, ein sehr wichtiger Posten, weil ich vorn in der Lobby sein und Staub wischen, den Boden fegen und die Aschenbecher ausleeren werde, und er ist so wichtig, weil ein Hotel nach seiner Lobby beurteilt wird. Er sagt, wir haben die beste Lobby im Land. Sie heißt Palmenhof und ist in der ganzen Welt bekannt. Jeder, der etwas darstellt, kennt den Palmenhof und die Biltmore-Uhr. Herrgott, die kommen sogar in Büchern und Kurzgeschichten vor, Scott Fitzgerald, solche Leute. Bedeutende Persönlichkeiten sagen, treffen wir uns unter der Uhr im Biltmore, und was wäre, wenn die dann kommen, und die Lobby ist verstaubt und mit Abfällen übersät. Das ist meine Aufgabe, dafür sorgen, daß das Biltmore berühmt bleibt. Ich muß saubermachen und darf nicht mit den Gästen sprechen oder sie auch nur ansehen. Wenn sie mich ansprechen, muß ich sagen, ja, Sir beziehungsweise Madam, oder nein, Sir beziehungsweise Madam, und weiterarbeiten. Er sagt, ich muß mich unsichtbar machen, und darüber muß er lachen. He, stell dir vor, du bist der große Unsichtbare, der die Lobby saubermacht. Er sagt, das ist eine Vertrauensstellung, und ich hätte sie nie bekommen, wenn mich nicht die Demokratische Partei geschickt hätte auf Empfehlung von dem Priester aus Kalifornien. Mr. Carey sagt, mein Vorgänger ist gefeuert worden, weil er unter der Uhr mit Collegemädchen geredet hat, aber der war Italiener, also wen wundert’s. Er sagt, ich muß immer auf Draht sein, vergiß nicht, jeden Tag zu duschen, wir sind hier in Amerika, sei vernünftig, halte dich an deinesgleichen, mit den Iren kannst du nichts falsch machen, übertreib’s nicht mit dem Trinken, und in einem Jahr könnte ich vielleicht zum Pagen oder Pikkolo befördert werden und Trinkgelder bekommen und, wer weiß, womöglich sogar zum Kellner aufsteigen, und das wäre dann wohl das Ende all meiner Sorgen. Er sagt, alles ist möglich in Amerika, schau mich an, ich besitze vier Anzüge.
Der Oberkellner in der Lobby wird Maitre d’ genannt. Er sagt mir, ich soll nur auffegen, was auf den Boden fällt, und darf nichts anrühren, was auf den Tischen ist. Wenn Geld auf den Boden fällt oder Schmuck oder irgend etwas in der Art, muß ich es ihm aushändigen, dem Maitre d’ persönlich, und er entscheidet dann, was damit zu geschehen hat. Wenn ein Aschenbecher voll ist, muß ich warten, bis mir ein Pikkolo oder ein Kellner sagt, daß ich ihn ausleeren soll. Manchmal sind in den Aschenbechern Gegenstände, die sichergestellt werden müssen. Eine Frau kann zum Beispiel ihren Ohrring abnehmen wegen der Entzündung und vergessen, daß sie ihn in den Aschenbecher gelegt hat, und es gibt Ohrringe, die Tausende von Dollar wert sind, was ich natürlich nicht wissen kann, so frisch vom Schiff runter. Es ist Sache des Maitre d’, alle Ohrringe in Verwahrung zu nehmen und sie den Frauen mit den entzündeten Ohren zurückzugeben.
In der Lobby arbeiten zwei Kellner, sie flitzen hin und her und stoßen zusammen und blaffen auf griechisch. Sie sagen zu mir, he, Ire, komm her, mach sauber, mach sauber, mach verdammten Aschenbecher leer, trag Abfall weg, wird’s bald, wird’s bald, na los, du betrunken oder was? Sie schreien mich vor den Collegestudenten an, die donnerstags und freitags in Scharen kommen. Ich hätte nichts dagegen, daß mich Griechen anschreien, wenn sie es nicht vor den Collegemädchen täten, denn die sind golden. Sie werfen ihr Haar zurück und lächeln mit Zähnen, so weiß und makellos, wie man sie nur in Amerika sieht, und alle haben gebräunte Filmstarbeine. Die Jungen haben Bürstenschnitt, die gleichen Zähne und Footballspielerschultern und sind mit den Mädchen ganz unbefangen. Sie reden und lachen, und die Mädchen heben das Glas und lächeln die Jungen mit strahlenden Augen an. Sie sind vielleicht in meinem Alter, aber in ihrer Gegenwart schäme ich mich für meine Uniform, meinen Besen und meine Kehrschaufel. Ich wollte, ich könnte mich unsichtbar machen, aber wie soll das gehen, wenn die Kellner mich auf griechisch und englisch und in einer Sprache dazwischen anschreien oder ein Pikkolo mich beschuldigt, ich hätte mich an einem Aschenbecher vergriffen, in dem was drin lag.
Es kommt vor, daß ich nicht weiß, was ich tun oder sagen soll. Ein Collegejunge mit Bürstenschnitt sagt, kannst du mal aufhören, jetzt hier zu putzen? Ich unterhalte mich mit der Dame. Wenn das Mädchen mich ansieht und dann wegschaut, wird mir heiß im Gesicht, und ich weiß nicht, warum. Manchmal lächelt mir ein Collegemädchen zu und sagt hi, und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Meine Vorgesetzten schärfen mir ein, ich darf kein Wort mit den Gästen sprechen, aber ich könnte sowieso nicht hi sagen, weil wir das in Limerick nie gesagt haben, und wenn ich es sage, fliege ich noch raus und stehe auf der Straße ohne einen Priester, der mir eine neue Arbeit besorgt. Ich würde gern hi sagen und für einen Moment zu dieser wunderschönen Welt gehören, aber dann denkt einer der Bürstenschnittjungs womöglich, ich starre sein Mädchen an, und beschwert sich beim Maitre d’ über mich. Ich könnte ja heute abend nach Hause gehen, mich aufs Bett setzen und üben, zu lächeln und hi zu sagen. Wenn ich mir Mühe gebe, kriege ich das hi sicher bald hin, aber ich müßte es ohne das Lächeln sagen, denn wenn ich auch nur ein bißchen die Lippen öffne, erschrecke ich die goldenen Mädchen unter der Biltmore-Uhr zu Tode.
Manchmal ziehen die Mädchen ihre Jacken aus, und wie sie dann in ihren Pullovern und Blusen aussehen, das ist ein solcher Anlaß zur Sünde, daß ich mich in einer Toilette einschließen und Hand an mich legen muß, und leise muß ich auch noch sein, aus Angst, von einem puertoricanischen Pikkolo oder einem griechischen Kellner erwischt zu werden, der dann geradewegs zum Maitre d’ läuft und berichtet, daß der Lobby-Hausdiener auf dem Klo an sich herumspielt.