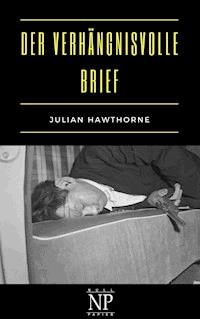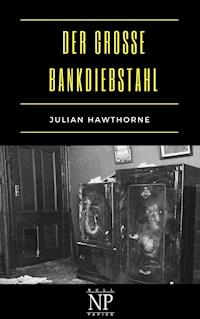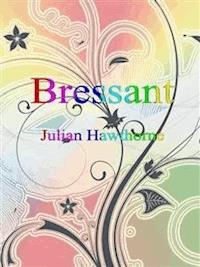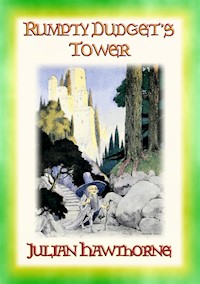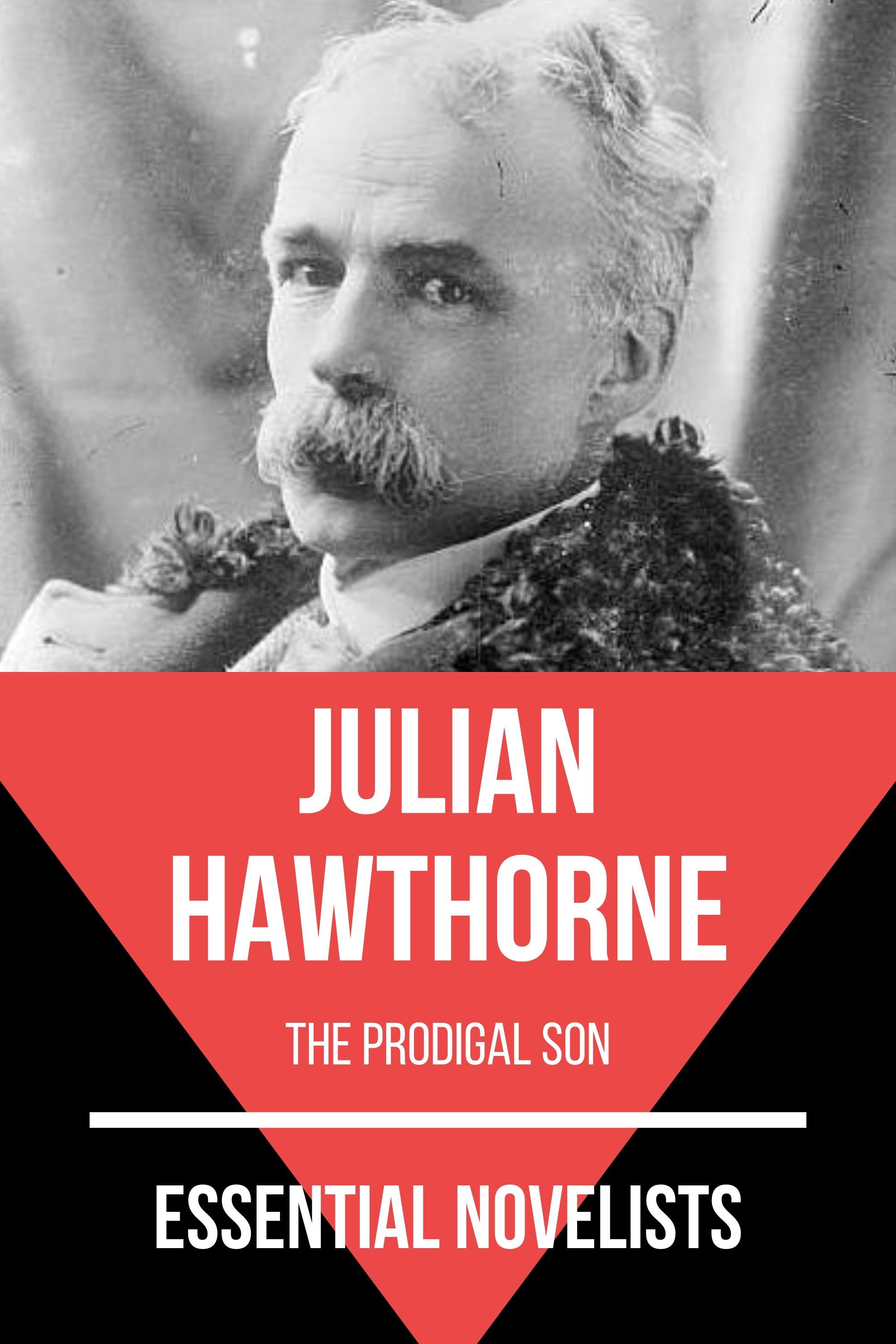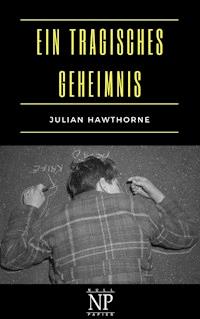
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Krimis bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Ein früher Meisterkrimi um den New Yorker Inspektor Byrnes. Inspektor Byrnes muss ein tragisches Geheimnis klären. Der New Yorker Ladenbesitzer Hanier wird ermordet aufgefunden. Doch die Tat scheint sinnlos, nichts wurde gestohlen. Alles deutet auf eine anderes, privateres Motiv als Raubmord. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Julian Hawthorne
Ein tragisches Geheimnis
Kriminalroman
Julian Hawthorne
Ein tragisches Geheimnis
Kriminalroman
(A tragic mystery)Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]Übersetzung: Margarete Jacobi EV: Robert Lutz, Stuttgart, 1914 (271 S.) 2. Auflage, ISBN 978-3-962813-95-6
null-papier.de/neu
Inhaltsverzeichnis
Erstes Kapitel. – Dunkelheit
Zweites Kapitel. – Mord!
Drittes Kapitel. – Im Zimmer des Inspektors
Viertes Kapitel. – Irrlichter
Fünftes Kapitel. – Das silberne Cigarettenetui
Sechstes Kapitel. – Eine Nachteule
Siebentes Kapitel. – Von Sinnen?
Achtes Kapitel. – Die Barbierstube
Neuntes Kapitel. – Ein häuslicher Sturm
Zehntes Kapitel. – Die Geheimschrift
Elftes Kapitel. – In Gooleys Schenke
Zwölftes Kapitel. – Maskenball
Dreizehntes Kapitel. – Kreuzverhör
Vierzehntes Kapitel. – Oberst Desmond
Fünfzehntes Kapitel. – Schatten
Sechzehntes Kapitel. – Eine Vertraute
Siebzehntes Kapitel. – Enthüllungen
Achtzehntes Kapitel. – Verhaftet
Neunzehntes Kapitel. – Das Geständnis
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Krimis bei Null Papier
Der Frauenmörder
Eine Detektivin
Hemmungslos
Der Mann, der zu viel wusste
Noch mehr Detektivgeschichten
Sherlock Holmes – Sammlung
Eine Kriminalgeschichte & Das graue Haus in der Rue Richelieu
Der Doppelmord in der Rue Morgue
Indische Kriminalerzählungen
Kriminalgeschichten
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Erstes Kapitel. – Dunkelheit
Um das Jahr 1881 begann sich das Westende der 26. Straße von New York jenseits der sechsten Avenue auszudehnen und sich gleichzeitig, wie man es zu nennen beliebt, zu »verschönern«. Die alten Häuser machten neuen Platz. An die Stelle der unregelmäßigen Bauart früherer Jahrzehnte trat die strenge Einförmigkeit, welche die heutige Architektur verlangt.
Wer mit den baulichen Einrichtungen der größten Stadt Amerikas vertraut ist, kann sich leicht vorstellen, dass solche sogenannten Verschönerungen dem ästhetischen Sinn wenig Befriedigung bieten. Wie wünschenswert, ja notwendig die Verbesserungen sein mögen, durch welche, genau nach Winkelmaß und Lineal aufgerichtet, gleichartige Gebäude und gerade Häuserreihen entstehen – die Städte erscheinen uns doch weit malerischer im Verfall, und unsere Vorliebe für unterbrochene und gebogene Linien, für Häuser, die sich sozusagen den Eigenheiten und Seltsamkeiten ihrer Bewohner anpassen – ist eine echt menschliche Schwäche. Einen ganz unerfreulichen Anblick aber gewährt es, wenn solch ein altes Gebäude zwischen den großen einförmigen Vierecken von Backstein und Mörtel eingezwängt ist. Man denkt dabei unwillkürlich daran, was uns in der Zukunft bevorsteht, wenn das Gleichheitsprinzip zur vollen Herrschaft gelangen wird, und Häuser sowohl als Menschen einander so ähnlich sind wie ein Ei dem anderen. Jeder wird dann das Vergnügen haben, auf der Straße nur Ebenbildern von seinem eigenen teuern, langweiligen und unbedeutenden Ich zu begegnen.
In dem ältesten und ohne Frage dem unmodernsten von allen Häusern im Westende der 26. Straße befand sich eine französische Weinhandlung. Die Franzosen, die doch in der Mode und allen Neuerungen den Ton angeben wollen, hängen in Wahrheit unter den Völkern Europas fast am zähesten an ihren nationalen Eigenheiten. Überall tragen sie ihr Frankreich mit sich und die französischen Einwanderer verschmelzen sich ebenso schwer mit der übrigen Bevölkerung als die Chinesen. Was sie berühren, erhält einen gallischen Anstrich und Beigeschmack. Selbst wenn sie ihrer Bewunderung für unsere sozialen Zustände Luft machen, hört man den Pariser Akzent durch: ihre liberté ist total verschieden von amerikanischer Freiheit. – Wie dem auch sei, so bilden sie doch einen sehr achtbaren Teil unserer nicht eingeborenen Bürgerschaft, führen ein geregeltes, friedliches Leben, erwerben ihren redlichen Unterhalt und bringen sich selten in Ungelegenheiten, weder in ihren häuslichen noch in ihren öffentlichen Beziehungen. Sich selber sprechen zu hören – natürlich ihre eigene Sprache – und in ihrer kleinen Welt sich eine Art Abbild der heimischen Boulevards und Kaffeehäuser zu verschaffen, ist ihr höchstes Streben und im Allgemeinen lassen die anderen Nationen sie auch ruhig gewähren. In der Nachbarschaft der kleinen Weinhandlung hatte sich eine förmliche Kolonie von Franzosen gebildet. Jeden Nachmittag und Abend konnte man sie dort in Gruppen an den Tischen sitzen sehen, wo sie ihren Wein schlürften, Domino spielten, und nach ihrer Weise unter lebhaften Gebärden debattierten und schwatzten.
Die Weinhandlung oder Restauration war ein hölzernes zweistöckiges Gebäude, das auf einer Seite an ein hohes Backsteinhaus, auf der anderen an einen alten Holzhof stieß, welcher durch einen hohen Bretterzaun von der Straße geschieden und mit geschichtetem Bauholz, Spänen und allerhand Schutt und Gerümpel angefüllt war. Die Vorderseite des Hauses zierte ein altmodischer gedeckter Vorbau, nach hinten ragte ein morscher Altan in den Hof hinaus. Über der Reihe von Flaschen im Ladenfenster, den eingerahmten Anzeigen und Weinmarken, hingen verwelkte, staubige Festgewinde von Wintergrün, die Überreste des Weihnachtsausputzes; denn der Anfang unserer Geschichte fällt in die Woche zwischen Weihnachten und Neujahr. – Bei Nacht wurde die niedrige schmale Eingangstür, deren obere Hälfte noch dazu aus Glas bestand, nur einfach mit Schloss und Riegel verwahrt; der redliche Besitzer mochte wohl glauben, dass in seiner armen Behausung für Einbrecher nichts zu holen sei. Betrat man den Laden, so befand man sich in einem kleinen Raum mit sauber tapezierten Wänden, dessen eine Seite der Ladentisch einnahm und aus dem man in ein hinteres Gebäude gelangte, wo Tische und Stühle für die Gäste standen, Flaschen auf den Brettern an den Wänden entlang und ein Bierfass mit dem Hahn im Spunde auf einem Gestell.
Im vorderen Laden waren zum Schmuck einige billige Farbendruckbilder aufgehängt und auf einem Gesims über der Geldschublade stand eine Gipsfigur, gleichsam als Wächter. – Dem Ladentisch gegenüber kam man durch eine Tür in die Hausflur, aus welcher die Treppe zum oberen Stockwerk hinaufführte. Dort lag nach der Straße zu das Schlafzimmer des Weinhändlers und seiner Frau, während die Kinder nach hinten hinaus schliefen. In dem Keller unter dem Hause hatten die Flaschenkisten, Wein- und Liqueurfässer und allerlei Gerümpel Platz gefunden, das man in den oberen Räumen nicht gebrauchen konnte. Im Ganzen machte der Laden wohl einen freundlichen Eindruck, aber das Haus war doch schon recht altersschwach und passte nicht mehr in unsere Zeit des Fortschritts – es saß nicht recht fest in den Fugen, die Dielen krachten bei jedem Tritt, kurz der Tag schien nicht mehr ferne, an dem die morschen Pfeiler und Balken unter dem Schutt und Abfall des benachbarten Holzhofs Platz nehmen würden. – Einstweilen kam jedoch die Miete nicht zu hoch zu stehen und die Stammgäste sahen über die Mängel an äußerem Glanz hinweg, solange nur der Claret und Absinthe von guter Qualität waren und die Preise mäßig.
In diesem Teil der 26. Straße – zwischen der sechsten und siebenten Avenue – war nur geringer Verkehr. Der Lärm der Großstadt drang kaum bis zu der abgelegenen Weinstube. Wohl hörte man das Gebimmel der Pferdebahnglocken vom Ende der Straße her und das Rollen und Rasseln der Züge auf der erhöhten Stadtbahn, aber die Geräusche klangen doch nur wie aus der Ferne herüber. Der kleine Laden lag abseits von der großen Welt und bis zum Morgen des 30. Dezember 1881 wussten unter den anderthalb Millionen Einwohnern New Yorks kaum ein paar Dutzend etwas davon, dass ein Mann wie Louis Hanier überhaupt existierte und in dem düstern alten Hause neben dem Holzhof sein Geschäft betrieb. – Dann aber wurde plötzlich, wie durch Zauberschlag die bescheidene Weinstube zum Gegenstand des allgemeinsten Interesses und zahlloser Mutmaßungen; der Name ihres Besitzers war in aller Munde, wer nur Augen und Ohren hatte, nahm teil an allen Ereignissen seiner unbedeutenden Lebensgeschichte – und alles das einzig und allein deshalb, weil der Mann auf so plötzliche tragische und völlig geheimnisvolle Weise umgekommen war.
Die Nacht des 29. Dezember war regnerisch, stürmisch und ungewöhnlich dunkel. Bei so abscheulichem Wetter mochte niemand draußen sein und trotz der Weihnachtswoche waren die Straßen wie gefegt. Auch Louis Haniers Gäste hatten sich bald verzogen und da er noch von der Anstrengung der Festzeit ermüdet war, schloss er den Laden früher als gewöhnlich. Spätestens um Mitternacht schlief er bereits nebst seiner Frau in guter Ruhe. Wer nicht obdachlos umherschweifte, sondern unter einem schützenden Dach weich und warm gebettet lag, dem gewährte das Klatschen des Regens, das Gurgeln und Spritzen der Wasserröhren draußen noch ein erhöhteres Behagen. Hoffen wir, dass Louis Haniers letzter Schlaf auf Erden fest und friedlich war und ihn heitere Träume umgaukelten. Er hatte ein reines Gewissen, stand in gutem Ruf bei seinen Nebenmenschen und seine Aussichten für die Zukunft waren auch keineswegs ungünstig.
Schlief Louis Hanier aber auch tief, so schlief er doch nicht lange. Es mochte gegen ein Uhr sein, als seine Frau plötzlich aus einem leichten Schlummer emporschreckte. – Was war das? – Zuerst wollte sie ihren Mann nicht wecken. Sie setzte sich im Bette auf und horchte. – In einem so alten baufälligen Hause kommen natürlich allerhand seltsame, unerklärliche Geräusche vor, noch dazu bei stürmischer Nacht: vielleicht krachen die Balken und Dielen, der Ruß fällt den Kamin herunter, oder Ratten und Mäuse nagen im Holzwerk. An solchen und ähnlichen Lärm, der wohl einen Fremden erschreckt hätte, war Frau Hanier längst gewöhnt. Aber heute klang es ganz anders als sonst und es beschlich sie ein unheimliches Gefühl, eine unbestimmte Furcht vor Unheil und Gefahr. Eine Mutter von sechs Kindern, eine Frau, die ihren Mann liebt, ist wachsamer und besitzt schärfere Sinne, als andere Sterbliche. Einige Vorfälle, die sich noch am späten Abend zugetragen, kamen ihr wieder ins Gedächtnis und bestärkten sie in dem Glauben, dass rohe Gewalttätigkeit und Verderben ihren stillen Haushalt bedrohten. Jetzt begann der Lärm von neuem. Sie ertrug die Angst nicht länger und weckte ihren Mann. Mühsam öffnete Hanier die Augen – zum letztenmal in diesem Leben.
Seine Frau teilte ihm ihre Befürchtungen mit; er versuchte sie ihr auszureden, doch vergebens. Nun horchte und er selbst musste gestehen, dass die Geräusche außergewöhnlicher Art waren. Man vernahm leise Fußtritte, Stimmengeflüster und seltsame Töne, die das Ohr nicht zu unterscheiden vermochte, dann ein Klirren wie von Glas. Gerade unter dem Schlafzimmer befand sich der Laden, von dort her schienen die Töne zu kommen. Sollten Diebe eingedrungen sein, um den Laden auszuplündern?
Unmöglich war das nicht. Hanier hatte zwar noch zuletzt den Riegel vorgeschoben, aber ein Einbrecher konnte leicht die Türe sprengen, wenn es ihm um der geringen Beute willen, die zu erwarten stand, der Mühe verlohnte. Doch Hanier, der noch etwas schlaftrunken war, glaubte die Ursache der nächtlichen Störung zu kennen. Er dachte, er wisse wer unten sei, und wenn er recht vermutete, so lag keinerlei Gefahr vor, obgleich die Sache immerhin der Aufklärung bedurfte. In kurzen Worten teilte er seiner Frau diese Ansicht mit, stand auf, fuhr in seine Beinkleider und schickte sich an hinabzugehen, um der Sache auf den Grund zu kommen. Zur selben Zeit hatte sich auch Frau Hanier erhoben und in das Nebenzimmer begeben, wo die Kinder schliefen. Sie weckte ihren ältesten Sohn, einen zehnjährigen Knaben, damit er seinem Vater beistehen solle. Ihrer Überzeugung nach waren Diebe eingebrochen, die sie verscheuchen wollte, ohne dass es zum Kampfe kam.
Als der Knabe munter war, eilte sie in ihr Schlafzimmer zurück, um ihren Mann zur Vorsicht zu mahnen und ihn zu bitten sich keiner Gefahr auszusetzen. Doch sie fand das Zimmer leer. Hanier war schon im Hausflur. Es herrschte undurchdringliche Dunkelheit, aber sie hörte ein loses Brett unter den Tritten ihres Mannes krachen und wusste, dass er an der obersten Treppenstufe stand. Mittlerweile war unten eine plötzliche Stille entstanden, als ob die Eindringlinge auch aufhorchten. Der Regen strömte hernieder, der Wind rüttelte an den Scheiben, sonst war kein Geräusch vernehmbar. Auf einmal hörte man schnelle Fußtritte im Laden, eine Tür drehte sich in den Angeln, ein plötzlicher Windstoß fuhr durch das Haus. Die Diebe machten sich aus dem Staube.
Das dachte Frau Hanier. Und auch Hanier selbst teilte wahrscheinlich diese Meinung. Er stand oben an der Treppe, die so schmal und steil war, dass zwei Personen nicht nebeneinander vorbeikommen konnten, und starrte in den schwarzen Abgrund hinab. War er wirklich beraubt worden, und hatten sich die Bösewichter mit dem Inhalt seiner Ladenkasse davon gemacht? – Bis jetzt hatte er, wie gesagt, etwas ganz anderes vermutet; nun aber, als er einsah, um was es sich handle, drängte es ihn, die Räuber seines Eigentums zu verfolgen und er begann rasch die Treppe hinabzusteigen.
Seine Frau war ebenfalls in die Hausflur getreten. Plötzlich erhellte ein greller Schein die Treppe, ein kurzer durchdringender Knall folgte. Sie sah die Gestalt ihres Mannes einen Moment lang in scharfen Umrissen sich gegen das Licht abheben und rückwärts schwanken – dann verschwand alles wieder in der dichten Finsternis. Aber neben ihr taumelte jemand vorbei, wankte mühsam in das Kinderzimmer und hindurch auf den morschen Altan, der nach dem alten Holzhof hinausging. Es musste ihr Mann gewesen sein, denn jetzt hörte sie seine Stimme wie mit äußerster Anstrengung einen heiseren, wilden Schrei ausstoßen, in die Nacht hinaus. Was er rief, vernahm sie nicht. Schrecken und Grausen übermannten sie, das Klatschen des Regens, das Heulen und Ächzen des Sturmes um das alte verwitterte Haus verschlangen den Schall. Die Fußtritte kamen zurück, blind tappte es durch das Gemach. Hanier taumelte nach dem Bett, fiel vornüber darauf hin, rollte dann schwer zu Boden und lag auf dem Rücken, ohne ein Glied zu regen; auch auf alle Fragen und Beschwörungen seiner verzweifelnden Frau gab er keine Antwort. Der brave, redliche Mann war tot. Schaudernd sank sein Weib neben dem Leichnam auf die Knie; noch gellte ihr der Schuss in den Ohren, der ihrem Manne das Leben geraubt.
Ein gewaltsamer Tod hat stets etwas Grausiges, das hier noch durch die Dunkelheit, die Verwirrung, das Entsetzliche des Vorgangs erhöht wurde. Frau Hanier war zuerst außer stande zu begreifen, dass ihr Mann, eine Minute zuvor noch voll Kraft und Lebensfrische, ihr für immer entrissen sei. Der Wechsel war zu plötzlich, zu fürchterlich! Mit wahnsinniger Angst richtete sie den Leblosen auf und mühte sich ab, ihn zu erwecken, indem sie ihn bei Namen rief. Aus seiner tiefen Brustwunde, die sie bei der herrschenden Dunkelheit nicht gewahrte, floss ihr das Blut über die Hände, über das Nachtgewand und es dauerte mehrere Minuten, bis das unglückliche Weib zu der entsetzlichen Kenntnis kam, dass sie nichts als die entseelte Hülle ihres Mannes in den Armen halte. –
Unterdessen war ihr Sohn bei dem Knall des Revolvers in die Hausflur gelaufen und zurück in das Hinterzimmer, wo er in der Finsternis, ohne es zu wissen, an seinem Vater vorbeigekommen sein musste. Hatte der Knabe die Fußtritte des fliehenden Mörders gehört und gemeint, dieser werde über den Holzhof kommen? Er schlüpfte auf den Altan und schaute hinab. Das Licht der Straßenlaterne beleuchtete eine Ecke des Hofes mit düsterem Schein und durch den Regen und die schwarze Nacht glaubte der Knabe, an dieser Stelle den Schatten einer menschlichen Gestalt zu erkennen, der plötzlich auftauchte und wieder im Dunkeln verschwand. Es war nur ein Augenblick – ob die Gestalt groß oder klein sei, Mann oder Frau, ja, ob die ganze Erscheinung nicht vielleicht nur eine Täuschung seiner Sinne gewesen, vermochte er nicht zu entscheiden. »Haltet den Dieb!« schrie er aufs Geratewohl; aber drunten blieb alles still und er sah nichts mehr.
Nun verließ der Knabe den Altan, tastete sich durch das Hinterzimmer und die Treppe hinunter bis zu dem Laden, wo eine niedrige Gasflamme ein schwaches Licht verbreitete. Niemand war dort; mit einigen Zündhölzern versehen, die er aus der Büchse vom Ladentisch nahm und nacheinander entzündete, stieg der Knabe in den Keller hinab. Dieser war gleichfalls leer und er begab sich die Treppe wieder hinauf in das Schlafzimmer. Ein brennendes Zündholz in der Hand trat er in das Gemach seiner Eltern und erblickte ein grausiges Bild.
Auf dem Boden neben dem Bett übereinander hingeworfen lagen sein Vater und seine Mutter von Blut überströmt. Entsetzt erkannte der Sohn, der bisher keine Ahnung von dem Geschehenen gehabt, woher das Blut komme und dass sein Vater tot sei. Auch Frau Hanier, die jetzt zum ersten Mal mit Augen sah, was sie vordem nur mit ihren Händen hatte befühlen können, schreckte bei dem fürchterlichen Anblick wie rasend empor. Sie sprang an das Fenster, riss es auf und: »Mord! Mord!« hallte es gellend in die vom Sturm durchheulte menschenleere Straße hinaus. –
Zweites Kapitel. – Mord!
Selten bleibt dieser Ruf lange ohne Antwort. Doch hier mitten in New York schickte ein verzweifelndes Weib ihn wieder und wieder hinaus und immer vergebens; es schien als habe die grausige Nacht alles Leben verschlungen und die ganze Riesenstadt in ein Grab verwandelt. –
Endlich jedoch erweckte der Schreckensschrei zwei Franzosen, die eine kleine Baracke in der Nähe bewohnten und bei Haniers ihre Mahlzeiten einnahmen. Sie betraten das Haus und nichts Gutes ahnend, tasteten sie sich die Treppe hinauf. Der Knabe hatte inzwischen eine kleine Lampe entzündet, bei deren unsicherem Schein sie schaudernd gewahrten, welche blutige Tat hier verübt worden war. Starr vor Schrecken blieben die Männer in der Tür des Schlafzimmers stehen. Alles war mit Blut bedeckt. Blut quoll aus der Brust des toten Mannes, es färbte Arm und Hals der trostlosen Witwe, befleckte sogar die Nachtgewänder der Kinder, die von dem Lärm ermuntert, schreiend und zitternd herbeigeeilt waren und mit den Füßen in die Blutlache am Boden traten. Die Männer standen wie festgewurzelt, bis endlich nach wiederholter Aufforderung der Frau Hanier einer von ihnen davoneilte, um die Polizei zu holen. Nicht lange, so hörte man die Polizeibeamten zum Zeichen ihrer Ankunft mit den Knitteln auf das Straßenpflaster stoßen; drei Schutzleute in wasserdichten Mänteln und Kopfbedeckungen kamen die Treppe hinauf ins Zimmer marschiert.
Louis Hanier brauchte keinen Arzt mehr, das lag außer allem Zweifel. Er war tot – ins Herz geschossen, aller menschlichen Hilfe entrückt. Die Polizeidiener fragten Frau Hanier aus und sie berichtete unter Schluchzen und verzweifelnden Gebärden, was geschehen sei. Des Knaben Aussage war weniger verwirrt, gewährte aber ebensowenig einen Aufschluss über die Missetäter, die das Verbrechen begangen. Nachdem die Schutzleute sich alle Auskunft verschafft hatten, die zu erlangen war, begab sich einer zur Meldung des Vorgefallenen nach dem nächsten Polizeiamt, während die beiden anderen die Mutter mit den Kindern in das Hinterzimmer schickten und neben der Leiche Platz nahmen, um die Ankunft der Runde abzuwarten.
Von diesen zwei Polizisten kannte einer, der schon längere Zeit den Dienst in diesem Stadtteil versah, den Toten und seine Familienverhältnisse; der andere jedoch, der erst kürzlich den Posten angetreten, war geneigt, Frau Haniers Beziehung zu der Angelegenheit in ungünstigem Licht zu betrachten. Ihre verwirrten Augen, ihr schreckliches Aussehen und die große Unwahrscheinlichkeit verschiedener Punkte in ihrem Bericht schienen ihm auf eine genauere Kenntnis der Umstände hinzuweisen, unter denen das Verbrechen begangen worden. Wusste sie mehr als sie zugestehen wollte? War sie nicht eine Französin? Französinnen haben zuweilen Liebhaber. Vielleicht hatte Frau Haniers Liebhaber ihr einen Besuch abgestattet und ihr Mann die beiden überrascht. Dies würde genügen, um die Katastrophe zu erklären. Zudem gab Frau Haniers Behauptung, dass ihr Mann im Dunkeln erschossen worden, dem Zweifel Raum. Sollte die im Dunkeln abgeschossene Kugel den Mann gerade mitten ins Herz getroffen haben? Überdies sollte Hanier die Todeswunde erhalten haben, während er die Treppe hinabstieg. Wie kam es dann, dass der Leichnam etwa zwanzig Fuß davon neben dem Bette lag? Würde er nicht hinabgestürzt und am Fuß der Treppe liegen geblieben sein? – Alle diese Umstände trugen ein ziemlich verdächtiges Ansehen und verdienten genaue Beachtung.
Der ältere Polizist verwarf jedoch diese sämtlichen Annahmen, berief sich auf seine Bekanntschaft mit der Familie, bestritt die Liebhabertheorie und erklärte, er sei von der gänzlichen Unschuld der Frau überzeugt. Ihre Erzählung laute zwar befremdlich, würde sich vielleicht auch nicht in allen Einzelnheiten als zutreffend erweisen; denn wer, der bei stockfinsterer Nacht aus dem Schlaf erweckt wird, hat gleich alle Sinne beisammen? – Aber der Absicht nach und im wesentlichen seien sie gewiss recht berichtet worden. Das Ende der Beweisführung war (wie dies in unserer rechthaberischen Welt meist der Fall ist) dass jeder bei seiner Meinung blieb, bis die Ankunft der Wache dem Streit ein Ende machte.
Vom Fuße der Treppe klang die Stimme des Polizisten, der die Runde hatte, zu ihnen herauf: »Hier unten ist eingebrochen worden und der Laden ausgeplündert. Kommt einmal herab.« –
Der Mann übertrieb nicht. Zwar war die Einrichtung unten immer einfach gewesen, aber sauber und ordentlich, jetzt lag in dem Laden das Unterste zu oberst gekehrt. Beim Schein der nun hell brennenden Gasflamme sah man umgeworfene Stühle, ausgetrunkene und zerbrochene Flaschen umherliegen, die Bilder waren von der Wand gerissen, die Gipsfigur über der Geldschublade zertrümmert, die Schublade selbst stand halb offen, ihres Inhalts beraubt. Spuren mutwilliger Zerstörung zeigten sich überall. Ein Polizeidiener trat mit einem Fuß in eine dunkle Flüssigkeit, die sich in einer Senkung des Bodens bei der Wand angesammelt hatte und schreckte zurück. War es Blut? Nach dem Auftritt im oberen Stock lag der Gedanke nahe; aber dies war nicht Blut, sondern der Inhalt eines Bierfasses, dessen Spund herausgezogen worden. Überlegte Bosheit und Freude an nutzloser Zerstörung hatte hier ihr Werk getrieben! Die Polizisten sahen einander verblüfft und betreten an.
»Zuerst wollen wir einmal sehen, wie sie hereingekommen sind«, meinte der Führer der Runde.
Darüber konnte kein Zweifel sein. Die Eingangstür war gesprengt worden. Der Riegel und das feste Schloss hatten zwar dem gewaltsamen Druck von außen widerstanden, aber die eisernen Klammern, mit denen sie befestigt waren, hatten sich aus den alten morschen Pfosten gelöst und hingen nun samt den Schrauben herab. Der Schlüssel steckte noch von innen im Schlüsselloch. – Der Polizist betrachtete das Eisenwerk genau. Kein Einbrecher hatte mit seinen Instrumenten daran herumhantiert. Diebe von Profession verlieren ihre Zeit nicht damit, Flaschen zu zerbrechen und Bierfässer zu leeren; auch schlagen sie keine Türen ein, die sie ebenso schnell und weit geräuschloser mit eigens dazu bestimmten Werkzeugen öffnen können. Ihr Zweck ist, sich in Besitz des Geldes zu setzen, nicht ihr Mütchen zu kühlen, ihren Hass zu befriedigen. Louis Haniers Mörder hatten zwar seine Kasse geleert, aber doch schien es, als hätten sie noch andere Absichten bei ihrem Einbruch verfolgt. Für einen Mord war, soweit sich die Lage der Dinge bis jetzt übersehen ließ, nicht der geringste Grund vorhanden. Die Diebe waren nicht in die Enge getrieben worden, der Weg zur Flucht stand ihnen offen. Hatten sie vielleicht absichtlich den Lärm verursacht, um Hanier zu wecken und so vor die Mündung ihrer Pistolen zu bekommen? –
Nachdem die erste Lokalbesichtigung beendet war, kehrte der oberste Schutzmann zum Polizeiamt zurück, um Bericht zu erstatten; nur ein Polizeidiener hielt Wache im Laden, damit an Ort und Stelle nichts verändert werde, denn der Fall gehörte unzweifelhaft vor die Geheimpolizei.
Die Nacht verging langsam; allmählich hörte der Sturm auf und ein kalter grauer Morgen brach an. Das Gerücht, dass ein Mord begangen worden, hatte sich in der Nachbarschaft verbreitet; die Kunde gelangte auch in die Zeitungsbüros der Großstadt. Schon früh am Morgen stellten sich die Reporter ein; nach Vorzeigung ihrer Karten gestattete ihnen der Polizist das Haus zu betreten. Sie stiegen ins obere Stockwerk hinauf und betrachteten den Leichnam, der starr und steif auf dem blutbefleckten Bette lag; sie nahmen die Verwüstung des Ladens in Augenschein, warfen einen Blick auf den Holzhof, zeichneten die Lage der Treppe auf und schrieben einige Bemerkungen in ihre Notizbücher; dann hielten sie noch eine Unterredung mit dem Schutzmann und einigen Zuschauern auf der Straße, worauf sie sich wieder zurückzogen, um ihren Bericht über das tragische Ereignis aufzusetzen. – Die Neugierigen blieben in Menge vor dem Hause stehen und starrten die verwitterten Mauern an, als könnten sie dort eine Erklärung des Geheimnisses lesen. Wer zu den Bewohnern der Straße gehörte, fühlte sich gewissermaßen in seinem Selbstgefühl gehoben: ein grässlicher Mord war in ihrer Mitte verübt worden, das erhöhte ihre Wichtigkeit, obgleich sie natürlich bedauerten, dass ein Ehrenmann wie Hanier zum Opfer gefallen war.
Auf dem Hauptpolizeiamt in der Mulberrystraße waren schon längst über das Verbrechen Beratungen gepflogen worden, ehe man noch anderswo beim Frühstück saß. Gegen neun Uhr stieg ein einfach gekleideter Mann die Stufen herunter, streifte an einer Gruppe müßiger Pflastertreter vorbei und schlug rasch die Richtung nach der Bleecker-Straße ein. Einer der Gaffer blickte ihm nach und wandte sich dann mit schlauer Miene zu seinem Gefährten: »Da geht ein Spürhund, um eine Fährte zu suchen.« sagte er.
Der Mann, auf welchen sich diese Bemerkung bezog, verfolgte seinen Weg in die Stadt hinein. Er war von mittlerer Größe mit etwas gewölbten Schultern, sonst aber stark und wohlgebaut. Auf den ersten Blick hätte man ihn für jung gehalten, betrachtete man ihn aber genauer, so fand man es schwierig, sein Alter zu bestimmen; er konnte zwischen fünfundzwanzig und fünfzig zählen. Ob es die Jahre waren oder schwere Erfahrungen, welche ihm die tiefen Runzeln auf die Stirne gedrückt, ließ sich nicht entscheiden. Er mochte zu der Klasse von Menschen gehören, welche früh ein dürres, verknöchertes Wesen annehmen, dann keine merkliche Veränderung mehr durchzumachen haben. Aus seinem blassen mageren Gesichte blickten ein paar wahre Luchsaugen. Sein Anzug hatte nichts Auffälliges, überhaupt war seine ganze Persönlichkeit durchaus nicht dazu angetan, besondere Aufmerksamkeit zu erregen. Das einzige Eigentümliche an ihm war sein halb schleppender, halb schleichender Gang.
»Schleppfuß« (so nennen wir ihn der Einfachheit wegen) fuhr mit der Pferdebahn die sechste Avenue hinunter bis zur 26. Straße. Dort stieg er aus und hatte in wenig Minuten den Schauplatz des Mordes erreicht. Er blieb stehen, wie jemand, der etwas sieht, das seine Neugier reizt, blickte am Haus in die Höhe, betrachtete den handfesten Polizisten an der Eingangstür, das gesprengte Schloss, und wandte sich schließlich den verschiedenen Gruppen zu, die umherstanden. Auf den Gesichtern der Leute war leere Schaulust geschrieben, sonst nichts. Nur eine Frau – augenscheinlich den höheren Klassen angehörig, obgleich ein langer grauer Regenmantel ihre sonstige Kleidung verhüllte – zeigte mehr Anteil. Sie war rasch die Straße heraufgekommen in Begleitung eines großen breitschulterigen Mannes in dunklem Überrock, der den Schirm seiner Pelzmütze tief ins Gesicht gezogen hatte.
Vor der Weinhandlung standen beide still und schauten aufs angelegentlichste nach dem Haus hinüber. Sie trug eine Art Schleier um den Hals, der den untern Teil ihres Gesichts verhüllte, während ihr Hut die Stirn verdeckte; nur die feingeschnittene Nase und ein paar sehr ausdrucksvolle blaue Augen blieben sichtbar. »Schleppfuß« glaubte zu bemerken, dass diese Augen sich beim Umblicken mit Tränen füllten; darauf schien sie sich mit bittender Gebärde an ihren Begleiter zu wenden, doch dieser – ein schon ältlicher Mann mit dichten schwarzen Augenbrauen und einem Bart, der stark ins Graue spielte – schüttelte sehr bestimmt mit dem Kopf. Er war unruhig, als wünsche er den Ort zu verlassen und die Worte, die er einigemale an sie richtete, enthielten wohl eine Aufforderung weiter zu gehen. Sie aber hielt ihn zurück, ja machte sogar Miene über die Straße zu gehen, um in das Haus zu treten, worauf er ihr jedoch kurz und gebieterisch den Arm reichte und sie fast mit Gewalt in der Richtung nach der 6. Avenue auf dem Wege zurückführte, den sie gekommen waren.
Schleppfuß hatte nicht übel Lust, ihm zu folgen – vielleicht wäre dadurch manche Mühe erspart worden – doch hielt ihn der Auftrag, den er hatte: an Ort und Stelle nach den näheren Umständen zu forschen, davon zurück. Am Ende war die Wahrscheinlichkeit, dass diese beiden Personen oder eine derselben etwas mit dem Mord zu schaffen hatten, doch zu gering, um einen Aufschub seines Geschäfts zu rechtfertigen. So wandte er sich denn von ihnen ab und richtete seine Aufmerksamkeit auf eine Gruppe Franzosen, die nicht weit von der Haustür aufs lebhafteste miteinander sprachen und gestikulierten.
Dass Schleppfuß der französischen Sprache mächtig war, hatte den Ausschlag bei seiner Wahl für diese Angelegenheit gegeben. So gesellte er sich denn zu der Gruppe und hörte ihrer Unterhaltung zu, die sich um den tragischen Tod ihres Landsmanns drehte.
Dem einen war Hanier schon von Paris her bekannt, wo er Besitzer einer Liqueurfabrik und ein vermöglicher Mann gewesen. Dann hatte er Unglück gehabt und war ausgewandert. Ein anderer erwähnte, dass sie beide Mitglieder derselben sozialen Verbindung seien und dass die Trauerkunde in der Gesellschaft gewiss großes Leidwesen erregen werde. Auch von den übrigen hatte jeder ein Wort des Lobes und der Anerkennung für den ermordeten Freund. Nun traten noch die zwei Männer hinzu, welche zuerst auf Frau Haniers Hilferuf in der Nacht herbeigeeilt waren und sahen sich sofort mit Fragen bestürmt. Es ergab sich, dass sie zu den letzten gehörten, die Hanier noch im Leben gesehen. Sie hatten den vergangenen Abend in der Weinstube zugebracht und dieselbe erst kurze Zeit verlassen, ehe der Laden geschlossen wurde.
Einer von ihnen schien plötzlich von einem neuen Gedanken ergriffen; er stieß seinen Gefährten an und rief:
»Tiens mon ami! Jetzt geht mir ein Licht auf. Das Lumpengesindel! Ja, die müssen es gewesen sein!« –
»Von wem sprichst du denn?« –
»Natürlich von den Spitzbuben, die während wir dasaßen, hereinkamen und das Geld aus dem Schubkasten stehlen wollten. Aber Hanier verdarb ihnen den Spaß und sie machten sich aus dem Staube. Die Sache liegt ganz klar. Weil sie ihre Absicht nicht ausführen konnten, sind sie hernach wieder gekommen, haben den Laden geplündert und den Mord verübt.«
Diese Mitteilung erregte großes Aufsehen. Viele Stimmen sprachen und schrien durcheinander und mehrere Minuten lang entstand ein wahres Kreuzfeuer von Fragen, Antworten und Vermutungen. – Man schien wirklich auf die rechte Fährte geraten zu sein. Schleppfuß war ganz Ohr. Nachdem die Sache noch eine Zeit lang hin und her besprochen worden, beschlossen die beiden Franzosen in das Haus zu gehen und Frau Hanier ihren Verdacht mitzuteilen. An der Tür wurden sie von dem Polizeidiener angehalten; als sie ihm aber ihre Absicht kundtaten, ließ er sie durch. Schleppfuß folgte ihnen in den oberen Stock.
In dem Schlafzimmer lag und stand noch alles wie zuvor, nur über den Leichnam hatte man ein Tuch geworfen. Frau Hanier saß am Bette, die Kinder waren in ihr Zimmer verwiesen worden. Die Franzosen berichteten der Witwe, dass am letzten Abend einige Männer in den Laden getreten seien und während zwei von ihnen die Aufmerksamkeit ihres Mannes abzulenken gesucht, habe der dritte den Geldkasten plündern wollen, sei aber dabei entdeckt worden, worauf alle drei über Hals und Kopf die Flucht ergriffen hätten. Die Frau besann sich, dass Hanier den Vorfall erwähnt habe, sie selber sei aber nicht zugegen gewesen, könne daher die Spitzbuben nicht wieder erkennen im Fall sie festgenommen würden. Sie war noch wie betäubt von dem Unglück, das sie betroffen, und selbst die Hoffnung, dass man den Mördern auf der Spur sei, schien ihren Eindruck auf sie zu verfehlen. Das Verbrechen war ja nicht wieder ungeschehen zu machen, selbst wenn die Missetäter ihre gerechte Strafe erlitten!
Die Franzosen entfernten sich schließlich, überzeugt, dass sie die richtige Spur gefunden und imstande sein würden, die drei Diebe wieder zu erkennen, wenn sich die Gelegenheit böte. Das Signalement der Spitzbuben wurde von dem wachhabenden Polizisten aufgeschrieben und der Telegraf trug es nach allen Richtungen hin. Aber Leute des Schlages gibt es in New York zu Tausenden; wer bürgte dafür, dass man der richtigen habhaft würde!
Inzwischen machte Schleppfuß Frau Hanier in ihrer eigenen Sprache Mitteilung von seinem Auftrag und dem Zweck seines Besuches. Er setzte ihr auseinander, dass die den Mord begleitenden Umstände die Vermutung nahe legten, der Täter habe Rache an seinem Opfer nehmen wollen. Um ihm auf die Spur zu kommen, sei daher das beste Mittel, sich alle Ereignisse aus Haniers Leben genau ins Gedächtnis zurückzurufen, sowie die Namen derjenigen, mit welchen er in engerem Verkehr gestanden. Nur so dürfe man auf Erfolg hoffen und Frau Hanier sei natürlich am besten imstande, die erforderliche Auskunft zu geben.
Auf diese Aufforderung hin riss sich die unglückliche Frau endlich aus ihrer dumpfen Erstarrung; sie beantwortete die an sie gestellten Fragen und erzählte Louis Haniers Lebensgeschichte. – Mehrere Stunden später kehrte Schleppfuß, im Besitz verschiedener Tatsachen von größerer oder geringerer Tragweite, nach dem Hauptquartier der Geheimpolizei in der Mulberry-Straße zurück und klopfte an die Tür des Polizeiinspektors.
Drittes Kapitel. – Im Zimmer des Inspektors
Die steinerne Front des Hauptpolizeiamts von New York geht nach einer Straße hinaus, die Backsteinseite nach einer anderen. Im Mittelpunkt desselben befindet sich ein viereckiges Zimmer, das sein Licht von dem innern Hof empfängt, den das große Gebäude umgibt.
Die Einrichtung dieses Zimmers ist fast luxuriös zu nennen. Auf dem dicken dunkelfarbigen Teppich gleitet der Fuß geräuschlos dahin; bei der Machart der Stühle ist weniger auf Prunk als auf äußerste Bequemlichkeit gesehen; die starken Tische, die mit grünem Tuch überzogen sind, haben eine gefällige Form. Kurz, die Nettigkeit und Gemütlichkeit des Gemachs würde angenehm auffallen, wären nur die mächtigen Glaskästen an den Wänden nicht da.